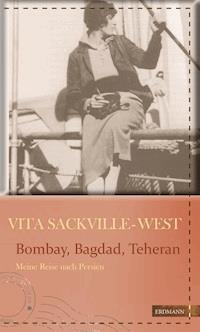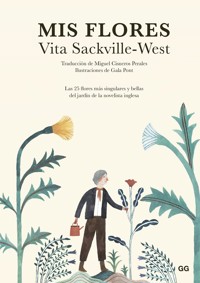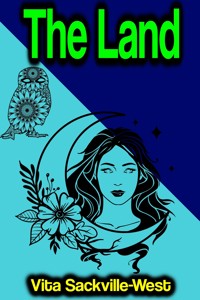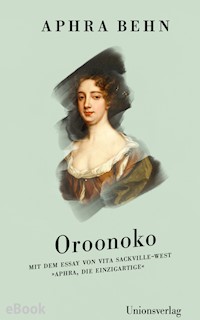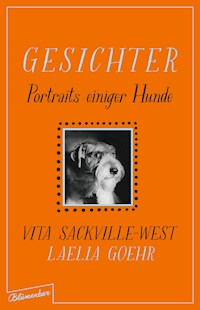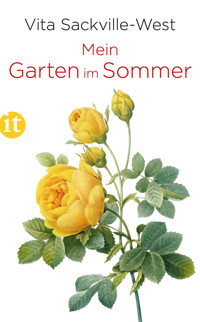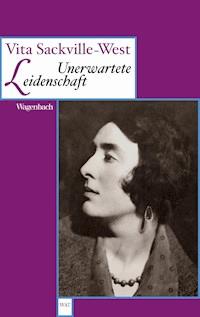10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vita Sackville-West, Schriftstellerin und begnadete Gärtnerin, hat nicht nur den berühmtesten Garten der Welt – Sissinghurst – geschaffen, sondern auch ihre Liebe zur Natur in ihren legendären, weil ebenso kenntnisreichen wie charmanten Gartenkolumnen festgehalten, die hier, nach Jahreszeiten geordnet, vorgestellt werden.
Jede Jahreszeit entfaltet ihren eigenen Zauber im Garten: Im Spätherbst erinnern noch einige Rosen und Hortensien an den vergangenen Sommer. Jetzt erblühen Dahlien, Astern, Clematis und Gladiolen in zahlreichen Farben. Die Nussbäume tauchen den Garten mit ihren Blättern in ein goldenes Gelb, und die ersten glänzenden Kastanien landen im raschelnden Laub. Nun gilt es, die Beete auf den Winter vorzubereiten und erste Zwiebeln der Frühblüher in den Boden zu bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Vita Sackville-West
Mein Herbstgarten
Aus dem Englischen von Gabriele Haefs
Mit farbigen Illustrationen von Pierre-Joseph Redouté
Insel Verlag
September
September … was für ein Wendepunkt, was für eine Wasserscheide im Jahreslauf. Ich denke an die Monate immer wie an Jahrzehnte im Menschenleben: April-Mai; Juni-Juli; August-September. Die Zeit von März bis Ende April ist die Jugend; die von Mai bis Juni die spätere Jugend bis zum dreißigsten Geburtstag, diesem unangenehmen Meilenstein; Juni und Juli ist die Zeit zwischen dreißig und vierzig, oder wollten wir sagen, fünfzig? Nach Ende Juli erreichen wir das unangenehme Stadium der Gewißheit, daß wir uns den sechzig nähern; dann kommt der September und wir gehen auf die siebzig zu, und wenn wir bei Oktober, November und Dezember angekommen sind, wäre es taktlos, die Parallelen noch weiter zu vertiefen.
Im September sollten wir an die bevorstehenden rauhen, windigen Tage denken. Kalte Winde können eine Pflanze ebenso nachdrücklich verletzen wie Feuer, aber ich stelle mir vor, daß wir die Winde weitgehend abwehren können, wenn wir zu dem Verfahren greifen, das in Kent »Hop-Lewing« genannt wird. »Lew« ist ein nettes kleines, altes Wort, das »Schutz« bedeutet (es ist verwandt mit dem deutschen Wort »lau«). Hier auf dem Land hört man es noch oft: »Die Lämmer wären alle erfroren, wenn ich nicht ein paar lews gemacht hätte.« Unter Hop-Lewing verstehen wir eine sehr grob gewebte Art Sackleinen, wie Hopfenzüchter sie auf hohen Pfählen an der Windseite ihrer Hopfengärten aufstellen. Sie sind an die einsachtzig breit und werden in Längen von etwa fünfundvierzig Metern verkauft. Ich sehe wirklich keinen Grund, warum wir sie nicht passend zuschneiden und in unseren Gärten verwenden sollten. Wir müssen sie ja nicht unbedingt auf hohen Pfählen anbringen.
Wir sollten sie auf dem Boden aufspannen und in regelmäßigen Abständen mit Stöcken feststecken. Das lockere Gewebe läßt die Luft hindurch, die alle Pflanzen so dringend brauchen und die so oft von mit Stroh und Farnkraut verdichteten Weidengeflechten oder durch die dicke Verpackung ausgesperrt wird, in die manche ihre Schätze während des Winters hüllen wie in einen warmen Schlafrock.
Ein länglicher Geist aus hop-lewing, ein grauer, durch die Mangel gedrehter Geist. So wird mein Garten im nächsten Winter umherspuken.
Jetzt treffen langsam die Herbstkataloge ein, und sie erinnern mich an die Päonien (Pfingstrosen). Es gibt nur wenige dankbarere Pflanzen. Kaninchen mögen sie nicht; sie blühen den ganzen Mai und Juni hindurch; als Schnittblumen halten sie sich im Haus oft über eine Woche; sie blühen in Sonne und Halbschatten; sie vertragen fast jede Art Boden, kalkhaltig oder nicht; sie finden sich sogar mit Ton ab; sie brauchen niemals vereinzelt oder verpflanzt zu werden; das hassen sie geradezu; und sie sind so langlebig, daß sie Sie vermutlich überleben werden, wenn Sie erst einmal eine Pflanzung gezogen haben (was gar nicht schwer ist). Dazu kommt auch noch, daß sie Vernachlässigung ertragen können. Meine haben sich durch das Unkraut des Krieges hindurchgekämpft und scheinen keinen Schaden daran genommen zu haben.
Aber wenn Sie ihnen Gutes tun, dann reagieren sie, wie jede Pflanze auf gute Behandlung reagiert. Wenn Sie ein wenig Knochenmehl übrig haben, streuen Sie es im Herbst aus. Das ist jedoch nicht unbedingt nötig. Unbedingt nötig ist zunächst sorgfältiges Pflanzen, darunter verstehe ich, daß Sie ein um die fünfzig Zentimeter tiefes Loch graben sollten; geben Sie zunächst verrotteten Dung oder Kompost hinein; füllen sie es dann mit normalem Erdreich, und pflanzen Sie untief, d. h., vergraben Sie die Spitze nicht tiefer als vielleicht zehn Zentimeter. Das ist wichtig.
Grob gesagt gibt es zwei Päonienarten: die krautartigen, zu denen wir die eigentliche Spezies zählen, und die Baumpäonie (Paeonia suffruticosa). Baumpäonien werden heute nicht mehr häufig angeboten und sind entsprechend teuer. Aber die Ausgabe lohnt sich, vor allem, weil sie schon früh zu blühen beginnen und sich in zunehmendem Alter darin noch immer weiter steigern. Sie sollten sie niemals beschneiden. Meine wurden von einem Aushilfsgärtner ruiniert, der noch dazu (was ich damals aber nicht wußte) ein Zeuge Jehovas war und der sie eines Herbstes in Grund und Boden beschnitt.
Die krautartige Päonie ist die Art, die wir oft in Cottagegärten in nicht sonderlich attraktiven Farbtönen von Rot oder Rosa sehen. Aber wir sollten sie deshalb nicht verdammen. Es gibt heute viele Varianten, einfache wie gefüllte, in allen Farben von reinem Weiß über Weißgelb bis zu Muschelrosa, Tiefrosa und dem Abendhimmelrot der P. peregrina. Diese lodert wirklich, und ihre Genossin P. lobata Sunshine kann sich mit ihr messen, wenn sie sie nicht sogar übertrifft. Von den Gelben würde ich P. mlokosewitschii empfehlen, wenn sie nicht so teuer wäre; ich habe meine aus einer preiswerten Samenpackung gezogen, aber dazu gehört viel Geduld. Von dieser abgesehen, ist P. Laura Dessert vermutlich die beste Gelbe, die für einen vernünftigen Preis zu haben ist. Sarah Bernhardt, die noch etwas preisgünstiger ist, hat riesige, blaßrosa gefüllte Blüten; die um einiges teurere Kelway's Supreme ist von feinem Weißrosa; Duchesse de Nemours, wiederum billiger, ist weiß mit einem leicht gelblichen Farbton und kleineren Blüten; Monsieur Martin Cahuzac, zum gleichen Preis, ist dunkelrot, und seine Blätter sind im Herbst von schöner Farbe.
Dieser Artikel wird von zwei Dingen handeln, von einem Baum und einer Lilie nämlich. Der Blasenbaum, Koelreuteria apiculata, ist im August, wenn er seine endgültige Größe von fünf bis fünfzehn Metern erreicht hat, von außergewöhnlicher Schönheit. Ein Baum erlangt eine solche Größe natürlich nicht innerhalb weniger Jahre, deshalb gilt diese Empfehlung nur für die, die für öffentliche Parks oder Gärten Bäume aussuchen oder vorhaben, sehr lange auf ihrem Grund und Boden zu bleiben; für die Besitzer eines kleinen Landhauses zum Beispiel. Nomadisierende Mieter können es sich nicht leisten, so lange zu warten.
Ich habe die Samen der Koelreuteria im verlassenen Garten einer alten französischen Abtei gesammelt; ich wußte damals nicht, was ich da vor mir hatte. Ich konnte nur sehen, daß es sich um einen eleganten Baum handelte, dessen Samenkapseln aussahen wie chinesische Lampions oder die Hülsen der Pflanze, die wir Lampionblume (Physalis peruviana) nennen und als Winterdekoration anpflanzen. Zu Hause säte ich die Samen in einer Schale aus, und sie keimten so energisch wie Gras. Ich sah natürlich, daß die Blätter ein sehr hübsches Rosa annahmen, aber erst, als ich in einem benachbarten Garten ein ausgewachsenes Exemplar sah, ging mir auf, welchen Schatz ich da erbeutet hatte. Dieses Exemplar stand in voller Blüte, hellgelbe Blüten auf geraden, etwa dreißig Zentimeter hohen spitzen Stengeln, ein wenig wie die Goldrute, wenn Sie sich Goldrute vorstellen können, die unmittelbar über Ihrem Kopf aus einem Baum herauswächst, und diese Blüten ragten kühn über Mengen von korallenroten Samenkapseln, die Ähnlichkeit mit Quasten hatten, und über fedrigen grünen Blättern auf. Ich übertreibe wirklich nicht. Der Anblick dieses Baums vor dem blauen Himmel war geradezu atemberaubend.
Die Lilie, um die es mir heute geht, ist Lilium regale (Königslilie), die süßduftende Trompete, vielleicht das am leichtesten anzubauende Mitglied dieser launischen Familie. Zwischen dieser Lilie und der Koelreuteria gibt es keinerlei Ähnlichkeiten, abgesehen davon, daß sie sich beide leicht aus Samen ziehen lassen. Reife Zwiebeln sind derzeit ziemlich teuer, wenn Sie also größere Mengen anpflanzen möchten, lohnt es sich, sie aus dem Samen zu ziehen – und dann ist jetzt der Moment gekommen, um in Ihrem eigenen oder den Gärten Ihrer Bekannten danach Ausschau zu halten. Sie können den Samen natürlich auch kaufen, aber es macht mehr Spaß, eine Samenkapsel aufzubrechen und die wunderbar verpackten, papierdünnen Samen selber herauszuschütteln. Jeder von ihnen keimt normalerweise, und eine Kapsel liefert mehr Lilien, als Sie vermutlich in Ihrem Garten unterbringen können. Nehmen Sie die Samen der stärksten Pflanze, säen Sie sie in einer »Samendose« aus, und pflanzen Sie dann im nächsten Jahr die kleinen Zwiebeln in Reihen in einem Beet, wo Sie ein Auge auf sie haben können; am Ende des zweiten Jahres sollten Sie eigentlich schon einige Blumen pflücken können, nach dem dritten müßten die Lilien voll entwickelt sein. Wenn Sie diesen Prozeß jedes Jahr wiederholen, dann dürfte es Ihnen in Ihrem Garten eigentlich niemals an L. regale fehlen, doch Kosten würden für Sie dabei nicht entstehen.
Sie wissen natürlich, daß Sie das auch mit den kleinen schwarzen, knopfartigen Wurzeln am Schaft der Tigerlilie, Lilium lancifolium, machen können?
Für alle, die über die »Samendose« gestolpert sind, will ich das amüsante Verfahren näher erläutern. Sie brauchen ein Glas mit Drehverschluß, ein Einmachglas zum Beispiel; das füllen sie mit einer Mischung aus Lauberde, Torf und Lehm. Diese Mischung setzen Sie unter Wasser und quetschen sie aus, bis sie nicht mehr tropft, sondern zu einem feuchten Schwamm geworden ist. Danach geben Sie schichtweise je eine Schicht »Schwamm« und eine Schicht Samen in das Glas, bis es voll ist. Dann drehen Sie den Deckel fest, stellen das Glas in einem warmen Zimmer auf die Fensterbank und warten, bis die Samen an den Glasrand wandern, wo Sie sehen können, daß sie sich zu kleinen kaulquappenartigen Dingern entwickelt haben, die, wie Sie hoffen, irgendwann dann zu Zwiebeln werden.
Ich bin immer überrascht, wenn jemand normalen Rosmarin nicht erkennt. »Was ist das?« fragen die Besucher und betrachten die großen dunkelgrünen Büsche, die sich so großzügig auf der Einfahrt zu meinem Haus verbreiten. Ich hatte Rosmarin für eine unserer verbreitetsten Pflanzen gehalten, und sei es nur wegen seiner sentimentalen Assoziationen. Angeblich sorgte Rosmarin für ein besseres Gedächtnis, weshalb es ein Symbol für Treue unter Liebenden wurde. »Ein Zweiglein davon spricht eine stumme Sprache«, sagte Sir Thomas More; eine andere Legende verbindet ihn mit dem Alter Unseres Herrn, dreiunddreißig Jahre, danach wächst er nicht mehr in die Höhe, nur noch in die Breite. Eine romantische Pflanze, aber seltsamerweise auch eine ziemlich unbekannte.
Es gibt mehrere Rosmarinarten. Wir haben den normalen buschigen Typ, Rosmarinus officinalis, der als Busch gepflanzt oder auch zur Hecke beschnitten werden kann. Als Hecke gefällt er mir nicht so sehr, denn dem ständigen Beschneiden fallen die Blüten zum Opfer, die die Hälfte seiner Schönheit ausmachen. Es ist immerhin eine dichte Hecke, wenn Ihnen daran gelegen ist. Beschneiden Sie ja nicht das alte Holz. Es gibt außerdem den korsischen Rosmarin, R. angustifolius Corsicus, mit eher fedrigen Blättern und hellblauen oder fast enzianblauen Blüten; er sieht weniger robust aus als der normale Rosmarin und ist vielleicht nicht so zäh, aber so wunderschön, daß er eine geschützte Ecke durchaus verdient hat. Er haßt kalten Wind. Der kompakte, pyramidenförmige Rosmarin, der den schönen Namen Miss Jessopp's Upright trägt, erreicht innerhalb weniger Jahre Gardemaß. (Wer mag Miss Jessopp wohl gewesen sein? Das wüßte ich wirklich gern.) Es gibt auch eine kriechende, für Steingärten geeignete Art namens Prostratus, aber die ist nicht besonders zäh, und ich würde sie höchstens Bewohnern der wärmeren Grafschaften empfehlen. Sie läßt sich jedoch in gute Laune versetzen, wenn ihre Wurzeln zwischen Steinen gut geschützt und für Frost und Feuchtigkeit unerreichbar sind, dann entwickelt sie einen dankbaren, immergrünen Teppich und ist eine gute Deckung für die kleinen frühen Zwiebeln, die diesen Teppich schließlich durchbrechen, wie die Damentulpe, Tulipa clusiana, die Osterglocken oder die winzigen Narzissen wie Narcissus juncifolius mit ihrem süßen Duft.
Wir sollten auch nicht vergessen, daß eine weißblütige Art des normalen Rosmarins erhältlich ist, was eine nette Abwechslung von den verbreiteteren blauen Blüten bedeutet.
Fast alle Rosmarinarten fühlen sich überall in der Sonne wohl, sie ziehen leichten und sogar kargen, sandigen, steinigen Boden vor. Im September geschnittene Ableger entwickeln sehr rasch Wurzeln, wenn sie fest in den Sand gesteckt und dort bis zum nächsten Frühling in Ruhe gelassen werden. Dann können sie ausgepflanzt werden.
Wer sich nicht für Blumen interessiert, interessiert sich nicht für Blumen. Er kennt ihre Namen nicht, was verständlich ist, wir können schließlich nicht alle Gärtner oder Botaniker sein, aber er weiß auch nicht, wie er Blumen betrachten sollte. Er geht nach der Masse und ist entsprechend beeindruckt, doch die feineren Nuancen entgehen ihm – und damit entgeht ihm eine ganze Menge. Er muß noch lernen, daß es nicht immer auf Größe und auffälliges Aussehen ankommt.
Ich denke hier vor allem an die kleinen Tulpen, die jetzt bestellt und irgendwann bis Mitte Oktober gepflanzt werden sollten. Sie sind die Winzlinge der Tulpenfamilie; von der Größe her lassen sie sich nicht mit den großen Darwin-Hybriden und nicht einmal mit den Cottagetulpen vergleichen, deren Blüte wir im Mai erleben. Einer meiner Lieblinge unter den kleinen ist Tulipa tarda, manchmal auch Tulipa dasystemon genannt. Ich weiß wirklich nicht, wodurch sie die Bezeichnung tarda (träge) verdient, sie blüht nämlich als eine der ersten, ist also alles andere als träge. Sie wird höchstens fünfzehn Zentimeter groß, ist grünweiß gestreift, sehr hübsch, wenn die Blüte fest geschlossen ist, und noch viel hübscher, wenn sie sich in der Sonne öffnet und einen flachen, gelbweißen Stern zeigt.
Es gibt außerdem Tulipa linifolia. Das ist eine kleine, leuchtend scharlachrote Tulpe aus Buchara in Zentralasien, dieser romantischen Gegend, die nur so wenige unter uns besuchen können, einem Paradies für wilde Blumen. Tulipa linifolia läßt sich ohne große Mühe in England anpflanzen, möglichst in sandigem Boden und soviel Sonne, wie unser Klima das nur gestattet.
Das gilt auch für die wilde griechische TulpeT. orphanidea. Sie ist außen bronzebraun-gelb und öffnet sich in der Sonne zu einem Stern, der sich nach Sonnenuntergang zu einer spitzen Knospe schließt, um sich dann abermals zu einem Morgenstern von geöffneten Blütenblättern zu entfalten.
Beides sind Tulpen für diejenigen, die wissen, wie sie sie betrachten sollten. Wer lieber auffälligere Tulpensorten hätte, sollte sich einige Zwiebeln der kaufmanniana zulegen, der sogenannten Seerosentulpe. Ich finde sie ziemlich vulgär im Vergleich mit den Winzlingen, denen mein Herz und meine Liebe gehören; aber es wäre töricht, ihnen ihre eigene Schönheit absprechen zu wollen, eine Schönheit ähnlich der der Seerosen, denen sie ja schließlich auch ihren Namen verdanken.
Da ich diesen Artikel unterwegs schreibe, möchte ich ein wenig davon erzählen, was ich auf einer vierzehntägigen Reise gesehen habe, Dinge, die mir neu waren oder die ich ganz einfach vergessen hatte. Ich hatte zum Beispiel die im Sommer blühende malvenfarbene Solanum crispum (Nachtschatten) vergessen, die im August so nützlich ist, ein wenig empfindlich vielleicht, denn sie braucht eine warme Südwand. Vergessen hatte ich auch die weiße Solanum jasminoides, die ebenfalls im August blüht, eine äußerst elegante Kletterpflanze, ebenfalls ein wenig empfindlich, aber in den südlichen Grafschaften lohnt der Versuch sich doch. Vergessen schließlich war die weiße – oder eher cremefarbene – Buddleia fallowiana alba (Sommerflieder) mit ihren grauen Blättern, ziemlich ungewöhnlich und eine willkommene Abwechslung von der normalen malvenfarbenen Variante. Buddleia nivea hat noch grauere, wollige Blätter, sie sind fast so wollig und zottig wie die der alten geliebten Cottage-Pflanze Stachys lanata, auch bekannt als Eselsohr oder Wolliger Ziest. Ich hatte Itea ilicifolia (Rosmarinweide) vergessen, einen Strauch mit langen, grauweißen Kätzchen von sanfter Schönheit, duftend und leider empfindlich, der es vorzieht, sich gegen eine Mauer zu lehnen. Schließlich war auch noch Berberis wilsoniae (Berberitze), die eigentlich für alle mit einer Vorliebe für graugrüne Blätter wie geschaffen ist, aus meinem Gedächtnis verschwunden.
Dann sah ich eine strauchartige Pflanze, die ich später als Abelia grandiflora identifizieren konnte. Es ist wirklich ein überraschend hübscher Strauch; er entwickelt einen Schatz an spitzen, hellrosa Knospen, die sich zu rosaweißen Blüten öffnen. Er ist recht zäh, ich würde ihn allen empfehlen, die im August- und Septembergarten ein wenig Farbe sehen möchten.
Ein weiterer Strauch, den ich unterwegs gesehen habe, ist Decaisnea fargesii. Er wird auch Blauschotenbaum genannt, weil er im Herbst hellblaue Samenkapseln entwickelt, wirklich dekorativ. Er ist recht zäh und sollte in jegliche ungenutzte Ecke gepflanzt werden, einfach wegen seiner gelbgrünen Blüten und seiner stahlblauen Samenkapseln im Herbst.
Das alles sind kurze Eindrücke von meiner Reise; ich muß Ihnen aber noch nahelegen, Indigofera dielsiana (Indigostrauch) anzupflanzen, es ist einfach eine überraschend schöne Pflanze. Sie entwickelt lange Zweige voller rosavioletter, wickenhafter Blüten, die an die dreißig Zentimeter lang werden und sehr elegant aus ihrem zarten Blattwerk herausragen. Sie paßt sehr gut zur oben erwähnten malvenfarbenen Solanum oder, stelle ich mir vor, zur im August blühenden blauen Ceanothus Gloire de Versailles (Säckelblume) und vielleicht sogar zum blauen BleiwurzCeratostigma willmottianum.