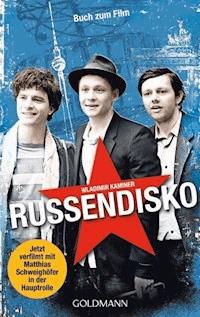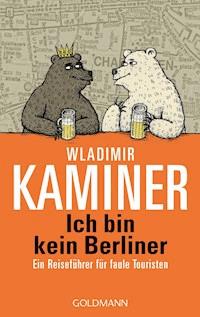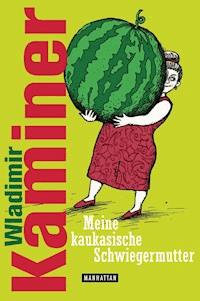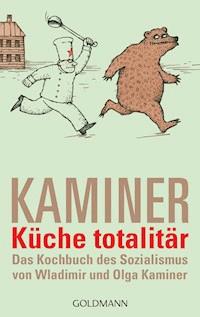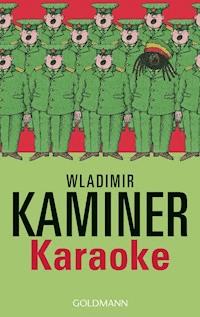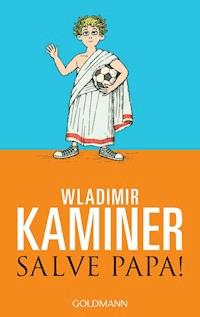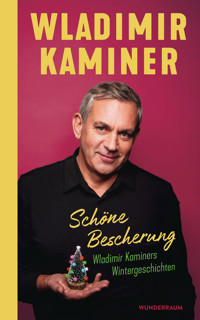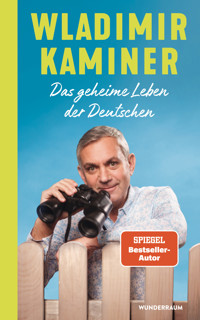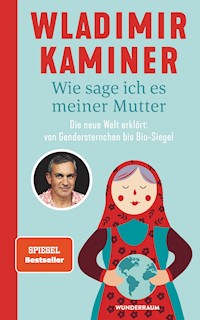6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Laube, Liebe, Hoffnung
Die Gärtner sind alle Verbrecher – das muss Wladimir Kaminer schon bald erkennen. Der Neuankömmling in der Berliner Kleingartenkolonie „Glückliche Hütten“ hat nämlich innerhalb kürzester Zeit gegen fast alle Vorschriften des Bundeskleingartengesetzes verstoßen. Aber das hält ihn nicht davon ab, sich mit Leib und Seele in das abenteuerliche Leben als Schrebergärtner zu stürzen. Und so hält er in diesem hinreißend komischen Buch ein Gartenjahr der etwas anderen Art fest, mit Rhabarberernte, interessanten Nachbarn und ungezähmter Natur …
Fertig ist die Laube!
Der Schrebergarten als Ort hinreißend lustiger Abenteuer und Heimat deutscher Eigenarten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Sonne ist nur ein Morgenstern
H.D. Thoreau
Parzelle 118 oder Die Russen kommen
Es mag banal klingen, ist aber wahr: Unser wertvollstes Gut sind unsere Erinnerungen. Ohne sie sind wir bloß Gemüse, unfähig zu denken und zu handeln. Der größte Traum jedes vernünftigen Menschen ist es doch, zweimal in denselben Fluss zu steigen, auf die gleiche Harke zu treten, in der gleichen Pfütze zu landen. Wer das nicht tut und nur darüber sinniert, wie sinnlos beziehungsweise unmöglich es ist, sich einem solchen kindischen Traum hinzugeben, ist ein Angsthase.
Doch viele Erinnerungen verblassen mit der Zeit, und die nächste Generation zweifelt sie an oder lacht sogar über sie. Um ihnen mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, braucht man handfeste Beweise, am besten Fotos. Schwarz-weiß ist wunderbar, das macht sie realistisch. Meine Frau und ich haben sehr viele Fotos, die wir getrennt in speziell dafür ausgewählten großen Schuhkartons aufbewahren. Zu jedem Anlass, aber auch ohne, holen wir die Kartons heraus und zeigen uns gegenseitig unsere Bilder. Auf den meisten Fotos, die meiner Frau gehören, sieht man junge, frech gekleidete Langhaarige beiderlei Geschlechts mit Bierflaschen oder Musikinstrumenten in der Hand – alles Dichter, Maler oder Schauspieler. Mit einigen von ihnen hat Olga noch immer Kontakt, aber von den meisten sind Namen und Aufenthaltsorte im Laufe der Zeit verloren gegangen. Eine typische Jugend in der schnöseligen Boheme St. Petersburgs offenbart sich auf diesen Bildern.
Einen anderen Eindruck hinterlassen Fotos, die im Haus ihrer Oma in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny geknipst wurden: ein Haus aus Stein, kaum zu sehen hinter den Bäumen und Büschen, drumherum Beete, Weinstöcke, die sich aus der Erde ranken, und Menschen mit bronzener Haut, die lächelnd ihre Harken, Sicheln und andere mir unbekannte landwirtschaftliche Werkzeuge in die Kamera halten. Olgas inzwischen verstorbene Oma ist auch dabei – eine kräftig gebaute alte Frau, stets mit einem weißen Tuch auf dem Kopf und einem Eimer Tomaten oder Kartoffeln in der Hand. Im kaukasischen Obstgarten, zwischen Kirsch- und Aprikosenbäumen, verlief ein beträchtlicher Teil der Kindheit und Jugend meiner Frau.
Diese landwirtschaftliche Seite ihrer Biographie, die Erinnerungen an Omas Garten, ihre Wünsche und Träume, die mit diesen Erinnerungen verbunden sind, sowie meine absolute Unkenntnis in Sachen Gartenarbeit und mein grenzenloses Vertrauen in das wirtschaftliche Treiben meiner Frau innerhalb der Familie trugen dazu bei, dass wir uns eines Tages beim Bezirksverband der Kleingartenkolonie »Glückliche Hütten« anmeldeten. Unser Ziel war, einen Schrebergarten in der Nähe unseres Hauses zu ergattern. Alle Freunde und Bekannten, denen wir davon erzählten, lachten uns aus. Sie räumten uns keine Chance ein, in das letzte Bollwerk des deutschen Spießers, die Kleingartenkolonie, einzudringen.
Die »Glücklichen Hütten« sahen wie eine gut geschützte Burg aus: Die Lauben waren mit hohen Zäunen und reichlich Stacheldraht gesichert, und große Hunde hielten in den Gärten Wache. Mit ein paar Kanonen auf den Dächern konnte diese Anlage problemlos gegen jede feindliche Armee der Welt bestehen. Von Weitem schienen die Gärten leer, doch wenn man sich einem Grundstück näherte und über den Zaun schaute, sah man sofort das Hinterteil des Besitzers über den Beeten schweben. Was sie da gerade machten, woran sie arbeiteten, war schwer zu begreifen. Sie krochen über ihre Erde, sie pflanzten ein, sie pflanzten aus, gruben, harkten, bewässerten ihren Rasen oder steckten einfach wie Strauße den Kopf in die Erde, wenn sie Fremde bemerkten. Wenn man über den Zaun grüßte, grüßten sie nicht zurück, als wollten sie sagen: Ihr werdet auf euren Platz an der Sonne in dieser Kolonie lange warten müssen, nämlich mein langes Leben lang. Denn alles, was ihr hier seht, jeden Millimeter Erde, haben wir mit Schweiß, Blut und Tränen begossen und zu dem gemacht, was es heute ist – ein Buddelkasten für Erwachsene, die mit ihrer Freizeit in der Großstadt nichts anfangen können.
Ich fand diese Kleingärtnerhaltung stets lächerlich. In der Großstadt Moskau aufgewachsen, hatte ich nie die geringste Neigung zur Gartenarbeit verspürt. Auch die Vorstellung einer eigenen Ernte ließ mich kalt. Das Obst aus dem vietnamesischen Gemüseladen an der Ecke schmeckte mir gut genug. Meine Frau war aber anders gestrickt. Die Erinnerung an den ersten grünen Pfirsich, den sie vor zwanzig Jahren im Garten ihrer Oma vom Baum holte, ist in ihrem Kopf fest stecken geblieben. »Obst, das nicht aus der Kaufhalle, sondern von Bäumen kommt, blühende Kirschen, Apfelbäume, Natur«, träumte sie. Ich unterstützte sie in ihren Träumen, hoffte aber insgeheim, dass wir den Garten nicht bekämen.
Die Leiterin der Aufnahmestelle des Kleingartenvereins, Frau Engel, machte mir Hoffnung. Auf unsere Frage nach den durchschnittlichen Wartezeiten sagte sie, das könne Jahre dauern. Die »Glücklichen Hütten« waren voll, und niemand hatte die Absicht, seinen Buddelkasten unseretwegen aufzugeben.
»Wir werden natürlich nicht wie diese Verrückten jedes Gräslein persönlich umgraben«, träumte meine Frau weiter. »Wir werden uns hübsche Gartenmöbel besorgen und eine Grillanlage im Garten aufstellen. Dann Freunde einladen, zwischen den Rosen sitzen und feiern. Und im August werden wir das Obst ernten und Konfitüre einkochen.«
In ihrem Traum saß sie bereits mit einem großen Hut im Garten, drumherum summten die Hummeln, und die Erde blühte vor ihren Füßen. Ihr Optimismus in dieser Sache gab mir zu denken. Ich wusste aus Erfahrung: Wenn meine Frau sich etwas in den Kopf gesetzt hat, wurde es früher oder später Realität. Olga hatte im Obi-Katalog bereits die Gartenmöbel gefunden, die zu unserem nicht existierenden Grundstück passten. Was soll’s?, dachte ich, ich weiß von Schriftstellern, die ihre Werke im Wald geschrieben haben, auf einem Schiff, sogar auf einem Eisberg. Man kann bestimmt auch in einer Schrebergartenkolonie gut leben und arbeiten. Hauptsache, es gibt dort eine Steckdose.
Es geschah an einem herbstlichen Nachmittag, genau genommen am 14.182sten Nachmittag meines Lebens. Ich saß gemütlich vor dem Fernseher, das ZDF brachte eine spannende Dokumentation über das Leben der Weinbergschnecken-Züchter in Frankreich, als plötzlich das Telefon klingelte. Eine unbekannte Frauenstimme verlangte von mir irgendetwas Unverständliches auf Amtsdeutsch: Es ging um den Antrag beziehungsweise Pachtvertrag beim Bezirksverband der Kleingärtner. Ob ich ihn schon gestellt hätte?
»Nein, tut mir leid, Sie haben sich verwählt«, sagte ich und legte schnell auf. Meine Frau kam aus der Küche. Sie wollte wissen, wer da gerade angerufen habe. Keine Ahnung, falsch verbunden, beruhigte ich sie. Zwei Minuten später klingelte das Telefon erneut. Diesmal nahm meine Frau ab. »Hurra!«, rief sie nach einem kurzen Telefonat, »Frau Engel hat einen Schrebergarten anzubieten! Sie lädt uns zu einem Besichtigungstermin ein, am nächsten Samstag um acht Uhr früh!« »Am Sonntag um sieben wäre noch besser«, konterte ich. Doch mein Gift konnte nichts mehr bewirken. Langsam, aber sicher steuerte unsere Familie auf die »Glücklichen Hütten« zu. Kleingärtner, aufgepasst, die Russen kommen!
Am Samstag regnete es. Im Vereinsgebäude, das wie ein DDR-Museum aussah, tranken zwei Frührentner ihren Kaffee. An der Tür hing ein Plakat – Männer, die aussahen wie Frauen. Es war eine Ankündigung: Im Vereinsgebäude der Kleingartenkolonie sollte demnächst ein Transvestiten-Kabarett stattfinden, und zwar am Vormittag. Warum nicht?, dachte ich. Zu dieser frühen Stunde konnte mich nichts wundern. Frau Engel begrüßte uns wie alte Freunde. Sie hatte tatsächlich etwas für uns. Genau genommen hatte sie sogar drei Gärten anzubieten, gegen einen geringen Abstand selbstverständlich. Ein paar Kleingärtner hatten sich anscheinend überangestrengt und waren gestorben oder weitergezogen, um neue Gartenkolonien zu gründen.
Nach dem Kaffee gingen wir uns die Grundstücke anschauen. Das erste sah nach unberührter Natur aus: ein kleiner schmuddeliger Dschungel mit einer Holzhütte für Onkel Tom in der Mitte. Kein Strom, kein Wasser, keine Rosen, nur Lianen überall. Das zweite Grundstück war uns zu groß und voller Gemüse, mit seinen Kartoffelbeeten konnte man ein ganzes Dorf satt kriegen. Das dritte hatte ein Schild am Gartentor: Fa. Pflaume. Parzelle 118. Frau Pflaume, eine Mittfünfzigerin mit Dauerwelle und Brille, wartete mit einer Harke in der Hand am Zaun auf uns. Der Mann von Frau Pflaume sei vor Kurzem gestorben, erzählte uns Frau Engel auf dem Weg zum Grundstück, die Kinder seien schon groß und weggezogen. Sie selbst habe keine Kraft, allein den Garten zu bestellen.
Schon von Weitem sah man, dass dieses Grundstück lange Zeit den Hauptfamilienschatz der Familie Pflaume darstellte. Auf einer relativ kleinen Fläche von zweihundertvierzehn Quadratmetern hatten hier zwei Menschen versucht, das Paradies im Maßstab 1:1 000 000 auf Erden zu errichten, und das mit Erfolg. Ich wagte kaum, mich zu bewegen. Ein falscher Schritt, und schon hatte man eine Schönheit der Natur plattgemacht. Auf Zehenspitzen liefen wir von einer Ecke des Gartens zur anderen. Freunde hatten uns im Vorfeld gewarnt, nicht gleich Ja zu sagen, falls uns irgendein Grundstück gefiel. Man müsste immer erst einmal etwas kritisieren, abwertende Bemerkungen über den Zustand des Gartens machen und die Anpflanzungen zusammenzählen, um Professionalität zu zeigen und die Abschlagszahlung zu drücken. Wir benahmen uns jedoch wie blutige Anfänger, die sich sofort in das Grundstück verliebt hatten. Schon beim ersten Anblick waren meine Frau und ich uns einig, dass wir dieses Paradies Nr. 118 gerne übernehmen würden.
Auf dem Grundstück stand ein Steinhäuschen mit einem Hochbett, einem Kühlschrank und einer Kaffeemaschine. Wasser und Strom waren vorhanden, an den Wänden hingen alte DDR-Poster. Hinter dem Haus befand sich noch ein abschließbarer Raum, vollgestopft mit landwirtschaftlichen Geräten, deren Zweck mir einstweilen noch unklar war. Manches, was dort an der Wand hing, erinnerte an mittelalterliches Folterwerkzeug.
»Das meiste werden wir gar nicht brauchen«, beruhigte mich meine Frau. »Und wenn schon, dann nur ab und zu mal, zum Spaß. Wir wollen doch keine Bauern werden. Unsere Werkzeuge sind bequeme Gartenmöbel und ein Grill – damit werden wir dieses Paradies perfekt machen«, flüsterte sie mir ins Ohr, während wir mit ernsten Gesichtern weiter im Kreis liefen und jede Ecke inspizierten. Dabei sagten wir zur Tarnung laut »Ah!« und »Oh!«, um bei Frau Pflaume und Frau Engel ein bisschen Eindruck zu machen. In Wirklichkeit hatten wir nicht die geringste Ahnung von den ganzen Pflanzen, wir wussten nicht einmal, wie sie überhaupt auf Deutsch hießen. Ehrlich gesagt wüsste ich nicht einmal die russischen Namen all dieser Pflanzen, außer von Rosen und Tulpen.
Frau Engel stand die ganze Zeit in der Mitte und redete mit uns Kleingartendeutsch, um das Grundstück aufzuwerten. Frau Pflaume stand neben ihr und schwieg. Sie sah auf die Erde oder blickte zum Himmel, so als würden wir, die Eindringlinge, sie gar nicht interessieren. Hinter dem Haus stand eine Biotoilette. Um nicht ganz als Gartendepp dazustehen, versuchte ich, Frau Engel in ein Gespräch über Biotoiletten zu verwickeln. Besser, als gar nichts zu sagen, dachte ich. Eine Diskussion über Bäume traute ich mir nicht zu.
»Sie müssen eine chemische Flüssigkeit in die untere Kassette der Toilette gießen«, empfahl Frau Engel.
»Und dann?«, ließ ich nicht locker. »Was mache ich, wenn die untere Kassette voll ist? Das Zeug kann sich doch nicht in Luft auflösen. Werden die Kassetten ausgetauscht? Von einem Biotoilettendienst abgeholt? Oder darf man den Inhalt als eine Art selbst erzeugten Naturdünger im eigenen Garten einsetzen?«
Bei der letzten Frage erntete ich einen Blick voller Misstrauen, der meine Kleingartentauglichkeit bei null einfror. Frau Pflaume schaute uns zum ersten Mal an. Die herbstliche Sonne blinkte in ihrem Brillengestell. Es sah so aus, als würde Frau Pflaume weinen. Wir sagten sofort Ja zum Grundstück und versprachen, uns um die Blumen und das Häuschen zu kümmern, dann unterschrieben wir und bezahlten. Mir tat Frau Pflaume leid. Ich wusste nicht, weswegen sie geweint hatte. Wegen ihres verstorbenen Mannes, wegen ihrer Lieblingsblumen, wegen uns, oder war es nur die Sonne, die ihr eine Träne hinter die Brille gezaubert hatte? Vielleicht war es eine Träne der Erleichterung? Auf jeden Fall hatten wir Mitleid mit ihr. Sie hatte hier dreißig Jahre lang geschuftet, wir dagegen wollten nur in Ruhe grillen.
Zu Hause blätterte ich das Übergabeprotokoll durch. Ich wollte mir endlich ein Bild von dem machen, was wir gerade eben gekauft hatten. Laut Unterlagen war ich nun glücklicher Besitzer einer alten, innen und außen verputzten Steinlaube. Das war schon mal gut. Weiter stand da, das Satteldach müsste erneuert und mit Pappe bedeckt werden, die Fundamente wären nicht frostfrei gegründet, es gäbe Wasserschäden in der Vorlaube, und der Zaun wäre verrostet. Das hörte sich alles nicht gut an. Dafür hatte ich einen Kompostbehälter aus Holz und siebenundvierzig Meter Maschendraht geerbt. In meinem Garten wuchsen sechs Apfelbäume, eine Birne, eine Pflaume, mehrere Süß- und Sauerkirschen, Rhabarber, Rhododendron, eine mir völlig unbekannte Forsythie und eine Yuccapalme, die wir wahrscheinlich übersehen hatten. Außerdem Mandelbäumchen, Pfingstrosen, Buschrosen, Farne, Johannisbeeren, Erdbeeren und Stachelbeeren! Diese ganze Pflanzenbande war ab sofort auf uns angewiesen, auf unsere Unterstützung, unser Mitwirken, unsere Gartenarbeit. Meine Vorlaube musste dringend renoviert werden. Schwarze Gedanken gingen mir durch den Kopf… Mensch, worauf hast du dich da eingelassen? Ein Schrebergarten! Eine solche Verantwortung! Konntest du denn nicht weiter wie alle normalen Leute am Falk-Platz grillen? Meine innere Stimme quälte mich bis tief in die Nacht. Ich träumte von Obst – viel Obst.
Im bald darauf beginnenden Winter besuchten wir unseren Garten nur drei Mal. Einmal, um die Wasseruhren auszuwechseln, und zweimal einfach so, um zu sehen, wie es unseren Bäumen ging. Auf dem Häuschen lag eine dicke Schneeschicht, und ich machte mir Sorgen, ob das Dach bis zum Frühling durchhielt. Zweimal heizte ich den Ofen, um den modrigen Schimmelgeruch aus der Bude zu kriegen. Der Schrebergarten spendete im Winter keinen Trost. Die Pflanzen sahen allesamt tot aus. Ich bereitete mich bereits innerlich auf den Frühling vor. Als Erstes wollte ich den Stacheldraht entsorgen, dieses Überbleibsel des Totalitarismus, dann eine neue Gartentür montieren, das Dach erneuern, ein paar Rosen umpflanzen und dann grillen. Ich suchte und fand in meinem Umfeld einige Freiwillige, die bereit waren, mir dabei zu helfen. Im März sollte die Arbeit losgehen, doch der Frühling ließ auf sich warten.
Auch Ende März lag noch Schnee auf dem Dach, die Kinder fuhren im Mauerpark Schlitten. Der Winter schien endlos. Opa Frost wollte seine Stellung nicht aufgeben, wahrscheinlich aus purer Schadenfreude, um frischgebackene Schrebergartenbesitzer zu quälen.
»Das ist eine Naturkatastrophe, wo bleibt denn nun die globale Erwärmung?«, schimpfte meine Frau.
Eines Tages im April wurden wir von Vogelgesang geweckt, die Sonne strahlte kräftig durch die Gardinen, draußen klingelten Fahrräder, Hunde bellten, der Frühling war da. Für den ersten warmen Sonntag beschlossen wir, eine Einweihungsparty in unserem Garten zu feiern – nur für die engsten Familienmitglieder, keine Gäste, damit uns nicht gleich das ganze frische Gras niedergetrampelt wurde.
Die ersten Insekten summten bereits in der Luft, die ersten Kleingärtnerhintern hingen über den Beeten. Die Gartenmöbel, die meine Frau per Katalog bestellt hatte, passten knapp in unseren kleinen Garten. Meine Eltern, meine Schwiegermutter sowie unsere beiden Kinder waren vom Schrebergarten begeistert, auch wenn sie sich das nicht anmerken ließen. Meine Frau stellte ihnen jede Pflanze einzeln vor.
»Hier sind die Rosen«, sagte sie, »und das da ist eine Sauerkirsche.«
»Und diese kleinen blauen Blümchen?«, fragte meine Mutter.
Tatsächlich waren gleich neben dem Zaun inzwischen viele kleine blaue Blümchen aus der Erde gekommen, die nicht im Übergabeprotokoll vermerkt waren. Niemand von uns wusste, wie sie heißen.
»Das sind Feldblumen«, behauptete meine Frau, »die gibt es überall. Sie heißen ›Vergiss mich‹ oder so ähnlich.«
Die Kinder bauten sich aus zwei muffigen Matratzen ein Zelt neben der Biotoilette und spielten einsame Insel. Unser erster Ausflug in die Natur fing gut an, endete jedoch in einem Desaster. Schuld daran war der neue Real-Markt im Gesundbrunnen-Zentrum. Dort gab es ein Regal mit russischen Lebensmitteln: eingelegte Steinpilze, Salzheringe und den berüchtigten Moosbeerenwodka, das Lieblingsgetränk jedes Landmannes. Natürlich kaufte ich eine Flasche für die Familienfeier im Schrebergarten. Ich konnte nicht wissen, dass meine Frau und meine Eltern das gleiche Regal aufgesucht und das gleiche Produkt gekauft hatten. So hatten wir plötzlich drei Flaschen Wodka auf dem Tisch statt einer und nur zwei Trinker, die den Moosbeeren zusprachen – meinen Vater und mich.
Bei einer Einweihungsparty gilt es als schlechtes Omen, wenn auf dem Tisch etwas übrig bleibt. Das würde sich negativ auf die Fruchtbarkeit des Gartens auswirken. Als abergläubische Menschen gaben wir uns also Mühe bei der Vernichtung der Vorräte. Mit der Folge, dass mein Vater und ich uns so gründlich betranken wie schon seit Jahren nicht mehr. Wir konnten zwar ohne fremde Hilfe sitzen und stehen, aber Gehen ging nicht mehr. Es war Abend geworden und hatte angefangen zu regnen. Die Kinder waren längst mit meiner Schwiegermutter nach Hause gegangen, die Frauen gingen auch, nur mein Vater und ich standen, eng aneinandergerückt wie zwei zusammengewachsene
Unerträgliche Schmerzen im ganzen Körper
Wir schufteten nach Plan und bauten Gartenmöbel zusammen. Ich hatte im Haus einen Werkzeugkasten mit verrostetem Hammer und Sichel gefunden, ein Erbe des Sozialismus. Wozu brauchte man im Garten Hammer und Sichel? Vielleicht konnte ich daraus eine Kunstinstallation machen. Unsere Beziehung zu den anderen Bewohnern der »Glücklichen Hütten« entwickelte sich frei nach dem alten russischen Witz über Gartennachbarn:
Trifft eine Frau einen Mann. »Hallo!«, sagt die Frau. »Kennen Sie mich nicht mehr? Unsere Gärten liegen doch nebeneinander! Schauen Sie mal!« Sie dreht sich um und wackelt mit dem Hintern. »Ach, Sie sind es! Ich grüße Sie!«, erwidert der Mann erfreut.
Ein paar Ärsche konnte ich inzwischen von Weitem identifizieren, obwohl wir schon zwei Vollversammlungen verpasst hatten und auch nicht zur Transvestiten-Show im Vereinsgebäude gegangen waren. Die neuesten Schrebergarten-Nachrichten hatten wir bisher immer nur zufällig erfahren, aus Flugblättern. Dank ihnen wussten wir auch, dass die Führung unserer Kolonie zum Tag der Solidarität der Arbeiterklasse zu einem Subbotnik aufgerufen hatte, einem freiwilligen Arbeitseinsatz zur Säuberung der ohnehin übersauberen Allee rund um das Vereinsheim. Alle Gärtner, die sich dem freiwilligen Arbeitseinsatz entzögen, müssten fünfundzwanzig Euro an die Vereinskasse zahlen. Ich beschloss, zum Subbotnik zu gehen. Ich bin kein Freund freiwilliger Arbeitsmaßnahmen, davon hatte ich in meinen jungen Jahren in der Sowjetunion genug gehabt. Auch wären mir die fünfundzwanzig Euro nicht zu teuer gewesen. Ich wollte einfach meine Nachbarn in entspannter Atmosphäre kennenlernen – ich hatte da nämlich ein paar Fragen bezüglich der Blumen. Unser Grundstück wurde mehr und mehr von kleinen blauen Blümchen unterwandert, von denen wir nicht einmal wussten, wie sie hießen. Diese Blaublumen-Invasion machte uns Sorgen. Einmal machte eine Schülergruppe vor unserem Garten halt. Die Lehrerin erzählte der Jugend etwas über die Schönheit der Natur und den Mut der Kleingärtner, die unter der ständigen Gefahr, einen Sonnenstich zu kriegen, die karge Berliner Erde mit ihrem Schweiß düngten und manchmal auch wie verrückt mit Hammer und Sichel jonglierten. Als die Lehrerin meine Frau hinter dem Gartenzaun erblickte, fragte sie ungeniert, wie diese wunderschöne blaue Pflanzenart heiße, die wir so großzügig gepflanzt hatten. Meine Frau erklärte mit ernster Miene, es seien chinesische Maiglöckchen. Die Schüler zückten ihre Kugelschreiber und notierten sich das. Ein anderes Mal kam eine Behindertengruppe und wollte dasselbe wissen. »Das sind thailändische Liebesblumen«, sagten wir.
Bestimmt werde ich beim Subbotnik ein paar Gärtner finden, die mit der blauen Blume schon Erfahrung haben, dachte ich. Daraus wurde aber nichts. Alle Gärtner über fünfundsechzig hatte man auf der Vollversammlung vom Schuften am Wochenende befreit. Dabei stellen gerade diese alten Gärtner die absolute Mehrheit in unserer Kolonie. Zum Subbotnik erschienen nur junge Gärtner um die vierzig, alles blutige Anfänger, die sich genau wie wir erst vor Kurzem in die »Glücklichen Hütten« eingemietet hatten. Es war eine kleine, aber bunte Truppe, die sich nach einer halben Stunde meckernd zum Biertrinken auf den Bänken niederließ.
Mein freiwilliger Einsatz war trotzdem nicht umsonst gewesen. Ich lernte etliche Neugärtner kennen, zum Beispiel Frau Krause. Ihr Grundstück befand sich am Ende der Kolonie, in einem Tal, umsäumt von Straßenbahngleisen. Im Grunde war ihr Grundstück die bepflanzte Straßenbahn-Endstation der Linie 9. Frau Krause strahlte Lebensfreude und Optimismus aus, und das sogar hauptberuflich. Laut eigener Auskunft war sie als Heilerin tätig, außerdem arbeitete sie als Anwältin für arme Menschen und Tiere sowie als Schauspielerin im Kindertheater und als Erziehungswissenschaftlerin im Verein für Schwererziehbare. Sie besaß mehr Tiere als Pflanzen auf ihrem Grundstück. Zu ihrer Menagerie gehörten unter anderem zwei Spiel- und Schmusehunde mir unbekannter, aber angeblich sehr edler Rasse. Der eine hatte einen Herzfehler, der andere war eine Zeit lang querschnittsgelähmt gewesen, aber von Frau Krause geheilt worden. Außerdem besaß sie drei Hippie-Meerschweinchen mit langen Haaren und acht Vögel: Wellensittiche, Minikakadus und einen Kanarienvogel mit dem Spitznamen Don Juan, der wegen eines Schlaganfalls nicht mehr fliegen konnte. Dazu kamen zwei Kinder im Grundschulalter und Herr Krause mit seiner neunzigjährigen Mutter. Diese freundliche, etwas durchgeknallte Gesellschaft hatte ständig zu tun. Und wenn sie ausnahmsweise nichts zu tun hatte, lief sie einfach hintereinander her im Kreis und tat so, als wäre sie sehr beschäftigt: Frau Krause allen voran, ihre Kinder hinter ihr her, dann der Mann mit den Hunden. Die Oma und Kanarienvogel Don Juan waren die Letzten, doch manchmal, wenn die Ersten zu schnell liefen, wurden die Letzten die Ersten.
Alle zwanzig Minuten krachte an diesem Grundstück eine Straßenbahn vorbei, dann versteinerte Großfamilie Krause für wenige Sekunden und schaute der Straßenbahn nachdenklich hinterher, was ihr eine gewisse Ähnlichkeit mit Playmobilfiguren verlieh. Nur dem Kanarienvogel mit dem Schlaganfall war der Straßenbahnlärm egal, er spazierte einfach weiter. Der Vogel hatte den Schlaganfall gleichzeitig mit Frau Krauses Schwiegervater erlitten. Den einen hatte sie retten können, den anderen nicht.
Ich lernte auch noch meine Nachbarn von gegenüber kennen, deren runde Kartoffelbeete mit einem Stein in der Mitte schon vorher unsere Aufmerksamkeit erregt hatten. Die Familie Kern war aus Baden-Württemberg nach Berlin gezogen, hatte ebenfalls zwei Kinder im Grundschulalter und wirtschaftete auf ihrem riesigen Grundstück streng nach der chinesischen Biogartenlehre. Überall lagen Steine herum, die die Sonnenenergie akkumulieren und an die Kartoffeln weitergeben sollten. Außerdem ragten seltsame spiralförmige Antennen aus der Erde. Herr und Frau Kern waren schon etwas länger in der Kolonie, hatten uns aber zum Thema blaue Blümchen trotzdem nichts mitzuteilen.
Unsere Nachbarn hatten mit ihren Gärten Großes vor. Angesichts ihrer ehrenwerten Absichten wurde mir unser eigener Gartentraum mit Grill und Gartenmöbeln etwas peinlich. Aber runde Kartoffelbeete? Nein, danke! Als erste Bepflanzungsmaßnahme beschlossen wir, eine natürliche grüne Mauer rund um unser Paradies zu errichten, damit niemand mehr zu uns in den Garten schauen konnte. Zu diesem Zweck bestellte meine Frau in einem Spezial-Katalog für Kleingarten-Freaks hundert »Ligustrum vulgare – wintergrüner, dicht verzweigter Busch, ideal als halbhohe Hecke bis zwei Meter«. Von Sonnenaufgang bis zum späten Abend pflanzten wir Ligustrum vulgare. Als wir ungefähr bei der neunundneunzigsten Pflanze angekommen waren, besuchte uns eine unbekannte Brünette vom Vereinsvorstand und qualifizierte unsere Arbeit als Verstoß gegen Paragraph sowieso des Kleingartengesetzbuches sowie Verletzung der jüngsten Beschlüsse der Vollversammlung der Gartenkolonie »Glückliche Hütten«. Laut diesem Beschluss mussten wir mindestens fünfzig Zentimeter Abstand vom Zaun des Nachbarn einhalten. »Ich rate Ihnen, alles sofort aus- und umzupflanzen«, drohte die Brünette.
Am nächsten Tag hatte ich unvorstellbare Schmerzen im ganzen Körper. Vor allem die Beine litten unter so starkem Muskelkater, als hätte ich am Berlin-Marathon teilgenommen. Meine Frau konnte sich praktisch gar nicht mehr bewegen. Es war Sonntag, alle normalen Bürger saßen auf ihrem Balkon und genossen die Sonne.Wir aber krochen wie zwei vergewaltigte Schildkröten in unseren Garten zurück, um unsere Ligustrum vulgare umzupflanzen. O du deutsches Kleingartengesetz! Wer hat dich geschrieben? Ich möchte den Autor gerne einmal persönlich kennenlernen. Aber eines habe ich herausgefunden: Die Homöopathen haben recht. Man kann tatsächlich Gleiches mit Gleichem heilen. Nach vier Stunden Gartenarbeit ließ der Muskelkater nach, und ich hatte sogar die Kraft, den elektrischen Rasenmäher auszuprobieren, den wir von Frau Pflaume geerbt hatten. Sofort meldete sich der Nachbar von links.
»Haben Sie etwa den Beschluss unserer Vollversammlung nicht gelesen? An Fest- und Feiertagen wird nicht gemäht!« Er paffte lächelnd an seinem Zigarettchen.
In der DDR war diese Gartengemeinde bestimmt eine Vorzeigekolonie gewesen. Die Stasi hatte ruhig schlafen können.
Ich stellte den Rasenmäher zurück in die Kammer und nahm die Sichel in die Hand. Ich verstand nun, wozu sie da war – um an Fest- und Feiertagen geräuschlos zu mähen! Das Rasenproblem erledigte sich übrigens am nächsten Tag von selbst. Wir bekamen Besuch. Die Kinder von Frau Krause und die Kinder der Familie Kern kamen, um mit unseren Kindern zusammen zu spielen. Vier fremde und zwei eigene Kinder, das macht zusammen ungefähr zwölf – und die wirkten, als würde sich eine Fußballmannschaft auf zweihundert Quadratmetern auf ein Endspiel vorbereiten. Keine Blume kann das überleben. Andererseits, wo sollten alle diese Kinder spielen, wenn nicht bei uns? Im Garten gegenüber hätten sie die mühsam angelegten runden Kartoffelbeete niedertrampeln, die Sonnenenergiezufuhr stören und die Biosteine durcheinanderbringen können. Bei Krauses im Garten hätten leicht die maladen Tiere verletzt werden können. Und wir wollten doch ohnehin nur grillen …
Als wäre das alles noch nicht demütigend genug gewesen, erzählte mir meine Frau von ihrer letzten Lesung auf einem Literaturfestival in Braunschweig. Die Veranstalter, ein junges Pärchen, meinten, auch sie hätten sich einmal einen Schrebergarten zugelegt. Sie wären die ganze Zeit in der Sonne gesessen, hätten nichts getan und wären nach einem Jahr aus der Gemeinde ausgeschlossen und enteignet worden.
Was also tun? Ich nahm mir vor, irgendwo im Internet dieses Kleingartenschwachsinnsgesetz zu finden, es zu studieren, zur nächsten Vollversammlung zu gehen und ein Gesetz vorzuschlagen, wonach jeder in seinem Garten pflanzen darf, was er will, wann er will und wo er will. Außerdem beschloss ich, ein neues Buch zu schreiben: einen Schrebergartenroman, der sich natürlich entwickeln sollte, von März bis Dezember.