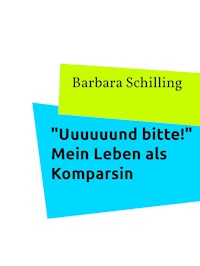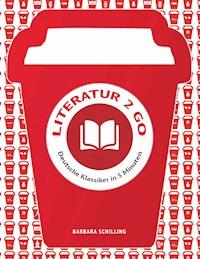16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges geboren, wächst die kleine "Hinterhof-Göre" Helene vaterlos in Berlin auf. Mit liebevollen Menschen an ihrer Seite und einer gehörigen Portion Glück überstehen Helene und ihre junge Mutter die nicht enden wollenden Bombennächte sowie die letzten Kriegstage und den Einmarsch der Roten Armee im Frühjahr 1945. Doch auch nach Kriegsende haben es Helene und ihre Mutter nicht einfach: Die Stadt liegt in Trümmern, Hunger und Not sind geblieben. Ihr Leben scheint leichter zu werden, als Helenes Mutter einen Alliierten heiratet, doch als Älteste von sechs Geschwistern muss Helene viel zu früh erwachsen werden. Der Roman erzählt die Geschichte einer entbehrungsreichen Kindheit im Berlin der Kriegs- und Nachkriegsjahre. Eine Zeit, in der es mit viel Mut, Menschlichkeit und Humor gelang, die Hoffnung zu bewahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2011
© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Titelfoto: Barbara Schilling, Christophe Denis Covergestaltung: Marco Linke Satz und Lektorat: BuchBetrieb Peggy Stelling, Leipzig eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
eISBN 978-3-475-54495-8 (epub)
Worum geht es im Buch?
Barbara Schilling
Meine Berliner Kindheit Brennholz, Kartoffelschalen und Bombennächte
Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges geboren, wächst die kleine »Hinterhof-Göre« Helene vaterlos in Berlin auf. Mit liebevollen Menschen an ihrer Seite und einer gehörigen Portion Glück überstehen Helene und ihre junge Mutter die nicht enden wollenden Bombennächte sowie die letzten Kriegstage und den Einmarsch der Roten Armee im Frühjahr 1945.
Doch auch nach Kriegsende haben es Helene und ihre Mutter nicht einfach: Die Stadt liegt in Trümmern, Hunger und Not sind geblieben. Ihr Leben scheint leichter zu werden, als Helenes Mutter einen Alliierten heiratet, doch als Älteste von sechs Geschwistern muss Helene viel zu früh erwachsen werden.
Der Roman erzählt die Geschichte einer entbehrungsreichen Kindheit im Berlin der Kriegs- und Nachkriegsjahre. Eine Zeit, in der es mit viel Mut, Menschlichkeit und Humor gelang, die Hoffnung zu bewahren.
Prolog
»Am 30. Mai ist der Weltuntergang, wir leben nicht mehr lang …« (Golgowski-Quartett 1954)
Am 30. Mai 1939 wurde ich in Berlin geboren. Am 1. September 1939 marschierten deutsche Truppen in Polen ein – der Zweite Weltkrieg hatte begonnen.
Meine Mutter kam aus sogenannten einfachen Verhältnissen, meinen Vater sollte ich niemals kennenlernen. Der 30. Mai war ein milder Vorsommertag, doch meine damals 16-jährige Mutter litt Höllenqualen. Sie wäre beinahe gestorben, zumindest kam es ihr so vor, bei meiner, nein, unserer Geburt. Denn ich hatte eine Zwillingsschwester. Sabine. Sie kam wenige Minuten vor mir zur Welt. Ein paar Tage lang schliefen wir in der Wiege nebeneinander, hörten die gleichen Stimmen, atmeten den gleichen vertrauten Duft von Kohlsuppe und feuchten Tapeten. Wir wurden von denselben Händen gestreichelt und steckten in den gleichen leinenen Windeltüchern. Wir teilten die Mutterbrust am Tage und das lauwarme Badewasser in der Zinkwanne am Abend. Eines Morgens jedoch, als uns unsere Mutter aus dem Bettchen nehmen wollte, schrie sie entsetzt auf. Sie stolperte zurück und blieb mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt stehen. Dann trat sie wieder an die Wiege heran und griff hinein. Fassungslos starrte sie auf das Baby, das steif in ihren Armen lag. Sabine war in der Nacht neben mir gestorben.
Kapitel 1
Von nun an war ich also allein. Natürlich nicht wirklich allein. Schließlich teilte ich die kleine Kellerwohnung in einem Arbeiterviertel mit unzähligen inzwischen »trocken gelegten« Kneipen, Bergmannstraße Nr. 8, mit meiner jungen Mutter Anneliese und mit meiner dicken Großmutter Hedwig.
»Janze verdammte Bande! Meiner Enkelin brecht ihr nich die Beenchen! Hau bloß ab, du. Und lass dir hier ja nie wieder blick’n, sonst …«
Meine sonst so friedliche Großmutter drohte dem Treppengeländer mit geballter Faust, denn die »Frau vom Amt« war längst hinaus auf den Hof geflohen. Oma Hedwig hatte in den letzten Tagen die Briefe, die vom Jugendamt kamen, nicht einmal mehr geöffnet. In kleine Schnipsel zerrissen, waren sie kommentarlos in den Herd gewandert, auf dem immer eine Kanne Muckefuck kochte. Als schließlich das Fräulein Stanke persönlich »in der Angelegenheit Helene Korritzke« bei uns vorbeigekommen war, hatte Großmutter ihr den härtesten Schemel hingestellt und nicht einmal ein Glas Wasser angeboten; schon bald hatte sie »Klartext« mit ihr gesprochen, wie sie es nannte. Eiskalt hatte sie die junge Frau fixiert, die unter diesem Blick allmählich zu stammeln begann.
»Es ist doch nur zum Besten Ihrer Enkelin. Also, wenn die Beine des Kindes erst mal gerichtet sind, findet sich alles andere von selbst. Und in diesem Alter, na ja, da wäre der Eingriff noch relativ umkompliziert.«
»In diesem Alter?! Die Kleene is jerade mal drei Jahre alt! Kommt jar nich in Frage!«
Meine Mutter saß stumm daneben. Sie war gerade erst von einer schweren Grippe genesen und wurde blass vor Sorge. Sie fürchtete, man würde ihr ihren letzten Zwilling auch noch fortnehmen.
Die Gefahr spürend hatte ich mich bereits beim Klingeln ängstlich in der Stube unter das schwere Eisenbett verkrochen und wie gebannt den erwachsenen Stimmen im Nebenzimmer gelauscht. Aber ich verstand nicht, was sie sagten. So hatte ich im staubigen Dunkel gelegen und auf den einzigen schmalen Lichtstreif gestarrt, der unter der herabhängenden Tagesdecke hindurchschien. Ich versuchte mich nicht allzu sehr vor den in meiner Fantasie riesigen Spinnen zu fürchten, die sicherlich zu Dutzenden in meinem Rücken lauerten, während meine krummen Beine, um die es ging, sich trotzig gegen die kahle weiße Wand am Bettende stemmten.
Das Fräulein hatte sich verstohlen in der kleinen ärmlichen Küche umgesehen und schnell hinzugefügt: »Sämtliche Kosten für die Operation übernimmt natürlich die Fürsorge.«
Das war zu viel. Die Stimme meiner Großmutter hatte so heftig gebebt wie ihr gewaltiger Busen: »Deshalb kommen Se extra her! Ne, dit gloob ick einfach nich. Dit kann doch nich Ihr Ernst sein! Im Leben nich werd ick erlauben, dass Sie und die feinen Herren Doktoren meine Lene zum Krüppel machen. Die Beine brechen und in Gips legen, damit se jerade werden. So’n Quatsch! Wenn ick dit schon höre. Ick sage Ihnen, die O-Beine wachsen sich janz von selber aus. Da braucht keener von denen kommen, die sich Ärzte schimpfen und Lenchen die Haxen richten, damit se angeblich jerade wieder zusammen wachsen.«
»Aber der Vormund …«, hatte die Dame im grauen Wollkostüm schwach eingewandt.
»Hör’n Se mir bloß mit dem Vormund auf. Jar nichts hat der zu sagen, solange ick hier bin, gar nix! Verstehen Se?!«
Die Fürsorgehelferin hatte einen letzten Versuch gestartet: »Aber das Amt hat schon …« Meine Oma senkte den Kopf wie ein angriffslustiger Stier.
»Wat haben die schon jemacht?«
»Na, es hat bereits …«
Drohend wie der Eisberg vor der Titanic hatte sich meine imposante Großmutter von dem schweren, abgesessenen Sofa erhoben. Ihre Augen funkelten zornig, und ihr Gesicht lief rot an – inklusive Doppelkinn.
»Na, da Ihre Tochter ja noch nicht volljährig ist und Sie …«, das Fräulein hatte hastig geschluckt. »Vielleicht wird nächste Woche jemand kommen, der die Helene abholt«, vollendete sie den Satz, während sie nervös ihre Handtasche umklammerte.
Meine Großmutter war explodiert vor Wut. Sie hatte mit der Faust auf die Spüle geschlagen, dass das Geschirr klapperte. Meine Mutter fuhr erschrocken zusammen, bekam aber wieder Farbe ins Gesicht, als wiederum ihre Mutter losdonnerte: »Na, dit soll’n se mal versuchen! Da soll’n se mal kommen, denen werde ick es schon zeigen! Die werden was erleben. Dit janze Haus werd ick zusammentrommeln. Nee, Fräulein, nich mit mir. Dit können Sie ihnen ausrichten. Und jetzt RAUS!« Schnaubend hatte sie mit beiden Händen das bleiche Fräulein zur Tür hinausgeschoben.
»Sie werden schon sehen«, hatte dieses beleidigt zwischen zusammengepressten Lippen auf der Türschwelle gezischt.
Meine Oma schaffte es trotz ihrer geringen Körpergröße, drohend auf das Fräulein hinab zu sehen, die Arme in die breiten Hüften gestemmt: »Hä?! Sie Würmchen wollen mir Angst machen? Dass ick nich lache! Lene kriegen Se nur über meine Leiche, sage ick Ihnen. Erst müssen Se an mir vorbei!«
Doch kaum, dass die konkrete Gefahr gebannt war, setzten sich meine Großmutter und ihre einzige Tochter an den Tisch im Wohnzimmer und beratschlagten aufgeregt, was nun zu tun sei. Als ich durch den Türspalt linste, sah ich die dunklen Schatten auf der Flurwand, deren Tapeten von einem früheren Brand geschwärzt waren. In der folgenden Woche benahmen sich die beiden Frauen höchst ungewöhnlich: Sie verboten mir im Hof zu spielen, und wir mussten auf Zehenspitzen durch die dunkle Wohnung schleichen, sobald Fremde das Haus betraten.
Zuerst fand ich das neue Spiel lustig, aber bald schon wurde es mir langweilig und ich sehnte mich danach, im Freien herumzutoben. Bei jedem Klopfen an der Tür schreckten die beiden Frauen totenblass zusammen; oft schlossen sie mich präventiv im Etagenklo ein, sobald Schritte die Treppe heraufkamen, was mir ebenfalls nicht sonderlich gefiel. Die erste Woche verging ereignislos und auch die zweite brachte nichts Neues. In den folgenden Tagen entspannten sich meine Mutter und meine Großmutter allmählich, blieben aber weiterhin wachsam. Ich lief wie gewohnt zu Hause auf meinen O-Beinen herum, spielte zunehmend lustloser mit den immergleichen Holzklötzen und sang den selbst genähten Puppen ohne Gesichter vielstrophige Fantasielieder von Bäumen und Blumen vor.
Die Fürsorge ließ nie wieder von sich hören.
Kapitel 2
Das Jahr 1944 brachte viele Veränderungen. Wir hatten von Freunden einen Tipp bekommen und zogen um. In die Gartenstraße 110 in Berlin Wedding – dritter Hinterhof: Stube, Küche, kleines Schlafzimmer. Es war himmlisch: ein halbes Zimmer mehr, und das zu dritt, es war ein echter Glücksfall. Nun musste niemand mehr in der Küche auf der harten Bank schlafen. Aus dem feuchten Kellergeschoss der alten Wohnung waren wir direkt unters Dach in die vierte Etage gewechselt. Auf einem Stuhl am Fenster stehend, beobachtete ich in den folgenden Wochen oft die Spatzen und bestaunte die weiten Dächer der Stadt, die sich wie ein Meer aus Rottönen vor mir ausbreiteten. Ich versuchte immer wieder vergeblich die vielen Stufen zu unserem Heim hoch oben unter dem Giebel zu zählen, während meine Großmutter dicht hinter mir unflätig fluchend die nicht enden wollende Treppe erklomm. Oben musste sie ihre durch die Kriegswirren geretteten 83 Kilogramm Körpergewicht, die allerdings nun allmählich doch zu schmelzen begannen, erst einmal mit einer saftigen Williams-Christ-Birne besänftigen, die sie auf wundersame Weise zu scheinbar jeder Tages- und Nachtzeit aus ihrer Schürzentasche zaubern konnte. Kaum waren wir eingerichtet, verbreiteten die Vorbereitungen für den 21. Geburtstag meiner Mutter bereits neue Aufregung.
»Endlich volljährig, jetzt kann ich wirklich tun und lassen, was ich will«, hörte ich sie oft leise summen, wenn sie ihre Lieblingstasse ohne Henkel abwusch. 21 – das bedeutete mehr Rechte und größere Freiheit. Meine Großmutter hatte versucht, heimlich eine kleine Geburtstagsfeier für ihre einzige Tochter zu organisieren. Doch meine Mutter hatte den Braten gerochen. Sie hatte es bereits geahnt, als meine Oma mehr Mehl als üblich für den sonst eher bescheiden ausfallenden Geburtstagskuchen verlangte. Zudem schickte sie mich mit einer Schüssel im Haus herum, um etwas zusätzliches Mehl bei den Nachbarn einzusammeln. Da meine Mutti uns auch noch auffällig unauffällig mit der Nachbarin tuscheln sah, wurde ihr Verdacht bestätigt. Sie freute sich riesig. Am Morgen ihres Geburtstages stand sie bereits um sechs Uhr, es war noch dunkel, in der zugigen Küche und kochte Kaffee. Nach dem Frühstück mussten wir sie wieder ins Bett schicken, um in Ruhe alles vorzubereiten. Um halb acht musste sie endlich zur Arbeit gehen und konnte unsere Geduld nicht mehr mit ihren vielen neugierigen Fragen auf die Probe stellen. Gegen Mittag war dann geputzt, gekocht und geschmückt. Papierschlangen hingen über den Schränken und Marschmusik erklang aus dem Radio. Neben bunten Kerzenstummeln reihten sich Bier, Ersatzkaffee, Pellkartoffeln und Fischstückchen auf dem abgenutzten, aber blank gescheuerten Küchenbuffet. Meine Mutter war sprachlos, als sie am späten Nachmittag von ihrer anstrengenden Aushilfsarbeit in der Wäscherei wiederkam. Sie schimpfte ein bisschen mit uns wegen der Verschwendung, heulte ein bisschen wegen der Umarmungen und ging sich dann endlich umziehen. Kurz darauf klingelte es auch schon an der Tür. Und wieder und wieder. Das Schellen wollte nicht abreißen. Immer mehr Menschen strömten in unsere kleine, glücklicherweise wenig möblierte Küche. Meine Großmutter hatte halb Berlin eingeladen. Ich hüpfte durch die Wohnung und begrüßte neugierig die Gäste. Als es keinen Platz mehr zum Hüpfen gab, schob ich mich an den inzwischen dicht gedrängten Leuten vorbei.
»Inge!«, rief ich froh, als ich sie mit einem gutaussehenden jungen Mann im braunen Hemd zusammen durch die Tür kommen sah.
»Na Süße«, begrüßte sie mich.
Ich klammerte mich an Inges geblümtes Kleid, bewunderte ihre langen Haare, die ihr bis auf ihr rundes Gesäß fielen und sah dann schüchtern an ihrem Begleiter hoch. Er trug die Haare sehr kurz und besaß schöne Zähne. Er hatte Inge zärtlich einen Arm um die Schulter gelegt, was ihr eine leichte Röte ins Gesicht trieb.
»Hallo. Wer bist denn du?«
Der fremde Mann beugte sich zu mir hinunter. Er war jetzt ungefähr auf meiner Augenhöhe.
»Hallo Lene. Ick bin der Manfred.«
»Ein Freund von Inge«, fügte er hinzu und lächelte verschmitzt zu ihr hinauf. Dann wandte er sich wieder mir zu. Freundschaftlich stupste er mich an der Nase. »Ick hab schon viel von dir jehört«, sagte er ernst. Ich schaute ihn überrascht und ein wenig misstrauisch an.
»Du bist ’n sehr hübsches, kluges, kleines Mädchen, hat mir Inge zu Hause erzählt.« Er machte eine bedeutsame Pause.
»Ick gloobe, sie hat Recht.«
Bei diesen Worten strahlte ich über das ganze Gesicht. »Ich bin schon … so alt«, erklärte ich stolz und hielt ihm meine Hand mit meinen kleinen störrischen Fingern hin.
»Ja – schon fast erwachsen«, grinste Inge mit erhobenen Augenbrauen spöttisch.
»Wo wohnst du? Bei der Inge zu Hause?«, fragte ich Manfred.
»Nein, bei Inge bin ick leider nur manchmal zu Besuch.« Sein Gesicht nahm einen nachdenklichen Ausdruck an. »Eigentlich wohne ick zurzeit überall und nirgends.«
Ich muss ihn völlig verständnislos angesehen haben, denn schnell fügte er erklärend hinzu: »Ick bin Frontsoldat, bei der Wehrmacht, weißte.« Mein Mund stand offen wie ein Scheunentor, während ich seinen Worten lauschte. Wie konnte man überall und nirgends wohnen?
»Und woher kommst du dann?«
»Also«, er machte eine kleine nachdenkliche Pause. Dann wählte er seine Worte sorgsam. »Wir wohnen meistens in Zelten und ziehen ständig weiter – dahin, wo der Feind is, verstehste jetzt?«
Ich machte große Augen, immer noch eine Hand in Inges weitem Kleid vergraben. Vom Feind hatte ich schon oft gehört, konnte ihn mir aber gar nicht vorstellen.
»Na ja«, er winkte ab. »Aber nu mal wat anderes: Jetzt hab ick einige Tage Urlaub und da wollte ick die Jelejenheit nutzen und mit Inge zusammen deiner Mama zu ihrem 21. Geburtstag gratulieren. Wir haben auch ein schönes Jeschenk für sie.« Aufmerksam musterte ich das Päckchen in seiner Hand. »Wo steckt se denn?«, fragte er mich.
»Dahinten, bei der Irmgard.« Manfred wandte den Kopf. Ich musterte seinen runden Schädel, der schwarz bepunktet vor mir zu schweben schien und hob dann zögernd die Hand.
»Wie ein Igel«, kicherte ich.
Er grinste und fuhr sich über die dunklen Stoppeln.
»Ja, haste Recht, stachelig wie ein großer Igel …«
»Wegen der Läuse …«, sagte Inge.
Erschrocken zog ich die Hand zurück. »Keene Angst«, lachte auch er, »die sind weg. Haben alle Nissen jeknackt – dit war ’n Spaß!«
Ich blieb skeptisch. »Was is da drin?« Ich deutete mit dem Kopf auf das Geschenk. Manfred zögerte einen Augenblick.
»Etwas janz Besonderes«, grinste er. »Aus fernen Landen sozusagen.«
»Haste das aus dem Krieg?«, fragte ich gespannt.
»Ja …« Inge puffte ihn unsanft in die Seite.
»Komm mit, Kleene. Dann kannste beim Auspacken zugucken«, bot sie an. Aber in diesem Augenblick ging die Tür auf, und unsere Nachbarin Frau Müller stürzte auf mich zu. Sie drückte mich erbarmungslos an ihre mächtige Oberweite und seufzte:
»Ach, meine Kleine. Da biste ja. Mensch, wie dünne du bist.« Sie kniff mir wie die Hexe bei Hänsel und Gretel prüfend in den Arm. »Wo is denn deine Mutter? Ick muss ihr unbedingt gleich gratulieren. Und ihr sagen, dass ick ein bisschen Grieß jekocht hab – der steht jetzt bei euch in der Küche …«
Sie lockerte den Griff um meine Schultern und sah sich hektisch um. Endlich bemerkte sie Inge und Manfred. Sogleich warf sie sich in Pose.
»Ja, hallöchen, wen haben wir denn da?«, flötete sie gut gelaunt. Nun hatte sie das junge Paar am Wickel.
Als Frau Müller mich wieder in Gänze freigab, begegnete ich dem Blick meiner Großmutter, die in der anderen Ecke des Raumes saß und die emotionale Begrüßungsszene verfolgt hatte. Sie verdrehte verzweifelt komisch die Augen und zwinkerte mir zu. Dann erhob sie sich lächelnd und trug ihr geleertes Bierglas in die Küche. Kurz darauf kam sie mit einem frisch gefüllten zurück und ließ sich nun wieder auf ihren Ohrensessel plumpsen. Wo sie die ganzen guten Sachen nur immer auftrieb …? »Ick hab eben alte Bekannte«, antwortete sie stets nur ausweichend, wenn meine Mutter sie misstrauisch nach der Herkunft der raren und begehrten Lebensmittel fragte. Ich setzte mich neben meine Oma auf die beinahe blank gescheuerte Armlehne. Ihre starken warmen Hände umfassten zärtlich meinen Bauch und hielten mich so auf dem Sessel fest. Meinen Kopf an ihre Brust gelehnt, sah ich zu, wie sie amüsiert unsere Gäste beobachtete, sich gar nicht schüchtern in laufende Gespräche einmischte und mit ihren trockenen Kommentaren so manches Gelächter unter den Anwesenden provozierte. Heimlich naschte ich einen Schluck aus ihrem Bierglas; sie gab vor nichts bemerkt zu haben, doch ich sah deutlich, wie ihr rechter Mundwinkel einen Augenblick gezuckt hatte, als ich das Bierglas wieder sinken ließ. Ich schluckte widerwillig die bittere, obgleich stark mit Wasser verdünnte Flüssigkeit und beschloss, niemals wieder in meinem ganzen Leben Bier zu trinken. Unwillkürlich schüttelte ich mich bei dem Gedanken ein ganzes Glas von diesem Gebräu leeren zu müssen. Was die Erwachsenen nur daran fanden?! Meine Geburtstagsmama rief mich zu sich. Sie drohte mir mit erhobenem Zeigefinger: »Na na na, was hab ich denn da gerade gesehen? Trinkst von Omas Bier. Mach das nich noch mal, sonst setzt es was, Fräuleinchen«. Neckend klapste sie mir auf mein Hinterteil. Ich schüttelte den Kopf.
»Und sag deiner Großmutter, dass ich alles sehe …«
»Ja, Mama.« Meine Mutter beugte sich zu mir und küsste mich auf die Wange. »Los, ab mit dir. Und sieh zu, dass du noch was vom Grießpudding abbekommst, bevor alles weg is.«
Eine hervorragende Idee befand ich und sauste in die Küche. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, um besser über die Küchenbuffetkante lugen zu können. Entschlossen langte ich nach dem Grieß, doch der tiefe Teller stand zu nah an der Wand. Ich konnte ihn nicht erreichen. Eine große Hand ergriff das Objekt meiner Begierde. Enttäuscht schaute ich nach oben, um zu erspähen, wer mir zuvorgekommen war. Es war Inges Begleiter. In seiner Faust sah die Schüssel ganz klein aus. »Hier Lene, die wollteste doch haben, nich wahr?« Ich nickte verdutzt, worauf Manfred mir beinahe feierlich die Schüssel überreichte.
»Danke«, ich überlegte kurz, »Manfred«, piepste ich, ohne meinen Blick von ihm zu wenden.
»Jern jeschehen«, antwortete er grinsend. Ich sah ihn noch immer unverwandt an.
»Mensch, na klar«, er schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. »Du brauchst noch ’n Löffel!« Er drehte sich suchend um. »Warte …, hier, den mach ick dir sauber.« Manfred ging zum Wasserhahn und wusch den Löffel ab. »So Madamchen, bitte sehr. Extra für dich.«
Ich nahm den riesigen Blechlöffel aus seiner Faust und begann, unsicher die Schüssel auszuschaben. Die Gäste waren schnell gewesen. »Das Auskratzen ist immer dit Beste, finde ick. Dit schmeckt am leckersten, oder?«
Er sah mich aufmerksam an. Ich nickte. Ich fühlte den Grieß an meinem Gaumen und meinte ein bisschen Süße zu schmecken. Zufrieden kauend verließ ich Manfred und die Küche. Im Nebenzimmer begann Frau Müller gerade meiner Mutter umständlich die Hand zu schütteln und ihr drei Minuten lang unablässig zum Geburtstag zu gratulieren. Frau Müller erzählte noch einmal von der Unmenge Heringssalat, den sie außerdem noch in die Küche gestellt hatte – »janz frisch, janz frisch zubereitet«, beteuerte sie leidenschaftlich – und drückte meiner Mutter dann eine Flasche Selbstgebrannten in die Hand. »Is von meinem Bruder aus Brandenburg«, lachte sie schelmisch. »Ein hervorragender Kartoffelschnaps.«
Meine Mutter dankte und öffnete die Flasche. Sie füllte zwei Gläser fingerbreit mit dem klaren Getränk und reichte Frau Müller eines.
»Auf Ihre Zukunft!«, prostete Frau Müller meiner Mutter zu und fügte dann schnell hinzu: »Auf unser aller Zukunft!«
Meine Mutti strahlte. Ihre glatten Haare hatte sie zu einem Dutt hochgesteckt und sie trug eine schmale goldene Kette zu einer Bluse, deren Farbe meine Großmutter als »Eierschale« bezeichnete. Sie trug heute keine Kittelschürze, sondern einen dunkelroten Rock, nicht ganz fleckenfrei, doch ich fand sie einfach zum Niederknien elegant.
Sie kam auf mich zu und kniff mir spielerisch in die Wange. »Na, was grinste so?« Sie zupfte mir den Rock zurecht und fragte vergnügt: »Und hat die Dame noch einen Wunsch an diesem besonderen Tag?«
Ich grübelte nur ein kleines Weilchen, wog den Wunsch nach einem knallroten Ball gegen meinen anderen großen Wunsch ab: »Ein Geschwisterchen«, antwortete ich mit glänzenden Augen.
»Was?«, fragte meine Mutter perplex.
»Ja, alle kriegen Brüder und Schwestern. Ich möchte auch jemanden zum Spielen – nur für mich.« An Omas entgleisten Gesichtszügen sah ich, dass sie mitgehört hatte.
»Na, dit fehlte uns jerade noch!«, sagte sie trocken. Meine Mutter und meine Großmutter sahen erst mich, dann einander an. »Na für den ›Kaninchenorden‹ in Bronze musste aber noch drei drauf legen«, kommentierte sie spöttisch meinen Wunsch, indem sie meine Mutter grinsend ansah. »Dit bronzene Mutterkreuz gibt’s erst ab vier Jören. Und für Jold musste sogar achte uff die Welt bringen. Aber wie man überhaupt eins ernähren soll in diesen Zeiten, dit verraten uns die Herren an der Spitze nich.«
Meine Mutter schaute sich nervös um. »Mensch Mutter, pass doch auf, was du sagst. Du weißt doch, hier haben die Wände Ohren.« Sie beugte sich noch näher zu ihr hinüber und tippte sich an die Stirn. »Als ob ich dem Führer ›Soldaten schenken‹ würde … Is doch unverantwortlich.« Ich schaute verständnislos von einem zum anderen und verstand nur, dass mein Wunsch nicht besonders gut ankam. Warum fragten sie mich dann? Ich wollte doch nur jemanden zum Spielen, keinen Soldaten. Die waren doch eh immer weg und kämpften gegen irgendwelche Feinde, so wie Inges Manfred …
Schließlich griff meine Oma in ihre Rocktasche und holte eine blank polierte Williamsbirne hervor. »Hier Süße, vielleicht tut’s die ooch erst ma.« Ich erwiderte nichts. Wie sollte ich denn mit der spielen? Erwachsene schienen doch nicht so klug zu sein, wie sie immer taten, nicht einmal meine Oma Hedwig. Ich nahm die Birne, beschloss aber ein bisschen zu schmollen, doch bald schon wurde mir das zu langweilig. Hier war einfach zu viel los heute. Ich blieb aber noch ein paar Minuten mit beleidigtem Blick stehen. Nur, um meinem Unmut den nötigen Nachdruck zu verleihen. Meine Großmutter ignorierte mein Tun gutmütig, dennoch meinte ich genau ein »Du-beleidigte-Leberwurst«-Lächeln auf ihren vollen Lippen zu erkennen. Ich gab das Schmollen auf und trollte mich. Neugierig schielte ich um die Ecke des Türrahmens hinein ins Zimmer.
Nachdem Frau Müller Herrn Heise entdeckt und fluchtartig das Wohnzimmer verlassen hatte, um ihn abzufangen, nahm mich meine Mutter auf ihren Schoß und fütterte mich mit einer halben Hackepeterstulle. Der Belag schmeckte irgendwie komisch, aber es gefiel mir bei ihr. Sie plauderte ausgiebig mit Inge und Manfred. Die beiden schauten sich immer wieder verliebt an. Später saß ich allein auf der Couch und tat, als würde ich gedankenverloren mit meiner Puppe spielen, während ich in Wirklichkeit gespannt zuhörte, was Frau Müller dem sichtlich gelangweilten Herrn Heise über meinen Vater erzählte. Sobald sie das Thema angeschnitten hatte, hatte ich meine Puppe sinken lassen und angestrengt gelauscht. Doch da Frau Müller dies bemerkte und mich anwies, doch woanders zu spielen, musste ich ein Täuschungsmanöver starten. So eine Gelegenheit gab es nicht alle Tage. Ich wusste nicht einmal, welchen Namen mein Vater hatte; das Einzige, was mir immer wieder zu Ohren kam, war, dass er sich nicht blicken ließ und nichts für mich bezahlte, was ich reichlich komisch fand: Warum sollte er für mich bezahlen, ich war doch eh schon seine Tochter …
Hinter vorgehaltener Hand berichtete Frau Müller, dass mein Vater ein nichtsnutziger, aber bildschöner Seemann gewesen sei. Er hätte meiner Mutter die Welt versprochen, sie – noch blutjung und unerfahren – in einer sternenklaren Nacht verführt. »Im Tiergarten, im Park …«, hatte sie lüstern geraunt. Wenig später sei er einfach auf und davon.
»Niemand hat seitdem wieder wat von ihm jehört«, pointierte Frau Müller ihren dramatischen Bericht. Herr Heise besah sich gelangweilt seine sauberen Fingernägel und nickte hin und wieder. Frau Müller fasste ihn beim Arm, um ihn auch körperlich in den Bann ihrer Erzählung zu ziehen.
»Manchmal meint die Anneliese zwar, ihn in einem der Kriegsberichte in der Wochenschau zu erkennen, aber dit is reine Einbildung, wenn se mich fragen.«
»Tut aber keiner«, murmelte Herr Heise heiser.
Doch Frau Müller war zu sehr mit ihrer eigenen Meinung beschäftigt, als dass sie diese Bemerkung für voll genommen hätte: »… kann man nich erkennen. Die huschen doch so schnell vorbei – und sehen irjendwie in Uniform alle gleich aus.«
Als Frau Müller die Uniformen erwähnte, regte sich zum ersten Mal etwas in Herrn Heises Gesicht. Ich konnte einen fast träumerischen Gesichtsausdruck ausmachen, so wie Mama ihn bekam, wenn sie von Himbeergeist oder der Brüsseler Spitze, die sie vor dem Krieg im »KaDeWe« gesehen hatte, schwärmte. Herr Heise liebte schnittige Uniformen beinahe ebenso wie Abzeichen, Medaillen, Urkunden, Schulterriemen und all den »Firlefanz«, wie meine Oma stets abschätzend bemerkte. »Und – kannste dir was koofen dafür? Nee!«, war ihre unerschütterliche Meinung zu diesem Thema.
Frau Müller versuchte das Zeichen von Interesse in der Miene ihres Gegenübers zu nutzen. Schnell fügte sie noch einige pikante Details hinzu: »Die Anneliese, ja«, sie dämpfte auffällig unauffällig die Stimme, »die soll aber nich die Einzige sein, die er – na Se wissen schon – angebufft hat und dann ab durch die Luzie …« Sie rückte noch näher heran und kroch Herrn Heise förmlich ins Gesicht. Ich musste mich ungeheuer bemühen, noch etwas von ihrem Getuschel zu verstehen, während ich meiner Puppe mit mechanischen Bewegungen zum fünften Mal den Rock an- und wieder auszog, um die Fassade zu wahren.
»Ein anderes Mädel, gleich hier ein paar Straßen weiter, soll ooch von ihm einen Braten in der Röhre jehabt haben.«
Erschöpft aufseufzend ließ sie sich wieder auf den Schemel sinken und schaute Herrn Heise ob dieser erstaunlichen Geschichte triumphierend an.
»Tja, so kann es gehen«, kommentierte Herr Heise vage diese Informationen. Er war wieder dabei seine makellosen Fingernägel zu reinigen. Frau Müller schien enttäuscht, sie hatte sich eine stärkere Reaktion erhofft.
»Und denn hat die Liese ooch gleich noch Zwillinge jekriegt, doppelt jestraft …«
Ihr Nachbar blieb stumm.
»Aber dit eine Kleine is gleich – na ja …« Sie schaute ihn Applaus heischend an. »Ja, wat sagen Se denn dazu?«, bohrte sie schließlich nach. Herr Heise sah sie erstaunt an.
»Tja, was soll ich dazu sagen? Ähm, war er Arier?« Frau Müller glotzte ein paar Sekunden verständnislos. Dann schnalzte sie verächtlich mit der Zunge angesichts solcher Ignoranz gegenüber einem handfesten, wenn auch schon verjährten Skandal und griff nach ihrem Glas. Sie tat einen tiefen Zug.
»Also, wenn man bedenkt, dass der damals gleich mehrere …«, beharrte sie.
»Die Tür zur Vergangenheit lässt sich nich öffnen, ohne dass sie knarrt«, warf Herr Heise ungerührt ein. »Jeder macht mal Fehler. Die Frage is, welche Einstellung er heute zu seinen Pflichten, als Deutscher, gegenüber seinem Volk hat.«
Frau Müller schüttelte den Kopf und drehte Herrn Heise den Rücken zu. Damit war das Gespräch beendet. Wenn Herr Heise ihr umfangreiches Wissen über ihre Mitmenschen nicht zu schätzen wusste, würde sich schon jemand anderes finden, der ihrer würdig war. Sie erhob sich und raunte im Türrahmen mit einem Kopfnicken auf Herrn Heise einer Nachbarin zu: »Pff, wer hat den denn einjeladen? Die sind doch alle gleich: braun und langweilig wie Gartenerde …«
Herrn Heise schien das in keiner Weise zu berühren; er hatte sich inzwischen ein Obstmesser genommen, um besser den nicht vorhandenen Schmutz unter den Nägeln zu erreichen. Ich bedauerte Herrn Heises Desinteresse sehr, denn natürlich brannte ich darauf, bei dieser einmaligen Gelegenheit noch mehr über meinen Vater zu erfahren, riskierte ich doch stets eine Kopfnuss, wenn ich meine Mutter oder Großmutter mit diesem heiklen Thema belästigte. Leider wusste ich immer noch nicht, wie mein Vater hieß. An diesem Abend beim Zubettgehen beschloss ich, ihn von nun an in meinen Gedanken »Manfred« zu nennen. Ich versuchte mir Manfred als Matrosen vorzustellen, worüber ich einschlief und prompt von einem weißen Segelboot mit winzigen Igeln und riesigen Läusen an Board träumte, obwohl ich noch nie ein echtes Segelschiff gesehen hatte. Nur ein paar Mal einen Dampfer auf der Spree.
Das Buffet des Festes war den Umständen entsprechend – alles war streng rationiert – spärlich, aber vorhanden, was vor allem dem unschlagbaren, manchmal skrupellosen Organisationstalent meiner Oma zu verdanken war. Die meisten Berliner hungerten – doch der unersättliche Appetit meiner »Omama«, die ihre durch die harten Zeiten stark dezimierte Körperfülle an diesem denkwürdigen Tag in einem violett-geblümten Kleid mit gestärktem Kragen verhüllte, sollte ihr dieses Mal zum Verhängnis werden. Ein kleiner toter Aal raubte meiner Großmutter, imposant von Statur und Stimme, unvermittelt ihre Lebensenergie: Nur wenige Tage nach dem 21. Geburtstag ihrer einzigen Tochter starb sie an einer Fischvergiftung.
Wir standen im Krankenhaus an ihrem Bett und konnten es nicht fassen, wie gelähmt starrten wir auf ihren kalten Körper. Sie war einfach gegangen. Nie vergaß ich den Anblick der Leiche, die gar nicht wie meine Großmutter aussah und doch frappierende Ähnlichkeit mit ihr hatte. Ihre rotbraunen Haare fielen glänzend und wohl frisiert über das weiße Kissen, und sie trug ihr bestes Kleid: blau-weiß gestreifte Baumwolle. So schön hatte ich sie noch nie gesehen. Sie hatte die Hände fromm über ihren runden Leib gefaltet, aber etwas fehlte: Nirgends beulten Birnenumrisse ihre Taschen aus. Auf ihrem Gesicht lag kein friedlicher, versöhnlicher Ausdruck; im Gegenteil: Es hatte einen beinahe verärgerten Zug angenommen, so als passte ihr das Geschehene gar nicht in den Kram. Inge hielt mich fest an der Hand; sie sprach nicht. Meine Mutter stützte sich bleich auf das Fußende des Bettes, um nicht zu stürzen, während ihr schmaler Mund flüsternd die immer gleichen Worte formte: »Warum haste das gemacht? Warum?« Sie schniefte deutlich hörbar. »Es war doch so schön, so eine schöne Feier … Du und deine verdammten Lieferanten, du … Ausgerechnet jetzt, wo ich …« Ihre Stimme versagte. Ich sah verwirrt und mit Unwillen, wie es von ihrer Nase auf den Fußboden tropfte. Ich schaute zu Inge hoch, doch sie schien mich vergessen zu haben. Der Rücken meiner Mutter zuckte heftig. Sie begann mit ihrer Faust, auf die Bettdecke zu hämmern. »Warum? Warum?«
Inge ließ meine Hand los und versuchte sie zu beruhigen, doch meine Mutter prügelte nun mit beiden Händen unkontrolliert auf die Decke ein.
»Warum?«, rief sie verzweifelt. Ich stand allein am Fenster und wagte nicht mich zu bewegen. Die resolute Krankenschwester beobachtete die Szene mitleidig, sie kannte viele Formen des Schmerzes, doch allmählich wurde sie ungeduldig, andere Patienten warteten. Wir mussten das Krankenzimmer, das nun zum Sterbezimmer geworden war, verlassen.
Nach der bescheidenen Beerdigung saßen meine Mutter und ich ganz allein in der kleinen Wohnküche. Der Herd war kalt, der Muckefuck sollte im kommenden Winter oft in der Kanne gefrieren, weil nichts mehr zum Heizen aufzutreiben war. Ich saß auf dem Schoß meiner verzweifelten Mutter, die sich nun ganz allein wähnte auf der Welt, und sah ihr seit einer halben Stunde ununterbrochen beim Weinen zu. Schließlich ließ der Regen draußen etwas nach, ein kalter Wind kam auf und rüttelte an der Scheibe. Meine Mutter schnäuzte sich mit der einen Hand und streichelte mir mit der anderen über die Wange, ihre Finger rochen nach Erde und Seife.
»Was soll’n wir denn jetzt nur machen, Lenchen?«, fragte sie seufzend.
Ich schmiegte meinen Kopf an sie. Ich fühlte, dass sie keine Antwort erwartete. Sie drückte mich noch fester an sich und schniefte mir ins Haar. Ich sah den Regentropfen zu, wie sie an der Fensterscheibe hinunterrannen, wie sie sich in Bächen sammelten und schneller wurden, bis sie auf den Rahmen schlugen und dort eine neue längliche Gestalt annahmen.
»Kommt Omama denn gar nich wieder?«, fragte ich verstört.
»Nein, mein Schatz, Oma is jetzt im Himmel und sieht alles, was wir hier unten tun.«
»Wirklich alles?«, fragte ich erstaunt.
»Ja, sie is immer bei uns. Sie passt auf, sie is jetzt dein Schutzengel.« Meine Mutter wiegte mich – schon wieder leise schluchzend – hin und her wie ein Baby. Ihre Strickjacke fühlte sich weich und warm an auf meiner Haut, und der Gedanke an meine Großmutter im Himmel beschäftigte mich, doch mein Magen knurrte unüberhörbar.
»Ich hab Hunger«, flüsterte ich kleinlaut. Meine Mutter sah mich mit ihren rot verquollenen Augen noch eine Minute lang traurig lächelnd an. Dann drückte sie den Rücken durch, stand langsam auf und kochte einen Topf dünnen Kaffee mit viel Milch für uns beide. Mir stellte sie eine kleine Scheibe Brot mit Margarine auf den weiß lackierten Küchentisch. Als Nachtisch aß ich einen rotbackigen Apfel, ganz klein geschnitten, so wie Oma ihn immer für mich gemacht hatte. Ich musste an die Birnen denken, die Oma so gern gegessen hatte und biss wütend in das Apfelstück. Wo war die Birne für mich? Warum nur ließ sie uns allein?! Einfach wegzugehen – das war ungerecht!
Am Abend hörte ich in der Ferne das dumpfe Dröhnen der Kampfflugzeuge. Unwillkürlich duckte ich mich, während meine Mutter hastig die Verdunkelungsrollos herunterließ – so wie es schon seit einiger Zeit Vorschrift war. Die feindlichen Kriegsflugzeuge sollten sich nicht am Licht der Städte orientieren und Ziele ausmachen können. Ich setzte mich neben ein dickes rotes Windlicht und kramte meine Buntstifte hervor. Auf der Rückseite eines alten Einkaufszettels malte ich ein Bild. Es zeigte meine Großmutter in ihrem blau-weiß gestreiften Kleid auf einer Wolke. Ich fand, es passte sehr gut, denn auch der Himmel war blau und die Wolke weiß. Ich legte das Bild auf das Fensterbrett, damit Oma es besser sehen könnte. Beim Zähneputzen kam mir der Gedanke, dass ja die Rollos Oma die Sicht auf mein Bild versperrten, doch dann fiel mir ein, dass Oma ja ohnehin alles sehen könnte, egal wo das Bild hing, und ich nahm es wieder fort und schenkte es meiner Mutter. So machte ich beiden eine Freude. Mit der Zahnbürste in der Hand stieg ich auf einen Stuhl und steckte den Kopf unter das Rollo, um zum Himmel aufzusehen. Mein Blick richtete sich auf die Sterne; je länger ich hinsah, desto mehr funkelnde Lichter schienen sich vom schwarzen Hintergrund abzuheben. Ich putzte sehr gewissenhaft jeden einzelnen meiner Milchzähne. »Armsein is keine Schande«, hatte Großmutter immer gesagt, »aber schmutzig wollen wir nich sein.«
Ich wusch mir auch Gesicht und Hände und sogar die Ohren, so gut es eben ging. Zudem erklärte ich der Oma, dass ich von nun an besonders brav sein wolle, da sie ja ohnehin alles wissen würde. Dann besann ich mich aber, und beschloss, lieber noch eine kleine Rückversicherung auszuhandeln.
»Und wenn ich doch mal ungezogen bin, dann verpetz mich bitte nich gleich bei Mama, ja? Ich sag es ihr dann bestimmt auch bald selber … irgendwann, versprochen.«
Ich blickte nachdenklich in die Höhe, legte den Kopf noch weiter in den Nacken. Meine Augen versuchten, das dunkle Blau des unseren Hof überspannenden Himmels zu durchdringen, etwas zu entdecken. Vergeblich.
»Gute Nacht, träum schön«, flüsterte ich und kletterte vom Stuhl.
Meine Mutter stand im Türrahmen, dicke Tränen rollten über ihre Wangen. Sie streckte mir die Arme entgegen.
»Komm Liebes, Zeit fürs Bett.« Sie schloss das Fenster, deckte mich zu und legte mir Amelie, meine heiß geliebte Puppe mit den geflochtenen Wollzöpfen, in den Arm. »Schlaft gut, ihr beiden«, sagte sie zärtlich und gab mir einen langen Gutenachtkuss.
Kapitel 3
Immer wieder rissen mich die Sirenen, deren durchdringendes Heulen ich mein Leben lang nicht vergessen können würde, aus dem Schlaf. In dieser Nacht hob mich Inge aus dem Bett und zerrte mich hastig zur Tür. Ich wollte nicht weggehen, ich fühlte mich so furchtbar müde und die Nachtluft war eiskalt.
»Wo is Mama?«, fragte ich verwundert.
»Sie is noch nich von Tante Hertha zurück. Komm schnell«, rief Inge und klemmte sich mein Köfferchen mit den wenigen Habseligkeiten unter den Arm. Es war stockfinster; die Verdunklungsrollos ließen nicht einmal das Mondlicht hinein. Schlaftrunken stolperte ich in meinem kratzigen Wollmantel über dem Nachthemd an Inges Hand über den Hof und dann die steile enge Treppe zum Luftschutzkeller hinunter. Doch plötzlich blieb ich stehen, mein Herz schien einen Schlag auszusetzen. Die Leute drängten weiter, doch ich stemmte mich entschlossen mit aller Kraft gegen die schweren Körper. »Amelie! Ich habe Amelie vergessen«, rief ich entsetzt. Sie musste in meinem noch warmen Bett liegen.
Inge sah mich ernst an. Sie ahnte, wie sehr ich meine Puppe Amelie, das letzte Geschenk meiner Großmutter, liebte. Die Leute wurden ungeduldig, schoben und stießen. »Es is zu spät. Du kannst sie jetzt nich mehr holen.« Sie zog mich entschlossen weiter. Das konnte ich nicht glauben, ich schrie und strampelte, und um ein Haar wäre ich zwischen den Beinen eines großen Mannes entkommen. Doch Inge erwischte mich in letzter Sekunde am Ärmel. Sie griff so fest nach mir, dass ihr Fingernagel splitterte, doch sie bemerkte es nicht. Mit bleichem Gesicht trug sie mich die letzten Stufen hinunter. Die Tür schloss sich und wieder hörte ich das tiefe Brummen der Flugzeuge, die wie riesige Bienen den Himmel über Berlin durchzogen.
Wir saßen auf einer harten Holzbank neben ängstlichen Nachbarn, bekannten und unbekannten Gesichtern. Sonst hatte ich immer mit meiner Mutter auf diesem Platz gesessen. Anders als in den vielen anderen Nächten zuvor senkte sich nicht gnädig der Schlaf über mich. Zu deutlich fühlte ich die Lücke in meinen Armen, Amelie fehlte. Stattdessen saß ich steif auf meinem Platz und zählte wieder und wieder die Mauersteine der grauen Kellerwände. Längliche Backsteine, einer neben dem anderen, endlose Reihen, die sich im Dunkel verloren. Ich zitterte. Die Hand, die mir Inge auf die Schulter gelegt hatte, spendete nur wenig Trost. In einer Ecke gleich neben dem Stützbalken stand ein Akkuradio, das immer wieder schrecklich krächzende Laute von sich gab. Der Mann im Radio kündigte einen schweren Luftangriff der Amerikaner an. Eine Viertelstunde später hörten wir dumpfe Einschläge. Die Decke über meinem Kopf schien zu wackeln. Doch das sei nur Einbildung, versuchte Inge mich zu trösten. Die da draußen seien viel zu weit weg. Aber nah genug, viel zu nah, sagte mir mein Kopf, und ich machte mich ganz klein an Inges Seite.
Amelie, dachte ich immer nur. Amelie! Was, wenn ihr etwas zustößt? In meinen Gedanken fielen schwarze Bomben auf unser Haus. Ich sah vor mir, wie Amelies Körper von umherfliegenden Splittern zerfetzt wurde und ihre blonden Haare qualmend verbrannten. Sie würde nicht einmal bluten, nur ihre Füllung würde herausquellen. Ich starrte mit aufgerissenen Augen auf die gegenüberliegende Wand, unfähig mich zu rühren.
»Hallo du.«
Unter meinem Blick nahm der Umriss mir gegenüber langsam eine menschliche Gestalt an. Ein alter Mann beugte sich zu mir hinüber und fragte: »Hast du Angst, meine Kleene?«
Ich schaute ihn nur stumm an.
»Das brauchst du nicht.«
Er senkte die Stimme fast unmerklich: »Bald ist es vorbei, alles wird gut, du wirst sehen.«
Seine warmen braunen Augen schienen zu leuchten, als er dies sagte. Ich reagierte nicht. Er ließ die Hand in seinen schmutzigen Hosen verschwinden und holte einen kleinen Gegenstand hervor. Er schloss beide Hände und hielt sie hinter seinen krummen Rücken.
»Na, willst du raten?«
Ich brauchte eine Weile, bis ich ihn verstand. Doch ich blieb stumm.
»Gut, in welcher Hand habe ich das Geschenk für dich versteckt?«
Ein Geschenk? Ich schaute ratlos. Dann kam mir der Gedanke, dass es vielleicht etwas zu essen sein könnte. Ich könnte es mit Inge und meiner Mutter teilen, wenn sie zurückkommen würde.
Der Mann, dessen Jackett so faltig wie sein Gesicht wirkte, kniff die Augen zusammen und flüsterte mit verschwörerischer Stimme: »Nun, was meinst du – ist es rechts oder links?«
Ich überlegte kurz, neigte langsam den Kopf und zeigte dann auf seine rechte Hand.
»Kluges Kind«, lachte er leise. Er hielt mir seine geschlossene Hand entgegen. »Sieh nach.« Ich zögerte, doch meine Neugier war stärker. Ich stand auf und ging zwei Schritte auf den grauhaarigen Unbekannten zu. Vorsichtig bog ich seine Finger zurück. Doch die Hand war leer. Enttäuscht wollte ich schnell wieder auf meinen Platz gehen. Aber der Mann sagte bestimmt: »Halt, es gibt immer mindestens zwei Möglichkeiten. Du musst doch noch in der anderen Hand nachsehen.«
Ich drehte mich um und lief zurück. Gespannt öffnete ich seine linke Hand. Dieses Mal hatte ich Glück. Ich musterte den kleinen, holzgeschnitzten Käfer. Er hatte sechs schwarze Punkte auf seinem roten Rücken und sechs kurze Beinchen an der Unterseite. Ich drehte ihn hin und her.
»Ich habe ihn selbst gemacht – für jemanden ganz besonderes …«
Er blinzelte kurz. »Wenn du die Augen schließt und ganz stillhältst«, erklärte er mir, »kannst du spüren, wie der Glückskäfer langsam auf deiner Handfläche entlang zu krabbeln beginnt. Das ist immer ein gutes Zeichen, dann gibt es Hoffnung.«
Erstaunt sah ich erst ihn, dann den Käfer an. »Wirklich?«
Er bejahte mit ernster Erwachsenenmiene und strich mir leicht mit dem Zeigefinger über die Wange. »Oh ja, aber du musst viel Geduld haben, damit er sich an dich gewöhnen kann.«
»Lene, komm her zu mir!«, rief Inge streng zu mir herüber.
Ich zögerte, doch er hieß mich zu ihr zu gehen.
»Nimm den Käfer mit, er gehört jetzt dir.«
Artig setzte ich mich neben Inge. Ich fühlte das glatte Holz des kleinen Tieres und versuchte in der nächsten Stunde möglichst unauffällig den Holzkäfer auf meiner Hand zum Laufen zu bringen. Manchmal sah ich ungeduldig auf, und immer dann lächelte mir der alte Mann auffordernd zu. Und kurz bevor es Entwarnung gab, fühlte ich es plötzlich: Der Käfer bewegte seine sechs Füßchen auf meiner Handinnenfläche! Er lebte.
Den Käfer fest umschlossen betrat ich unsere Wohnung. Fast hätte ich den Wassereimer umgestoßen, den wir immer bereitstellten für die Löschtrupps, im Falle eines Falles. Doch auch heute war unser Haus von den Bombenangriffen verschont geblieben. Ich sah mich um: Alles schien so wie immer. Mit klopfendem Herzen lief ich direkt ins Schlafzimmer. Welch ein Glück: Amelie saß unbeschadet auf dem Stuhl neben meinem Bett. Behutsam legte ich ihr meinen neuen Freund, den Holzkäfer, in den Schoß.
»Sieh mal Amelie, das ist Ernst, der Glückskäfer. Den hat mir heut ein Mann im Keller geschenkt; der hätte Oma bestimmt auch gefallen – der Käfer …«
Ich deckte Ernst behutsam mit dem Rocksaum der Puppe zu. »So, jetzt hat er’s schön warm bei dir. Und dass ihr euch ja vertragt!«
Ich drohte mit dem Zeigefinger, wie ich es bei Mutter gesehen hatte. Kurz darauf öffnete sich die Wohnungstür. Ich stürmte in den Flur, um nachzusehen, wer gekommen war. Gott sei Dank: Erleichtert umarmte ich meine atemlose aber unverletzt zurückgekehrte Mutter. Sie herzte mich, als hätte sie mich drei Wochen nicht gesehen, und genauso kam es ihr auch vor. Sie flüsterte Inge zu, wie es ihr im Bezirk Charlottenburg ergangen war, wie sie sich im fremden Keller noch einen Platz erkämpft und das dumpfe Grollen der Maschinen gehört hatte. Sie schienen direkt über ihrem Kopf gekreist zu haben. Immer lauter, immer mehr.
»Gebetet hab ich, Inge. Gebetet, dass ich mein kleines Mädchen heile wieder sehe. Und dann, dann hat’s ganz furchtbar geknallt, so, dass ich dachte: So, nu is zu Ende. Direkt neben uns haben sie zwei Häuser weggebombt, nichts is geblieben. Als wir später hochkamen: nur Staub …«
Sie schien durch die Wand zu sehen. Ihre Lippen bebten. »Gebrannt hat’s überall und immer wieder stürzten plötzlich Wände ein. Eben noch gehste da lang und im nächsten Augenblick – mein Gott, fast hätte es uns erschlagen.« Ihr Mund sah ganz starr aus vor Schreck; ihre Lippen waren schmutzig und aufgesprungen, und ich hatte fast ein bisschen Angst vor ihr.
»Mensch, ihr, ich … Was hab ich für ein Glück gehabt. Oh Gott, oh Gott.«
Sie hielt sich die Hand vor die Augen. Ihre Schultern begannen zu beben. Inge streichelte ihr behutsam über den Arm.
»Is ja schon gut. Du hast es geschafft. Jetzt biste hier – bei uns.«
Meine Mutter sah nicht auf, murmelte nur: »Ja. Ja, ich bin hier. Und was is mit den andern? Da waren Kinder – nich älter als Lene …« Sie stockte beim Gehen und beim Reden. »Ich saß mit im Keller, und es dröhnte und krachte. Die Wände wackelten, alle schrien durcheinander. Ich fühlte, wie Putz und Mauerwerk auf uns niederprasselten. Mein ganzer Körper fühlte sich an, wie eine große Wunde. Als ich wieder den Kopf heben konnte, saßen wir, die Reihe an der Wand, noch da und hielten uns die schmerzenden Stellen. Aber auf der gegenüberliegenden Seite …« Sie weinte heftig. »Da war nix. Nichts mehr. Die ganze Kellerhälfte war quasi weg. Alle tot. Keiner war übrig. Die gesamte Seite weggebombt. Nur Blut und Leichen.« Ich schauderte beim Zuhören und versuchte an etwas anderes zu denken. Doch die beschriebenen Bilder drängten sich mir so deutlich auf, als wäre ich dabei gewesen. Inge bemerkte nicht, wie ich blass wurde. Meine Mutter war zusammengesunken. Sie saß auf dem kahlen Flurboden und schluchzte. Sie schüttelte immer wieder fassungslos den Kopf. Als sie sich wieder ein wenig beruhigt hatte und aufstehen konnte, seufzte ich leise. Ich hatte große Angst um sie. Und um mich. Was ging hier nur vor? Wie gut, dass Inge da war. Sie führte meine Mutter in die Küche, setzte sie an den sauberen Küchentisch und zog ihr mit großer Ruhe die Schuhe aus. »So, nun ruhste dich erst mal aus und trinkst einen schönen starken Kaffee.« Sie setzte Wasser auf und fischte aus einer mir gänzlich unbekannten und bis dahin gut versteckten Dose einige wenige echte Kaffeebohnen heraus. Ich staunte. »Für Notfälle«, raunte sie mir ernst zu. »Hier Lene«, sie reichte mir mit wichtiger Miene drei Tassen und drei Löffel. »Du deckst heute den Tisch.« Ich nickte. Vorsichtig trug ich das Geschirr und Besteck zum Tisch und verteilte gewissenhaft die Löffel. Dann kletterte auch ich auf einen Stuhl und sah mit großen Augen Inge beim Kaffeemahlen zu. Mit Kraft schien sie den Hebel zu drehen, starrte konzentriert auf das braune Pulver. Meine Mutter bewegte sich nicht. Ich bekam allmählich wieder stärkere Angst. Würde sie jetzt immer so bleiben? So komisch? So, als säße da eine andere Frau als meine Mutter? Inges Antennen registrierten die gespannte Situation. Sie redete auf meine Mutter ein, rieb ihr die Finger warm und schaffte es wirklich, dass diese ein wenig zu sich kam. Ich stand kurz vor dem Losheulen, das war zu viel für mich. Inge drückte mich hilflos, sah von mir zu meiner Mutter hinüber. Betont fröhlich schob sie mir den fast leeren Zuckertopf zu und sagte: »Mensch Lene, erzähl doch mal deiner Mama von dem tollen Spielzeug, das du heut geschenkt gekriegt hast.«
Unsicher sah ich sie an.
»Na los, Lene. Deine Mama is schon ganz gespannt. Nich wahr, Anneliese?«
Sie stieß auffordernd meine Mutter an. Mühsam hob diese den Kopf aus der Hand. Inge sah ihr in die Augen. »Dein Kind lebt – und braucht dich.«
»Ja, natürlich«, flüsterte meine Mutter immer noch irgendwie abwesend.
»Na los, nu erzähl mal. Bist doch sonst nich so schüchtern.« Inge knuffte mich neckisch in die Seite, während sie meine Mutter nötigte das heiße schwarze Gebräu zu trinken. Der Kaffee schien ihr gut zu tun. Sie versuchte, über den Rand ihrer angestoßenen Tasse ein gequältes Lächeln zu schicken. Ich blickte meine Mutter lange an und begann dann stockend zu erzählen. Mit jedem Wort schienen die Augen meiner Mutter ein wenig klarer zu werden, und so berichtete ich ihr schließlich ausführlich von meinem Glückskäfer Ernst. Ich rannte ins Schlafzimmer, um ihn ihr zu zeigen, und als sie ihn in der Hand hielt, und ich ihr erklärte, dass ich ihn auf meiner Hand hatte laufen fühlen, war sie fast wieder bei uns angekommen.
In dieser Nacht gab es noch ein weiteres Mal Bombenalarm. Zu dritt suchten wir Schutz im Keller; der alte Mann war nicht gekommen.
Ich sah ihn nicht wieder.
Kapitel 4
Ernst, der Käfer bekam einen Ehrenplatz bei uns auf der Ablage im Flur. Er beäugte jeden, der kam oder ging und war immer dabei, wenn ich das Haus verließ. Doch er und ich waren klein und drohten in den Wirren der Zeit verloren zu gehen. Nach dem gescheiterten Hitler-Attentat am 20. Juli sollte der Krieg noch knapp zehn lange Monate dauern. In diesem Zeitraum fielen beinahe genauso viele deutsche Soldaten wie in allen vorangegangen Kriegsjahren zusammen. War auch Manfred darunter? Inge wurde immer stiller. Die letzten Jahrgänge, die Jüngsten, viele von der Schule direkt an die Front geschickt, wurden regelrecht verheizt. Göring brüllte die Regimenter an: Jeder sei verpflichtet, »einen feigen Hund, der seine Waffe wegwirft und die Flucht ergreift sofort zu erschießen«. Brutalität und Ohnmacht griffen immer stärker um sich. Von all dem bekam ich nicht viel mit, und doch machte sich ein Gefühl der Beklemmung breit, denn ich sah und hörte zu viele Dinge, als dass ich nicht die steigende Gewaltbereitschaft gespürt hätte.
In den letzten bangen Kriegswochen, als es jede Nacht Alarm gab, unsere Nachbarn nicht wussten, wie sie den nächsten Tag überleben sollten, steigerten die schlechten offiziellen und inoffiziellen Nachrichten die Verzweiflung und ließen das, was die furchtbaren Kriegsjahre von den Herzen übrig gelassen hatten, noch härter werden. Der unerträglich gewordene Hunger nagte an jedem. Manche Menschen plünderten rücksichtslos und brutal; Inges kleiner Bruder wurde im August im Streit um ein Huhn getötet. Zwei Männer schlugen um sich, bei dem Versuch das tote Tier ganz für sich zu bekommen. Inges Bruder witterte seine Chance und riss das Huhn in einem besonders chaotischen Moment an sich. Ein Stein traf ihn hart an der Schläfe, sodass er blutüberströmt umfiel und auch nicht wieder aufstand, als man ihm ein paar Steckrüben als Ausgleich anbot. In unserer Straße kam es zu ähnlichen Szenen.
Mit Omas Weggang waren auch ihre Lebensmittelquellen versiegt. Hunderte Flüchtlinge und Ausgebombte zogen mit ihren wenigen Habseligkeiten durch die Stadt. Beinahe täglich wurden es mehr. Spitznasige bleiche Gesichter lugten unter den Lumpen hervor; verkrampfte Hände zogen wacklige Leiter- und Kinderwagen hinter sich her. In unserem Haus war nur eine Familie, die ihre Wohnung im Bombenhagel verloren hatte, einquartiert worden – zu viel war auch bei uns schon beschädigt.
Manchmal spielte ich mit deren Kindern auf den inzwischen hoch aufgetürmten Schutthaufen. Man konnte anhand des Bewuchses der Trümmer abschätzen, wie lange das Haus bereits eine Ruine war – quasi ein botanisches Zeitbarometer. Waren die Steine kahl, frisch gebrochen und ragten rostfreie Eisenträger in den kühlgrauen Himmel, wuchs kaum ein Blatt dazwischen. An anderer Stelle dagegen, dort wo die Steine schon länger den Naturelementen ausgesetzt waren, sprossen Sträucher und sogar kleine Bäume im losen verwitterten Mauerwerk empor. In offene Schlaf- und Wohnzimmer, wie in ein Puppenhaus, konnte man hineinsehen, die Tapeten, Bilder und noch viele alltägliche Gegenstände konnte man ausmachen. Es wuchsen dort nun echte Zimmerpflanzen, nicht im Kübel, sondern direkt aus dem aufgerissenen Boden, genährt von Sonne und Regen unter freiem Himmel.
Wir sprangen über Steinbrocken, überall häufte sich Geröll, selten nur fanden wir Spuren von Aufräumungsarbeiten. Wir betraten ein halb eingestürztes Haus, spitzten die Ohren, denn nicht selten hausten Waisenkinder, zu kleinen aus Verzweiflung gefährlichen Banden zusammengerottet, in den Kellerräumen. Aber es war still, totenstill. Es roch nach Sand und trockenem Dreck. Brandspuren zeichneten die Wände; helle Vierecke verrieten, wo Bilder gehangen hatten. Die Flurdecke war zu großen Teilen eingebrochen.
Im oberen Stockwerk machten wir einen schrecklichen Fund: Ein Haufen Dreck brach zusammen, als wir über ihn hinweg kletterten. Ich stürzte zwei Meter in die Tiefe und schlug dumpf auf einer sackartigen Polsterung auf. Es war ein menschlicher Körper, eine weibliche Leiche in weiß-blauer Schürze war unter den Trümmern begraben gewesen und ich war nach meinem Sturz auf ihr gelandet! Ich schrie und stieß panisch die dunkel verfärbte Hand von meinem Bein.
Gott sei Dank musste ich das Gesicht nicht sehen. Es war unter Zement- und Ziegelbrocken verborgen. Schreckliche Albträume von meiner toten Omama folgten auf dieses Erlebnis. Von da an traf ich mich nicht mehr mit den Ausgebombten-Kindern, irgendwie gab ich ihnen die Schuld für den Vorfall, sie hatten diese Ruine zum Spielen ausgewählt – obwohl mich meine Mutter ermutigte sie wieder zu besuchen. »Wer weiß, vielleicht sind wir morgen schon ebenfalls ohne Wohnung und müssen zu fremden Leuten ziehen. Dann biste auch froh, wenn dich einer mag.« Ich wusste, dass sie Recht hatte, aber sie wusste nicht, dass wir immer gleich rausgeschickt wurden, um im Hof zu spielen, weil es in den anderthalb Zimmern, die die Familie zugeteilt bekommen hatte, einfach zu eng wurde. Und da ich keine Lust verspürte, noch einmal solch einen grässlichen Fund zu machen, mied ich die Familie. Ich hatte meiner Mutter auch nichts von der gruseligen Hand berichtet; womöglich würde sie mich gar nicht mehr auf den Hof lassen. Dieses traumatische Bild wurde bald von einem noch schrecklicheren verdrängt: Herr Hugothal aus der dritten Etage hing eines Tages blau angelaufen in unserem Hausflur und ließ dunkel die Zunge heraushängen. Sein treuer, aber inzwischen erbärmlich abgemagerter Rauhaardackel stellte sich auf den Absatz, sah in die Höhe zu Herrn Hugothals baumelnden Körper hinauf und jaulte herzzerreißend, als man ihn aus der Wohnung heraus gelassen hatte. Unser Nachbar hatte sich um die Mittagsstunde einen Strick genommen und ihn mit einem Seemannsknoten am hölzernen Treppengeländer befestigt. Das andere Ende hatte er sich als Schlinge um den dünnen Hals gelegt und war in die Tiefe gesprungen. Als einzige verwirrende Nachricht hatte er eine Notiz auf dem Fußboden des Flures hinterlassen. Mit Kreide stand dort in wackeligen Buchstaben: »Meine Ehre heißt Treue« geschrieben. Es war der Leitspruch der SS, der bedingungslose Ergebenheit für Führer und Volk verlangte. Da er weder eine Frau noch andere Angehörige hatte, übernahm die Hausgemeinschaft seine Bestattung. Doch es gab kaum noch Särge, so wurde er in einem morschen Besenschrank auf einem Trümmergrundstück beerdigt, ich hatte mir die Stelle genau gemerkt und mied sie wie den Teufel. Seine spärlichen Hinterlassenschaften wurden gerecht zwischen den Mietparteien aufgeteilt. Wir erhielten etwas verbogenes Werkzeug und einige Bilder, auf denen weiße Seerosen und schwimmende Meerjungfrauen gemalt waren, die ich sehr schön fand. Meine Mutter fluchte, sie hatte gehofft, ein paar gute Kleidungsstücke zu ergattern, denn ich brauchte dringend einen Mantel, den sie daraus hätte nähen können. Ich aber war froh, dass wir keine Kleidung bekommen hatten, ich wollte nicht im Mantel vom toten Herrn Hugothal herumlaufen. Sicher hätte ich immer an seine aufgequollene dunkle Zunge denken müssen – so wie ich es jetzt tat, wenn ich das Mädchen aus der Flüchtlingsfamilie in Herrn Hugothals gekürztem Mantel die Stiege heraufkommen sah.
Jeden Morgen wurde von den Bewohnern über die Weltlage diskutiert, meist im Hof beim Müll wegbringen, wobei es wenig fortzuwerfen gab, die Mülltonnen blieben so mager wie wir. In den vergangenen Monaten wurde nur noch müde gemurmelt, geflucht und manchmal leise gebetet. Nur wenige glaubten noch an einen Sieg. Herr Heise von gegenüber predigte zwar als linientreues Parteimitglied ununterbrochen den großen »Endsieg« und nötigte nach wie vor jeden, der die Treppe erklomm, zur korrekten Ausführung des Hitlergrußes, doch immer weniger Menschen kümmerten sich um seine mit zunehmend heiserer Stimme gebellten Befehle. Da sein einst nicht unerheblicher Einfluss bei den Erwachsenen – sie fürchteten ihn – spürbar nachließ, verlagerte er seine Bemühungen nun auf die Jugend, der seiner Meinung nach ohnehin die Zukunft des »Großdeutschen Reiches« gehörte. Oft erschrak ich fast zu Tode, wenn hinter mir plötzlich die harte Stimme Herrn Heises erklang: »Heil Hitler!« Mir war, als könnte ich den kalten Luftzug spüren, jedes Mal, wenn Herr Heise seinen rechten Arm mit seinen makellos sauberen Fingernägeln hochriss. Manchmal rannte ich einfach davon. »Deutsche Jugend: zäh wie Leder, hart wie Krupp-Stahl und flink wie Windhunde! Der Führer zählt auf dich«, rief er mir dann hinterher. Doch das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich hatte diesen kleinen schnauzbärtigen Mann aus dem Radio erst einmal von Weitem gesehen, er kannte mich nicht; wie sollte er da auf mich zählen – ich war nur ein kleines Mädchen. Unwillkürlich musste ich an Manfred denken. Ob er Hitler kannte? Ob er wusste, was Herr Heise meinte? Doch ich hatte nie den Mut, Herrn Heise mit meinen Zweifeln und Fragen zu konfrontieren. Ich wollte nur weg – fliehen vor diesem humpelnden Mann mit der lauten Stimme und dem schlechten Atem. Doch meist gab es kein Entkommen. Auch mein kurzer Wink und mein gemurmelter Gruß genügten ihm nicht. »Mensch Mädel, nimm Haltung an, steh gerade«, fuhr er mich dann mit rotem Gesicht an. Er drückte mir die Schultern nach hinten und hob meinen rechten Arm, sodass dieser jetzt gestreckt die Treppe hinauf deutete, als wolle ich jemandem den Weg zeigen. Ich hatte große Lust zu weinen. »Heil Hitler!«, blökte Herr Heise vor mir.
»Heil Hitler«, flüsterte ich und hoffte, Herr Heise würde noch heute ganz weit von hier fortziehen.
Herr Heise fixierte mich streng, er ließ nicht locker. »Lauter!«, forderte er energisch.
Ich blieb stumm und betrachtete ängstlich und trotzig den frisch gewachsten Linoleumboden unter meinen Füßen, während die alte Frau Johansen aus der zweiten Etage wortlos an uns vorbeiging. Warum? Warum sagte sie nichts?, dachte ich verzweifelt. Warum befreit sie mich nicht von den Schikanen dieses Mannes? Doch die Erwachsenen hatten andere Sorgen. Die Lebensmittelbezugsscheine waren kaum noch das Papier wert, auf dem sie gedruckt waren, und jede Nacht rissen uns die Bomber ankündigenden Sirenen mehrmals aus dem unruhigen Schlaf.
»Überleben« hieß die Parole der Stunde – so lange wie möglich und notfalls auf Kosten der anderen. Die einst penibel gepflegten Vorgärten waren kahl und hügelig – aufgrund eiliger Begräbnisse. Der Tod war eingekehrt in beinah jedes Haus, er gehörte dazu – immer wieder trafen Bomben die Menschen in den Lebensmittel-Warteschlangen, wurden Häuser und Läden zerstört. Doch die Toten, die ich im Vorbeigehen flüchtig sah, hatten die Haare nicht wohlgeordnet und ihre besten Kleider an, wie ich Oma im Krankenhaus in Erinnerung hatte. Diese hier lagen schlaff, oft verstümmelt einfach auf der Straße, blutüberströmt, verkohlt, verrenkt; meine Mutter drehte mir den Kopf weg, doch ich hatte schon zuviel gesehen, um nicht vom Grauen der Realität auch in meinen Träumen verfolgt zu werden. Jeden Abend beteten meine Mutter und ich vor unseren Betten zu Gott und baten ihn und Großmutter um Schutz in diesen schwierigen Zeiten.
Und immer wieder Fliegeralarm, manchmal vergaß ich sogar, wie oft wir in einer Nacht in den Keller rannten. Die Kellerräume mit ihren Phosphorzeichen zur Orientierung im Dunkeln wurden zu unserer zweiten Heimat, wobei kaum mehr jemand dieses Wort in den Mund nehmen wollte. Was war davon geblieben? Meine Knie und Schläfen waren immer aufs Neue vom Blut verkrustet, weil ich so oft in der Eile, die die Gefahr verkündenden Sirenen hervorrief, die kantigen Stufen zum Luftschutzkeller hinunterfiel. Schlaftrunken und mit meinem Köfferchen, das meine wenigen Habseligkeiten, inklusive meiner Puppe und dem hölzernen Käfer beherbergte, stolperte und rutschte ich so manches Mal unglücklich die Treppen hinunter, ohne dass Inge oder meine Mutter es verhindern konnten. Wir sahen viele Male über rauchenden Trümmern im Osten die Sonne aufgehen. Manchmal staunte meine Mutter, dass sie nach diesen Nächten voller real gewordener Albträume überhaupt wieder aufging. Ich stand neben ihr und hielt mich an ihrer Hand fest, während ich allmählich bezweifelte, dass meine Großmutter uns auch durch den dicken, schwarzem Rauch hindurch vom Himmel aus ausreichend sehen und beschützen könnte. Die Erwachsenen warteten ängstlich und hoffnungsvoll zugleich auf den Tag, da der Krieg endlich ein Ende finden würde; manchmal flüsterten Inge und meine Mutter im Wohnzimmer; sie sehnten sich nach Frieden. Ich wusste noch nicht, was das Wort Frieden bedeutete, ich kannte nur den Krieg, ahnte aber, dass es etwas mit ruhigen Nächten und unvorstellbar viel Essen zu tun haben musste …
Kapitel 5
Meine Schutzengel-Großmutter schien eines Tages einen Augenblick abwesend zu sein, vielleicht »organisierte« sie gerade etwas oder las jemandem gehörig die Leviten da oben, wie sie es auch hier unten gern getan hatte: Am liebsten hatte sie jedem ihre Meinung gesagt, laut und deutlich, was nicht immer ungefährlich gewesen war, vor allem in Herrn Heises Gegenwart. Aber sie war gestorben, bevor er ihr ernsthaft etwas anhängen konnte. Jedenfalls schenkte sie mir nicht die nötige Aufmerksamkeit. Vielleicht lag es aber auch daran, dass Ernst, mein Glückskäfer verschwunden war. Im März 1945 jedenfalls wäre ich ihr beinahe gefolgt.