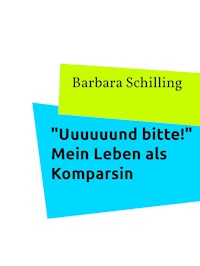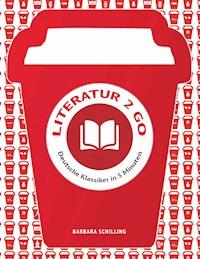16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Herbst 1944, inmitten des kriegsgebeutelten Berlin lebt der 11-jährige Egon. Sein Vater ist vermisst, die Mittel zum Leben sind knapp, die Zukunft ist ungewiss. Die einzige Ausflucht ist das Fußballspiel und die Freundschaft zu Kalle. Gemeinsam träumen sie von besseren Zeiten und einer Karriere in einem erfolgreichen Club. Täglich erleben sie die Einschränkungen, die Zerstörung und das Leid des Krieges. Dazu kommt die Angst, selbst eingezogen zu werden und als Kanonenfutter zu enden. Dann scheint sich ein Ausweg zu öffnen: ein bekannter Verein sucht einen Nachwuchsspieler. Nur ein Junge soll aufgenommen werden, nur ein Junge kann damit dem Kriegsdienst entgehen. Die Freunde stehen plötzlich zwischen Gewissen und Rivalität, Sport und Überlebenskampf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Anmerkung: Nicht alle Ereignisse, zeitlichen Begebenheiten und vermeintlichen Fakten sind »wahr«. Die Geschichte von Egon und Kalle ist größtenteils frei erfunden.
Für meinen Vater
LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2013
© 2014 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Titelfoto: Bundesarchiv, Bild 183-S75383 Lektorat und Satz: BuchBetrieb Peggy Stelling, Leipzig Datenkonvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
eISBN 978-3-475-54232-9 (epub)
Worum geht es im Buch?
Barbara Schilling
Mit Erbsen auf Soldaten
Kapitel 1
»Jetzt schieß doch, Keule!« Der blonde Junge mit den streichholzdünnen Beinen schrie aus vollem Halse. »Schieß endlich!« Seine Stimme überschlug sich. »Worauf warteste denn? Uff Frieden?«
Ich traf Karl-Heinz das erste Mal »im Stadion«. So nannten wir Kinder aus der Nachbarschaft den Bolzplatz im Park. Jeden Tag, bevor wir um die letzte Ecke bogen, bangten wir erneut, ob unser »Stadion« überhaupt noch da war, denn in letzter Zeit hatten sich die Holzdiebstähle gehäuft; kaum etwas war vor den Baumaterial- oder Brennholzjägern noch sicher … Auch heute hatte ich wieder aufgeatmet; unsere Tore aus den wurmstichigen Balken standen noch, windschief und verwittert, aber voll funktionsfähig. Mein Traum war es, die »Pille« einmal vor den Augen der Großen voll ins Dreiangel zu knallen – so wie ich es im Verein früher schon oft gemacht hatte. Einmal zeigen, was ich, den sie nicht grundlos die »Bombe« nannten, konnte … Die halbe Nachbarschaft war versammelt, alles was laufen konnte, säumte den Spielfeldrand. Wer was auf sich hielt, kam hierher, um zu spielen – oder wenigstens um zuzuschauen. Denn die »Großen« waren nur selten so gnädig, einen von uns »Kleinen« mitspielen zu lassen; es sei denn man hatte ein paar Sechser, um ihnen »was zu kauen« zu besorgen, sprich mit Backwaren ließen sie sich manchmal bestechen, einen ein paar Minuten mitspielen zu lassen. Die in unseren Augen Dreikäsehochs taten das immer mal wieder. Doch das war unter unserer Ehre, wir wollten ohne Arschkriechen zeigen, was wir auf dem Kasten hatten. Nur bekamen wir nie die Gelegenheit dazu …
Jeder einzelne Junge und auch jedes der beiden Mädchen am Spielfeldrand brannte darauf, den Halbwüchsigen, die den Platz gänzlich für sich beanspruchten, seitdem sie vor ein paar Monaten zwei windschiefe Tore zusammengezimmert hatten, einmal zeigen zu können, was in ihm steckte. Ich war da keine Ausnahme. Da wir schon nicht mitkicken durften, kommentierten wir jede Szene frech und lautstark. Immer die stille Hoffnung nährend, dadurch unsere Fachkenntnis unter Beweis stellen und eventuell doch mal eine Chance als Mittelfeld- oder wenigstens Abwehrspieler ergattern zu können. Daran gar als Stürmer eingesetzt zu werden, war nicht zu denken.
Ich schaute mir entrüstet den mal genauer an, der so vorlaut herumkrakeelte. Karl-Heinz war neu hier. Das war mal klar. Den hatten wir hier noch nie gesehen. Doch statt sich – wie es die ungeschriebenen Gesetze des Bolzplatzes vorsahen – anfangs vornehm zurückzuhalten, brüllte der Neue gleich los, als sei er hier zu Hause. Wir waren fassungslos. Und bestürzt, denn statt ihn mit einem gehörigen Anschnauzer zur Räson zu bringen, wie es die Großen bei uns stets taten, wenn wir uns ihrer Ansicht nach zu weit vor wagten, ließen sie seine Sprüche durchgehen, ja, lachten sogar. Keine Frage, er amüsierte sie – und schnappte uns damit die ohnehin seltenen Sympathiepunkte weg, nach denen wir so lechzten. Heinrich, mein Kumpel, blickte sich finster um, immer wieder stieß er mich an. Ich war verwirrt, verletzt, eifersüchtig und erbost. Wozu hatte ich die letzten Wochen und Monate denn jede freie Minute hier verbracht? Hatte alles getan, um, wenn schon nicht das Wohlwollen, so wenigstens die Aufmerksamkeit der älteren Jungs auf mich zu lenken? Dafür, dass so mir nichts dir nichts ein dahergelaufener Knabe mit Storchenbeinen uns die Show stahl? Was bildete der sich ein?! Ich schnaubte, nicht nur innerlich. Als ungekrönter Anführer der »Opposition« musste ich handeln, ein Zeichen setzen. Das hier war unser Revier.
»He Piefke, halt mal die Füße still. Hier wird nich jepöbelt.«
Ich ballte die Fäuste, bereit auf den großen, schlaksigen Nebenbuhler loszugehen. Umsonst. Er reagierte nicht. Ich wiederholte meine Aufforderung doppelt so laut. Ganz klar, das war eine Provokation. Ich forderte ihn heraus. Beim dritten Mal bewegte er sich endlich: Aufreizend langsam drehte er den Kopf in meine Richtung. Ich sah seine blonden Haare hinter den großen roten Ohren strähnig abstehen. Alle im Umkreis hielten den Atem an. »Pass uff. Gleich jibt’s ne Keilerei«, hörte ich meinen Nachbarn einem anderen Jungen zuflüstern. Ich sah Kalle an, fixierte ihn, hoffte, möglichst einschüchternd zu wirken – meist war mir das nicht zuletzt wegen meiner recht stämmigen Statur ganz gut gelungen. Ich nickte auffordernd, wartete. Ich weiß nicht, was ich erwartete. Aber … es geschah … nichts. Kalle machte keinerlei Anstalten irgendwie zu reagieren. Er drehte sich einfach wieder weg und fuhr fort, das Spiel zu verfolgen – und zu kommentieren. Ein Skandal, er ignorierte mich, MICH! Einfach so. Ich brannte innerlich, war außer mir. So konnte niemand mit mir umspringen, und schon gar nicht der Neue. Ich würde meinen Platz verteidigen, mich behaupten – koste es, was es wolle. Am meisten wurmte mich, dass die Großen ihn nicht schikanierten, wie sie uns stets »klein hielten«. Ja, sie tolerierten, verteidigten sein Tun sogar. Fehlte nur noch, dass sie ihn zum Mitspielen einluden, undenkbar! Mir wurde heiß vor Wut, mein Gesicht glühte. »Los, Egon, zeig dem ma, wat ne Harke is!«, feuerte mich unser Torwart Fritz an. Er spuckte vor uns aus, warf aufgebracht seine fleckige Schiebermütze in den Staub und hüpfte wie irr darauf herum. Ich stürzte mich halb blind vor Rage auf den Neuen, prügelte auf ihn ein, als wäre er ein Sandsack. »Hau druff, hau feste druff!« Selbst Heinrich wollte nun ordentlich Kloppe sehen. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen; hier draußen herrschten raue Sitten, wer nicht untergehen wollte, musste treten, meist nach unten. »Wenn die anderen erstmal oben sind, isses zu spät, dann biste abjeschrieben«, pflegte mein Vater zu sagen. »Du musst Zähne zeijen im Leben.« Ich dachte wütend an meinen Vater und verdrosch Karl-Heinz nach Strich und Faden – aber, wie es sich gehörte, ohne kratzen, beißen und spucken.
Doch es war vertane Liebesmüh: Als er wieder stand, mit blutender Nase und schlammverschmierten Sachen, sah ich in seinen Augen, dass es nichts gebracht hatte. So konnte ich ihn nicht kriegen; er zeigte trotz der Schläge, die er von meinen erprobten Fäusten hatte einstecken müssen, keinerlei Angst. Er sah mir geradewegs in die Augen.
Seine Sommersprossen leuchteten auf dem erhitzten Gesicht und er lachte mich aus. »Wattn? Dit war schon alles? Pah, zeig mal, wat du wirklich druff hast, du … Schisser.« Er wankte, wirkte aber überzeugt weiterzukämpfen – bis zum Äußersten. Ich zögerte einen Augenblick vor Überraschung. Normalerweise hatten meine Gegner nach solch einer Eröffnung genug, die Fronten waren geklärt, und ich hatte nichts weiter zu befürchten. Doch nun sollte ich noch einmal ran. Der kurze Augenblick des Zögerns war mein großer Fehler. Schon hatte er sich mit seinem ganzen kümmerlichen Gewicht auf mich geworfen und rang mich mit der Kraft der Verzweiflung tatsächlich nieder. Seine Fäustchen waren keine wirkliche Gefahr, doch sein Ellenbogen traf mich hart an der Schläfe, mehr zufällig als bewusst geführt, doch mir wurde kurze Zeit schwarz vor Augen. Er stieg von mir runter. Schwer atmend blieben wir beide sitzen; der Pulk Schaulustiger, der sich um uns gebildet hatte, gierte erwartungsvoll. Würde es eine dritte Runde geben? Doch ich hatte genug für heute. Mein Magen war ein harter Knoten und mein Kopf schmerzte höllisch. Kalle stand auf, schaute in die Runde, spuckte Blut und Schleim aus und reichte mir dann die Hand zum Aufstehen. »Ick bin übrijens Kalle«, stellte er sich mit einem schiefen Grinsen vor. »Mit wem hab ick dit Vergnüjen?«, fragte er scheinbar amüsiert. Doch ich schlug seine Hand weg, rappelte mich hoch und sah zu, dass ich Land gewann. Zu Hause leckte ich meine Wunden und ärgerte mich noch Tage später über die schmähliche Niederlage vor meinen Kumpels.
Kapitel 2
Doch nun zum Anfang der Geschichte, zumindest was meine persönlichen Erlebnisse angeht: Am 21. April 1933 erfuhr ich den Beistand eines wie auch immer gearteten Schutzengels. Ohne diesen hätte mich das gleiche Schicksal ereilt wie meine Mutter. Anna Frieda Emma Hammerschmidt, geborene Petzold, verstarb einen Tag nach der Geburt ihres ersten und einzigen Kindes. Todesursache war eine Eklampsie, eine plötzlich auftretende, schwere Erkrankung: Blutdruckunregelmäßigkeiten, Krämpfe, schließlich Bewusstseinsverlust – nicht selten damals bei Erstgebärenden. Sie fiel ins Koma und starb kurz darauf, ohne mich ein einziges Mal gesehen zu haben. Die Vorboten eines solchen Anfalls waren oft starke Kopfschmerzen; sie hatte seit jeher ständig an diesen gelitten, es existierte kaum ein Foto, auf dem sie sich nicht an die Stirn fasste, aber dies erfuhr ich erst später. Ich durfte leben – sie war tot, dabei hätte ich sie so gern kennengelernt … Das Kopfweh erbte ich von ihr; oft hatte ich schon als Kleinkind unter Schmerzen zu leiden – kalte Wickel verschafften mir ein wenig Linderung. Später wurde es dann besser und die Migräne trat nur noch selten auf.
Mein junger Vater war verstört, traurig und unfähig, einen Säugling zu versorgen. Zudem war das »Frauensache«. Und so kam ich, erst wenige Tage alt, zu meiner Pflegemutter – der ersten von vielen.
Tante Trutchen war die älteste Schwester meines Vaters. Sie lebte wie mein Vater im Bezirk Weißensee in Berlin. Gleich um die Ecke also. Genau genommen waren es nur wenige Häuser, die uns trennten – meinen Vater und mich. Sie selbst hatte keine Kinder, was ihr schwer zu schaffen machte. Und so nahm sie mich mit sehr gemischten Gefühlen auf, aus Mitleid und auch ganz einfach, weil sich sonst niemand fand. Ihr Mann war ein kleiner Kaufmann, genauso wie mein Vater. Er betrieb eine Eisenwarenhandlung, in der sich die Werkzeuge und Nägelschachteln sowie die vielen verschiedenen Schraubenarten bis hinauf zu Decke stapelten. Kein freies Fleckchen Wand war zu sehen. Alles verdeckt von braunen Bretterregalen, die von der Tür mit dem hohen Glöckchen bis hinter zum Vorhang reichten. Dieser Vorhang trennte den schon bescheidenen Verkaufsraum von einem winzigen Ladenhinterzimmerchen ab, das ein Schreibpult mit Stiften, Ordnern und Zetteln und diverse ausrangierte Eisenteile beherbergte. Auf einem niedrigen Hängeboden fanden sich verstaubte Kisten voll Gerümpel und Unmengen von Spinnen – schmal- und dickbäuchige, mit langen und kurzen, beharrten und glatten Beinen. Mein Onkel Herbert war von ruhigem Gemüt und begegnete den Sperenzchen seiner Frau mit so viel Nachsicht wie er aufbringen konnte. Wenn es ihm zu viel wurde, drehte er sich um und verschwand für einige Zeit im Keller, zu dem unter einer schweren Bodenplatte versteckt eine steile Treppe hinunterführte. Meine Tante wurde ob ihrer im Kiez bekannten Häkel- und Backkunst bewundert und ihrer vielversprechenden, ausladenden Hüften wegen gelobt. Doch Kinder bekam sie trotzdem keine, was in ihr zuerst Trauer, dann Neid und schließlich Bitterkeit aufkommen ließ. Da war ich nun, eine kleine Halbwaise und eine relativ junge Frau vom unerfüllten Kinderwunsch heimgesucht, die sich erbarmte, sich eine Zeit lang um mich zu kümmern. »Bis ick wat Eijenes hab …« Glücklich wurden wir beide auf Dauer nicht miteinander.
»Dit konnte nich jut jehen, hab ick gleich jesacht«, hatte eine weitere Schwester meines Vaters, Tante Herta später immer verlauten lassen.
»Jar nüscht haste jesacht«, hatte mein Vater stets protestiert. »Von wejen! Jeschwiegen habt ihr. Und später denn – froh, dass ihr noch mal davonjekommen seid, habt ihr eifrig jenickt. Ne jute Idee haste es jenannt. Dann hätte se wenigstens ooch mal wat Kleenet …«
Ich mochte Tante Herta. Wenn ich sie später mit meiner Stiefmutter besuchte, bewunderte ich immer ihre Wohnung. Sie lag im Vorderhaus und schien mir sehr vornehm: mit Vorhängen, gutem Porzellan und schweren Holzmöbeln. Obwohl all diese Dinge schon nicht mehr neu waren, schienen sie – wie die Tante selbst – seltsam alterslos zu sein. Seitdem sie verwitwet war, beherbergte Herta einige Untermieter. Herr Ösede hatte ein eigenes schönes Zimmer mit Wasserleitung, das er mir gern zeigte. Genau wie seine Fotoapparatesammlung, vier Laikas, mit denen er vornehmlich kleine Jungs fotografierte, wenn sie ihm vor die Linse kamen. Auch von mir wollte er stets ein Foto machen, aber ich blieb nie lange dort, denn ich fühlte mich in seiner Gegenwart nicht ganz wohl. Sehr gern hingegen quatschte ich mit den anderen beiden Untermietern, einem Pärchen, das sich den Geräuschen nach zu urteilen untereinander blendend, mit dem Haushund allerdings nur schwer vertrug. Die Frau schnürte der Tante jeden Tag das Korsett, das deren verwachsene Wirbelsäule stützte. Im Wohnzimmer stand ein seltsames Gestell, das ich liebend gern als Turngerät benutzt hätte, wenn es nicht strengstens verboten gewesen wäre, denn es diente einzig und allein dazu, dass sich Herta daran auf mysteriöse Weise aushängen und damit ihr Rückenleiden ein wenig lindern konnte. Im gemeinsamen Badezimmer stand das Fahrrad des Mannes. Immer wenn ich »austreten« musste, wie es hier hieß, bewunderte ich es gebührlich und strich manchmal andächtig über den »Brux-Sattel«, einen englischen Rennsattel. Ein paar Mal schlief ich auch bei der Tante in einem eigenen winzigen Zimmerchen, das man sogar abschließen konnte. Es war toll, immer gab es bei ihr warmes Wasser, soviel man wollte, nur das Klappbett musste ich morgens einklappen. Ich fürchtete mich davor, eines Nachts mitsamt dem Bett in die Schrankwand hochgeklappt zu werden und ersticken zu müssen. Darum wanderte ich gern, wenn alle schliefen zu meiner Tante hinüber, wich den knarrenden Flurdielen aus, drückte die geschwungene Klinke der Flügeltür auf und huschte heimlich in ihr Bett, wo es warm und kuschelig war und so gut nach Lavendel roch. Herta schickte mich niemals fort; sie tat stets so, als schliefe sie tief und fest und merke nichts von meinem Besuch, als streichle ihre Hand nur im Traum sanft und liebevoll mein Haar. Sobald die ersten Sonnenstrahlen durch das hohe Fenster drangen und den Stuck an der Decke erhellten, schlich ich mich auf Zehenspitzen wieder zurück in mein Zimmer und wir trafen uns erst zum Frühstück wieder.
Dort bei Tisch ging es immer recht lustig zu, nur ab und zu gab es Unstimmigkeiten, meist wegen des Geldes, denn jeder Untermieter musste aufschreiben, wie viel er an warmem Wasser verbraucht hatte. Es wurde nur mit Gas geheizt, und das war teuer.
Trotz des anfänglichen Entzückens bei meinem Anblick im niedlichen Wollstrampler, war Tante Trutchen nicht wirklich mit mir warm geworden. Im Gegenteil: Nach der ersten Euphorie verdeutlichte ihr mein Babyschreien ihren eigenen Verzicht nur umso stärker. Sie wurde immer deprimierter und machte schon bald einen komplett überforderten Eindruck. Als ihr Mann mich in letzter Sekunde aus dem Badeeimer gefischt hatte, in den sie mich in einem Anflug von stiller Verzweiflung für einen Moment kopfüber hatte gleiten lassen, sodass nichts als zwei blonde Locken noch aus dem Wasser herausschauten, wurde ich schon am nächsten Tag weitergereicht.
Ich sollte mein Glück bei einem anderen Pärchen finden, zumindest dort suchen. Immerhin hatten mich Onkel und Tante gut gefüttert, so brachte ich einige Kilos auf die Waage und war bereits deutlich gewachsen, als ich zu Onkel Franz und Tante Bertha kam, die beide nicht mehr ganz jung waren. Tante Bertha war die ältere der beiden Schwestern meiner Mutter und hatte, wie diese, häufig schlimme Kopfschmerzen.
Tante Trutchen hatte mich gut eingepackt und mir ein dickes Bündel mit Wäsche und Utensilien, manche noch nagelneu, mitgeschickt, doch Onkel Herbert wollte allein fahren. Er brachte mich in eine kühle Kellerwohnung, wo mich meine neuen Pflegeeltern lächelnd in Empfang nahmen. Es wurden nur wenige Worte gemurmelt, hastig Grüße getauscht, dann fuhr Onkel Herbert wieder zu seiner Frau. Mich ließ er in einer uralten Holzwiege unter dem halben Fenster zurück. Wenn Onkel Franz zur Arbeit gegangen war, beobachteten Tante Bertha und ich oft stundenlang die vorbeigehenden Füße. Immer wieder staunte meine Pflegemutti, wie viele Leute barfuß durch die Straßen gehen mussten. Doch meist schlief sie darüber ein. Wenn ihr rollender Husten mich weckte, begann ich zu schreien und hörte lange nicht auf. Häufig gesellten sich dann zu ihren Atembeschwerden auch noch pochende Migräneanfälle, sodass Onkel Franz nach der erschöpfenden Arbeit auch noch den Haushalt machen und seine Frau und ein hungriges Baby versorgen musste. Auch hier war also kein Platz für mich. Nach wenigen Monaten war ich dann wieder bei meinem Vater, der allerdings noch weniger mit mir anzufangen wusste, zumal ich ihn ständig an den Tod seiner geliebten Frau erinnerte. Er konnte oder wollte mich nicht einmal wickeln. Er stach mir in seiner Unbeholfenheit die Sicherheitsnadel in die Haut statt in das Windeltuch und war nach kurzer Zeit so verzweifelt, dass er nicht mehr ein noch aus wusste. Da kam ein rettender Engel, zumindest für eine kurze Zeit: Eine hilfsbereite Nachbarin, deren Ähnlichkeit mit seiner verstorbenen Frau meinen Vater zusätzlich deprimierte, nahm sich meiner einige Zeit an. Doch auch das war nur eine Zwischenstation. Ich wurde von Freunden zu Verwandten hin- und hergeschoben; keiner konnte oder wollte sich wirklich um mich kümmern, hatte genug eigene Kinder oder Sorgen, nicht selten beides …
In den ersten fünf Jahren habe ich bei insgesamt acht verschiedenen Pflegefamilien gelebt; und früh schon wurde mir bewusst: Keiner will mich haben. Nirgends gehöre ich richtig hin. Zuhause war immer dort, wo ich gerade mit Essen und Kleidung versorgt wurde. Papa war der Onkel, der mich immer wieder mal am Wochenende besuchte.
Die wechselnden Bezugspersonen verunsicherten mich, obwohl ich es ja nicht anders gewohnt war. Oft blass und kränklich aussehend, nahm ich ab dem ersten Lebensjahr schlecht zu, egal wie man mich aufpäppelte. Mein Körper blieb knochig und dünn; erst im Knabenalter von zwölf fing ich endlich an Fleisch anzusetzen. Ich schoss plötzlich in die Höhe, wurde mittelgroß und wusste plötzlich nicht mehr wohin mit meinen Gliedmaßen. Dass ich als Kleinkind schmächtig war, war zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich, doch die augenfällig magere Erscheinung eines Pflegekindes wog doppelt schwer. »Vernachlässigt« hörte ich sie manchmal raunen, doch niemand tat etwas. Der Alltag schien alle fest im Griff zu haben, niemand fühlte sich verantwortlich. Zu schwer wogen die Schicksale der anderen Familienmitglieder, zum Beispiel das des nach einem misslungenen Abtreibungsversuch geistig behindert zur Welt gekommene Kind eines Großcousins. Oder das des von Rachitis verkrüppelten Körpers eines Bruders meiner Mutter oder das des bettelarmen Familienzweiges um den trunksüchtigen Hugo und seine Frau. Ich war da nur ein kleines Rädchen im Getriebe; mein Vater arbeitete hart, um sich das kleine Geschäft aufzubauen und ihm und mir ein bescheidenes Einkommen zu sichern. Da blieb nicht viel Zeit und Kraft für »Gefühlsduselei«; ich war versorgt, hatte ein Dach über dem Kopf, zu essen und etwas anzuziehen. Mehr hatte man nicht zu wollen. Und tatsächlich ging es mir rein materiell nicht schlecht, doch emotional war ich chronisch unterversorgt. Mir hatte von Anfang an die Wärme und Nähe einer Person gefehlt: meiner Mutter. Ich wurde von den Verwandten umsorgt, ich trank den dargebotenen, extra für mich angerührten heißen Kakao, aß die dicken Butterbrote unter den neidischen Blicken meiner temporären Geschwister. Doch keine Milch und kein Speck konnte mir die nötigen seelischen Nährstoffe ersetzen, denen ich so sehr bedurfte: elterliche Liebe. Ich sah, wie meine jeweiligen Pflegeeltern die anderen Kinder küssten, wie sie mich dagegen ansahen – mitleidig und kühl, sorgenvoll und genervt, weil ich ihnen in meiner Magerkeit trotz ihrer Fürsorge dauernd ein schlechtes Gewissen machte. Bestenfalls war man mir wie einem Hündchen zugetan. Selbst in den gut gemeinten, etwas hölzernen Umarmungen fühlte ich die emotionale Distanz. Ein fahriges über den Kopf streichen konnte mich für einen ganzen Tag in Hochstimmung versetzen. Dass auch die anderen Kinder mit Zärtlichkeiten eher zurückhaltend bedacht wurden, schien diese nicht zu stören. Doch mir war ständig kalt … Wie oft wünschte ich mir wenigstens echte Geschwister zu haben. Jungen und Mädchen an meiner Seite, die mich genauso ansahen, genauso busselten und meinetwegen auch genauso verhauten, wie sie es untereinander taten. Mit feuchten Augen beobachtete ich ihre vertraute Nähe und hoffte auf ein Wunder … Doch mein Wunsch wurde nicht erfüllt. Ich blieb allein.
Kapitel 3
Als ich im besten Knabenalter war, mein Geburtstag war übrigens nur einen Tag nach Hitlers – »Jott sei Dank, da hat er noch mal Glück jehabt«, seufzte die eine Hälfte der Verwandtschaft, »Oh, wie schade«, raunte die andere –, verkündete mein Vater, er hätte eine neue Liebe.
Zwischen zwei Bissen krümeligen Geburtstagskuchen – »Kriegskuchen« aus etwas Mehl, Kaffeesatz, Zichorie und Kunsthonig gebacken – erklärte er: »Annemarie heeßt se. Jeborene Ohnstein. Näherin. Eine janz patente Frau. Wirklich toll, ihr werdet se lieben!« Während mein Vater einen Obstschnaps verlangte, tauschte die Geburtstagsgesellschaft bedeutungsvolle Blicke aus.
»Na, ob ick se lieben werde, weeß ick nich«, hustete Tante Bertha.
»Nu komm, Anna is doch nu schon lange jenug unter der Erde«, wandte Onkel Franz schüchtern ein und kratzte sich umständlich am Unterbauch, woraufhin Bertha verstummte. Onkel Franz trug ein Bruchband aus Leder. Legte er das Band ab, käme der Darm an beiden Seiten heraus, so erklärte er es mir anschaulich und genoss den Schrecken, der bei mir damit auslöste sichtlich. Sein Leistenbruch, der mir Alpträume bescherte und ihn so manchen Schmerz erleiden ließ, sollte ihm jedoch letztendlich das Leben retten, was er da aber noch nicht einmal ahnte: Aufgrund dessen musste er nämlich nicht Soldat werden. Ich fand das als Kind ungeheuer spannend, konnte mir aber nicht vorstellen, wie Gedärme, wie ich sie vom Schwein beim Schlachter gesehen hatte, aus meinem Onkel herauskommen sollten …
»Recht haste, Franz!«, stimmte ihm Onkel Herbert zu. »Wat is n Mann schon ohne Weib? Ne Frau muss wieder ins Haus, schließlich is Wilhelm ooch nich mehr der Jüngste, ha ha.«
Sofort widersprach mein Vater und forderte einen weiteren Schnaps für sich und Onkel Herbert.
»Ach wat, jetzt sei nich so knauserig Mathilde, für alle. Darauf müssen wa anstoßen.«
»Na, ick weiß nich. Mitten im Krieg ne Hochzeit … in deinem Alter …«
»Na, wer weiß, wie lange wir noch können, wa?! Wat sein muss, muss sein«, wischte er den Einwand fort.
»Der Junge braucht endlich ne Mutter. Und ick …«
Onkel Herbert lachte anzüglich. »N warmet Bett.«
»Nachtijall, ick hör dir trapsen.«
»Wat soll denn dit nu wieder heeßen?«
»Na, ick bitte dich … Näherin isse, wie praktisch für dich …«, stichelte die Tante. »Kannse ja gleich prima für dich arbeiten.«
»Nich für mich, mit mich«, scherzte mein Vater gutgelaunt. »Is aber wirklich ein himmlischer Zufall.«
»Na, ob der Himmel da mitjemischt hat, bezweifle ick …«
»Wie jung isse denn?«, fragte neugierig Tante Mathilde und reichte die Gläser herum.
»Neun Jahre jünger als ick, junger Spund isse. Ihr süßer Kopp hat dit Licht der Welt Ende Dezember erblickt …«
»Na, so jenau wollt et keener wissen …«
»Und«, Mathilde goss vorsichtig die Gläser halbvoll, »isse fleißig? Kannse kochen?«
»Sie hat alle Qualitäten, die zählen …«, überging mein Vater die Frage charmant.
»Und los, mach voll die Gläser hier. Wat sollen wir denn mit so ner Pfütze? So jung kommen wir nie wieder zusammen.«
»Wo er Recht hat, hatt er Recht«, rief Onkel Herbert grinsend und erhob sein Glas.
»Uff die Liebe!«, prostete er den anderen zu.
Ich saß in der Ecke mit meinen Holzbauklötzen und schaute den Großen beim Feiern zu.
Ich verstand schon, als Tante Trutchen ihr Glas in meine Richtung schwenkte und leise sagte: »Na für dich wird et dit beste sein, wieder ne richtije Familie zu haben.«
Kapitel 4
Wenige Wochen später heiratete mein Vater seine Annemarie, und ich bekam eine neue Mutti, das heißt, eine Stiefmutti, aber das war mir egal. Eine eigene Mutter, welch ein Luxus, ein Wunder! Diese Frau hier blieb; nicht wie all die anderen Tanten, die ich schon hoffnungsvoll und vergeblich »Mutti« genannt hatte. Annemarie schien mir wie ein Engel. Sie war lieb und sanft und immer für mich da. Sie blieb, als ich Röteln bekam, sie blieb, als der Krieg seinen Lauf nahm. Sie blieb bei mir. Immer. Ich konnte zu jeder Tages- und Nachtzeit zu ihr gehen, nie stieß sie mich weg. Ob im Kurzwarenladen in der Langhansstraße 151 in Weißensee zwischen Wäsche und Krawatten, Strümpfen und bunten Knöpfen, mit denen meine Eltern nun handelten, oder in der Wohnung: Ich war nicht mehr allein.
Ob sie mit Kunden sprach, und ich still sein musste, oder wir zusammen mit den Näherinnen im Hinterzimmer plauschten – ich fühlte mich bei ihr geborgen. Und ich genoss die ersten Wochen so intensiv, dass ich mich manchmal heimlich kneifen musste, um zu testen, ob ich doch nur wieder träumte. Aber der blaue Fleck war echt – und Annemarie auch.
Doch je mehr ich sie liebte, weil sie mich liebte, desto größer wurde meine Angst sie wieder zu verlieren … Ich begann panisch zu werden, wenn ich nicht wusste, wo sie gerade war, sie nicht hörte. Ich begann zu klammern wie ein Äffchen. Meine Verlustangst trieb mich mehrmals pro Nacht aus dem Bett, um heimlich nachzuschauen, ob sie noch da war. Erst wenn ich mir sicher war, dass sie wie all die Nächte zuvor in dem breiten Ehebett schlief, fand ich wieder für einige Stunden Ruhe, bevor ich mich wieder vergewissern musste, dass diese Mutter, die so gut nach Eierkuchen und Baumwolle roch, kein Traum war, sondern eine Frau aus Fleisch und Blut. Nicht selten bin ich vor ihrer Tür wachend auf der Schwelle eingeschlafen.
Die Begebenheiten des Tages, an dem ich zu den beiden zog, waren die ersten, an die ich mich ganz bewusst erinnere. Zumindest glaube ich das. Vielleicht aber stammten sie doch nur aus Erzählungen, aus in vielen Jahren geronnenen Erinnerungen, die so oft in meinem Beisein erzählt wurden, dass ich sie mir einverleibt habe, sie mit mir verwachsen sind, als wäre es meine eigenen: ein Gemisch von schattenhafter Ahnung und wiederholten Berichten.
Ich stand auf der Türschwelle zum Laden. Sah all die hellen und hautfarbenen Wäschestücke im Schaufenster, war geblendet von der Weiße der Hemden und Mieder, die von der Nachmittagssonne heiligengleich zu leuchten schienen. Ich blieb im Türrahmen stehen, während eine matronenhafte Dame das Geschäft betrat. Sie verschwand im hinteren Teil des Ladens, ohne weiter auf mich zu achten. Ich schmiegte mich an das harte Holz, spürte die Neigung der Schwelle unter meinen Füßen und fixierte ein Paar lange, wunderschöner Glacé-Handschuhe in einer Vitrine über dem Verkaufstisch. Ihr Stoff versprach fein und weich zu sein, ein märchenhafter Schimmer lag auf diesen zarten Kleidungsstücken. Ich sah sie lange an, dann hörte ich Schritte. Zuerst begrüßte mich Annemarie. Sie kam in kleinen Schritten auf mich zu und hockte sich vor mich.
»Hallo!«, sagte sie, doch ich antwortete nicht.
»Komm doch rein.«
Ich rührte mich nicht.
Mein Blick glitt wieder zu den wundervollen Handschuhen hinüber.
Sie sah in dieselbe Richtung und fragte, indem sie mir die Hand auf die Schulter legte: »Sie sind sehr schön, nicht wahr?«
Ich nickte zaghaft.
»Gefallen sie dir?«
Wieder senkte und hob ich den Kopf.
Einen Moment lang war es still – bis auf das Brummen, Trappeln und Murmeln des dumpfen Straßenlärms, der von draußen hereindrang.
Dann nahm Annemarie mich bei der Hand.
»Komm, ich zeige sie dir.«
Und ich folgte ihr.
Meine Zeit vor dem Tag X, an dem mein eigentliches Leben begann, verblasste schnell. Doch Annemarie wollte wissen, woran ich mich entsinnen konnte. Und so erzählte ich ein bisschen; sie fragte meinen Vater und wir zwei versuchten ab und zu gemeinsam die Vergangenheit zu rekonstruieren.
Die letzte und längste Zeit hatte ich bei Onkel Männe und Tante Trude gewohnt. Ich erinnere mich an die gutbürgerlich eingerichtete Wohnung, die ich auch später immer wieder besuchte. Sie hatten selbst einen kleinen Sohn: Alfred. Er war etwa drei oder vier Jahre älter als ich und musste jeden Tag am Flügel das Klavierspiel üben. Der ältere Sohn war bereits ein erwachsener Mann und ausgewandert. Er wollte nun in Kanada sein Glück machen. Tag für Tag hatte er mehrere Stunden vor den Tasten verbringen müssen, hatte Alfred mir später erzählt und gebeichtet, wie sehr er das gehasst hat. Später, als der Krieg im Prinzip schon längst verloren war, wurde er noch zum Flakhelfer ernannt. Er musste 1945 »Berlin bis zum letzten Mann verteidigen« und die meisten seiner begabten Finger im Wahnsinn der Zerstörung zurücklassen. Alfreds rechte Hand wurde komplett, seine linke zur Hälfte verstümmelt. Er spielte nie wieder Klavier. Und dennoch schien ihn später die Tatsache zu versöhnen, dass er – anders als so viele seiner Mitstreiter – mit dem Leben davongekommen war.
Tante Trude, seine Mutter, hatte den Ehrgeiz gehabt, das Beste aus den Kindern zu machen. Das bedeutete für sie, das Beste aus ihnen herauszuholen. Disziplin, Bescheidenheit, Fleiß und Sparsamkeit waren ihre erklärten Tugenden. Onkel Männe war Zahlmeister bei der Wehrmacht. Alfred erzählte mir oft von seinem langen Säbel, den er stolz präsentierte, wo immer es möglich war.
Alfred war damals auch der erste, der zu mir sagte, als ich von Annemarie als meiner Mutter sprach: »Die is jar nich deine Mutter!«
Worauf ich ihn erstaunt ansah und dann ruhig erwiderte: »Ick weeß, jehe doch immer uffn Friedhof zu ihr, zur Richtijen.«
Nun sah er mich erstaunt an. Damit hatte er nicht gerechnet.
Nach einer Pause sah ich ihn an.
»Aber nu is Annemarie meine Mutter. Meine zweite Mutti.«
Ich liebte alles an ihr. Und ich ließ keine Gelegenheit aus, in ihrer Nähe zu sein. Manchmal schien mein Vater schon fast eifersüchtig, doch sagte er nie etwas dergleichen. Allein die Blicke und seine gerunzelte Stirn verrieten mir, dass ihm einiges gegen den Strich ging. Doch das trieb mich nur noch näher zu meiner Stiefmutter. Ich saß – anfangs noch in einen blau-weiß gestreiften Matrosenanzug gesteckt – gern bei ihr im Laden. Oft lauschte ich den Geräuschen auf der Straße, dem Lachen und Schreiben, dem Gemurmel, dem Motorenlärm, dem fernen Straßenbahn-Geratter und noch fernerem S-Bahn-Getöse. Gern mochte ich das Hufgeklapper des Pferdewagens. Der Kneipier in unserer Straße ließ das Bier mit einem robusten Wagen und ebensolchem Pferd einfahren. Manchmal, wenn wir vom Milch holen zurückkamen, konnte mit meiner Stiefmutter beobachten, wie die schweren Holzfässer in den Keller gerollt wurden. Die Stirn des Mannes war schweißbedeckt, wenn er seine Schiebermütze zum Gruß vom schütteren Haar nahm. Und ich stand bewundernd auf der anderen Straßenseite und schaute zu, wie dieser Mann allein die großen dunkel gefleckten Fässer von dem unter der Last knirschenden Holzwagen hob, geschickt einige Meter über den Bürgersteig rollte als spielte er nur Boccia, und diese dann nacheinander im Untergeschoss der Kneipe versenkte. Ob ich wohl auch einmal so stark sein würde, fragte ich mich. Das Pferd wieherte und riss mich aus meinen Gedanken. Es hob den Schweif und ließ eine ordentliche Portion Mist auf das Pflaster fallen, der nun aus den Rillen dampfte. Manchmal sammelten die Leute, die einen Schrebergarten besaßen, wie zum Beispiel unsere Bekannten einen an der Lankewerft hatten – zu meiner Bewunderung hatten sie dort auch ein Paddelboot stehen –, hinter dem Wagen die Pferdeäpfel auf, um damit ihre Beete zu düngen. Wir Kinder ekelten uns und sangen frech dazu: »Wir sammeln Lumpen, Knochen und Papier, ausjeschlagne Zähne sammeln wir …« Wenn es den Erwachsenen zu bunt wurde, flog schon mal ein frischer Pferdeapfel in unsere Richtung, was den Spaßfaktor aber nur zusätzlich erhöhte.
In die Kneipe ging mein Vater auch ab und zu, meist ohne seine Annemarie. »Frühschoppen« hieß das Trinken früh am Tag – ein Sonntagsvergnügen. Mein Vater kannte den Kneipier sowie die meisten Gäste in der Kneipe. Die Arbeit in den kleinen Industriebetrieben und die enge Nachbarschaft ließen einander recht vertraut sein. Die Stammkneipe, deren Besitzer auch die Drechslerei im Bezirk besaß, war für viele Männer das zweite Wohnzimmer. Wenn mein Vater »einen im Tee« hatte, stieg er schon mal über den Tresen und stibitzte Zigaretten. Einem Knopffabrikant, der ebenfalls regelmäßig Gast in der Wirtschaft war, wurde immer angst und bange, wenn er das sah: »Oje, mach dit nich! Wenn der dich sieht!« Er meinte den Wirt, den großen kräftigen Kerl, der keinen Spaß verstand, wenn sich jemand an seinem Eigentum vergriff. Hätte der ihn erwischt! Hat er aber nicht, zumindest nicht an diesem Abend. Und an keinem der folgenden.
Mit dem Krieg wurde das Bier langsam knapper, und die Ration war oft schon am Nachmittag aufgebraucht. Wenn »Molle und Korn«, wie Bier und ein Schnäpschen hier bestellt wurden, aus waren, mussten sich die Gäste mit den Ersatzprodukten zufrieden geben, die allerdings kein Ersatz waren. Dementsprechend sank die Laune an manchen Abenden drastisch: Missmut machte sich breit, wo vorher Frohsinn, derbe Scherze und ein gesunder Zweckoptimismus vorgeherrscht hatten – ganz gleich wie schlecht die allgemeine Lage sich dargestellt hatte: Die Berliner hatten sich nicht unterkriegen lassen. Doch allmählich wendete sich das Blatt.
Unbarmherzig schleppte mich Annemarie zu sämtlichen Verwandten meines Vaters. Sie selbst hatte kaum Familie, nie habe ich ihre Eltern kennengelernt, und sie bestand darauf, dass ich möglichst einmal alle lebenden Verwandten sehen sollte. Dieses Mal stand ein Besuch bei Mathilde Redomski an. Sie wohnte am Pistoliusplatz. Meine Mutter und ich stiegen in die »Elektrische«; Straßenbahnfahren war das einzige, das mir diesen langweiligen Pflichtbesuch versüßte. »Wat wollen wir eijentlich da?«, fragte ich meine Stiefmutter missmutig. »Ick kenn die doch jar nich …«
»Eben«, antwortete sie spitz. »Genau das wollen wir ändern!«
»Aber wieso denn?«, quengelte ich.
»Ich möchte, dass du die Familie deines Vaters kennst. Also mach gefälligst einen guten Eindruck, verstanden?« Leise und nachdenklicher fügte sie hinzu: »Wer weiß, wofür das mal gut ist.«
Ich starrte aus dem Fenster: Häuser, Ruinen, Menschen hasteten mit gesenkten Köpfen durch die Straßen, ab und zu Qualm. Manchmal kam mir alles so unwirklich vor. Mittendrin war ich, der in einen inzwischen viel zu kurzen, abgebürsteten, aber scheußlichen Konfirmandenanzug aus dem Lagerbestand des Ladens gezwängt, und in notdürftig mit Asche polierten Schuhen zu einer unbekannten Tante fuhr. Wozu? Das war doch haarsträubend! Viel lieber hätte ich mit meinen Freunden die Straßen unsicher gemacht und nach Abenteuern und Kleingeld Ausschau gehalten. Nun würde ich wieder stundenlang an einem Kaffeetisch stillsitzen müssen, Brot und Zichoriekaffee anstarren und mir Fragen wie: »Und, wie läuft’s in der Schule?« oder Kommentare wie: »Ja, aber janz der Papa. Wie ausm Jesicht jeschnitten!« anhören müssen. Obwohl die Tante so etepetete tat, gab es nur dünnen Tee. Nicht einmal trockenen Kuchen, der noch das beste an dieser ganzen Veranstaltung gewesen wäre …
Mein Vater würde angesichts dieser aus seiner und meiner Sicht unsinnigen Treffen nur amüsiert den Kopf schütteln und sagen: »Jetzt is mit dem Quatsch nu aber Schluss!«
»Träumerli«, nannte Annemarie mich bei meinem Kosenamen. »Aufwachen! Wir sind da.« Sie nahm mich an die Hand, wir mussten aussteigen. Nach ein paar Minuten Fußweg erreichten wir ein großes altes Mietshaus, das einmal vornehm gewesen sein musste. Doch nun hingen Drähte aus dem Mauerwerk heraus, und die Haustür war aus den Angeln gerissen worden, sodass Laub und Unrat in den Flur hineinwehten. Sand knirschte unter unseren Füßen, als wir die breite Treppe hinaufliefen. Annemarie straffte die Schultern, zog ihren Rock glatt und sah mich prüfend an. Ich fürchtete schon, gleich würde sie wie früher ihren Rockzipfel mit der Zunge anfeuchten und mir damit den Dreck aus dem Gesicht wischen. Wir betraten das Haus. Es war seltsam, diesen eindrucksvollen Flur so ganz ohne Tür, ohne Grenze nach draußen zu sehen. Plötzlich taten mir die Bewohner leid; die hatten zwar Stuck und Wandbemalungen, aber wir hatten wenigstens eine Tür im Hausflur, auch wenn diese wurmstichig und von vielen Fußtritten unten ganz abgeschabt war. Die Familie, oder das, was davon übrig war, kam mir etwas seltsam vor mit all ihrem Nippes, den langen hohen Bücherregalen und den seltsamen Instrumenten im Studierzimmer, aber sie war sehr nett. Neugierig betrachtete ich das Gesicht des Mannes, der uns etwas kurzatmig begrüßte. Es war lang und schmal und ein wenig blass. Wie um dies auszugleichen, war das seiner Frau rundlich und rosarot. Ihre Tochter hieß Luise und hatte wunderschönes langes Haar, das seidig im Kerzenlicht glänzte. Ich verliebte mich auf Anhieb in sie, hätte aber eher meinen rechten Fuß geopfert, als das zuzugeben. Wir verbrachten einen anfangs etwas steifen, dann aber angenehmen Nachmittag im »Salon«. Ich war recht schweigsam, doch das fiel kaum auf, da ich generell kein Junge vieler Worte war. Nur einmal stupste mich Annemarie unter dem Tisch mit ihrem Fuß an, weil ich mit offenem Mund ungebührlich lange Luise angeschaut hatte, die gerade von ihren Klavierstunden berichtete. Ich klappte den Mund zu und zwang mich, sie nicht weiter anzustarren. Das gelang mir genau zwei Minuten. Damit es nicht peinlich werden konnte, verabschiedeten wir uns. Doch bevor wir die gut-bürgerliche Wohnung verließen, erinnerte mich Annemarie an das Gastgeschenk, das wir Luise und ihrem leider abwesenden, weil kranken Bruder mitgebracht hatten: Anisbonbons. Fast hatten wir sie vergessen. Nervös fummelte ich die durchsichtige Tüte aus meiner Tasche und reichte sie mit zittrigen Händen meiner Angebeteten, die sich herzlich bedankte. Ich sah sie aufmerksam an, und sie drehte sich so, dass ich sogar für einen viel zu kurzen Augenblick »versehentlich« ihre Hüfte berühren durfte. Unwillkürlich erlitt ich einen kurzen Anfall von Atemnot. Währenddessen hatte meine Stiefmutter ahnungsvoll die Tüte mit den hellen Bonbons inspiziert, sagte aber nichts. »Oh, wie fein. Bonbons liebe ich!«, rief die Tante erfreut und griff in die Tüte, bevor ich es verhindern konnte. Aus welchem plausiblen Grund auch? Na ja, wird schon keiner dran sterben, dachte ich insgeheim, fühlte mich aber doch unwohl, als ich beobachtete, wie sich zwei Steilfalten über der Nase im runden Gesicht abzeichneten. Konzentriert lutschte sie. Ich wandte mich schon halb in Richtung Tür, gleich würde sie dem Betrug auf die Schliche kommen. Wie unaussprechlich peinlich wäre das, vor Luise, vor Annemarie, vor Tante und Onkel, vor allen … Ich atmete schwer. Plötzlich hellte sich ihr Gesicht auf, als hätte sie in ein Spanferkel gewonnen. »Ach, ich weiß«, sagte sie und sah uns aus großen glänzenden Augen an. »Anisbonbons, das schmeckt nach Anis.« Noch immer beklommen nickte ich. »Wunderbar«, strahlte sie. »Allerdings«, jetzt kam das dicke Ende wohl doch noch …, »allerdings«, sie machte eine Pause und fischte sich einen neuen Bonbon aus der Tüte, »sind diese hier ungewöhnlich klebrig.« Ihre kleinen Finger hatten das Bonbon schnell in den Mund geschoben und wischten den Kleberest nun verstohlen und kaum sichtbar am Rock ab. »Aber lecker sind sie.« Ihr Lachen klang hell und offen. Ich mochte sie immer mehr. Annemarie warf mir einen schnellen vielsagenden Blick zu. Mein Blutdruck hätte wohl dem meines an einem Schlaganfall gestorbenen Großvaters zu seiner schlimmsten Zeit Konkurrenz gemacht. Ich schwankte noch immer zwischen Furcht und Erleichterung. Nun bediente sich auch Luise bei den mitgebrachten Süßigkeiten; ihr Mund formte ein rundes »O«, während sie sich die Süßigkeit genüsslich auf der Zunge zergehen ließ. Ich hätte ihr ewig zuschauen können. Versonnen besah sie sich ihre Fingerspitzen und leckte sie dann weniger als ihre Mutter auf die Etikette bedacht ab. Fasziniert sah ich zu, wie sie schnell hintereinander ein zweites und drittes Bonbon aß. »Gut«, konstatierte Luise, »aber klebrig.«
Ich überlegte fieberhaft. »Haben vielleicht zu lange in der Sonne jelegen«, warf ich so gleichmütig wie möglich ein.
Die beiden Damen des Hauses nickten zustimmend. »Das wird es sein«, murmelte die Tante und reichte ihrem Mann die Tüte, der jedoch kein Interesse hatte. Auch uns wurde von der Leckerei angeboten; ich griff zu, meine Stiefmutter lehnte ab. Inzwischen war die Spannung aus meinem Körper gewichen, gut gelaunt lutschten wir drei unsere Bonbons, während Annemarie und der Onkel noch ein wenig im Flur plauderten. Ich wagte nicht, zu ihr rüberzusehen – aus Angst, dass wir beide angesichts der prekären Situation laut losprusten müssten. Und so verabschiedeten wir uns zügig, und nicht ohne eine halbherzige Gegeneinladung auszusprechen.
Kaum hatten wir Familie und Haus hinter uns gelassen, sah mich Annemarie bitterböse an. Ich konnte nicht anders: Ich lachte laut heraus, gackerte und schüttelte mich vor Lachen. »Ick fand dit jerade … so aberwitzig.« Entgegen ihrer ursprünglichen Absicht mir eine Standpauke zu halten, musste Annemarie schließlich mitlachen. Sie konnte sich der gerade erlebten Situationskomik nicht erwehren. »Oh, Aniiiiiiis«, ahmte ich die leicht lispelnde Tante nach. »lecker, aber sie kleben ein wenig …«
Nun war es auch um Annemarie geschehen; sie musste stehenbleiben. Lachend hielt sie sich die Tasche vor den Bauch. »Du, du bist unmöglich«, stammelte sie zwischen zwei Lachanfällen.
»Wieso, hat doch allen geschmeckt«, protestierte ich. »Und die Laune war doch toll zum Schluss.«
»Lagen wohl in der Sonne …« setzte ich lispelnd noch einen drauf. Wieder brach ein lautes kaum unterdrücktes Lachen aus Annemarie heraus. Sie rang um Fassung. Es dauerte etwas, bis wir uns beruhigt hatten.
Erst als wir in der Straßenbahn waren, verscheuchte sie kurzzeitig das alberne Grinsen auf meinem Gesicht mit der Frage: »Was hast du denn mit den Bonbons gemacht?«
»Jar nüscht«, log ich mit bester Unschuldsmiene.
»Mein lieber Freund!«, sie drehte mich zu sich um, »ich bin doch nicht meschugge! Die Anisdinger waren mit Schokolade überzogen als ich sie gekauft, oder besser, für diesen wichtigen Besuch teuer organisiert habe.« Ich verstummte schuldbewusst; ich war gierig gewesen. Warum sollten immer nur die anderen es gut haben, hatte ich gedacht? Also hatte ich einige der köstlichen Bonbons weggenascht. Doch als der Inhalt der Tüte deutlich, zu deutlich zur Neige ging, hatte ich meinen Plan geändert: Behutsam hatte ich lediglich die Schokolade, ohnehin das Beste, von den Bonbons gelutscht. Danach hatte ich jedes einzelne fein säuberlich wieder in die Tüte getan. Sie waren danach hell und glänzten wie frisch gemacht. Nur, dass sie ein wenig klebten … Meine Stiefmutter sah mich noch immer auffordernd an; es hatte keinen Zweck, sie zu belügen. Also senkte ich den Blick übertrieben beschämt und gestand ihr den Schokoladenmundraub. Sie konnte es auch jetzt kaum glauben. »Was hast du gemacht?! … Igitt, wie und dann wieder in die Tüte rein? Einfach so? … Die abgelutschten Dinger?!« Als sie sich genug stiefmütterlich empört hatte, musste sie wiederum lachen. »Also, du bist mir ja ein Schlawiner, mein lieber Mann!«
»Aber eens musste mir zujute halten?«
»Was denn?!«
»Es hat keener wat jemerkt«, wandte ich ein. Sie grinste mir zu.
»Ja, Gott sei Dank bist du wenigstens schlau genug …«
Aber Strafe muss sein; und meine Strafe war, dass ich Luise sehr lange nicht wiedersehen durfte.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht? Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!