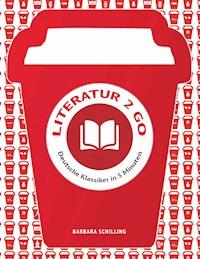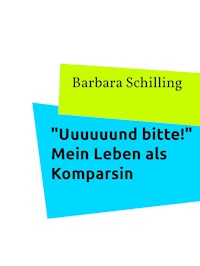
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Ich war jung und brauchte das Geld ...“ Stellen Sie sich einmal Ihren Lieblingsfilm ohne Komparsen vor … Irgendetwas würde fehlen; genau: Viele Szenen würden kalt, leblos und gestellt wirken, manche erst gar nicht ohne die vermeintlichen Passanten, Restaurantbesucher oder Mitarbeiter funktionieren. Doch kaum ein Zuschauer macht sich Gedanken über diese wichtigen Personen im Hintergrund … dabei ist das eine ganz eigene Welt -- „Komparserie ist lukrativ …“ Oh ja! Aber nicht für Komparsen. Es sei denn, Sie kennen den Produktionsleiter. Dieser Roman räumt auf ironisch-amüsante Weise mit dem Mythos Komparserie auf, Kapitel für Kapitel enttarnt der Text die Vorteile des Komparsenjobs als VorURteile.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titelseite… eine Erfahrung - oder: Das erste MalKapitel 11. Komparserie …... ist unterhaltsam… ist lehrreich… ist romantisch… erfordert schauspielerisches Talent… ist eine Herausforderung… ist interessant... ist lukrativ… ist aufregend… ist eine Chance… ist gesellig… macht klug… macht schön… ist abenteuerlich… ist überraschend… ist unvergesslich… ist für jeden etwas… ist easy… ist immer lustig… ist der Weg zum ErfolgImpressum"Uuuuuund bitte!" Mein Leben als Komparsin
Vorwort:
Stellen Sie sich einmal Ihren Lieblingsfilm ohne Komparsen vor … Irgendetwas würde fehlen; genau: Viele Szenen würden kalt, leblos und gestellt wirken, manche erst gar nicht ohne die vermeintlichen Passanten, Restaurantbesucher oder Mitarbeiter funktionieren. Doch kaum ein Zuschauer macht sich Gedanken über diese wichtigen Personen im Hintergrund so vieler TV- und Kinoszenen…
Dieser Roman möchte den Mythos Komparserie näher beleuchten und viele Vorteile des Komparsenjobs als VorURteile entlarven:
Komparserie
… ist eine Erfahrung
… ist amüsant
… ist unterhaltsam
… ist lehrreich
… ist romantisch
… erfordert schauspielerisches Talent
… ist eine Herausforderung
… ist interessant
… ist lukrativ
… ist aufregend
… ist eine Chance
… ist gesellig
… macht klug
… ist schön
… ist abenteuerlich
… ist überraschend
… ist unvergesslich
… ist für jeden etwas
… ist easy
… ist immer lustig
… ist der Weg zum Erfolg
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre
Barbara Schilling
… eine Erfahrung - oder: Das erste Mal
„Ich war jung und brauchte das Geld.“ Diese Universalausrede passte auch bei mir: Gerade das Abitur bestanden, wohnte ich das erste Mal allein. Ich war in eine lustige gemischte WG im Berliner Multi-Kulti-Bezirk Tiergarten gezogen …
Kleines Mädchen in großer Stadt "geht zum Fülm" (wie der Berliner sagt ... ;-) Nun, Berlin ist riesig, und viele Filmproduktionen sind hier ansässig – naiv, neugierig und größenwahnsinnig wie ich war, und weil ich gerade nix Besseres zu tun hatte, stürzte ich mich in das Abenteuer Komparserie. Ich kam zu dieser Art des „Nebenerwerbes“ wie die Jungfrau zum Kind: Unverhofft kommt oft.
Kapitel 1
Ich fühlte mich frei. Ich konnte endlich tun und lassen, was ich wollte. Mein kleines Reich, über das ich in der Turmstraße Nr. 1 uneingeschränkt herrschen konnte, maß genau 23,8 Quadratmeter, verfügte über ein Fenster zum Hof und kostete mich in meinen Augen damals horrende 289 EUR im Monat. Der Preis der Freiheit.
Was brauchte ich mehr? Ein Studienplatz. Um mein vermeintliches Traumfach, Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität studieren zu können, fehlten mir allerdings noch einige Wartesemester. Irgendetwas etwas anderes anzufangen wollte ich nicht. Ein Studium um des Studierens willen, BWL, Afrikanistik oder gar Linguistik zu belegen, nur um eine Daseinsberechtigung für die Caféteria und ein Alibischein für die Eltern bzw. das Bafögamt zu haben, kam für mich nicht in Frage. Zudem wären diese Semester nicht als Wartesemester angerechnet worden. Ich musste also warten. Das konnte ich. Dachte ich zumindest. Während meiner langjährigen Tätigkeit als Komparsin sollte ich allerdings eines Besseren belehrt werden …
Um meinen Lebensunterhalt allein finanzieren zu können, musste ich also jobben. Ich war neugierig: Über dubiose Zeitungsannoncen, Aushänge und Empfehlungen von Freunden, probierte ich mich in verschiedenen Nebenjobs aus. Ich räumte meterhohe Regale ein, unterrichtete hyperaktive Kinder im Tanzen und wischte in einer Arztpraxis das Blut vom Boden. Schließlich versuchte ich mich sogar als Haustürvertreterin für Lexika, doch die vielen traurigen Geschichten bei diesen Begegnungen veranlassten mich viel zu oft, die Bücher zu verschenken statt sie zu verkaufen. Dies tolerierte mein Chef trotz seiner betont „sozialen Einstellung“ erwartungsgemäß nicht sehr lange. Anschließend arbeitete ich eine Weile im Call Center, wo ich unter anderem schwerhörigen alten Leuten am Telefon überteuerte Lotterielose „verkaufen“ sollte, was auf beiden Seiten Probleme aufwarf: Zum Einen hatte ich mit einem großen Manko in diesem Hardseller-Business zu kämpfen – ich hatte ein Gewissen - zum Anderen aber war es auch eine richtig schwierige Aufgabe. Denn die Senioren ließen sich nicht so leicht „behumpsen“, manche wurden sogar richtig ausfallend in ihrer Wut, und ich bekam mehr als einmal glühende Ohren aufgrund der mir bis dahin völlig unbekannten Hardcore-Rentnerflüche, die durch das Headset mein Innenohr und schließlich meine auditive Hirnrinde erreichten.
Frustriert schlug meine verrückte Mitbewohnerin Sabine, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte, vor, es doch „auf der Oranienburger, wo die Nutten stehen“ zu versuchen. „Schnell mal ein zwei Hunnis. Den Stundenlohn möchte ich haben“, flachste sie mit ihrem Herr-der-Ringe-Kaffeebecher in der Hand im Türrahmen lehnend. „Aber nicht deren Kunden!“, konterte ich. Ich wusste, wovon ich redete, schließlich hatte ich bereits einige Monate auf der Oranienburger gearbeitet - auch als „Bedienung“, aber eben „nur“ als Kellnerin. Ganz bieder in einem mexikanischen Restaurant. Die schweren gusseisernen Pfannen der Fajita-Gerichte und das lautstarke Grölen der oft schon früh betrunkenen Touristen, die zum Teil in Reisebussen angekarrt wurden, und deren lüsterne Fleischbeschau waren mir noch in guter Erinnerung …
Auf einer Semestereröffnungsparty, neidisch beobachtete ich die aufgekratzten Studienanfänger um mich herum, lernte ich Flo kennen. Flo hieß eigentlich Florian, studierte, äh hab ich vergessen, Sinologie oder so etwas exotisches … oder waren es doch Kulturwissenschaften? Ein Fach mit dem garantiert nie Geld verdienen würde … Jedenfalls war er sehr nett, und wir verstanden uns auf Anhieb. Irgendwann klagte ich ihm mein Leid, und er erzählte begeistert von seinem recht einträglichen und gar nicht langweiligen Job als Komparse beim Film. Das klang wirklich wunderbar. „Beim nächsten Mal nehm ich dich mit“, versprach er kurzentschlossen. Ich zögerte „Aber es ist kein Hostessenjob oder sowas?“ Er lachte. „Nein! Und ich bin auch nicht der Zuhälter, vor dem dich deine Eltern immer gewarnt haben.“ Er zwinkerte. „Und außerdem: Als Hostess musst du, entgegen des weit verbreiteten und scheinbar unausrottbaren Vorurteils, zwar in der Regel auch nichts Anrüchigeres tun, als nett lächeln und Flyer oder Getränke verteilen, aber: Als Komparsin bist du einfach nur am Set. Sein allein um des Seins willen – Ontologie, verstehst du …“ Ich verstand kein Wort von seinem philosophischem Geschwafel; war dieses pseudointellektuelle Getue bei Studierenden der Geisteswissenschaften zwangläufig? Ich grinste schief. „Vollständig angezogen“, fügte er scherzend hinzu.
„Was tut man da eigentlich genau?“ wollte ich wissen. Er überlegte eine Weile. „Im Grunde ist es der (Alb-)Traum eines jeden Schauspielers: Man spielt sich selbst - einen Passanten, einen auf den Bus Wartenden oder einen Cafégast zum Beispiel.“ Er nahm noch einen Schluck Becks. „Allerdings einen ohne Namen, es heißt immer nur ‚Eh, du da! Du mit dem roten Mantel!‘“. Er sah mich an. „Ich will ehrlich sein, so toll wie das alles klingt, ist es natürlich nicht. Ziemlich langweilig. Du bist dort ein Nobody, quasi ein Niemand …“ „Ja, aber kein Anderer bezahlt mich sonst dafür ein Niemand zu sein.“ Er nickte. „Was macht man noch?“ Gespielt nachdenklich zog er die hohe Stirn kraus: „Hm, also zum Beispiel nippt man auf imaginierten Galas an falschem Sekt in Plastik-Sektkelchen, die aber verdammt echt aussehen. Alles ist Show, alles Kulisse, nichts ist echt, oft nicht einmal die Brüste die Hautdarstellerin oder das Haupthaar des alternden Regisseurs … Film ist immer ein riesengroßer Fake! Alles aus Pappe – oder eben Silikon …“
„Cool“, sagte ich mit leuchtenden Augen, „die große bunte Plastikwelt des Films, das sehe ich mir an - ich bin dabei!“
Am Wochenende fürchtete ich, er hätte unser bierseliges Gespräch und damit sein Versprechen mir gegenüber vergessen, doch er meldete ich gleich am Montag.
Schon am übernächsten Tag kam „mein großer Auftritt“; es war ein Drehtag im schönen aber „jwd = ganz weit draußen“ gelegenen Stadtteil Adlershof angesetzt. Jemand war kurzfristig ausgefallen und so konnte ich dank Flos Vermittlung einspringen.
Fürs „Rumsitzen und nett aussehen“ bezahlt zu werden, war doch super – dachte ich mir. Und wer weiß: Vielleicht würde ich ja auch den einen oder anderen „Star“ zu Gesicht bekommen, wobei ich die meisten TV-Sternchen „in natura“ gar nicht erkennen würde.
An meinem ersten Drehtag war ich genauso aufgeregt wie aufgebrezelt. Ok, sagte ich mir, „Sowtime!“:
Meine Premiere begann früh: Als um 5.30 Uhr mein Wecker klingelte, dessen Weckzeit seit meiner Schulzeit nicht mehr neun Uhr unterschritten hatte, bekam ich meine Augen kaum auf. “Was soll’s“, sagte ich mir, „heute ist der erste Tag deines neuen, aufregenden, verantwortungsvollen, erfüllten, luxuriösen Lebens.“ Auf der Suche nach meinen Klamotten tapste ich durch die kalte Altbauwohnung. Ich verbrühte mich am Kaffee, trat ins Katzenklo und holte mir an der Tischkante einen blauen Fleck, doch nichts konnte mich entmutigen, denn insgeheim beherrschte mich die irrationale Hoffnung, als Shootingstar oder new face „entdeckt“ zu werden und ab sofort in ein sorgenfreies, beneidenswertes Leben katapultiert zu werden. Allerdings wollte ich diese eitle Prinzessinnen-Hoffnung nicht zugeben, nicht vor meinen Mitbewohnerinnen - ja nicht einmal vor mir selbst. Ich zog mich mit großer Sorgfalt an, legte Make-up auf, beim Film darf man ruhig etwas tiefer in den Farbtopf greifen, doch auch nicht zu tief, zögerte ich. Vorsichtshalber verzichtete ich auf Theaterschminke, um nicht allzu „dick aufzutragen“. Ich malte also mit zittriger Hand (femme) fatale Lidstriche auf meine verquollenen Augen. Dabei hoffte ich inständig, dass es auf dem Hinweg wenigstens nicht regnen würde, was mein Make-up in eine expressionistische Farbexplosion verwandeln würde, sondern dass ich gleich zu Beginn mit einem gekonnten „Uschi-Augenaufschlag“ überzeugen konnte. Schließlich hatte ich diesen ausgiebig vor dem Spiegel geübt: „Hallo, ich bin die Claraaaa!“ Das zweite A würde ich lang ziehen und dabei die Wimpern klimpern, würde es atemlos sexy ausklingen lassen; so hatte ich mir das vorgestellt. Denn bekanntlich ist der erste Eindruck ja das Wichtigste. (Ich lernte bald zu schätzen, dass es bei der Komparserie eine Menge, quasi fast unendlich viele „erste Male“ gab, denn die Komparsen sind so etwas wie die Eintagsfliegen in der Film-Fauna: Ihre Lebensspanne beträgt in der Regel maximal einen Tag, meist exakt 10,55 Stunden – danach müssen Überstunden gezahlt werden. Meistens stehen sie nur lästig im Weg herum, und wenn sie nicht da sind, vermisst sie keiner. Doch wenn ihr Einsatz ansteht an und sie nicht sofort zur Stelle sind, dann ist „Polen offen“ – wie meine Oma sagen würde. Denn ihre einzige Aufgabe ist eine stabile Population zu halten; sie dürfen nicht aussterben, aber auf das Individuum, auf einen mehr oder weniger kommt es nicht an. Deshalb macht sich auch niemand vom Team erst die Mühe, die Namen zu erfragen: pure Verschwendung von Zeit und Gehirnschmalz – morgen sind schon wieder neue da. Es ist ein bisschen wie in der Amöbenzüchtung oder beim Arbeitsamt: Du bist einfach eine Nummer unter vielen, und hast zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein …)
Ich war so püppchenhaft zurechtgemacht, dass selbst Florian mich nicht gleich erkannte. Ich ging etwas beschämt neben ihm zur U-Bahn. „Nun gut, beim Film, DEM visuellen Medium schlechthin kam es ja nun mal nicht auf meine Fremdsprachenkenntnisse oder inneren Werte an, sondern „uff die Optik“ wie mein Opa so schön sagte“, verteidigte ich mein monströs knappes Outfit halbherzig. Wieder musterte Flo meinen Minirock, der eher in die Kategorie Gürtel fiel, meine hohen Schuhe, mit denen ich nicht laufen konnte, die aber prima zur schwarz-glänzenden Strumpfhose passten und meinen engen Pullover, der wie zufällig einen Streifen meines Bauches freiließ, was dazu führte, dass ich a) den ganzen Tag über angestrengt versuchte, meinen Bauch einzuziehen und b) mit einer tierischen Gänsehaut zu kämpfen hatte. Flo grinste fröhlich. „Wie du meinst. Vielleicht hat es deshalb bei mir noch nicht mit dem Durchbruch geklappt … Ok. Also, ran an die Buletten.“
Als wir gut zwei Stunden später nach tausendmaligem Umsteigen endlich aus der Bahn stiegen, waren wir bereits spät dran; Flo hechtete die Straße entlang; ich stolperte hinterher. Und dann erblickte ich es, das Set, den Drehort, wo all meine … na, was auch immer … Wirklichkeit werden sollten. Es war grandios: Schon von weitem sah man LKWs und Wohnwagen, die Licht- und Tontechnik wurde gerade aufgebaut; überall wurden Kabel verlegt und Markierungen angebracht, Schienen für die Kamera wurden installiert, Kostüme umher getragen und Kaffee ausgeschenkt; es herrschte eine geschäftige, aber sympathische Atmosphäre. Sämtliche Leute waren in dicke Daunenwesten gehüllt; die meisten davon wraen mit unzähligen Taschen besetzt. Walki-Talki-Gesprächsfetzen erfüllten die Luft. Plötzlich verstand ich sogar die Leute, die unbezahlt zum Dreh kamen, nur um einmal „Filmluft“ zu schnuppern. Wenn Flo von ihnen redete, hörte ich ein Spur von Verachtung in seiner Stimme.
Ich war beeindruckt, begeistert: Boah, echt, cool – hier wird ein Film gedreht, wie ich es schon oft auf der Straße gesehen hatte, und nun war ich, klein Clara, ein Teil davon, das war phänomenal! Ich straffte die Schultern und stürmte den Platz: „Achtung, jetzt komme ich!“
Leider hatte mir allerdings niemand gesagt, dass Flo und ich auf einem Außendreh eingesetzt würden. Es herrschten den ganzen Tag Temperaturen von knapp über null Grad. Ich fror entsetzlich, versuchte es mir aber nicht ansehen zu lassen, was mir gründlich misslang: Ein Häufchen Elend - mit schlotternden Knien und roter Nase hätte ich Rudolf, dem Rentier Konkurrenz machen können. Vergeblich zog und zerrte ich an meinem kurzen Pullover. Mich ständig schnäuzend, versuchte ich standhaft zu lächeln, und auf die anfangs höflichen, mit der Zeit immer genervter werdenden Nachfragen aus der Dispo in Gestalt einer untrennbar mit ihrem Klemmbrett verwachsenen Blondine, ob mir kalt sein, nur: „N-n-nein! Wie wie k-k-k-ommen Sie denn da-ada-rauf?“ zu antworten. Ich nieste an einem Stück. Irgendwann wurde meine Zähneklappern so laut, dass sich der Tonmann zwei Meter von mir entfernt beschwerte, und man mich zurück in den nur wenig wärmeren Aufenthaltsbus schickte – die anderen Komparsen, auch Florian, schauten mir nach - , wo ich schamrot literweise heißen Kaffee in mich hineinkippte, um mich schnellstmöglich aufzuwärmen. Als Resultat musste ich später - endlich wieder draußen bei den anderen - alle fünf Minuten auf‘s Klo rennen. Somit war ich mehr als einmal nicht an meinem zugewiesenen Platz, wenn das gottgleiche Kommando „Uuuuund bitte!“ des Zeus äh … Regisseurs erklang. Ich machte damit schließlich die ganze Crew verrückt. Immer wieder musste die Szene wiederholt werden. Beinahe hätten sie sogar meine Gage einbehalten und Schadensersatz wegen Verzögerung gefordert. Auf dem Nachhauseweg war Flo, der mich ja empfohlen hatte, sehr still. Er meldete sich drei Tage lang nicht bei mir. Ich quatschte ihm auf den Anrufbeantworter, dass ich verstanden und gelernt hätte: Ich hatte mir von meinem ersten Komparsengeld in der „Garage“, meinem Lieblingssecondhandladen, Winterstiefel und eine dicke Jacke gekauft.
Kurz darauf rief er mich an, der nächste Drehtermin stand an: Im Park …
1. Komparserie …
… ist amüsant
… zumindest im Sommer, wenn man NICHT bei fünfzehn Grad Minus im Aufenthaltsbus sitzt und krakelige Verwünschungen an die vor Kälte von innen beschlagenen Scheiben malt!
Es kann aber in der Tat sehr lustig werden; nicht selten ergeben sich sogar unfreiwillig komische Szenen … z. B. wenn das Filmkind entflohen ist, das Starlet noch immer über der Schüssel hängt oder die Kostüme vertauscht wurden. Meine persönliche Aufregung war am größten, als ich das erste Mal ein Mikro angesteckt bekam. Der Sender wurde mir hinten am Hosenbund angeklemmt. Doch dazu später mehr.
In der Unterhaltungsindustrie, sprich der kommerziellen Filmbranche zu arbeiten, kann durchaus schweißtreibend sein
Stellen Sie sich einmal vor, Sie werden einem Ihnen bis eben noch gänzlich unbekannten Menschen circa 20 Zentimeter gegenüber dessen ausladender Nasenspitze platziert und sollen sich mit ihm auf Kommando unterhalten. „Ganz unverkrampft bitte!“ Das funktioniert schon im Fahrstuhl nicht, selbst wenn man von einigen nicht unwichtigen Parametern wie Alter, Geschlecht, Interessen, Kulturkreis und Sympathie etc. einmal absieht. Irgendwann geht im Alltag allerdings die Fahrstuhltür wieder auf, und Sie können aufatmend Ihrer Wege gehen. Und genau das ist eben der kleine aber feine Unterschied: Bei der Komparserie kann man nicht einfach aus der Situation fliehen; man wird verdammt nochmal dafür bezahlt, auszuharren. So lange, bis aus dem Off endlich das erlösende „Cut.“ oder „Danke!“ erklingt. Solche Gesprächsszenen nehmen mitunter absurde Formen an: Zum Beispiel wenn Sie mit jenem dickbäuchigen Menschen möglichst vertraut reden sollen, damit die Barszene echt aussieht, aber gänzlich ohne Ton! Kein Laut ist erlaubt. Wenn Sie sich also gerade an den Eigengeruch, schiefen Blick und die aus den Ohren herauswachsenden Haare ihres „Kollegen“ gewöhnt, und sich mit größter Mühe dazu durchgerungen haben, einen Small Talk zu starten, ertönt die Anweisung des Regieassistenten dies doch bitte gefälligst tonlos zu machen. Nun, versuchen Sie mal ein Gespräch mit einem Unbekannten in angespannter Atmosphäre zu führen, ganz gleich ob über das Wetter, Apfelkuchenrezepte oder die politische Weltlage – ohne die Stimme benutzen zu dürfen. Lediglich der Mund darf auf und zu gemacht werden, da ja bei Strafe kein Ton herauskommen darf – und das alles ohne zu lachen! Falls Ihnen das auf Anhieb gelingt, ziehe ich ehrfürchtig den Hut vor Ihnen. Ich selbst habe fünf Anläufe und drei verschüttete Gläser „Filmprosecco“ gebraucht, bis ich es zumindest halbwegs geschafft habe, meinem Gegenüber nicht bei jeder kaulquappenartigen Mundbewegung die Apfelsaftschorle ins Gesicht zu prusten.
Das ist eine echte Leistung. Das einzig Gute an den vielen Wiederholungen, die es beim Film in der Regel gibt, bis eine Szene perfekt im Kasten ist (und es gibt vieeeeele Gründe zur Wiederholung, Mikro im Bild, Texthänger, schlecht gespielt, falscher Abgang, nervös gackernde in die Kamera winkende Komparsen …), ist, dass ich dadurch einige Zeit für den Stummfilm-Small Talk zum Üben hatte. Wieder was gelernt: Playback-Reden!
Genau das war bei meinem zweiten Dreh geschehen. Flo hatte die Chefin der Komparsenagentur bekniet. Mit dem Ergebnis, dass ich eine neue Chance bekommen hatte. Allerdings hatte Florian zwei Bedingungen bestellt. Ich durfte nur mitkommen, nachdem ich ihm versprochen hatte, mich erstens nicht „wie ein Hafennutte aufzubrezeln“, das sei peinlich, und zweitens nicht hysterisch zu werden, wenn ich sah, was er heute spielen würde.
Ich stutzte zwar, versprach ihm aber natürlich beides. Ich hätte ihm alles versprochen, sogar meine nicht vorhandenes Vermögen überschrieben, nur damit ich wieder an den spannenden Ort des Geschehens zurückdurfte. Ich ahnte ja noch nicht, dass ich hier und heute in die Geheimnisse des oben geschilderten stummen Sprechens mit Fremden eingeweiht würde. Auch kühlte sich mein anfänglicher Enthusiasmus etwas ab, als ich erfuhr, dass wir wieder nicht für einen Blockbuster, sondern für eine „bekannte und erfolgreiche Vorabendserie“ drehen würden. „Macht nix, viele haben mal klein angefangen“, tröstete mich das unsichtbare Engelchen auf meiner rechten Schulter. „Ja, aber so klein ...?!“ murrte das fiese Teufelchen auf meiner linken.
Ich nahm mir vor, dieses Mal einen zuverlässigen, seriösen und professionellen Eindruck zu machen. Heute sollte man das Greenhorn nicht sofort ansehen. Ich wollte auch genau aufzupassen, weder über die Kamerakabel stolpern noch meinen Einsatz verpassen. So, ich kam also brav und kälteadäquat ausgerüstet in Stiefeln, Wollweste und Anorak angetrabt, später sollte ich mich in der oben geschilderten „silent-talking“ Barszene in dem Zeug halbtot schwitzen, und lauschte Flos geheimnisvollen Andeutungen. „Du darfst nicht hysterisch werden, ok? Auch wenn du sowas noch nie gesehen hast.“ Ich? Hysterisch? Ach was, das war ich doch nie! Na ja, fast nie. Nein, ehrlich, dafür war ich viel zu schüchtern. Ich verstummte dann eher. Dann konnte man mich wie zur Salzsäule erstarrt in eine Ecke stellen, sah und hörte stundenlang nichts mehr von mir … Wieso denn hysterisch? Mein Gott, welche tragende Rolle hatte Florian wohl ergattert?! Vielleicht war der Hauptdarsteller ausgefallen? Oder er musste jemanden doubeln, gar ein wahnsinnig gefährliche Szene als Stuntman wagen? Ich war schrecklich neugierig, doch er blockte alle meine Fragen und verschwand schließlich für eine Ewigkeit in der Maske, einem heiligen Hort, den zu betreten nur Eingeweihten oder nach Aufforderung gestattet war. Denn dort lagerten so gefährliche Utensilien wie Camouflage und Haarspray, die bei nicht fachgerechter Anwendung in der Tat zu schrecklichen Entstellungen führen konnte; Beispiele sind man zugegebenermaßen täglich in der U-Bahn.
Nachdem ich völlig durchgeschwitzt aus der Barszene kam, wo ich in wilder Gesichtsgymnastikmanie dem Mann, der meinen Begleiter spielen sollte, und der verzweifelt versuchte, das Glucksen und Lachen zu unterdrücken, welches ihn angesichts unserer grotesk stummen Darbietung ständig zu übermannen drohte, wortlos meine Lebensgeschichte erzählt hatte, war eine Außenszene an der Reihe. Jemand erklärte: „Also, es hat einen Mord gegeben, und nun wird die Leiche von den Beamten aus dem See gezogen!“ Ich schauderte, aber nicht wegen der morbiden Handlung, sondern wegen der niedrigen Temperatur. Hier draußen zu stehen und die Spaziergänger zu geben war schon hart, aber: Wer würde sich denn bei diesem Wetter freiwillig ins Wasser legen?! „ARME SAU!“, musste ich unwillkürlich denken. Sicher nahmen sie eine Puppe … Wiederum: brutal, aber ökonomisch: Ein Statist war billiger als eine lebensechte Puppe anfertigen zu lassen.
Ich trat von einem Bein auf’s andere; schon jetzt begann die Kälte aus dem Parkboden langsam die Beine hochzukriechen. Die etwas desolat wirkende Dame, die als Komparsenführerin für „den Haufen“ wie sie uns liebevoll nannte, zuständig war, verkündete nun alles zwei Minuten wie ein Muezzin in auf- und abschwellendem Singsang, dass es „so-fo-hort“ losginge und wir uns unbedingt bereit zu halten hätten. Ich und meine ca. acht Kollegen waren längst in der „Hab-acht“ Stellung steif geworden, gingen aber brav bei jeder Aufforderung erneut sichtbar in Startposition, als müssten wir gleich lossprinten und nicht einen gemütlichen Spaziergang simulieren. Ich kam mir vor wie beim Nachtdienst auf der freiwilligen Feuerwehr, vor dem ich mich erfolgreich zu drücken geschafft hatte.
Wir hatten die uns angewiesenen Plätze eingenommen. Ich sah mich um, und … erstarrte. Ein blau gefrorener Fuß lag am Ufer. Er sah genauso schrecklich aus, wie man ihn sich vorstellte. Ein Toter, verblüffend echt geschminkt, das leblose Fleisch wirkte wächsern, die Blutgefäße schimmerten bläulich. Ich schluckte unwillkürlich. Ein Lob an die Maskenbildner: Detailgetreu war das auf jeden Fall. Ich sah in Gedanken schon den Zettel zur Identifikation der Leiche an ihrem kalten Zeh baumeln. Ich fixierte den Fuß – und das, was daran hing, gleichzeitig abgestoßen und fasziniert. Die Filmleiche schwamm noch halb im Wasser: Es war definitiv ein Mensch, keine Puppe. Wie gruselig! Eisige Schauer liefen mir über den Rücken. Das war … Florian! Es war mein Flo, der da schwamm. Gerade als ich losrennen, mich instinktmäßig ins eiskalte Wasser stürzen und eine lebensrettende Mund-zu-Mund-Beatmung versuchen wollte, schaltete sich mein Verstand wieder ein. Keine Panik! Durchatmen: Ein und aus, ein und aus … Florian, hatte mich gewarnt. Was hatte er noch gesagt? Ich solle nicht hysterisch werden, egal in welcher Rolle ich ihn … Oh nein! Das hier ging nun wirklich zu weit, er konnte doch keine Leiche spielen, das war doch … pietätlos. ER doch nicht, grotesk war das, herzinfarktauslösend. Das musste jemand anders, irgendwer, ein anderer - obwohl, wer denn …? Warum nicht er? Florian hatte sich sicher sehr über den Job gefreut; es gab extra Kohle, und es war mal wieder etwas ganz anderes. Ja, in der Tat! Gedankenversunken ignorierte ich das auffordernde Zischen von der Seite.