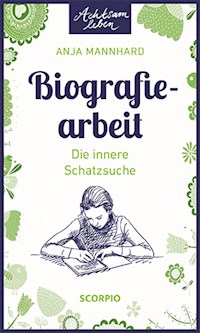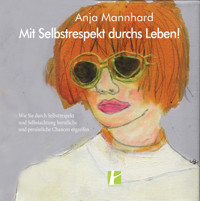30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Soll ich den Schritt in die Selbstständigkeit wagen? Anja Mannhard geht einen ungewöhnlichen Weg, um diese Frage zu beantworten. In 22 Interviews beleuchtet sie alle Themen, die bei einer Praxisgründung wichtig sind. Sie spricht mit Experten aus der Finanz- und Versicherungsbranche, mit den Partnern aus Pädagogik, Psychologie, Medizin und Verwaltung, kommentiert diese Aussagen und ordnet sie in den Kontext ein. So schafft sie die Basis für eine informierte Entscheidung. Ratschläge aus erster Hand zu - Existenzgründung und Praxisführung - Selbstmanagement und eigene Positionierung - Frauen und Finanzen - Erfolgreiche Kommunikation als Wirtschaftsfaktor - Schlüsselfaktoren für den persönlichen Erfolg
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Anja Mannhard
Meine eigene logopädische Praxis
Tipps und Gespräche zu Existenzgründung und Praxisführung
33 Abbildungen
Widmung
Abb. no.1 Mein Großvater Emil Hurst, 4.6.1916 – 11.7.1995 (Foto: privat).
Meinem Großvater Emil Hurst in bleibender Dankbarkeit.
Was im Leben zählt, so Sartre, ist der absolute Einsatz. (Sartre, Jean Paul 1946 L'existentialisme est un humanisme. Paris Gallimard)
Für tolle FrauenHelma Sick
Berit Saure
Britta Hilliger
Jacqui Forster
Elvira Kitzinger
Pippi Langstrumpf - meinem Idol un Vorbild
Für tolle Männer Dr. Rudolf Hausmann
Wolfgang Hein
Oliver Kenk
Dr. Peter Rönnefarth
Prof. Dr. Wolfgnag G. Braun
Prof. Dr. Wolfgang Wendlandt
Geleitworte
Geleitwort von Helma Sick, Finanzberaterin„Geld ist mir nicht so wichtig!“ Keinen anderen Satz höre ich von Frauen im Zusammenhang mit Geld häufiger als diesen. Während Geld den Männern Macht verleiht und ihnen angeblich erotische Ausstrahlung verleiht, ist für die meisten Frauen der Umgang mit Geld immer noch wenig erstrebenswert. Trotz bester Ausbildung und großer Tüchtigkeit ist es vielen selbstständigen Frauen immer noch fast peinlich und unangenehm, ein angemessenes Honorar für ihre berufliche Leistung zu verlangen.
Frauen sind selbstbewusster geworden, keine Frage. Noch nie gab es so viele gut ausgebildete Frauen wie heute. Viele erobern männlich dominierte Lebensbereiche. Nur Geld ist für viele Frauen weiterhin ein Tabuthema geblieben. Es fehlt oft die positive Einstellung dazu und auch die Lust sich mit Geld zu beschäftigen. Diese ist bei Frauen deutlich geringer ausgeprägt als bei Männern, wie viele Untersuchungsergebnisse bestätigen.
Lebt ein altes Rollenbild weiter? Frauen können gut mit Geld umgehen und hervorragend damit wirtschaften. Sie durften das über Generationen hinweg aber eher mit „kleinem Geld“ beweisen, also mit dem Wirtschaftsgeld, mit dem sie häufig ganze Familien durch schwere Zeiten brachten. Der Umgang mit „großem Geld“ oblag Jahrhunderte lang den Männern. Auch heute noch überlassen Frauen oft die Geldfragen dem Vater, dem Partner, dem Bruder oder sie haben einen anderen männlichen Ratgeber, nicht selten den Zahnarzt oder gar den Friseur. Auch wenn sich in den letzten 20 Jahren die Situation von Frauen grundlegend geändert hat – in den Köpfen vieler Frauen lebt das alte Rollenmodell – Mann sorgt vor, Frau wird versorgt – noch weiter.
Warum ist Geld für Frauen so wichtig? Frauen leben im Durchschnitt 6 Jahre länger als Männer und brauchen deshalb im Alter eine bessere finanzielle Absicherung. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus: Frauen haben im Alter meist viel weniger Geld zur Verfügung als Männer. Die durchschnittliche Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung liegt für sie bei nur knapp 500 Euro (Männer knapp 1 000 Euro).
Bei selbstständigen und freiberuflich tätigen Frauen sieht es meist noch schlechter aus. Denn anders als bei Angestellten gibt es hier keine Zwangseinzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung. Die Gefahr, das Problem zu verdrängen, ist hier also besonders groß.
Der Umgang mit Geld: Viele Umfragen bestätigen meine langjährige Erfahrung: Sehr viele Männer fangen schon in jungen Jahren an zu sparen, oft schon während Ausbildung oder Studium und interessieren sich bereits mit 20 für ihre spätere Altersversorgung. Das macht kaum eine Frau. Frauen fangen oft erst mit Anfang/Mitte 30 an, sich mit dem Thema Geld und Geldanlage zu beschäftigen. Damit verschenken sie viele Jahre, in denen ihr Geld mit Zins und Zinseszins arbeitet und für sie Früchte tragen könnte.
Auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit! Den Kopf nicht in den Sand stecken... Leider kommt es noch sehr häufig vor, dass Frauen sich auf ihren Partner verlassen und dann verlassen werden, mit oft unabsehbaren finanziellen Folgen. Immerhin wird ja in Großstädten jede 2. Ehe geschieden. Der Prinz entpuppt sich eben manchmal als Frosch! Deshalb ist ein Mann keine Altersversorgung!
Fazit: Frauen müssen erkennen, dass sie für ihr Leben selbst verantwortlich sind. Dazu gehört auch, sich um das eigene Geld zu kümmern, eine finanzielle Lebensplanung zu entwerfen, sich Ziele zu stecken und rechtzeitig für das Alter vorzusorgen.
Abb. no.2 Helma Sick (Fotograf: Quirin Leppert, München).
Helma Sick, München, im Frühjahr 2013
Geleitwort von Thomas Brauer, Schulleiter in Mainz und Schatzmeister des Deutschen Bundesverbands für Logopädie (dbl)„Die Logopädie ist endgültig in der (freien) Marktwirtschaft angekommen!“
Marketing, Liquiditätsplanung, Unternehmensführung, Businessplan? Wird in diesem Buch über Logopädie gesprochen? Ja, denn die Logopädie ist endgültig in der (freien) Marktwirtschaft angekommen. So manche Praxisinhaberin bzw. mancher Praxisinhaber im Norden, Süden, Osten und Westen unserer Republik hat das in den letzten Jahren zu spüren bekommen. Denn das seit den 1980-er Jahren geltende Wortpaar „Praxiseröffnung – Warteliste“, scheint es in der Logopädie nicht mehr zu geben. Stattdessen müssen sich niedergelassene Logopädinnen und Logopäden vermehrt mit Konkurrenzdruck, Budgetierung, Finanzierung und sogar Insolvenz beschäftigen.
Einpacken? Den geliebten Beruf an den Nagel hängen? – Dies ist für die meisten von uns sicher keine Lösung. Aber sich in bisher unbekanntem Terrain fortbilden, vielleicht nochmal studieren, sich mit den neuen Herausforderungen auseinandersetzen – das passt zu Logopädinnen und Logopäden, die ja auch in der Therapie ihrer Patienten immer wieder eine neue Herausforderung sehen. Und wenn Sie als Leserin oder Leser dieses Buch zur Hand genommen haben, gehören Sie vermutlich auch zu denen, die im Verbund und im Netzwerk mit anderen Berufsgruppen die Herausforderungen angenommen haben, die heute an die Führung einer logopädischen Praxis gestellt werden. Wir sollten kreativen Köpfen wie der Autorin dieses Buches danken, dass sie uns durch die interessanten Interviews mit Menschen aus für uns wichtigen Berufsgruppen auf diesem Weg unterstützt.
Abb. no.3 Thomas Brauer (Foto: dbl e.V.).
Thomas Brauer, Mainz, im Frühjahr 2013
Geleitwort von Christiane Hoffschildt, Präsidentin, dbl e.V., www.dbl-ev.deDer Stellenwert der Logopädie in der Gesellschaft wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter zunehmen. Denn je älter die Menschen in Deutschland werden, desto häufiger treten Krankheiten auf, die das Sprechen und das Schlucken stark beeinträchtigen können. Die Betroffenen brauchen dann oftmals logopädische Therapie. Diese kann Leben retten, beispielsweise durch die Pneumonieprophylaxe durch Dysphagietherapie, und sie sichert Lebensqualität und Teilhabe.
Die rund 15 000 Logopädinnen und Logopäden in Deutschland sind im Gesundheitssystem also unverzichtbar. Ihre Leistung trägt dazu bei, dass Menschen in Würde und größtmöglicher Teilhabe altern können. Und auch in der Behandlung von kindlichen Sprach- und Sprechstörungen ist die Logopädie nach wie vor die wichtigste Behandlungsform. Um die Logopädie immer besser mit wissenschaftlicher Evidenz zu untermauern, setzt sich der Deutsche Bundesverband für Logopädie (dbl) für die primärqualifizierende Akademisierung ein.
Jede Kollegin und jeder Kollege, die eine eigene Praxis gründen, wissen um die große Relevanz der Logopädie. Die Freude am Beruf motiviert sie, jeden Tag aufs Neue ihr Bestes zu geben. Sie bauen langfristige und intensive Patientenbeziehungen auf und begleiten kranke und betroffene Menschen oft wochen- oder monatelang. Neben der therapeutischen Arbeit müssen sich Logopädinnen in der eigenen Praxis jedoch auch den wirtschaftlichen Herausforderungen stellen. Darauf kann dieses Buch sie sicherlich sehr gut vorbereiten. Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Erfolg im Beruf und freue mich, viele von Ihnen im dbl begrüßen zu dürfen.
Abb. no.4 Christiane Hoffschildt (Foto: privat).
Christiane Hoffschildt, Frechen, Mai 2013
Vorwort
„Aber wie fühlt man sich, wenn man eine geschlossene Tür öffnet? Wohl!“ Ruth Dreifuss, 1. Bundespräsidentin der Schweiz in [14], S. 48.
Es beginnt mit einem diffusen Gefühl. Etwas stimmt in Ihrem Job nicht. Was ist es? Sind es die Kollegen, die Praxis- oder Klinikleitung, sind es inhaltliche Anforderungen? Das Chaos im Kopf ist Ihnen nicht neu, es kehrt immer wieder. Sie versuchen es durch alle möglichen Aktionen zu beseitigen: Fortbildungen, neue Arbeitsorganisation, wiederholte Gespräche mit der Familie. Aber Ihre diffuse Unzufriedenheit bleibt. Ihre ganzen Unternehmungen erscheinen Ihnen wie eine neu angestrichene Gefängniszelle. Frisch gestrichen statt wirkliche Freiheit und Entfaltung. Selbstverantwortung übernehmen heißt, sich die Frage zu stellen: „Wie gehe ich mit mir selbst und meiner Antwort auf das Leben um?“
Nehmen Sie sich einmal Zeit und finden Sie Antworten auf die Frage, was anders laufen soll als bisher? Gehen Sie Ihren Berufsalltag durch und fragen Sie sich, was konkrete Auslöser Ihrer Unzufriedenheit sind. Führen Sie darüber ein Tagebuch oder Protokollheft. Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer Talente und Fähigkeiten. Denken Sie an Situationen, die Sie gut bewältigt haben. Wagen Sie zu träumen! Sprechen Sie mit Personen, die das tun, was Sie gerne tun würden.
Möglicherweise stellen Sie fest, dass Sie sich selbstständig als Logopädin oder Logopäde in eigener Praxis verwirklichen wollen. Dann wünsche ich Ihnen zur Vorbereitung mit meinem Buch viele hilfreiche Tipps und Informationen, eine gute Motivation und viel Erfolg! Aber auch bereits selbstständig tätige Kolleginnen und Kollegen werden in diesem Buch viele Anregungen und Hilfestellungen finden. Ebenso wurde mir in den Gesprächen zum Buch immer wieder gesagt, wie wichtig meine Inhalte für alle (selbstständigen) Therapeuten wie auch Ärzte sind, da sie gemeinsame Anliegen haben. Insofern dürfen sich gerne Ergo-, Physio- und Lerntherapeuten sowie Ärzte von meinen Inhalten angesprochen fühlen, auch wenn ich mich als Logopädin meist explizit an Logopädinnen und Logopäden richte.
Selbstständigkeit ist heutzutage jedoch nicht mehr das meist gesuchte Berufsfeld für Logopädinnen, vielmehr ist durch die Veränderung des Marktes ein breites Aufstellen ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen gefragt. Das klassische Modell, ich mache mich selbstständig und lebe von den Honoraren der Krankenkassen, dürfte ausgedient haben. Interdisziplinarität und vom staatlichen Gesundheitswesen unabhängige Leistungen sind heutzutage zusätzlich gefragt. Auch hierzu liefert mein Buch vielfältige Anregungen, unter anderem durch die Interviews und Modellprojekte.
Dass ich mich in diesem Buch immer wieder speziell an Frauen wende, sei mir bitte seitens der Herren verziehen. Jedoch sind überdurchschnittlich viele Frauen in dieser Branche tätig und dies bedarf aus meiner Sicht auch eines spezifischen Eingehens auf die Zielgruppe. Frauen sind heute hochqualifiziert, machen häufiger Abitur als Männer, stellen in Studienfächern wie Medizin und Jura die Mehrheit. Trotzdem führen sie seltener, verdienen weniger Geld, arbeiten in weniger prestigeträchtigen Bereichen. Nichtsdestotrotz können mit Sicherheit auch Männer von diesem Ratgeber profitieren.
Sie werden in diesem Buch einige Experteninterviews aus diversen, für Logopäden und Therapeuten relevanten Branchen finden. Ich durfte im Rahmen dieses Buchprojekts viele spannende Erfahrungen machen, interessante Menschen mit vielfältigen Lebensläufen kennenlernen und mein Wissen über die diversen Branchen erweitern. Auch die kritischen Erlebnisse mit Interviewpartnern, von denen ich berichte, haben mich viel gelehrt – manchmal sogar nachhaltiger! Die ersten Fragen hängen von der Branche des Interviewpartners ab. Umso spannender war es für mich, am Ende jedem ein paar persönliche Fragen zu stellen, die bei allen Interviews gleich sind. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind interessant zu lesen. Auch ich beantworte die persönlichen Fragen – am Ende des Vorworts.
Auch wenn ich im Buch ausschließlich Zitate von Frauen verwende, schließe ich das Vorwort mit folgendem Zitat eines berühmten und amüsanten Mannes, weil es mir ganz genauso geht:
„Ich denke viel an die Zukunft, weil das der Ort ist, wo ich den Rest meines Lebens zubringen werde.“ Woody Allen, Filmregisseur, in [10], S. 59.
Ich danke allen Interviewpartnerinnen und -partnern und insbesondere sonstigen Wegbegleitern dieses Buchprojekts:
Christiane Hoffschildt (dbl)
Thomas Brauer (dbl)
Helma Sick, München
Sabine Schwab (Thieme Verlag)
Dr. Christian Urbanowicz (Thieme Verlag)
Anja Mannhard
Freiburg i. Br., im Frühjahr 2013
Persönliches
Darin bin ich professionell In meinem Fach, insbesondere in der Behandlung von kindlichen Sprech- und Sprachstörungen, in der Therapie von Stottern und Poltern bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, in der Stimmtherapie mit Erwachsenen, zu Gruppentherapiekonzepten zur Behandlung von Redeflussstörungen, Stottern und Poltern, Stimmstörungen, Sigmatismus, Aphasien. Ich habe viel Zeit und Geld in Aus- und Weiterbildung investiert, gehe individuell auf Patienten, auch mit schwierigen Befunden, ein und sehe dies als Herausforderung an. Die Eltern- und Angehörigenberatung nimmt bei mir einen wichtigen Stellenwert ein – bei Kindern ohnehin und bei Erwachsenen, wo es vom Patienten gewünscht wird und sinnvoll ist. Die logopädische Tätigkeit verstehe ich nicht rein als symptomorientiert-funktionelle Therapie, sondern als einen umfassenden Blick und eine alltagsnahe Hilfestellung für den kommunikationsgestörten Patienten.
Als Seminarleiterin für pädagogische Fachkräfte fühle ich mich professionell, und insbesondere als Kommunikationscoach für Frauen und im lösungsorientierten Burnout-Coaching, in der Entwicklung von interdisziplinären Modellprojekten sowie als Lehrlogopädin in meinen Fachbereichen.
„Sammle Erfahrung und sei ein Teil der Veränderung der Welt.“ Suraya Pakzad, afghanische Frauenrechtsaktivistin, in ▶ [26] , S. 260.
Etwas Wichtiges, das ich auf meinem Weg zur Expertin in meinem Bereich gelernt habe Diese Tätigkeit ist zutiefst menschlich. Sie treten als Person in den Vordergrund und in die Beziehung ein, sei es mit Patienten, Klienten oder Kursteilnehmern. Wer sich persönlich heraushalten möchte, wird in diesem Beruf keinen Erfolg haben. Damit hängt zusammen, dass Ihre Individualität gefragt ist, Ihre persönlichen Merkmale, Stärken und Schwächen. Ich habe gelernt, dass sich selbst zu leben und seinem eigenen Weg zu folgen, Reife, Stärke und Reflexionsvermögen mit sich bringt, womit aber nicht alle umgehen können. Auch Anfeindungen und Intrigen können auf dem Weg zur Expertin erlebt werden. Davon sollte man sich in der beruflichen und persönlichen Entwicklung aber nicht einschränken lassen, sondern seinen eigenen Weg gehen!
„Es braucht großen Mut, niemandem zu folgen.“ Caroline Casey, Gründerin der Stiftung Kanchi, in ▶ [26], S. 228.
Für Erfolg braucht man Durchhaltevermögen, Kritik- und Reflexionsfähigkeit, „ein dickes Fell“, Disziplin, Spaß an dem, was man tut, Humor, Empathie, Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse und der anderer, gute Mentoren und Wegbegleiter, Professionalität, Ausgleich im Privaten, ein gutes Finanzkonzept. Nur eine zufriedene Logopädin ist eine gute Therapeutin!
„Disziplin ist eine erlernbare Eigenschaft. Ich denke, Disziplin ist eine strukturierte Form der Leidenschaft.“ Cathy Freeman, international erfolgreiche Leichtathletin und 1. Aborigine-Olympiasiegerin, in ▶ [26] , S. 328.
Das hat mein Leben in neue Bahnen gelenkt Interessanterweise eher kritische Erfahrungen wie Täuschungen, die mir die Augen geöffnet haben, die mir ermöglichten, mich neu zu orientieren und daran zu wachsen, Veränderungen einzugehen. Veränderungen und Trennungen schaffen Raum für Neues. Ich habe erlebt, dass die Enttäuschung ein heilsamer Prozess ist, der mich in meiner persönlichen Weiterentwicklung positiv beeinflusst hat.
Die Kunst – ich begann mit 18 Jahren zu malen – ist neben Literatur bis heute eine der wichtigsten Ressourcen in meinem Leben. Mein geliebter Großvater, der mich in einer elenden Kindheit stabilisiert hat. Begegnungen mit vielen interessanten Menschen, die mir das Wichtigste in meinem Leben sind.
„Wenn man eine Vision, ein Ziel oder einen Traum hat, dann gibt es immer einen Weg dorthin.“ Marianne Raven, Anwältin und ehem. Geschäftsführerin von Plan Deutschland e.V., in ▶ [26], S. 280.
Das motiviert mich Freude, Begeisterung, an Herausforderungen wachsen, kreatives Gestalten, Austausch mit Anderen, Lebenslust, Liebe, persönliche Weiterentwicklung. Es gibt nichts Schöneres als Menschen, die einen in seinem Sein erkennen, bestätigen und anregen und an deren Leben man selbst teilhaben darf.
„Folgt euren Träumen und habt Selbstvertrauen. Habt keine Scheu, Fehler zu begehen.“ Shirin Ebadi, 1. iranische Richterin, Menschenrechtsaktivistin und Anwältin, in ▶ [26], S. 247.
Diese Ressource(n) kann ich jedem empfehlen Austausch mit anderen, die es gut mit einem meinen, in Kommunikation treten, auch oder gerade bei Schwierigkeiten. Probleme als Herausforderung ansehen. Personen sprechen, die einen Schritt weiter als man selbst sind, weil sie älter und erfahrener sind oder in einer Sache einen Wissensvorsprung haben. Ich finde den Respekt vor der Weisheit des Alters, wie man ihn in arabischen Kulturen findet, auch für westliche Kulturen empfehlenswert! Interessant ist es, Menschen aus ganz anderen Branchen zu sprechen und trotzdem Gemeinsamkeiten zu erkennen. Der Neugierde nachgehen! Ein persönliches Profil entwickeln und leben, was auch bedeutet, nicht „Everybodys Darling“ zu sein. Wir werden als Originale geboren und sterben als Kopien, schreibt Arno Gruen (Dem Leben entfremdet, Klett Cotta 2013).
„Wenn du immer Dasselbe machst, bekommst du auch immer dieselben Ergebnisse. Wenn du willst, dass sich etwas ändert, musst du es ändern. Es passiert nicht einfach von allein.“ Caroline Casey, Gründerin der Stiftung Kanchi, in ▶ [26], S. 233.
oder
„Wenn du dich nicht sichtbar hinstellst und auf deiner Position beharrst, dann merkt auch keiner, dass du da bist. Ich habe auch Niederlagen erlebt, aber wenn man Sachen durchsetzen will, braucht man wachsenden Einfluss.“ Ursula von der Leyen, Arbeitsministerin, in ▶ [8] .
Das empfehle ich persönlich der Zielgruppe dieses Buches – den Logopädinnen und Logopäden Sich mit einem eigenen Schwerpunkt positionieren, die eigene Marke entwickeln, im Beruf persönlich hervortreten. Sich nicht zu früh selbstständig zu machen, sondern Zeit in Weiterbildung und Berufserfahrung investieren. Sich für anständige Honorare einsetzen, sich nicht unkollegial „billig verkaufen“, um Marktvorteile zu gewinnen und sich für Geld interessieren. Natürlich sind Preisabsprachen nicht erlaubt, aber man sollte sich damit in einem gewissen Rahmen bewegen, um nicht dazu beizutragen, die ohnehin wenig angemessenen Honorare für Logopädinnen und Logopäden noch weiter drücken zu lassen. Die Sätze der gesetzlichen Krankenkassen sind gering genug, und das Verhalten der privaten Kassen und deren Versicherten sowie die Zahlungsmoral für Leistungen der Logopädie nicht viel besser!
Besonders den Frauen empfehle ich mehr Ehrlichkeit untereinander. Dass es Konkurrenz auch in diesem Beruf gibt, gerade unter Selbstständigen, ist ein Fakt, der gerne ignoriert oder verschleiert wird. Es wird gerne eine „Pseudofreundschaft“ mit allen dargestellt, gerade unter Therapeutinnen und im sozialen Bereich. Das ist weder ehrlich, noch realistisch und führt zu verdeckten Intrigen. Eine offene, faire und sportliche Konkurrenz ist gesünder! An dem Punkt dürfen aus meiner Sicht Frauen von Männern etwas lernen, die können das meist besser. Auf einer wirklich ehrlichen Grundlage miteinander kann man gemeinsam auch tatsächlich solidarisch für wichtige Ziele in diesem schönen und gesellschaftlich wichtigen Beruf eintreten! Dafür die eigenen Energien einzusetzen und die anderer zu mobilisieren, könnte sich für alle lohnen.
„Es sind nicht die Männer, die Frauen auf dem Weg nach oben behindern, die Frauen behindern sich selbst.“ Gertrud Höhler, Publizistin, Politik- und Unternehmensberaterin, in ▶ [26], S. 149
oder
„Bei der Frage: Was können Frauen erreichen? ... sind leider immer noch andere Frauen das größte Problem.“ Christine Bortenlänger, Geschäftsführerin und Vorstand der Bayrische Börse AG, in ▶ [1].
Vita
Anja Mannhard, geboren 1969, ist staatlich anerkannte Erzieherin und staatlich anerkannte Logopädin sowie Lehrlogopädin. Sie ist weitergebildet in Personzentrierter Beratung nach C.R. Rogers und Lösungsorientierter Therapie nach Steve de Shazer.
Abb. no.5 Anja Mannhard (Foto: privat).
Anja Mannhard arbeitet als Kommunikationscoach, v.a. für Frauen und Leiterinnen pädagogischer Einrichtungen und betreibt Burnout-Coaching. Von ihr stammen zahlreiche Fachveröffentlichungen zu den unten genannten Arbeitsschwerpunkten. Sie war Fachbeiratsmitglied Kita aktuell BW und ist Mitglied der Women Speaker Foundation. Mannhard führte über 12 Jahre mehrere Praxen für Logopädie.
Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Kindersprache, Stimme, Redeflussstörungen Stottern und Poltern, Gruppentherapie, Kommunikation, Burnout und Kinderzeichnung.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Geleitworte
Vorwort
Persönliches
Vita
1 Selbstmanagement und eigene Positionierung
1.1 12 Schritte zur Positionierung
1.2 Interviews
1.2.1 „Im Praktikum hat man mehr Verantwortung und erlebt, wie der Alltag wirklich abläuft“ Logopädin Aleksandra Wójcik
1.2.2 „Die Arbeitsfelder der Logopädie werden sich in Zukunft noch weiter diversifizieren“ Logopädieschulleiterin Dr. phil. Angelika Bauer
1.2.3 „In der Summe der Erfahrungen weiß ich, dass meine Arbeit wirklich etwas nützt“ Hochschuldozent Prof. Wolfgang G. Braun
1.2.4 „Die Ausbildung der Logopäden muss in ein primär qualifizierendes Studium umgewandelt werden!“ Logopädieschulleiter Thomas Brauer
2 Existenzgründung und Praxisführung
2.1 Businessplan
2.2 Versicherungen
2.2.1 Unfall-, Berufsunfähigkeits- und Haftpflichtversicherung
2.2.2 Praxisversicherung
2.2.3 Krankenversicherung
2.3 Kassenzulassung
2.4 Interviews
2.4.1 „Versicherungsvermittler und Verkäufer leben von Provisionen, die die Gesellschaften bezahlen“ Versicherungsmakler Oliver Kenk
2.4.2 „Ich empfehle, den Vertrag vor Unterschrift von einem Anwalt für Mietrecht prüfen zu lassen!“ Rechtsanwältin Claudia Matt
2.4.3 „Für Existenzgründer bietet die azh spezielle Konditionen und Beratungsleistungen.“ Abrechnungszentralen-Geschäftsführerin Susanne Hausmann
2.4.4 „Unsere Experten sind an guter Zusammenarbeit beim Abrechnungsverfahren interessiert.“ DAK-Pressesprecher Martin Plass und Daniel Caroppo in Zusammenarbeit mit dem Verband der Ersatzkassen e.V.
3 Frauen und Finanzen – nicht nur für Frauen
3.1 Wie denken Sie über Geld?
3.2 Finanzberatungen und Kredite
3.3 Kassensturz
3.4 Interviews
3.4.1 „In Zeiten der Krisen hat es sich bewährt, wie Frauen anlegen!“ Dipl.-Bankbetriebswirt Michael Hettich
3.4.2 „Es ist wichtig, sich nicht von seiner Überzeugung abbringen zu lassen!“ Finanzberaterin Helma Sick
3.4.3 „Steuern sind nicht langweilig! Ich habe noch Spaß an meinem Beruf.“ Dipl.-Volkswirt und Steuerberater Andreas Hubert
4 Erfolgreiche Kommunikation ist ein Wirtschaftsfaktor
4.1 Berichterstattung und interdisziplinäre Fallgespräche
4.2 Werbung
4.2.1 Werbeinhalte
4.2.2 Werbeformen
4.2.3 Website
4.2.4 Empfehlungen
4.2.5 Kommunizieren der Praxisschwerpunkte und Qualifikationen
4.3 Zusätzliche Arbeitsfelder
4.4 Informations- und Kooperationsveranstaltungen
4.4.1 Eltern-Informationsworkshop für Kindertagesstätten
4.4.2 Informationsabende gemeinsam erleben
4.4.3 Gemeinsam Sprache fördern – Logopäden und Erzieherinnen im Tandem
4.5 Erfolgreich Pressetexte für die Praxis schreiben
4.6 Interviews
4.6.1 „Eine Webseite muss man pflegen und ständig aktualisieren.“ Webdesigner Walter Blauth
4.6.2 „In der Praxis müssen Erzieherinnen mit Anderen interdisziplinär zusammenarbeiten.“ Sozialpädagogin Gabriele Marx
4.6.3 „Das Verordnungsverhalten der Ärzte muss entsprechend der WANZ-Regelung verlaufen.“ Kinder- und Jugendarzt Dr. Detlef Schlassa
4.6.4 „Eltern stärker einzubinden, ist immer sinnvoll!“ Kinder- und Jugendärztin Dr. med. Ute Seufert-Satomi
4.6.5 „Das Kommunikationsverhalten ist mir wichtig, die Interaktion zwischen Mutter und Kind.“ Kinder- und Jugendärztin Dr. med. Angelika Henzler-Le Boulanger
4.6.6 „Machen Sie auf die Behandlung aufmerksam, platzieren Sie sich in Gremien!“ HNO-Arzt Dr. med. Heiner Wirtz
4.6.7 „Ein Budget ist für mich kein Steuerungsinstrument für die Behandlung von Patienten!“ Hausarzt Dr. med. Peter Rönnefarth
4.6.8 „Dem interdisziplinären Auftrag werden wir gerecht, wenn wir wissen, was wir tun, und dies fachübergreifend kommunizieren.“ Zahnärztin, Kieferorthopädie Dr. med. dent. M. Sc. Gloria Werner
4.6.9 „Ich brauche vor allem eine ehrliche Rückmeldung!“ Vorsitzender des Ärztlichen Kreisvereins Lörrach Dr. med. Ingolf Lenz
4.6.10 „Die Kinder bei uns sind immer auch noch von noch anderen Störungen betroffen.“ Dipl.-Psychologe Gerald Winkelmann, Frühförderstelle Lörrach
4.6.11 „Bei auffälligen Befunden empfehle ich eine Kontrolle ggf. mit weiterer Abklärung.“ Schulärztin OMedR Ute Berens
5 Anstatt eines Nachworts
6 Anhang
6.1 Quellenangaben
6.2 Literaturtipps
6.3 Literatur der Autorin
Autorenvorstellung
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum
1 Selbstmanagement und eigene Positionierung
„Es gibt nichts Schöneres, als sich mit Problemen auseinander zu setzen, nach Lösungen zu suchen und sie umzusetzen.“ Ruth Dreifuss, 1. Bundespräsidentin der Schweiz, in ▶ [26], S. 51.
oder
„Ich glaube, wir Frauen sollten uns sehr intensiv mit dem Thema Macht beschäftigen, denn wer Macht hat, kann verändern.“ Gabriele Heinisch-Hosek, Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen Dienst in Österreich, in ▶ [26], S. 64.
In meiner Tätigkeit als Stottertherapeutin habe ich das lösungsorientierte Konzept von Ben Furman entdeckt▶ [5] und dazu am Beispiel einer Gruppentherapiemaßnahme mit stotternden Schulkindern in meiner Praxis publiziert (www.anjalingua.de).
Einige Jahre später fand ich das Büchlein „Jetzt geht’s! Erfolg und Lebensfreude mit lösungsorientiertem Selbstcoaching“ ▶ [27] auf dem Büchertisch eines Kongresses zur Lösungsorientierten Therapie. Die Leitgedanken sind für mich nach wie vor aktuell, sei es für die inhaltliche Arbeit mit Patienten oder Klienten als auch für die Reflexion mit sich selbst.
Ich skizziere im Folgenden die 12 Schritte im Überblick für die Überlegung, sich als Logopädin selbstständig zu machen, oder aber auch, um sich immer wieder einer Überprüfung zum eigenen Standort und -punkt zu unterziehen, wenn man schon länger selbstständig und berufstätig ist. Dies muss nicht nur in der Selbstständigkeit sein.
1.1 12 Schritte zur Positionierung
1. Beschreiben Sie Ihre Vision Wenn Sie den Blick in die Zukunft richten, wie sieht sie aus? Die Vision der idealen Zukunft stellt das Fundament dar, auf dem Sie alle weiteren Schritte aufbauen. Wie eine zufriedene Inhaberin eines Schokoladengeschäfts erzählt, die zuvor Diätberaterin war und sich an den Beratungen „mit erhobenem Zeigefinger“ entgegen jeden Genusses störte, darf die Zukunft jedoch nicht nur aus einem Traum bestehen, sondern er muss auch „Füße haben“. Sprich, die Planbarkeit und der Realitätssinn dürfen dabei nicht verlorengehen, wenn Sie Ihren Traum verwirklichen wollen.
2. Legen Sie ein Ziel fest Welche Ziele helfen Ihnen, Ihre Vision zu verwirklichen? Gibt es bestimmte Fähigkeiten, die Sie erlernen wollen oder bereits vorweisen? Welche Aufgaben möchten Sie vollenden? Je genauer Sie Ihre Ziele positiv formulieren, umso realistischer ist es, dass Sie sie erreichen. Große Ziele unterteilen Sie in Teilziele. Notieren Sie, wann Sie mit wem was tun und was Sie selbst an Aktivität einbringen, um das Ziel zu erreichen.
3. Suchen Sie sich Helfer Sie brauchen Verbündete, Hilfe, Unterstützung und Ermutigung von Anderen. Laden Sie sie ein, Sie bei Ihrem Projekt zu unterstützen. Meine Anregung ist, mit Menschen zu sprechen, die Sie interessieren und inspirieren. Das können Menschen aus ganz anderen Branchen und aus Ihrer eigenen sein. Über den eigenen Tellerrand zu schauen, ist sehr bereichernd. Treten Sie in Kommunikation! Ich bin erstaunt, dass manche Ärzte zu mir sagen, die Logopäden würden nicht mit ihnen kommunizieren. Logopäden sind Therapeuten für Kommunikationsstörungen! Besinnen Sie sich auf Ihre wichtigste Ressource, das persönliche Gespräch, das führt Sie weiter.
4. Schauen Sie auf den Nutzen Welchen Nutzen hat es für Sie, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben? Was ist danach besser als vorher? Welche Vorteile bringt der Erfolg für Sie selbst, aber auch für andere? Welche positiven Auswirkungen gibt es? Wie lohnt sich Ihr Einsatz zum Erreichen Ihres Zieles für Sie selbst und gegebenenfalls auch für Ihre Helfer?
5. Achten Sie auf bisherige Fortschritte Es ist unwahrscheinlich, dass Sie nicht schon vorher über Ihre neuen Ideen nachgedacht haben. Sie haben bereits Einiges unternommen, um sich weiterzuentwickeln, gegebenenfalls auch im Hinblick auf Ihr Ziel oder Ihre Ziele. Achten Sie auf bisherige Teilerfolge!
6. Planen Sie künftige Fortschritte „Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden“, sagt ein berühmtes Sprichwort. Um sich einen Prozess stufenweise vorzustellen, sollten Sie davon ausgehen, dass die Dinge gut laufen und Sie Ihr Ziel erreichen werden. David Garrett, ein begnadeter und schöner Geiger, sagt, dass er sich ein Konzert wie ein Sportler einen Lauf vorher genau vorstellt, das Fingerspiel auf der Geige der einzelnen Stücke in Gedanken durchläuft (neben dem ganz praktischen tatsächlichen Üben der Fingerfertigkeit), um auf das Konzert bestens vorbereitet zu sein.
7. Stellen Sie sich den Herausforderungen Fordern Sie sich! Es macht keinen Sinn, aus Angst vor der Herausforderung ein Ziel auszuwählen, das weder wirklich ansprechend ist, noch Ihren tatsächlichen Leistungen entspricht. Manchmal ist das Erreichen eines Zieles nicht leicht. Meist benötigt es, eine gehörige Portion Disziplin. Auch Rückschläge müssen in Kauf genommen werden. So viele Interviewpartner in diesem Buch haben bei den persönlichen Fragen gesagt, dass sie für Erfolg Durchhaltevermögen und Mut wichtig finden!
8. Machen Sie sich selbst Mut Gerade sprachen wir davon, Mut! Fördern Sie Ihren Optimismus, schauen Sie auf das, was Ihnen in der Vergangenheit schon gelungen ist. Suchen Sie sich „Krafttankstellen“. Das können Ihre Helfer, wichtige Hobbys oder sonstige Ressourcen sein.
9. Geben Sie ein Versprechen Nach dem Planen und Vorbereiten kommt die (Vorwärts-)Bewegung. Die größten Erfolgsaussichten haben Sie, wenn Sie nur eine Entscheidung über den jeweils zunächst anstehenden Schritt treffen, dabei aber Ihr großes oder gesamtes Ziel nicht aus den Augen verlieren.
Apple-Gründer Steve Jobs hatte sein Studium abgebrochen und sagte, er könne die jetzigen Stationen seines Werdegangs stets nur mit seiner Vergangenheit verbinden, die Zukunft bei Veränderungen bliebe offen. Er weiß vorher nicht, wie sich eine Veränderung oder Entscheidung auswirken wird. Somit kann man immer nur in Teilschritten planen und handeln (Isaacson W. Steve Jobs: A Biography. Simon Schuster 2011).
10. Führen Sie ein Fortschrittstagebuch Notieren Sie Ihre Erfolge auf dem Weg zum Ziel. Das hilft besonders in Momenten, wo Sie nicht so recht an sich glauben, oder bei Rückschlägen. Kleine Schritte sind der Beginn von etwas Großem! Damit Sie Ihre Fortschritte bemerken, benötigen Sie eine Methode, sich Ihre Etappensiege zu notieren. Wie viele Interviewpartner in diesem Buch sagen, braucht es das Quäntchen Glück zum Erfolg, aber auch Ihre eigene Aktivität.
11. Bereiten Sie sich auf mögliche Rückschläge vor Manchmal tritt eine Entwicklung nicht so ein, wie wir uns das erhofft haben. Wenn man mögliche Rückschläge im Geist vorher durchspielt, und wie man damit umgehen kann, erleichtert das unter Umständen die Situation. Ich stelle mir bei existenziellen Ängsten, die manchmal als Selbstständige auftreten, gerne den schlimmsten Fall vor, was würde ich dann tun? Meist tritt der gar nicht ein, sondern es kommt irgendwann eine Wende und es geht positiv weiter. Das Leben verläuft zyklisch, es gibt Hochs und Tiefs.
12. Feiern Sie Ihren Erfolg und danken Sie Ihren Helfern Seien Sie nicht zu bescheiden. Eigenlob stimmt! In Deutschland regiert manchmal der Geiz, manchmal der Neid und man feiert kaum mehr ausgelassen und freut sich an Erfolgen, an den eigenen und an denen anderer. Das finde ich persönlich sehr schade! Wenn Sie einen Erfolg zu verbuchen haben, dürfen Sie sich an Ihrer Leistung freuen und diese wertschätzen. Ein Fest ist beim Erreichen eines größeren Ziels allemal angemessen! Auch Helfer und unterstützende Menschen sollen daran teilhaben. Sich gegenseitig zu würdigen ist ein wichtiger Akt menschlicher Beziehungen.
1.2 Interviews
1.2.1 „Im Praktikum hat man mehr Verantwortung und erlebt, wie der Alltag wirklich abläuft“ Logopädin Aleksandra Wójcik
Interview
Frage:
„Gratulation! Sie haben vor 3 Monaten Ihren Berufsabschluss erzielt. Wie geht es Ihnen?“
Aleksandra Wójcik:
„Danke, mir geht es sehr gut damit, denn ich habe mir diesen schon seit längerer Zeit sehr gewünscht. Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt für mich. Ich bin derzeit auf der Suche nach einem Job, da ich gerne ins Berufsleben einsteigen würde.“
Frage:
„Wie gestalten Sie die Jobsuche?“
Aleksandra Wójcik:
„Ich suche in der Presse, nutze das Internet und schaue im Forum Logopädie, welches ich zugesandt bekomme. Schön ist auch, dass die DAA uns Absolventen Stellenangebote mailt, die deutschlandweit sind und auch die Schweiz einschließen. Bei mir ist, aufgrund meiner Wohnlage, der Sonderfall, dass ich sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland auf der Suche bin. In der Schweiz kann man nicht überall arbeiten, weil die EDK-Anerkennung oftmals Voraussetzung ist. Die EDK – schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen – ist eine Institution zur Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen. Man muss sein Diplom und alle geforderten Unterlagen an diese Institution einreichen, und es wird geprüft, ob die gewünschten Voraussetzungen zur Anerkennung des jeweiligen Berufsabschlusses erfüllt werden.“
Frage:
„Von deutschen Erzieherinnen und Krankenschwestern weiß ich, dass die deutsche Ausbildung in der Schweiz angesehen und das Honorar deutlich besser ist als in Deutschland. Wie ist das in der Logopädie?“
Aleksandra Wójcik:
„Ich kann das zurzeit noch nicht sagen, diesbezüglich habe ich noch zu wenige Informationen. Zu meiner Ausbildungszeit in Hannover sagte man, dass die deutsche Ausbildung in der Schweiz hoch angesehen wäre, weil man sich bewusst sei, dass sie ein hohes Niveau habe. Hinsichtlich des Verdienstes habe ich aus mehreren Quellen gehört, dass dieser gravierend höher anzusiedeln ist als in Deutschland.“
Frage:
„Wie fühlen Sie sich durch Ihre Ausbildung auf die Berufstätigkeit als Logopädin vorbereitet?“
Aleksandra Wójcik:
„Sehr gut, aus mehreren Gründen. Die Theorie ist seitens beider Schulen sehr gut abgedeckt worden und auch der praktische Teil. Das finde ich sehr wichtig, auch im Vergleich zu meinem früheren Studium, wo es rein theoretisch lief. Als Auszubildende für Logopädie hat man beim Abschluss schon am Patienten gearbeitet, auch durch die Praktika, man hat reales Berufsleben kennengelernt.“
Frage:
„Freiberufliche Praxen übernehmen nach wie vor einen großen Anteil der praktischen Ausbildung einer Logopädin, indem sie Praktikanten in ihrer Praxis betreuen. Wie bewerten Sie diese Form der praktischen Ausbildung?“
Aleksandra Wójcik:
„Als ich mich für Praktikumsstellen beworben habe, habe ich oft die Meinung gehört, dass die Schulen ihre Ausbildung auf externe Stellen verlegen würden. Das stimmt so nicht, ein großer Teil der praktischen Ausbildung wird auch an der Schule vermittelt. Wichtig sind aber auch Erfahrungen in Praxen, Kliniken und Kindergärten. In der Schule verläuft dies gelenkter, im Praktikum hat man noch mehr Verantwortung und erlebt, wie der Alltag wirklich abläuft.“
Frage:
„Gibt es Verbesserungsvorschläge für diese Art der Ausbildung? Wie ich Sie verstehe, sind Sie zufrieden mit dem Verlauf der praktischen Ausbildung?“
Aleksandra Wójcik:
„Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf, sowohl theoretisch, als auch vor allem praktisch. Ich hatte großes Glück mit meiner Praktikumsstelle, ich war ja zu beiden externen Praktika in Ihrer Praxis. Bei Ihnen konnte ich viel lernen, vor allem im Bereich Stottern, Poltern und Gruppentherapien. Durch die Praktika hat sich für mich der Kreis vom Theoretischen zum Praktischen geschlossen. Was den praktischen Teil betrifft, habe ich keine Verbesserungswünsche. Ich finde es gut, dass von der Schule für uns externe Stellen in Klinik, Kindergarten oder Altersheim durch Kooperationsverträge gestellt wurden. Bei den beiden externen Praktika gab es seitens der Ausbildungsstätte die Auflage, ein Praktikum bzw. einen Teil in einer logopädischen Praxis und ein Praktikum bzw. einen Teil an einer Klinik zu absolvieren.“
Frage:
„Ist das heutzutage noch realistisch? So viele Praktikumsplätze gibt es doch gar nicht, als dass man sich das noch aussuchen könnte.“
Aleksandra Wójcik:
„Nein, es ist nicht wirklich realistisch, vor allem in Hannover war es schwierig, Praktikumsplätze zu bekommen. Viele Logopäden in freien Praxen waren nicht davon angetan, Praktikanten aufzunehmen, sie haben blockiert. In Hannover gibt es 3 private Ausbildungsstätten für Logopädie und eine staatliche, daher ist der Markt ziemlich überlaufen.“
Frage:
„Was sagen Sie dazu, dass die freiberuflichen Logopäden kein Honorar für die Anleitung der Praktikanten erhalten? Aus meiner Sicht müssten die Lehranstalten, gerade die privaten, die doch einiges an Schulgeld jeden Monat von den Auszubildenden verlangen, ein Honorar zahlen. Eine potenzielle Konkurrentin unterstützt man mit der Teilhabe am eigenen Know-how im Praktikum möglicherweise auch, wenn sich diese dann im eigenen Umfeld selbstständig macht. Freiberufliche Logopäden müssen auch unternehmerisch denken.“
Aleksandra Wójcik:
„Das ist sicher richtig, vor allem weil es in der heutigen Zeit bestimmt nicht einfach ist und weil einem viele Hürden in den Weg gelegt werden. Vielleicht kann man das aber auch anders sehen. Wenn man einen Praktikanten hat, hat man einerseits Arbeit mit ihm, man kann aber auch voneinander profitieren. Wer frisch auf den Markt kommen will, hat eine starke Motivation, man kann sich auseinandersetzen, man bringt eigene Ideen und frischen Wind rein, gerade auch in der Therapie mit Kindern.“
Frage:
„Viele Logopäden arbeiten selbstständig. Wie fühlen Sie sich durch Ihre Ausbildung auf so eine Tätigkeit vorbereitet?“
Aleksandra Wójcik:
„Wie bereits erwähnt, habe ich meine beiden externen Praktika bei Ihnen als selbstständige Logopädin absolviert und dadurch einen guten Einblick bekommen. Im Unterricht an der Schule sind Unterschiede zwischen selbstständig und angestellt sein angeschnitten worden, jedoch fehlte die persönliche Erfahrung. Es waren eher rudimentäre Informationen im Fach Berufskunde, aber keine tiefgreifenden Details.“
Frage:
„Ich finde das erstaunlich, denn das war bereits zu meiner Ausbildungszeit so, und das ist jetzt über 15 Jahre her. Es gab bei uns wenige Stunden Berufskunde, und dies noch nicht einmal von Dozenten, die in der Tat einmal selbstständig gearbeitet haben. In Ihrem Fall so viele Jahre später und mit Ihrer Erfahrung, an 2 verschiedenen Schulen ausgebildet worden zu sein, scheint sich da nicht wesentlich etwas verändert zu haben! Gab es die logopädische Existenzgründung als Fach? Gab es Fächer wie Betriebswirtschaft mit Versicherungswesen und Finanzen, Erstellen eines Businessplans, Marketing für logopädische Praxen oder Ähnliches?“
Aleksandra Wójcik:
„Gänzlich unvorbereitet wurden wir nicht entlassen. Hinsichtlich der Selbstständigkeit gab es wie gesagt nur einen Einblick, aber nichts Tiefgreifendes. Die persönliche Erfahrung im Praktikum war da viel mehr wert. An der DAA bestand das Fach Berufskunde aus 3 Teilen: Praxisrecht für Therapeuten, Strukturen des Gesundheitswesens und Berufskunde.“
Frage:
„Können Sie kurz skizzieren, was die Inhalte dieses Faches waren?“
Aleksandra Wójcik:
„‚Praxisrecht für Therapeuten‘ hatte Rechtliches zum Inhalt. Die Dozentin war Anwältin. ‚Strukturen des Gesundheitswesens‘ befasste sich mit der ISK – Intensiven Sprachförderung im Kindergarten – und wurde von einer Sozialpädagogin vermittelt. In ‚Berufskunde‘ war unsere Schulleiterin die Dozentin. Der Fokus lag auf den Rahmenbedingungen der logopädischen Arbeit. Darunter fielen die Heilmittelrichtlinien, Berufsleitlinien, Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement (Ansatzpunkte: Ausbildung, Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität) und Modelle therapeutischer Zusammenarbeit (ICF der WHO).“
Frage:
„Aus meiner Sicht überschätzen sich manche Berufsanfänger und machen sich umgehend nach dem Examen selbstständig. Leider ist die frühere Voraussetzung, dass man zuvor mindestens 2 Jahre Berufserfahrung sammeln musste, aufgehoben worden. Damit ‚verderben‘ Berufsanfänger den Markt, weil der Patient zunächst einen unerfahrenen Berufsanfänger nicht sofort von einem versierten Kollegen mit jahrelanger Erfahrung unterscheiden kann, vor allem wenn er über die sogenannten Soft Skills verfügt, also nett, freundlich und hilfsbereit ist. Was meinen Sie dazu?“
Aleksandra Wójcik:
„Diese Meinung teile ich, es ist in meinen Augen ein Fehler, sich von Anfang an selbstständig zu machen. Die Anleitung fehlt, der Austausch, man kann nicht um Rat fragen. In der Ausbildung gibt es viel Wissen und Erfahrung, aber man ist dennoch nicht auf dem Stand, um sich selbstständig zu machen. Meine Empfehlung ist: Erst berufliche Erfahrung in jeder Hinsicht sammeln, in Praxis oder Kliniken arbeiten, wo ein Team vorhanden ist, man jemanden an der Hand hat, der einen leitet und in den Beruf einführt. Eine meiner Kommilitoninnen machte sich nach ca. einem halben Jahr selbstständig. Das halte ich für übereilt.“
Frage:
„Eines Tages kommt eine schöne Fee und sagt, Sie hätten im Rückblick 3 Wünsche an Ihre Ausbildung zur Logopädin frei. Wie lauten Ihre Wünsche? Was hätte gegebenenfalls anders laufen sollen?“
Aleksandra Wójcik:
„Die Ausbildung an einer privaten Institution ist ziemlich teuer. An einer staatlichen Ausbildungsstätte wären die Kosten geringer, jedoch sind die Plätze sehr rar. Finanzen spielen leider immer eine große Rolle. Außerdem wäre es von Vorteil, wenn die Zahl der Auszubildenden geringer wäre. Es wäre leichter Praktikumsstellen zu finden und aussichtsreicher, einen Job zu finden.
Mein 2. Wunsch: In der 1. Ausbildungsstätte hätte ich mir persönlich eine andere Schwerpunktsetzung im Fach Stimme gewünscht. Der Schwerpunkt lag dort auf dem Schlaffhorst-Andersen-Konzept. Sicherlich kann man diesem Konzept viel entnehmen, vor allem auch fürs Funktionale Stimmtraining. Ich wechselte ja die Schule, weil ich durch das Examen gefallen und umgezogen bin. In der neuen Schule hat sich für mich das Bild vervollständigt, dort gab es andere Therapiekonzepte, die zu gleichen Teilen vermittelt wurden. Man kann nicht jedes Konzept an jedem Patienten anwenden. Man wird dem Patienten gerechter und fühlt sich besser, wenn man in mehreren Konzepten sicher ist.“
Frage:
„Aus meiner Sicht ist es Aufgabe der Ausbildung, den Schülern ein ‚Handwerksköfferchen‘ mit verschiedenen Methoden zu vermitteln, sodass sie später entsprechend ihrer persönlichen Neigungen und Fähigkeiten und vor allem individuell zum Patienten passend die richtige Methode auswählen können, abgesehen davon, dass die Beziehungsarbeit in der Therapie eine genauso große Rolle spielt. Eine einzige Methode, die ein Lehrlogopäde favorisiert, kann nicht einziger Gegenstand eines Faches in der Logopädieausbildung sein. Haben Sie noch einen 3. Wunsch?“
Aleksandra Wójcik:
„Die Logopädie sollte einen akademischen Abschluss haben! Wie ich schon zuvor erwähnte, habe ich vorher studiert und traf aus privaten Gründen die Entscheidung, zur Logopädieausbildung zu wechseln. Ich habe das Niveau der Ausbildung stark unterschätzt! Auf 3 Jahre gesehen ist das Niveau sehr hoch. Es gleicht einem Fachhochschulstudium.“
1.2.1.1 Persönliches
Darin bin ich professionell Im Umgang mit Menschen. Egal, welchen Alters, ob Kind oder Erwachsener, schwer beeinträchtigt oder weniger, mit oder ohne Behinderung, Ausländer oder nicht, und egal, welcher Schicht der Mensch angehört. Ich bin nicht perfekt in meinem Beruf, habe kein 100%iges Wissen und auch nicht sehr viel praktische Erfahrung, jedoch habe ich ein starkes Fundament, welches ich mit viel Motivation sehr gerne ausbauen möchte.
Etwas Wichtiges, das ich auf meinem Weg zur Expertin in meinem Bereich gelernt habe Dass man auf seinem Ausbildungsweg Erfahrungen in Theorie und Praxis machen muss. Dass man jedem Menschen ganz individuell begegnen muss. Außerdem ist es immer von großem Vorteil, mehrere Konzepte kennenzulernen, ein breiteres Wissen zu haben, in jedem Störungsbild.
Für Erfolg braucht man Motivation, Selbstvertrauen, Intelligenz und Geld.
Das hat mein Leben in neue Bahnen gelenkt Chronologisch gesehen: die Migration aus Polen nach Deutschland, bedauerlicherweise die Trennung meiner Eltern, das Kennenlernen meines Mannes, das Abitur und der anschließende Beginn des Jurastudiums, die Entscheidung vom Studium zur Logopädieausbildung zu wechseln, leider durch das Logopädie-Examen zu fallen, der Umzug aus Deutschland in die Schweiz, das Erlangen der Berufserlaubnis zur Logopädin.
Das motiviert mich Für sich einen Erfolg verzeichnen können, seinen Beruf gut ausüben, eigene Erwartungen und die des Gegenübers erfüllen. Meine Familie und meine Freunde. Literatur, Musik und Sport.
Diese Ressource(n) kann ich jedem empfehlen Nicht in Routine verfallen, den Menschen als Individuum in der Begegnung sehen, die Ressourcen des Patienten im Auge behalten und die Arbeit darauf ausrichten können, nicht nur das Defizit sehen, sondern auch die Ressourcen – vor allem in der Aphasietherapie.
Das empfehle ich persönlich der Zielgruppe dieses Buches – den Logopädinnen und Logopäden Nicht in Schubladendenken und Routine zu verfallen, immer mit der Zeit gehen bzw. offen sein für Neues und interdisziplinären Austausch wie auch gegenseitigen interdisziplinären Respekt.
1.2.1.2 Vita
Aleksandra Wójcik (▶ Abb. 1.1), geb. Kowalska, wurde 1977 in Breslau/Polen geboren; 1998 Abitur an der St.-Ursula-Schule in Hannover, 1998–2007 Jurastudium an der Leibniz-Universität in Hannover, 2007–2009 Ausbildung zur Logopädin an der Ross-Schule in Hannover, 2010–2011 Ausbildung zur Logopädin an der DAA in Freiburg. Aleksandra Wójcik ist seit 2011 staatlich anerkannte Logopädin und lebt seit 2010 in Basel/Schweiz.
Abb. 1.1 Aleksandra Wójcik, Logopädin (Foto: privat).
Kommentar von Anja Mannhard
Externe Praktika sind unverzichtbarer Bestandteil der Ausbildung von Logopädinnen und Logopäden und bereiten auf den Beruf praxisnah vor. Seien Sie sich dieser Wertigkeit bewusst und gestalten die Kooperation entsprechend:
Treten Sie mit den Anleitern vorab in Kommunikation und stimmen Sie Ziele und Aufgaben des Praktikums ab.
Wenn keine Entlohnung möglich ist, sollten andere Formen der Anerkennung gefunden werden.
Praktikumsanwärter sollten sich mindestens mit einer Kurzbewerbung schriftlich bewerben, in der sie Angaben zur Person, zum Stand der Ausbildung und zu den Zielen des Praktikums formulieren.
Bedenken Sie, in welchem Rahmen Sie Patienten Praktikanten „zumuten“ wollen. Jemand, der einer Therapie beiwohnt, verändert diese, auch wenn er „nichts tut“. Ich wundere mich, wie viele Kollegen Praktikanten rein nach Anruf aufnehmen, ohne persönliche Kenntnis der Person. Dies kann unter Umständen den therapeutischen Prozess stören.
Sich schnell nach dem Examen selbstständig zu machen, ist unverantwortlich und schadet dem Qualitätsstandard in der Logopädie.
„Das Ausmaß an Unterstützung und Verständnis, das ich von Frauen und Männern aus allen kulturellen und sozialen Schichten erhalte, (...) gibt mir viel Kraft.“ Waris Dirie, UN-Sonderbotschafterin, ehemaliges Topmodel, in ▶ [26], S. 415.
1.2.2 „Die Arbeitsfelder der Logopädie werden sich in Zukunft noch weiter diversifizieren“ Logopädieschulleiterin Dr. phil. Angelika Bauer
Interview
Frage:
„Sie sind Neurolinguistin und gehören in der Logopädie gemeinsam mit Luise Springer, Luise Lutz und Annelie Kotten zur ‚Generation der 1. Stunde‘. Können Sie uns Ihren Werdegang in der Logopädie kurz skizzieren?“
Angelika Bauer:
„Ich habe in Konstanz Linguistik studiert, dann 2 Jahre Neurolinguistik als Aufbaustudium in Brüssel. Da dieser 2-jährige Aufbaustudiengang in Belgien zur Ausübung des Berufs ‚Logopädin’ berechtigt, bin ich auch in Deutschland als Logopädin staatlich anerkannt. 1981–2008 war ich – mit einer kleinen Forschungsunterbrechung (2002–2004) – als Sprachtherapeutin an der Neurologischen Klinik in Elzach tätig. Ich habe also als Sprachtherapeutin/Klinische Linguistin/Logopädin eine klinische Sozialisation durchlaufen und nie in freier Praxis (und nie mit Kindern) gearbeitet. 2009 habe ich von Helga Johannsen-Horbach die Leitung der DAA Logopädieschule in Freiburg übernommen. Dabei waren Aus- und Fortbildung für mich kein völlig neues Gebiet. Parallel zu meiner klinischen Tätigkeit habe ich seit Mitte der 80er Jahre gemeinsam mit meiner Kollegin Gudrun Kaiser Fortbildungsseminare gegeben, und seit 1992 unterrichte ich in verschiedenen Logopädieausbildungsgängen (Fachschule, Diplomstudiengang, Bachelorstudiengang) in der Schweiz. Was damals eine Möglichkeit war ‚reflektierte Praxis’ in mein berufliches Leben einzubinden (und dafür bezahlt zu werden), ist heute mein ‚Kerngeschäft‘.“
Frage:
„Inwiefern unterscheiden sich die Tätigkeiten einer Neurolinguistin und einer Logopädin in der Klinik?“
Angelika Bauer:
„Diese Frage lässt sich sicher nicht allgemeingültig beantworten. Ob Unterschiede in der alltäglichen Arbeit bestehen, dürfte von Einrichtung zu Einrichtung variieren. Die Abteilung Sprachtherapie der Neurologischen Klinik Elzach war immer gut durchmischt. Klinische Linguisten, Sprachheilpädagogen und Logopäden arbeiteten ohne Unterschiede im Hinblick auf Aufgaben und Arbeitsorganisation zusammen. Wir haben uns jedoch immer darum bemüht, dass alle die jeweiligen Besonderheiten ihrer Grundausbildung einbringen konnten, damit alle von den unterschiedlichen pädagogischen, theoretischen und praktischen Hintergründen der Kollegen profitieren konnten.“
Frage:
„Logopäden werden in der Ausbildung immer noch kaum oder unzureichend auf die betriebswirtschaftliche Seite der Selbstständigkeit vorbereitet, obwohl danach viele eigene Praxen führen (wobei sich das künftig ändern könnte, da der Markt mit freien Praxen zumindest in Städten gesättigt sein dürfte). Das zeigt unter anderem ein Interview in diesem Buch ▶ Link mit einer Berufsanfängerin seit 2012, die wie bereits ich vor über 15 Jahren zu Zeiten meiner Ausbildung kein grundständiges Fach hatte, in der auf die betriebswirtschaftliche Seite einer Praxis umfangreich vorbereitet wurde. Der Industrie- und Handelskammer, die beispielsweise bei Handwerkern obligatorisch Existenzgründungskurse anbietet, wenn ein Meister sich selbstständig machen will, sind wir nicht zugeordnet. Es sind auch nicht alle Logopäden Mitglied beim dbl und müssen es auch nicht sein, es gibt ja auch kritische Stimmen, weil nicht alle mit der Mitgliedschaft zufrieden sind. Das Problem betrifft nicht nur Logopäden, sondern alle Therapieberufe wie auch das Medizinstudium, denn auch Ärzte erzählen mir in den Gesprächen, dass sie im Studium kein BWL hatten. Eine Unternehmensberaterin, mit der ich sprach, kennt gerade eine Therapieausbildungseinrichtung, die ihre Abgänger explizit auch auf die Unternehmensführung vorbereitet. Kann sich eine Ausbildungsstätte heutzutage noch leisten, ihre Abgänger so wenig auf die selbstständige Tätigkeit als Logopädin vorzubereiten?“
Angelika Bauer:
„Ich bin nicht der Meinung, dass ‚Unternehmensführung’ ein Inhalt der logopädischen Fachschulausbildung zu sein hat. Die Logopädieausbildung ist eine Grundausbildung, die ihre Absolventen befähigen soll, den heutigen Anforderungen entsprechend logopädisch zu arbeiten – das ist Aufgabe genug! Im Fach Berufskunde sollten die relevanten Rahmenkonzepte wie das Gesundheitsmodell der WHO, die aktuellen Arbeitsfelder, künftige Perspektiven und natürlich die Positionierung der Logopädie im deutschen Gesundheitswesen mit den daraus resultierenden Möglichkeiten, Anforderungen und Einschränkungen skizziert werden. Die Vermittlung betriebswirtschaftlicher Kenntnisse gehört nicht dazu, ausgenommen der Hinweis, dass die Gründung einer Praxis diese erfordert.
Es ist völlig offen und muss offen bleiben, in welchen institutionellen Kontexten die Absolventen nach dem Examen arbeiten. Die Arbeitsfelder der Logopädie sind diversifiziert und werden sich meiner Einschätzung nach in Zukunft noch weiter diversifizieren. Die jeweils erforderlichen spezifischen Qualifikationen bzw. Kompetenzen muss man sich dann ‚vor Ort’ aneignen.
Von unseren letzten 3 Jahrgängen hat sich kein einziger Absolvent sofort in eigener Praxis selbstständig gemacht. Knapp über 60% arbeiten angestellt in Praxen, die anderen arbeiten in Kliniken, Frühförderstellen, Beratungsstellen, interdisziplinären Therapiezentren, in der Sprachförderung im Kindergarten oder sind ins benachbarte Ausland gegangen, wo sie ganz andere Rahmenbedingungen vorfinden als bei uns.“
Frage:
„Sie sind als Ausbilderin sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz tätig. Wie unterscheiden sich die beiden Ausbildungssysteme, und könnten die beiden Länder voneinander lernen?“
Angelika Bauer:
„In der (deutschsprachigen) Schweiz ist die Akademisierung vollzogen. Die Logopädieausbildung ist schon seit einigen Jahren ein Bachelorstudiengang und in pädagogische (z.B. Basel, Rorschach) oder heilpädagogische Hochschulen bzw. Fachbereiche (z.B. Zürich, Fribourg) eingebunden. Da die Mehrzahl der Schweizer Logopäden im vorschulischen und schulischen Bereich arbeitet, haben pädagogische Aspekte in der Schweizer Ausbildung deutlich mehr Gewicht als bei uns und bestimmen auch die Selbstdefinition der Logopäden. Demgegenüber fallen in den meisten Studiengängen die klinisch-medizinischen ‚Säulen’ der Logopädie etwas schlanker aus. Es wird von den politischen Entwicklungen in Deutschland abhängen, ob wir von den Schweizern lernen können. Konkret: Davon, ob es der Logopädie gelingt, sich mit ihren spezifischen Kompetenzen auch in den pädagogischen Bereich einzubringen. Was die Qualität der Studiengänge betrifft, so haben die Schweizer mit denselben Problemen zu kämpfen wie wir: viel Stoff, wenig Zeit und dabei den Anspruch, den Studierenden die Möglichkeit zu eröffnen, theoretische und praktische Kompetenzen zu erwerben. Ich würde mir für Deutschland und für die Schweiz wünschen, dass der Logopädie-Bachelor auf mindestens 7 Semester aufgestockt wird.“
Frage:
„In Deutschland übernehmen freiberufliche Praxen nach wie vor einen großen Anteil der praktischen Ausbildung eines Logopäden, indem sie Praktikanten in ihrer Praxis betreuen. Die Auszubildenden bewerten diese Form der praktischen Ausbildung durchweg als positiv und wertvoll und fühlen sich erst dadurch wirklich auf die praktische Seite des Berufs realistisch vorbereitet. Was meinen Sie dazu, dass ich sage, die freiberuflichen Logopäden müssten ein Honorar für die Anleitung der Praktikanten erhalten? Aus meiner Sicht müssten die Lehranstalten, gerade die privaten, die doch einiges an Schulgeld jeden Monat von den Auszubildenden verlangen, ein Honorar zahlen. Eine potenzielle Konkurrentin unterstützt man mit der Teilhabe am eigenen Know-how im Praktikum möglicherweise auch, wenn sich diese dann im direkten Umfeld selbstständig macht, und das verärgert nur dann, wenn man den Eindruck hat, dass einem zuvor kostenlos das Know-how abgeschaut wurde. An sich wäre es ja wünschenswert, dass praktizierende Logopäden die nachfolgenden unterstützen. Ich meine, wenn freiberufliche Logopäden mit ihren Leistungen Teil der Ausbildung sind, sollten sie auch bezahlt werden, denn sie müssen auch unternehmerisch denken, und es wäre Luxus, ihr Können zu verschenken. Ob man sich den Luxus heutzutage noch leisten kann, stelle ich in Frage.“
Angelika Bauer:
„Den nächsten Generationen die Türen nicht zu öffnen, fände ich schade – zumal alle derzeitigen Praxisinhaber von diesem Modell profitiert haben. Diese Art von besitzstandswahrendem Konkurrenzdenken ist mir völlig fremd. Stellen Sie sich einmal vor, was passieren würde, wenn die jeweils erfahrene Generation aufhören würde, ihr Wissen an die nächste weiter zu geben. Dass dadurch Konkurrenz entstehen kann, ist nicht vermeidbar. Was Sie aber hauptsächlich stört, ist, dass dies (meist) unentgeltlich geschieht. Dem ist – betriebswirtschaftlich gedacht – nichts entgegenzusetzen. Die Ausbildungsrichtlinien des Logopädengesetzes fordern eine hohe Anzahl von Stunden praktischer Ausbildung. Darüber hinaus ist eine starke Verzahnung von theoretischer und praktischer Ausbildung erwünscht. Wie diese Anforderungen umgesetzt werden, hängt von den jeweiligen Rahmenbedingungen und den didaktischen Konzepten der Ausbildungsstätten ab. Wenn die jeweilige Schule sich so organisiert hat, dass ein Teil der praktisch-therapeutischen Ausbildung extern gemacht wird (und dies gilt meines Wissens auch für einige staatliche Schulen), sollte den externen Ausbildern ein Honorar bezahlt werden. Dann muss man sich konkrete Gedanken darüber machen, was genau dieser Lehrauftrag beinhaltet, wie viele Stunden er umfasst etc. Letztlich ist entscheidend, welche Funktion(en) die externen Praktika im Rahmen der Ausbildung übernehmen. Ob sie z.B. der therapeutischen Ausbildung im engeren Sinne dienen (‚Therapieren lernen’) oder ob es darum geht, eine der praktischen Varianten der Berufsausübung (in der Praxis, in der Klinik, im Beratungszentrum, in der Frühförderung etc.) kennenzulernen. Wir haben uns für das letztgenannte Konzept entschieden: Die praktisch-therapeutische Ausbildung findet in der Ausbildungsambulanz der Schule statt. Externe Praktika gelten als Hospitationspraktika und sollen Blicke über den therapeutischen Tellerrand unserer Ausbildungsambulanz hinaus, v.a. aber Einblicke in verschiedene Arbeitsfelder der Logopädie ermöglichen. Die Praktikanten sollen Unterschiede sehen, den organisatorischen Rahmen beschreiben, die Qualifikationen der Fachkräfte, die Arbeitsanforderungen und -formen, das besondere Klientel usw. Diese Erfahrungen werden von unseren Auszubildenden positiv bewertet.
Das schließt natürlich nicht aus, dass Kollegen die Praktikanten je nach Ausbildungsstand einbinden und sie auch therapieren lassen. Unsere Praktikumsgeber haben aber keinen praktisch-therapeutischen Ausbildungsauftrag. Ich würde mir wünschen, dass die externen Praktika für beide Beteiligten gewinnbringend sind; dass die Praktikanten z.B. an organisatorischen Arbeiten (z.B. an Büroarbeiten und an Dokumentationsaufgaben) beteiligt werden, aber auch Aufträge bekommen z.B. etwas zu recherchieren, passendes Therapiematerial zu suchen oder zu erstellen oder sich vorbereitende Gedanken über diagnostische Instrumente zu machen, neue Verfahren vorzustellen oder zu erproben, Sprachsamples zu erstellen oder Untersuchungen detailliert auszuwerten. Sie sollen etwas lernen, aber auch indem sie – so die Zielvorstellung – etwas für die Praktikumsgeber tun. Auf diese Art und Weise könnten Praktikanten auch für die Praxen ‚gewinnbringend’ sein.
Ich möchte gerne noch eine eher allgemeine Anmerkung zum Thema ‚praktische Ausbildung’ machen: Ich bezweifle, dass der Auftrag der ‚praktischen Ausbildung’ in den Fachschulen darin besteht, auf die praktischen Seiten des Berufs realistisch vorzubereiten. Zumindest wenn damit nur die Vorbereitung auf eine niedergelassene Tätigkeit gemeint sein sollte, wäre eine derartige Interpretation des Auftrags sehr kurzsichtig und auch sehr eng gedacht. Das Berufsbild der Logopädie ist in beständigem Wandel begriffen – u.a. dies macht diesen Beruf ja so spannend – und auch die Arbeitsfelder verändern sich kontinuierlich. Wir können niemanden auf die aktuell gegebenen Bedingungen ausrichten, geschweige denn ‚zuschneiden’, sondern müssen unseren Auszubildenden möglichst die Kompetenzen vermitteln, die sie benötigen, um sich nachher in den verschiedensten Arbeitsfeldern und mit sich verändernden Aufgaben zurechtzufinden.
Aus unserer Sicht konzentriert sich die Aufgabe der praktischen Ausbildung vielmehr auf den Erwerb grundlegender Kompetenzen in der logopädischen Zusammenarbeit mit unseren Patienten und ihrem Umfeld und im interdisziplinären Team. Auch hier verändern sich Anforderungen (wie evidenzbasiertes, reflektiertes Arbeiten, Evaluation und Dokumentation), Rahmenkonzepte (wie das Modell funktionaler Gesundheit der WHO, Interdisziplinarität), Sichtweisen auf die Therapie (partnerschaftliche und partizipative Therapeut-Patient-Beziehung), Therapieansätze, Lerntheorien und Vieles mehr. Dieses Wissen und dieses praktische Know-how gehören zu den logopädischen Kernkompetenzen, auf die wir uns zu konzentrieren haben und die in allen logopädischen Arbeitsfeldern erforderlich sind.“
Frage:
„Nun stelle ich eine lange Frage! Mehrere Ärzte, mit denen ich Interviews zu diesem Buch geführt habe, meinen, dass Logopäden sich wie Ärzte in einer Niederlassungsregelung organisieren müssten. Es sei fatal, wie stark die Anzahl der logopädischen Praxen in den letzten Jahren gestiegen sei