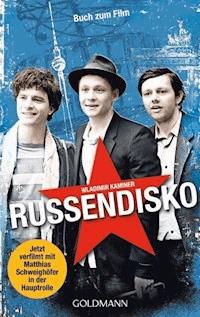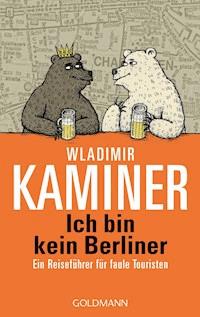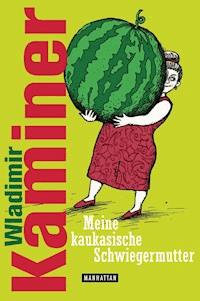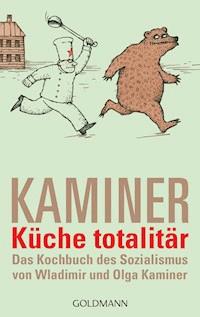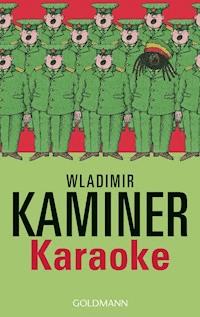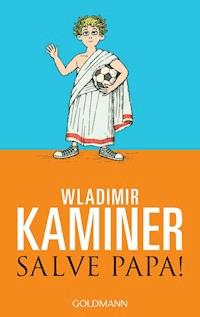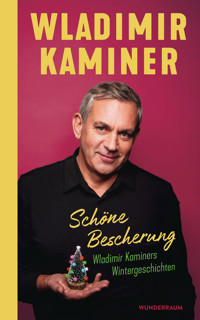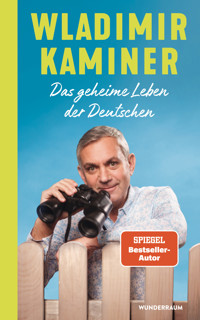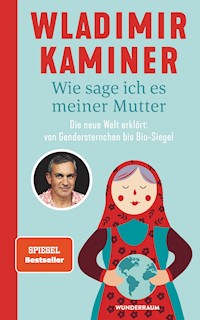Inhaltsverzeichnis
Widmung
Lob
Neue Nachbarn
Die Russen-WG
Der 7. Tibeter
Wer ist Deutschland?
Die Zugvögel
Mongolian Standard
Deutsch als Spritze
Der Enkel des Partisanen
Erdbeeren mit Sahne
Gespräche über die Ewigkeit
Die Mutter (nicht von Gorki)
Ein ungewöhnliches Konzert
Väter und Söhne
Plüschtiere aus Schlobin
Der Ernst des Lebens und das ewige Eis
Der Russe lacht nicht
Das russische Rebellen-Gen
Andrej und das Geheimnis der blauäugigen Blondine
Jeder ist ein Dichter
Die Kirche
Blauwürste und Dame mit Hut
Was mir mein Nachbar über weißrussisches Bibergeil erzählte
Moskauer Sitten
Der Sinn des Eisfisches
Wie Russen Weihnachten feiern
Karl Marx und seine Leser
Ein Toast auf Joyce
Das Parfüm
Natürliche Bevölkerungsentwicklung
Die Qual der Wahl
Hunde
Wer wird Milliardär?
Radio
Blumen aus Moskau
Copyright
Aufzeichnungen aus dem Treppenhaus
Statt eines Vorworts: Auszüge aus Leserbriefen
Auch wir hatten russische Nachbarn. Ständig brannteLicht bei denen in der Wohnung, egal ob Tag, ob Nacht,immer hörte man sie singen, kochen oder fluchen, dieFenster waren immer erleuchtet. Tagsüber saßen sie normalerweisezu Hause, nachts torkelten sie die Treppen herunter.»Die Russen schlafen nie«, seufzte mein Vater.
Leser X. aus Geiselkirchen
In Hamburg hatte ich eine Blondine als Nachbarin, ichglaube, es war eine Russin. Einmal saß ich zu Hause undlangweilte mich, da dachte ich, gehe ich doch mal rüberund lade sie auf ein Glas Wein zu mir ein, die Russinnenmüssen doch einen guten Sinn für Humor haben. Ichklopfte an ihre Tür und sagte: »Hören Sie mal, Frau Katjuscha,ich möchte nicht drum herumreden. Ich bin allein,Sie sind allein, kommen Sie doch mit mir mit.« Dazumachte ich eine einladende Geste. Die Russin wurde plötzlichrot. Sie sagte so etwas wie »kren tebe« und knallte dieTür zu, ganz spießig. Zu Hause blätterte ich im Wörterbuch.»Kren« soll auf Russisch Meerrettich heißen.Was dasmit mir zu tun hatte, weiß ich bis heute nicht.
LeserY. aus Buchholz
Der Russe im Erdgeschoß benahm sich eigentlich ganzfreundlich. Jedes Mal wenn ich von der Arbeit nachHause kam, saß er an seinem Fenster und rauchte. Ersagte zu mir stets »Guten Tak!« und »DollerWagen!« Einmalparkte ich wie immer vor dem Haus, ging zur Tür,aber der Mann war nicht da. Nur das Fenster in seinemZimmer stand offen. Ich schaute vorsichtig hinein. Überalllagen Autoreifen aufeinandergestapelt und auf demTisch ein Maschinengewehr.
Leserin T. aus Karlsruhe
In Bremen wohnten unter uns Russen aus Riga. Sie sprachen untereinander Russisch, und eine ihrer Töchter wurde die beste Freundin meiner Mutter und dann auch meine Babysitterin. Ihre Hochzeiten feierten sie auch russisch, d.h. das Essen hatte viele Gänge und nach jedem wurde eine schwarze Zigarette geraucht. Sie schenkten uns irgendwann einen Samowar.
Leser H. aus Bremen
Eines Tages klingelte es an meiner Tür. Es war Sonntag.Draußen stand meine russische Nachbarin, die sagte,dass ihr das Salz ausgegangen sei.
Zumindest ließen sich ihre Gesten und das antiquarischeRussisch-Deutsch-Wörterbuch mit dem Finger aufdemWort »Salz« so deuten. Ich füllte also Salz in ein Glas,genug, um ein mehrgängiges Menü komplett ungenießbarzu machen. Aber meine Nachbarin lachte nur. Ichhatte sie offenbar missverstanden. Also kein Salz? Nein,Moment – Meersalz? Nein, auch falsch. Jetzt aber -alles klar: mehr Salz. Noch mehr? Kein Problem. Ichdrückte ihr meinen kompletten Vorrat in die Hand: eineBüchse bestes jodhaltiges Speisesalz.
Salz verwende ich für Nudelwasser, und noch nie istmir ein Rezept untergekommen, für das man eine ganzePackung davon gebraucht hätte. Meiner Nachbarin offensichtlichschon. Eine Packung war zu wenig. Mit denHänden deutete sie etwas sehr Großes an. Und dann etwasRundes. Dann wieder etwas Großes, das wohl einSack sein sollte. Ein Sack? Ein Sack Salz für etwas Rundes?Für ganz viele runde Sachen? Sie eilte in ihre Wohnungzurück und holte einen Kohlkopf. Und so langsamdämmerte es mir.Weißkohl plus Salz ergibt Sauerkraut.
Ich war stolz auf meine Kombinationsgabe. Anscheinendhatten meine russischen Nachbarn beim Zubereitungsprozessden point of no return erreicht, bevor ihnendie zweitwichtigste Zutat ausgegangen war. Ich ruderteheftig mit den Armen, um mein Bedauern auszudrückenund zeigte meine leeren Hände. Dann deutete ich treppabundtreppaufwärts sowie in alle Himmelsrichtungen, umzu signalisieren, dass wir uns aufteilen sollten, um bei denrestlichen Nachbarn sammeln zu gehen. Es kam so nochein ordentlicher kleiner Salzberg zusammen. Das fertigeSauerkraut konnte ich leider nicht mehr probieren, weilich wenig später ausgezogen bin. Aber ich bin sicher, es istgut geworden.
Leserin A. aus München
Neue Nachbarn
Nachts fing es an zu regnen, die Tropfen trommelten eine Herbstsymphonie auf das neu gedeckte Plastikdach über den Mülltonnen im Hinterhof. Ich saß auf dem Balkon und las Die früheuropäische Geschichte von Le Goff. Gegen 2.00 Uhr klappte ich das dicke Buch zu und machte das Licht in der Wohnung aus. Alles versprach, eine gute, ruhige Nacht zu werden.
Um 5.00 Uhr rissen mich die Katzen aus dem Schlaf, die völlig verstört ihren Urinstinkten folgend über mein Bett sprangen. Dieses merkwürdige Verhalten der Hauskatzen bei Vollmond erklärt sich durch die früheuropäische Geschichte, schoss es mir durch den Kopf. Wir alle waren einmal etwas ganz anderes gewesen und haben uns im Laufe der Jahrhunderten zivilisiert, doch manchmal kommt die Vergangenheit wieder hoch, und wir fallen zurück. Besonders sichtbar ist dieses Phänomen bei Hauskatzen. Tagsüber sind sie zahm und verschlafen, nachts verwandelt sie die Kraft des Mondes in wilde blutrünstige Bestien, die sie früher vermutlich auch waren. Ich verscheuchte die Tiere und legte mich wieder hin.
Um halb acht knallten die ersten Türen im Treppenhaus, die Kinder gingen zur Schule, und um 8.00 Uhr spielte jemand Trompete auf dem Balkon. Ich legte mir mein Kissen auf den Kopf, krümmte mich zusammen, aber nichts half gegen diese verdammten Trompetensoli. Die Melodie schien mir irgendwie bekannt, nur erinnerte ich mich nicht, woher. »Wer ist diese Sau?«, dachte ich im Halbschlaf. Die Oma aus dem dritten hat zwar einen Knall, aber keine Trompete. Der dicke Junge mit der Pfeife aus dem zweiten Stock kam auch nicht in Frage, er konnte unmöglich so gut spielen. Vielleicht der Internetdesigner mit vergipstem Bein aus dem Hinterhofparterre? Dann erinnerte ich mich an das neue Schild auf unserer Gegensprechanlage, das ich am Vortag entdeckt hatte; zwei Namen, die irgendwie russisch klangen. Ein Trompetenspieler mit russischem Doppelnamen? Das hatte uns gerade noch gefehlt. Wann war er nur eingezogen? Sein Umzug musste geräuschlos verlaufen sein, ich hatte weder einen Umzugswagen vor dem Haus gesehen noch Kartonstapel unten im Flur. Ich hatte diesen Musiker noch nie getroffen, ich wusste nicht einmal, in welche Wohnung er eingezogen war. Das Einzige, was ich über ihn wusste: Der Mann spielte um 8.00 Uhr früh Trompete auf dem Balkon. Das war eigentlich zu erwarten gewesen! Aus unerfindlichen Gründen ziehen hauptsächlich Durchgeknallte in unser Haus, keine vernünftigen Bürohengste, keine Angestellten des öffentlichen Dienstes, sondern sonderbare Künstler und Sportler. Über uns wohnt eine Opernsängerin, in der Wohnung gegenüber ein Dartspiel-Weltmeister, im Erdgeschoß mein Hobbytrommler und Technofreak. Der Trompeter war unvermeidlich.
Am Nachmittag machte ich meinen neuen Nachbarn im Treppenhaus ausfindig: ein Jungstudent mit Lederjacke, Rucksack und schwarzem langem Haar. Ich sprach ihn auf das Trompetespielen an, ob er immer nur von 7.00 bis 8.00 Uhr spielen könne. Er sagte »Sdrawstwujte« zu mir. Tatsächlich ein Landsmann! Wir redeten eine halbe Stunde miteinander. Unglaublich aber wahr, es waren gleich zwei Russen in das Haus gezogen. Ab sofort wohnte ich mit einer Russen-WG unter dem selben Dach! Beide um die dreißig Jahre alt. Der eine, Andrej, war erst vor
Die Russen-WG
In den nächsten Tagen und Wochen lernte ich meine neuen Nachbarn besser kennen. Fast jeden Tag hing einer von ihnen bei mir in der Küche, oft ging ich zu den Jungs nach oben. Wir wurden Freunde. Die anderen Bewohner unseres Hauses empfingen die Russen-WG nicht mit Blumen. Vor allem die Rentnerin aus dem vierten Stock und unser Hausmeister zeigten Misstrauen. Bei dieser Bevölkerungsgruppe ist die Fremdenangst am stärksten entwickelt. Grundsätzlich können sie sich mit großen Hunden und frischen Ausländern schwer abfinden. Als ich vor einigen Jahren in dieses Haus einzog, hielt mich der Hausmeister auf dem Hof an und erzählte etwas unvermittelt, auch er habe einmal acht Jahre in Neukölln in »völlig türkischer Umgebung« gewohnt und hätte »mit denen nie ein Problem« gehabt. Was meint er?, grübelte ich. Es war wahrscheinlich als eine Art Warnung gedacht. Danach wollte er wissen, was ich von der »Visa-Affäre« halte. »Die Politiker sollten nicht nur reden, sondern sofort alle Konsulate in Osteuropa schließen und das Land am besten von allen Seiten einmauern«, sagte ich, um den Hausmeister zu provozieren. Er blickte misstrauisch, stimmte mir aber, wenn auch nachdenklich, zu.
Die Visa-Affäre im Jahr 2005 war ein Hammer. Die Angst ging um in Deutschland, einem armen Land, das permanent gefährdet ist und ausgebeutet wird – von Sozialhilfeempfängern, Arbeitslosen, Islamisten, Hasspredigern, Schwarzarbeitern und obendrein auch noch von Millionen ukrainischen Kriminellen und Prostituierten, die mit einwandfreiem Visum nach Deutschland kamen, um hier ihre Untaten zu begehen. »Jahrelang wurden bis zu 2000 Visa pro Tag in Kiew vergeben«, berichteten die Zeitungen. »Wenn das wahr wäre, hätten die Eindringlinge das Land schon längst flächendeckend ausgeraubt«, dachte ich. Doch die meisten glaubten der Berichterstattung.
Deutschland tat sich schon immer schwer mit Ausländern. Auch wenn der Bundestag einstimmig die Bundesrepublik per Gesetz zu einem Einwanderungsland erklärt, wird sich an den Tatsachen, die das Gegenteil beweisen, nichts ändern. Die Ursachen für die Fremdenabwehr bleiben im Dunkeln. Wahrscheinlich hat Deutschland mit seinen Ausländern und seinem Volk einfach Pech, sie wollen und wollen nicht zusammenkommen. Die deutschen Ausländer sind meistens sehr zickig. Sie wollen sich nicht in die deutsche Kultur einweihen lassen, viel lieber bleiben sie unter sich und bilden zu diesem Zweck Cliquen und Ghettos. Sie sitzen den ganzen Tag in ihren Kneipen herum, kucken ihren Fußball und trinken ihr Bier. Sie sprechen auf den Straßen und in den Geschäften laut ihre Fremdsprachen, ohne auf die Einheimischen Rücksicht zu nehmen. Es wirkt demütigend. Diese ständige Fremdsprecherei lässt die Einheimischen argwöhnen, dass die Ausländer vielleicht Böses über sie reden oder, noch schlimmer, ihnen etwas verheimlichen könnten. Daraufhin werden die Einheimischen sauer und meiden ihrerseits die Ausländer. Die Einheimischen bilden eigene Cliquen und Ghettos, wo sie unter sich bleiben, ihren Fußball kucken und ihr Bier trinken. Nur wenige Einzelgänger können über diese Mauer des Misstrauens auf die andere Seite klettern. Ich nenne sie die Helden der Integration.
Zu diesen Menschen gehört zum Beispiel mein neuer Nachbar Andrej aus der Russen-WG im vierten Stock. Er wird nicht müde, sich für alles Deutsche zu interessieren, vor allem für deutsche Frauen und die deutsche Sprache. Er hat sich vorgenommen, das Deutsch-Russische Wörterbuch auswendig zu lernen und ist schon beim Buchstaben »J« angekommen. Das alles ist ihm aber noch nicht genug. »Wir müssen die Sorgen der Einheimischen verstehen können, ihr Leben von innen studieren«, behauptet er. Zu diesem Zweck kuckt er sich seit Monaten alle Staffeln von »Big Brother« an. Seine erste Erkenntnis war, dass die Deutschen selbst ihre Sprache in viel kleinerem Umfang benutzen, als es in dem tausend Seiten dicken Deutsch-Russischen Wörterbuch eigentlich vorgesehen ist. Die Container-Insassen kamen mit gerade mal fünf Sätzen prima klar.
Für Andrej war das ein Zeichen: Er musste sich nicht weiter mit dem dicken Wörterbuch quälen. Auch die moderne deutsche Singkultur reizte ihn sehr, weil sie so lebensfroh klingt und keine besonders ausgeprägten Sprachkenntnisse erfordert. Er kaufte sich auf dem Flohmarkt eine Platte mit dem deutschen Superhit »Wann wird’s mal wieder richtig Sommer«, legte sie in einer Endlosschleife auf, spielte dazu Trompete und terrorisierte damit einen Monat lang das ganze Haus. Die Nachbarn von unten klopften immer wieder mit einem Besen gegen die Decke. Andrej dachte, sie freuen sich, wenn sie ihre Folklore hören. Die Nachbarn beschwerten sich jedoch beim Hausmeister, der bei uns im Haus unter anderem für den Frieden und die Völkerverständigung zuständig ist. Der Hausmeister klingelte daraufhin bei der Russen-WG.
»Ich habe Signale bekommen, dass Sie mit Ihrem Freund nachts laut afrikanische Tanzmusik hören, dazu schreien und im Wohnzimmer herumspringen. Hören Sie auf damit«, sagte der Hausmeister. »Bei uns in Deutschland wird nach 22.00 Uhr nicht mehr getanzt. Hier leben Menschen, die früh aufstehen müssen. Und bringen Sie endlich Ihren Balkon in einen ordentlichen Zustand, im Interesse des Gesamtanblickes der Hausfassade. Wir wollen doch alle Frieden, oder?«
Andrej war erstaunt, dass seine Nachbarn ihre eigene Folklore nicht mochten, fügte sich jedoch. Doch sein Drang zu ständiger Kommunikation mit den Vertretern des Gastlandes war damit auf keinen Fall erloschen. Anders als sein schweigsamer, nachdenklicher Mitbewohner ist Andrej ein Kommunikationstier. Über solche Menschen wird behauptet, dass sie zu sprechen beginnen, noch bevor sie geboren werden. Danach hören sie nicht mehr auf. Auch seine Gastfreundschaft kennt keine Grenzen. Die Russen-WG gleicht einer Falle: Man kommt sehr leicht hinein, aber kaum wieder heraus. Mir ist es ebenfalls noch nicht gelungen, weniger als drei Stunden bei meinen Nachbarn zu verbringen.
»Wladimir«, sagte Andrej neulich zu mir, als wir uns wieder einmal auf der Treppe begegneten, »ich habe in der Zeitung deine Geschichten gelesen. Du musst unbedingt über meine Oma schreiben, sie macht völlig irre Sachen. Komm bitte kurz mit nach oben, das muss ich dir erzählen.«
Erst nach drei Stunden gelang es mir, seine Wohnung wieder zu verlassen. Zwischendurch musste ich meine Frau anrufen, die sich schon Sorgen gemacht hatte, weil ich ja eigentlich nur zum Briefkasten gehen wollte, um die Post abzuholen. In den drei Stunden habe ich alles über Andrejs Oma erfahren sowie über seine anderen zahlreichen Verwandten, die alle Ende der Neunzigerjahre ihre Heimatstadt St. Petersburg verlassen und sich über die ganze Welt verstreut hatten. Andrej erzählte mir tatsächlich interessante Geschichten; die Menschen in seiner Familie schienen alle sehr abenteuerlustig zu sein. Seltsamerweise hatte ich jedoch keine Lust, über seine Oma oder die anderen Familienmitglieder zu schreiben. Ich wollte bloß nach Hause und die Zeitung lesen. Das ging aber nicht. Andrej erzählte und erzählte, ich hörte höflich zu. Nach einer Weile begriff ich, dass er von alleine nie aufhören würde. Aus Höflichkeit verbrachte ich noch eine weitere halbe Stunde in der Küche, dann nutzte ich eine Pinkelpause von ihm, um mich schnell zu verabschieden.
Ich weiß, dass Andrej selten Besuch bekommt. Seine Landsleute kennen ihn und haben einfach keine Lust auf die unendlichen Monologe, und seine einheimischen Nachbarn halten ihn wahrscheinlich für verrückt, weil er sie ständig auf der Treppe anspricht. Mehrmals lud er sie schon zu sich ein, sie blieben aber hart und lehnten alle Einladungen ab. Die ersten Einheimischen, die seine Wohnung betraten, waren die Zeugen Jehovas vor etwa einem Monat: zwei Männer und eine Frau. Sie fragten Andrej freundlich, ob sie nicht reinkommen dürften.
»Wir werden Ihre kostbare Zeit nicht lange in Anspruch nehmen. Wir wollen mit Ihnen nur kurz über Gott und die Welt reden«, sagten sie.
Andrej freute sich riesig. »Das ist aber ein sehr großes Thema, das hat mich immer schon interessiert«, meinte er und zerrte die drei in seine Wohnung. Danach habe ich das Trio nie wieder gesehen. Manchmal hört man komische Geräusche aus der Russen-WG, als würde dort ein Chor singen. Ich habe Grund zur Annahme, dass die Zeugen Jehovas sich noch immer irgendwo in der Wohnung befinden. Zum einen war das im August angekündigte Gesprächsthema tatsächlich sehr umfangreich angelegt.
Der 7. Tibeter
Auf unseren Spaziergängen durch Berlin landeten meine russische Nachbarn, meine Frau Olga und ich einmal zufällig in Kreuzberg. Es war gerade Mittagszeit und Sergej schlug vor, in einem vor kurzem eröffneten Restaurant was zu essen. Das Lokal hieß Der 7.Tibeter, es handelte sich dabei um ein kleines Restaurant mit original tibetischer Küche, und das Personal wirkte ebenfalls original tibetisch. Die Speisekarte war kurz und knapp formuliert, ökologisch bewusst, aber bescheiden, ohne ausgefallene Vorspeisen und Zwischengänge und diesen ganzen überflüssigen Schickschnack. Eigentlich typisch für diese Gegend. Wenn Berlin ein Planet wäre, dann wäre Kreuzberg sein Tibet. Nicht umsonst wird ausgerechnet hier das tibetische Neujahrsfest gefeiert, angeführt von Nina Hagen und anderen Abgespaceten.
Die Speisekarte des 7. Tibeters las sich wie eine Parodie auf die kulinarische Vielfalt. Man hatte mindestens drei Dutzend Gerichte im Angebot, doch das meiste lief auf dasselbe hinaus – auf Teigtaschen. Es gab gedünstete Teigtaschen, gebratene Teigtaschen, Teigtaschen mit Fleisch und Gemüsefüllung, gekocht, frittiert, scharf und weniger scharf, mit und ohne Salat. Dazu Rotwein. Oder zur Abwechslung Weißwein. Meine Frau konnte mit der tibetischen Küche nicht viel anfangen.
»Das sind doch alles Pelmenis, wie sie jede Oma in Sibirien macht«, meinte sie rebellisch. »Das haben diese Bergleute alles den Russen abgekuckt.«
»Was würden Sie uns empfehlen?«, fragte ich die hübsche Kellnerin um Rat.
»Wir haben sehr viele Gerichte«, sagte sie, »aber die meisten Gäste entscheiden sich für Teigtaschen.«
Das wunderte uns überhaupt nicht. Ohne lange zu überlegen, entschieden wir uns wie die anderen Gäste. Sergej nahm die gedünsteten, Andrej die gebratenen Teigtaschen, meine Frau und ich blieben beim Wein. Die Kellnerin notierte gewissenhaft unsere Bestellung auf einem Block, um die Teigtaschen nicht zu verwechseln und verschwand in der Küche. Wir rätselten währenddessen über den geheimnisvollen Namen des Ladens. Der 7.Tibeter, das klang nach einer Geschichte.
»Eine alte Legende«, meinte Sergej. »Ich erinnere mich dunkel daran. Die Blavatskaja und Rerich haben darüber berichtet. Auf dem höchsten Berg Tibets, weit über den Wolken, sitzen seit einer Ewigkeit sechs Weise und warten auf den siebten. Nur gemeinsam können sie den Menschen die Wahrheit und den Sinn des Daseins offenbaren. Jeder von ihnen besitzt einen Teil dieser Wahrheit. Aber einer ist verschwunden – mit dem siebten Tibeter. Im Grunde warten wir alle darauf, dass er zurückkommt.«
»Wo ist er denn hin?«, fragte meine Frau. »Was sagt die Legende?«
»Das weiß ich nicht, ich habe es vergessen«, winkte Sergej ab. »Er ist wahrscheinlich vom Berg gestiegen, um frische Teigtaschen zu holen, hat es aber auf dem Rückweg nicht ausgehalten und unterwegs alle aufgegessen. Daraufhin konnte er sich vor Scham nicht mehr auf dem Gipfel blicken lassen. Denn kaum käme er dort an, würden ihn die anderen sechs fragen: ›Na, wo sind unsere Teigtaschen, du Tibeter?‹«
»Und so wandert er seit einer Ewigkeit durch die Welt und findet nirgends Ruhe, während seine Freunde auf dem Berg verhungern und die Menschheit weiter im Dunkel des Unwissens umherirrt. Und schuld daran sind nur die Teigtaschen«, spannen wir gemeinsam die Geschichte zu Ende.
Der Koch brachte unsere Bestellung persönlich an den Tisch.
»Dürfen wir Sie etwas fragen?«, erkundigte ich mich höflich.
»Natürlich«, nickte er.
»Wer oder was ist der siebte Tibeter? Klären Sie uns bitte auf!«
»Ich bin’s«, sagte der Koch und lachte. »Ich bin der siebte Tibeter, das heißt der siebte Mensch aus Tibet, der hier eine Aufenthaltgenehmigung bekommen hat. Vor mir waren es nur sechs. Es gab zwar noch einen siebten, aber dessen Asylantrag wurde abgelehnt, er kam dann ein Jahr später unter einem anderen Namen wieder. Aber da war er schon der zwölfte. Und ich bin der siebte!«, lächelte der Koch stolz.
Wer ist Deutschland?
Als ich zusammen mit meiner Frau und den Kindern vor drei Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit samt Personalausweis errang, bekamen wir mehrere Merkblätter mit auf den Weg, deren Empfang wir quittieren mussten. Das erste Merkblatt hieß Über den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit. Warum sollen wir sie verlieren, wenn wir sie gerade erst bekommen hatten?, wunderte ich mich. Weil in Deutschland keine doppelte Staatsangehörigkeit geduldet wird. Meine Frau und ich sind aus der Sowjetunion nach Deutschland ausgewandert. Unsere sowjetischen Pässe wurden uns noch von der letzten DDR-Regierung, die uns aufgenommen hatte, entzogen. Wir haben seitdem zwar nie wieder einen russischen Pass angestrebt, waren aber juristisch gesehen russische Bürger geblieben. Deswegen mussten wir, um in Deutschland eingebürgert zu werden, den Austritt aus der russischen Staatsangehörigkeit beantragen, die wir de facto nicht mehr besaßen. Die Botschaft der russischen Föderation sagt den Betroffenen in solchen Fällen, sie sollen »nach Hause fahren« und sich dort an das russische Innenministerium wenden. Die meisten haben jedoch längst kein Zuhause in der alten Heimat mehr. Sie haben ihre Wohnungen verschenkt, verkauft oder an den Staat verloren.
Dabei geht es nicht um Einzelfälle, sondern um Zehntausende. Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht hat natürlich eine Ausnahme für diese Fälle vorgesehen. Diejenigen, die hier als Kontingentflüchtlinge anerkannt wurden, können sich die Mühe sparen, einen Nachweis ihrer Staatenlosigkeit zu erbringen. Sie werden a priori als Staatenlose behandelt und können in Deutschland nach Erfüllung einiger anderer notwendiger Kriterien eingebürgert werden. Dazu bekommen sie das Merkblatt Über den Fortbestand der bisherigen Staatsangehörigkeit. Wenn Sie im Ausland jemals in Schwierigkeiten geraten, sollten Sie sich nicht an die deutschen Behörden wenden, sondern an die Ihres ursprünglichen Heimatlandes.
Sie müssen unterschreiben: »Wenn mir mein Recht auf Wiederausreise verwehrt wird, sind die deutschen Auslandsvertretungen nicht in der Lage, wirksamen deutschen Rechtsschutz zu leisten.« Und so weiter. Sie werden also gleich am ersten Tag als Bürger zweiter Klasse abgetan, der nicht einmal mit dem deutschen Rechtsschutz im Ausland rechnen darf.
Noch schlimmer sind die Kinder dieser unfreiwilligen Doppelbürger dran, denn sie kommen nicht als Kontingentflüchtlinge auf die Welt, sondern als ganz normale Kinder und bekommen deswegen die ursprüngliche Staatsangehörigkeit ihrer Eltern. Selbst wenn die Eltern aufgrund ihres besonderen Status längst Deutsche geworden sind, ihre Kinder sind es deswegen noch lange nicht. Sie werden einem Land zugeschrieben, in dem sie nie gelebt haben. In unserem Fall wurde eine Ausnahme gemacht – wegen meines Bekanntheitsgrades, wie mir unsere nette Sachbearbeiterin im Rathaus erklärte. Deswegen haben meine Kinder die deutschen Pässe bekommen, allerdings unter Vorbehalt, genauer gesagt: nur bis zum Erreichen der Volljährigkeit. Danach werden sie ausgebürgert, wenn sie nicht nachweisen, dass sie keine Esel sind, Entschuldigung, ich meine, dass sie keine andere Staatsangehörigkeit besitzen.