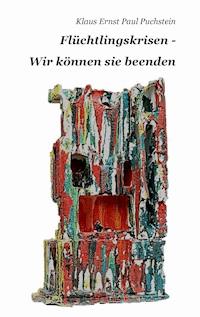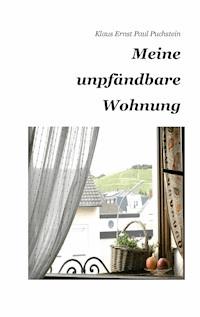
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vom 6. Lebensjahr an wuchs der Autor in einem „unpfändbaren“ Haus auf, das seine Eltern ohne Eigenkapital vom Staat finanziert bekamen. Das war nach dem 2. Weltkrieg 1954 für die Flüchtlingsfamilie die wichtigste Starthilfe. „Die Hälfte der Rentnerinnen und Rentner soll künftig auf Grundsicherung angewiesen sein. Was ist das für ein Armutszeugnis für unsere wohlhabende Gesellschaft?“ fragt er. Von Armut betroffen oder bedroht sind auch Alleinerziehende, Behinderte, geringfügig Beschäftigte, Beschäftigte mit Zeitverträgen, Arbeitslose und alle, bei denen die Wohnkosten über einem Drittel des Nettolohns liegen. Alle wissen, dass wir dringend bezahlbaren, barrierefreien und sicheren Wohnraum lebenslang brauchen. „Wie können wir der Armutsfalle und steigenden Wohnkosten entkommen?“ Diese zentrale Frage für die Gesellschaft und die Behörden beantwortet der Autor mit seiner Forderung nach einem Gesetz für ‚unpfändbare Wohnungen‘ nach dem Muster von 1954.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 52
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort Corinna Rüffer, Mitglied des Bundestages
Was ist falsch gelaufen?
Einige Praxisbeispiele
Die verunsicherte Gesellschaft
Zumindest die Wohnung muss sicher sein
Unsere Häuser und Wohnungen – am langfristigen Bedarf vorbei gebaut
Wohnungen – wie wir sie brauchen
Die sichere Wohnung – unpfändbar
Voraussetzungen für die Unpfändbarkeit
Der Umbau des Hausbestands
Wie müssen die Baugesetze geändert werden?
Der Gewinn für die Gesellschaft
Der Gewinn für die öffentlichen Haushalte
Kalkulation: Neubau oder Sanierung
Die Chancen für ein Gesetz:
Das Recht für jede natürliche Person im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland, den Status Unpfändbarkeit für eine Wohnung zu erhalten.
Unpfändbare Wohnungen für SozialhilfeempfängerInnen?
Mindestgrößen für Wohnungen
14.1. Mindestgröße einer Wohnung für eine/n RentnerIn, in der er/sie bis zum Lebensende bleiben kann
14.2. Mindestgröße einer Wohnung für junge Menschen
Quellen
Register
Danke
Vorwort Corinna Rüffer
Deutschland mangelt es an bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum. Das trifft insbesondere Menschen mit Behinderung, Menschen mit geringem Einkommen oder Rentnerinnen und Rentner. Sie können sich ihre Wohnungen häufig schlicht nicht mehr leisten oder müssen sie verlassen, weil sie nicht barrierefrei sind. Und vielen behinderten Menschen ist es nicht möglich, ihren Wunsch auf ein selbstbestimmtes Leben in einer barrierefreien Wohnung zu verwirklichen.
Klaus Puchstein macht mit seiner Forderung nach einem Gesetz zur „Unpfändbarkeit“ der eigenen Wohnung einen interessanten Vorschlag, diesen Missstand zu beheben. Ihm schwebt vor, dass möglichst viel pfändungsfreier und barrierefreier Wohnraum mithilfe staatlicher Unterstützung geschaffen werden sollte. Dieser Vorschlag ist dazu geeignet, Menschen die Sicherheit zu geben, in den eigenen vier Wänden und in einer barrierefreien Wohnung auch im hohen Alter möglichst selbstständig und in einem vertrauten Umfeld leben zu können. Gleichzeitig profitieren auch behinderte Menschen von den dadurch geschaffenen barrierefreien Wohnungen. Gerade für eine inklusive Gesellschaft ist bezahlbarer barrierefreier Wohnraum unverzichtbar.
Corinna Rüffer MdB
Sprecherin für Behindertenpolitik der Grünen-Bundestagfraktion
.
Was ist falsch gelaufen?
2016 im Frühjahr wird das Dilemma deutlich und die Talkshows greifen das Thema auf:
Bis zu 50% der künftigen AltersgeldbezieherInnen werden in Deutschland staatliche Unterstützung benötigen.
Bei allen Ratsmitgliedern und in allen Kommunen gehen da die Alarmglocken an! Der Sozialetat wird den gestalterischen Spielraum für andere Maßnahmen endgültig abwürgen.
Was ist falsch gelaufen? Haben die Regierungen der letzten Jahre Fehler gemacht? Haben wir alle Fehler gemacht?
Die Erklärungsversuche sind zahlreich und allzu leicht wird die Verantwortung irgendwohin oder zu irgendjemandem geschoben.
Haben wir allzu leichtgläubig die Verantwortung für uns selbst einfach abgegeben? Bei der Politik? Bei der Werbung, die uns Glück beim Konsum verspricht?
Wieso sind wir nicht misstrauischer gegenüber allen Heilsversprechen?
Unser Vertrauen hat in den letzten Jahren nicht nur diesen einen Knacks bekommen. Das spüren die Menschen und besonders auch die Verantwortlichen in den unteren Etagen der Politik: in Gemeinde- und Stadträten, in Kreis- und Landtagen.
Eine Milliardenkrise jagt die nächste. Funktioniert Europa noch oder nicht mehr? Was ist los? Vor allem: wo gibt es noch Sicherheit? Die Sicherheitsfrage rückt absolut in den Vordergrund.
Der Bestand an kleinen bezahlbaren Wohnungen hat einen Tiefpunkt erreicht. Das Leben der Hälfte aller Rentner wird noch unsicherer. Angst vor dem Alter breitet sich in der Bevölkerung aus.
Einige Praxisbeispiele
1. 28.4.2016 In der Talkshow von Maybritt Illner war die Riesterrente das Thema. Heraus kam, dass ein großer Teil der Menschen im Alter nicht genug Geld zur Verfügung haben wird. Je nach Interessenlage machten die Gesprächspartner für die problematische Situation andere Gründe verantwortlich. Alles wurde diskutiert - außer den Lebenshaltungskosten. Der wesentliche Faktor Wohnkosten war dort kein Thema.
Problem:
Man kann versuchen, Renten und kleine Einkommen zu verbessern. Es ist aber sinnlos, wenn die Wohnkostensteigerungen jede Verbesserung wieder auffressen.
Lösung:
Mein Ansatz ist, Wohneigentum für einen erheblich größeren Teil der Bevölkerung zu schaffen, als es bisher der Fall ist. Dies können keine Luxuswohnungen sein, wie es sie in großer Zahl bereits gibt, und von denen zurzeit noch viel mehr gebaut werden.
Wie kann man für breite Teile der Bevölkerung einen Anreiz schaffen, preiswerte Wohnungen in angemessener Größe zu bauen oder bestehende Wohnungen entsprechend umzuwandeln? Können das nur Menschen mit genügend Kapital oder gibt es auch einen Weg für Menschen ohne Eigenkapital und mit geringfügigem Einkommen Wohneigentum in bescheidenem Rahmen anzuschaffen?
2. 1954 zogen meine Eltern mit 3 Kindern und Oma in eine eigene Doppelhaushälfte mit 80 qm Wohnfläche. Das Haus wurde zu 100% fremdfinanziert, weil wir als Flüchtlingsfamilie Wohnraum brauchten. Auch ein Garten zur teilweisen Selbstversorgung war vorhanden.
Die öffentliche Hand finanzierte das Haus über die Lastenausgleichsbank, weil meine Eltern im Krieg einen Betrieb verloren hatten und den wieder aufbauen mussten. Die Lastenausgleichsbank gab es parallel zur KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau, die für Privatleute die Entschädigungen finanzierte.
Die öffentliche Hand misstraute aber den Banken und setzte für das Haus die Richtlinien des Reichsheimstättengesetzes fest. Dieses Gesetz beinhaltete als wesentliches Element die Unpfändbarkeit.
Die Unpfändbarkeit sollte verhindern, dass die Familie das Haus wieder verlor, wenn sie und der Betrieb in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten. Der Staat wollte so doppelte Kosten abwenden und vermeiden, dass er im Falle der Insolvenz des Betriebes auch wieder für Wohnraum für die Familie sorgen musste.
3. In den 90er Jahren berichtete mir ein ehemaliger Kommissar der Abteilung Mord von einem Fall aus seiner Dienstzeit. Ein pensionierter Beamter hatte Suizid begangen. Im Abschiedsbrief beklagte er sich bitter, dass die staatliche Pension nicht ausreichte, weil bei ihm der Pflegefall eingetreten war und er jetzt Sozialhilfeleistungen beantragen musste. Trotz lebenslanger Leistung für den Staat müsse er nun zum Bittsteller werden – das ginge gegen seine Ehre und deswegen scheide er aus dem Leben.
Schon damals war die private Insolvenz im Pflegefall vom Staat als Regel akzeptiert. Eine Absicherung war kaum möglich.
4. Am 31.3.14 meldete dpa
Forscher: Zweierbeziehungen in getrennten Wohnungen halten Jahre
Rostock (dpa) - In getrennten Wohnungen zu leben ist für Partnerschaften weit weniger gefährlich als bisher angenommen. Die Distanz schadet der Liebe nicht unbedingt. Das ergab eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Über einen Zeitraum von drei Jahren hatten mehr als die Hälfte der beobachteten Beziehungen Bestand. Nur rund 15 Prozent der Partnerschaften scheiterten und etwa ein Drittel zog in eine gemeinsame Wohnung. Das ergaben die Analysen des Bundesinstituts bei rund 12 400 Personen.