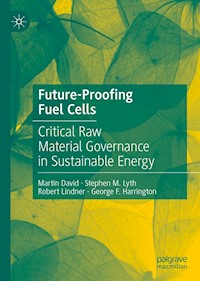Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Einer alten Uhr seines Großvaters ist es zu verdanken, dass der junge, verschüttete Soldat, Thomas, überhaupt ausgegraben und gerettet wurde. Niemand glaubte seiner Mama, Berta, denn sie behauptete, den Verschollenen gäbe es noch. Geboren in Wels, wo er die Volksschule absolvierte. Der Vater erhält eine Berufung nach Leipzig als Komponist. Thomas wurde in der berühmten Thomasschule, an der schon Johann Sebastian Bach Thomaskantor war, aufgenommen. Johann, der Vater, hatte sehr mit den politischen Kräften zu kämpfen, da er sich bis zuletzt gegen eine Mitgliedschaft bei der NSDAP erfolgreich widersetzte. Thomas lernt Klavierspiel und Querflöte, darf sogar im Gewandhausorchester mitspielen. Wird Thomas Altphilologe? Nachdem Leipzig im Dezember 1943 ausbombardiert wurde, muss er zum RAD und dann zur Wehrmacht. Eines Tages kommt er an die Ostfront. Durch ein Wunder überlebt er den Krieg, wendet sich danach nicht nur der Sprache, sondern auch der Musik, als Sprache, die alle Menschen miteinander verbindet, zu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Briefe, Fakten, Anekdoten
Dieses Buch ist meinen Kindern und Enkelkindern gewidmet!
Und allen Menschen die es gerne lesen.
Inhaltsverzeichnis:
Vorwort
Ein Zeichen
Berta
Neue Wege
Neuland
Als Lukas Geige erlernte
Johannapark
Besuch von Anna Maria
Der Eisvogel
Die Regentage
Es kam doch anders
Richtung Osten
Großvaters Uhr
Das Lager
Der Widerstand
Hoffnung
Der lange Weg
Beinahe zuhause
Bertas Vorhersehung
Ankunft
Ein Brief
Wer war Thomas Christian David
Fotos und Briefe
Vorwort
Wir schreiben das Jahr 2025!
Da gibt es Grund zu feiern. Der Komponist und Musiker, Thomas Christian David, würde am 22. Dezember 2025 seinen 100. Geburtstag haben. Ein Hoch auf ihn!
Diese Tatsache gab mir als Sohn Anlass, nach seiner Jugendzeit zu forschen.
Meine Erzählung schildert meines Vaters Jugend und beschreibt die ersten 20 Lebensjahre von 1925 bis 1945.
Grundlage dieses Textes sind eine bunte Mischung aus originalen Briefen, anekdotischen Erzählungen, die er mir selbst übermittelte, Geschichten aus seines Bruders Mund und Geschichten, die von mir selbst hinzugefügt wurden, in der Absicht, die Handlungen zu ergänzen und in einem weiterführenden Bogen erzählen zu können.
Mein Vater starb am 19. Jänner 2006.
Er hatte mir gelegentlich aus seiner Kindheit und Jugend einiges erzählt, über Erlebnisse aus der Schulzeit und im Krieg. Es waren Blitzlichter.
Nun just in seinem 98. Lebensjahr begann ich, mich mit ihm und seiner Jugend von neuem zu beschäftigen. Dabei mehrte sich schrittweise das Bedürfnis, ihm viel mehr Fragen gestellt zu haben, als ich das getan hatte.
Und nun ist es nicht mehr möglich. Es gibt kaum noch Menschen, die ihn so gut kannten, dass sie an seiner statt Antworten geben könnten auf meine speziellen Fragen.
Ich wollte, dass seine Geschichte nicht verloren geht, damit unsere Kinder und Kindeskinder auch noch erfahren können, wer ihr Großvater, Urgroßvater usw. war. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Freund der Musik, den solche Inhalte auch ansprechen.
Ich machte mich auf die Suche.
Im Internet gab es wenig über ihn persönlich und schon gar nichts aus seiner Jugendzeit. Aber über Johann Nepomuk David, seinen Vater, gab es aus der Leipziger Zeit, die Gymnasialzeit meines Vaters bis er dann eingezogen wurde, einiges Brauchbares zu finden. Mit Hilfe von Bernhard Kohl, einem Schüler und Verehrer Johanns, fand ich weitere Bausteine. Eine musikwissenschaftliche Abhandlung über „Das Musikstudium in der NS-Zeit“ von Maren Glotz und ein ausgezeichnetes Buch über „Die Thomaner 1928 bis 1950“ brachten auch noch ergänzende Fakten und Einblicke in das Zeitgeschehen. Es gab noch mehrere Gespräche mit seinem Bruder Lukas, bevor auch er im Oktober 2021 starb.
Erst viel später kam mir in den Sinn, dass es da noch Briefe geben müsse. Und ich fand weit über 100 Briefe und Schreiben aus der Zeit, als Thomas zum Militär musste. Was für eine Fülle an Informationen. Und Fotos gab es ebenfalls. Eine reine, trockene Wiedergabe der Einzelheiten schien mir uninteressant. Was mich interessierte, waren die Menschen:
Wie dachten sie? Was bewegte sie? Was stand für ein Denken hinter ihrem Verhalten. Ich musste mich in sie hineinversetzen. Immerhin kannte ich alle persönlich und kenne viele Erzählungen über sie und direkt von ihnen oder von Verwandten, die sie auch persönlich kannten.
Indem ich mich mit allen Beteiligten des Buches intensiv verband, erlebte ich quasi ein „Gespräch“, eine Begegnung mit ihnen. Ich lernte auf diese Weise alle besser kennen. Sie stehen lebendig vor mir. Es erweiterte mein „Verständnis“ für meinen Vater und für seine Familie.
Und so bin ich direkt froh und dankbar, dass ich diesen Weg gewählt habe, mich mit meinen Vorfahren auseinanderzusetzen.
Vorausgeschickt werden sollen seine eigenen 1984 geschriebenen Worte:
„Das Mitsingen im Leipziger Thomanerchor, die Zeit meiner Aushilfstätigkeit als Flötist in manchen Programmen des Gewandhausorchesters, erste Erfahrungen in der Kammermusik und die starken Eindrücke großer Musiker und großer Persönlichkeiten wie Karl Straube, Theodor Biebrich und meines Flötenlehrers Karl Bartuzat haben ihre Wirkung nicht verfehlt.
Zeitlich davor liegt die Zeit im Elternhaus mit dem Eindruck von Harmonie und Glück der Kindheit, aber auch mit der Selbstverständlichkeit, dass der Mensch erst mit dem Musiker anfängt als solcher diskutabel zu werden.
Ohne Zweifel hat mein Vater meine ganze Jugend von Anfang an aufs entschiedenste beeinflusst und geprägt. Einerseits habe ich bei ihm spielend und nachahmend alle Facetten des musikalischen Handwerks und die dazugehörige Weltanschauung gelernt, andererseits hat er aber auch klargestellt, dass Musik ein edler Teil unseres Lebens sei, dass man aber auch dieses ganze Leben kennen müsse. Mit anderen Worten, er hat einen umfassenden Bildungsanspruch an mich gestellt, und ich bemühe mich noch heute, diesem nachzukommen. Ein russischer Freund, dem ich vor kurzem einiges aus meiner Gefangenschaft erzählte, meinte dazu: „Sie haben wirklich ein romantisches Leben gehabt!“ Ich hatte das bisher nicht so empfunden, muss aber zugeben, dass mein Schicksal von unglaublichem Glück begünstigt war in der Gestalt einiger weniger Personen auf der russischen Seite, die mein Leben retteten, meine Wunden pflegten und schließlich meine recht frühe Heimfahrt ermöglichten. Das wird für mich immer ein Wunder reiner Menschlichkeit bleiben. Die Liebe zu diesen Menschen und zur russischen Sprache ist mir davon geblieben.“
Nun hoffe ich, dass es mir gelungen ist, alle Leser auf eine solche Art anzusprechen, dass sie sich gleichermaßen angeregt und interessiert fühlen, egal ob sie aus der Familie stammen, Interessierte oder Lesefreudige sind.
Einen besonderen Dank möchte ich noch Magda David und Brigitte Födinger aussprechen, die sich die unendliche Mühe gemacht haben, dieses Buch durchzulesen und sprachliche Korrekturen vorzunehmen.
Der Malerin, Angela Sommerhoff, möchte ich noch sehr danken. Sie hat das Titelbild und weitere Bilder der Familienangehörigen großherzig gestiftet. Auch Beatrix Fiala sage ich meinen herzlichsten Dank für die geduldige und aufwendige Vorbereitung des Buches und des Settings für den Verlag, sowie die Ausarbeitung der Fotos und Fotokopien aller Dokumente.
PS:
Zwischenzeitlich wurde mir klar, dass es nicht dabeibleiben könne, nur über die Jugendzeit meines Vaters zu schreiben.
Und so folgt diesem Buch das Buch: Thomas Christian David, Begegnungen, eine Zusammenstellung von Gesprächen und Texten zu seinem künstlerischen Leben von 1945-2006.
Wien, im September 2025, Martin David
Ein Zeichen
Nicht jeder, der in den Krieg geschickt wurde, kam zurück. Entweder erfuhr man, er sei gefallen oder er galt als vermisst. Doch je länger die Zeit ohne Lebenszeichen oder einer Benachrichtigung verging, desto mehr erhärtete sich die Gewissheit, dass man den einen oder anderen geliebten Menschen nicht wieder in die Arme werde schließen können.
Berta, die Mutter von Thomas, hatte so eine Situation schon mit ihrem Bruder, Otto, erlebt, der im Jahre 1916 im ersten Weltkrieg gefallen war. Sie hatte all den Schmerz ihrer Eltern, ihrer Geschwister hautnahe miterlebt. Sie selber war erschüttert und konnte es lange nicht fassen, dass ihr Bruder nie wieder kommen würde.
Jetzt war Thomas, ihr eigener Sohn, verschollen. Schon bald ein Jahr hatte man von ihm nichts mehr gehört. Sie hatten sich gegenseitig so viele Briefe geschrieben. Eines Tags musste er nach Kielce und dann weiter nach Petrikau in den Nordosten, nach Polen. Dann riss der Kontakt plötzlich ab.
„Thomas?“, rief sie mit leiser Stimme. „Thomas!“, etwas lauter. Konnte es sein, dass er sie etwa nicht gehört hatte?
Es kam keine Antwort. „Thomas!“, wiederholte sie eindringlich und winkte mit den Händen ganz aufgeregt. Er sollte sie sehen. Sie, seine Mutter. Seine Mutter, die ihn liebte, die ihn so lange entbehren musste. Endlich. Endlich war er heimgekehrt vom Krieg. Er lebte! Er lebte wirklich, und bewegte sich in der großen Menschenmenge ganz hinten. Berta war kleingewachsen, vielleicht hatte er sie deshalb nicht bemerkt?
„Thomas!“, rief sie nochmals laut, „hier bin ich! Schau her!“, um ihn auf sich aufmerksam zu machen. Hatte er gewinkt? Die Kappe geschwenkt? Aber alle riefen durcheinander. Mütter schrien. Väter schrien, Söhne riefen laut. Und endlich, als man sich gefunden hatte, umarmte man sich herzhaft. Die Tränen liefen. Es weinten gerührt Mütter. Es weinten bewegte Väter. Es weinten die jungen Männer, die ausgehungert, abgemagert und schmutzig aussahen. Aber ihre Augen leuchteten! Ihre Gesichter lachten und strahlten.
„Thomas!“, rief sie nochmals. Aber scheinbar hatte er sie immer noch nicht gehört. Und irgendwie kam er nicht näher, auch wenn sie ihre Schritte beschleunigte, um ihm entgegenzulaufen.
Mal sah sie ihn da! Dann wieder dort. Es war so viel los. Ein unheimliches Getümmel. So viele Menschen strömten aus den Zügen. Die Menschenschlange war endlos. Immerhin dafür, dass die meisten als vermisst galten, waren es unendlich viele, die hier gekommen waren! Und jede Minute fuhr ein anderer Zug ein, mal mit Personenwagen, mal mit Güterwagen. Überall quollen die abgemagerten jungen Männer hervor…
„Thomas!“, sie war verzweifelt. „Das kann doch nicht sein!“ Sie hatte ihn sicher gesehen. Sie war ihm entgegengekommen. Sie beeilte sich. Und doch schien er sich immer weiter von ihr zu entfernen. Ja, er wurde tatsächlich kleiner. Immer seltener sah sie ihn. Weinend brach sie zusammen.
„Hat er mich denn nicht gehört? Hat er mich nicht mehr erkannt?! Mein lieber, mein guter Thomas!“ Die Tränen rannen ihr die Wangen herunter. Heftig musste sie schluchzen. Dann verlor sie ihn aus dem Blickfeld. Ein unsäglicher Schmerz packte sie. Sie wollte schreien. Sie wollte brüllen, gegen den unbarmherzigen Himmel aufbegehren. Dann sah sie ihn plötzlich deutlich aber fern noch einmal winken. Er rief ihr etwas zu. Es war tonlos und so konnte sie nichts hören….
Sie schluchzte. Langsam fühlte sie ihren schweren, ans Bett haftenden Körper. Wo war sie? Sie erwachte.
Eine Weile hing sie dem Traum noch nach und spürte diesen unsagbaren Schmerz, den sie von anderswoher genau kannte: nämlich, wie es ist, ein Kind zu verlieren, einen Bruder zu verlieren. Das Herz pochte ihr heftig und schnell in der Brust. Schweißperlen spürte sie kühl über die Stirne, über die Wangen hinunterkullern.
Diese Ohnmacht! Es einfach geschehen lassen müssen. Nur hilflos zusehen können. Nichts tun können. Wie oft hatte sie diesen unsagbaren Schmerz bereits durchgemacht? Dann fasste sie sich. Und sie wusste: „Es war ein Zeichen! Es war das Zeichen, dass er kommen wird. „Ich weiß es, er wird kommen!“, dachte sie. Dann lag sie noch eine Weile im Bett, das angenehm warm war und fasste ihre Gedanken. Allmählich beruhigte sich ihr Herz.
Wieder sollte ein neuer Tag in Gmunden anbrechen, an dem sie sich um Lukas kümmerte und den Haushalt erledigte. Ein Tag, der voller Gedanken, voller Sehnsucht nach dem Erstgeborenen steckte. Voller Gefühle und Kummer, denen sie sich selbst überlassen war, die sie behutsam zur Seite schieben musste, denn es war ja noch einer da. Lukas, der kleine Bruder, eine Sonne, eine Wonne, ein süßer Lausbub. Ohne ihn hätte sie wahrscheinlich nicht durchgehalten. Er, obwohl er ihre Fürsorge brauchte und bekam, war in Wahrheit ihre Stütze.
Berta
Eines freitags saß Berta am Nachmittag im kleinen Wohnzimmer mit der Nadel in der Hand und dem weißen Hemd ihres Mannes, das sie noch vor dem Sonntagsgottesdienst da und dort reparieren musste. Sei es, dass ein Knopf schon baumelte und abzustürzen drohte, sei es, dass sich eine Naht unter der Achsel löste. Um sich ein neues zu kaufen, dafür reichte nicht das Geld, das ein evangelischer Pastor verdiente.
Mit den Gedanken war sie ganz woanders, nicht bei dem Stück weißen Stoffs, das sie in Händen hielt, nicht bei ihrem Mann. In den Gedanken saß sie am Klavier und spielte Bach. Bachs Musik liebte sie. Diese war so heilsam und friedlich und trotzdem machte sie wach. Ja, es gehörte eine ganz schöne Portion Aufmerksamkeit dazu, um bei den vielstimmigen, polyphonen Kompositionen nicht aus dem Takt zu kommen und sich zu verspielen.
Bach ging ihr durch den Kopf. Sie dachte an ihre Geschwister und deren Familien.
Da stach sie sich plötzlich mit der Nadel. Um Gottes Willen, Blut! Warum blutete man an den Fingerbeeren so leicht und so stark? Es darf nur ja kein Blutstropfen auf den sauberen, weißen Stoff kommen. Schnell steckte sie den Finger in den Mund. Es dauerte. Es dauerte viel zu lange. Beim Klavierspiel wäre das nicht passiert. Aber sie riss sich zusammen und machte weiter, als der Finger zwar nicht mehr blutete aber immer noch schmerzte.
Warum der Stoff auch so zäh sein musste. Man brachte eine dünne Nadel kaum durch. Aber mit einer dicken würde man viele kleine Löcher hinterlassen, und das sieht auch nichts gleich. Da entdeckte sie noch ein kleines Löchlein, vermutlich von einer Motte gefressen. Auch das noch.
Das Stopfen, wenn es schön aussehen sollte, war sehr aufwendig. Aber Johann Sebastian half ihr. Seine Klänge feuerten sie an durchzuhalten. Es sollte ja heute noch fertig werden. Morgen brauchte er, der Pastor, es, natürlich sauber und perfekt zu seiner Predigt.
Als sie sich zum zweiten Mal stach, wäre ihr fast ein Fluch über die Lippen gekommen. Wieder warten. Und diese Schmerzen. „Ich brauche meine Finger doch! Wenn ich nicht mehr spielen könnte, würde ich in dieser Öde umkommen.“ So ging es ihr durch den Kopf. Und sie hatte Mühe, Johann Sebastian wieder einzuladen, weiter in ihrem Kopf zu erklingen und zu strahlen. Wenn sie Bach nicht gehabt hätte!
Einsam war sie hier. Der Herr Pastor, Johann Jungreithmaier, ihr Mann, war zwar ein lieber Mensch. Nein, es war ganz und gar nicht so, dass sie nicht miteinander redeten. Aber die Gespräche mündeten meist schnell in all den Texten, die er in Predigten umwandeln wollte. Berta sollte sie anhören, Stellung dazu nehmen und ihm damit verhelfen, sein Predigen mehr und mehr zu vervollkommnen. Ja, er hörte ihr schon zu. Er ließ sie ihre Gedanken ausbreiten. Aber er ging nicht drauf ein, sondern machte geschickt einen Bogen und leitete geschickt zu dem über, von dem er gerne etwas von der Kanzel gesprochen hätte.
Da stach sie sich zum dritten Mal. Es schmerzte so heftig. Nur mit Mühe zog sie die Hand zurück und schmiss gleichzeitig das Hemd auf den Tisch, damit es nicht rote Flecken bekäme. Vom Finger tropfte es heftig auf den Boden. Die Tränen standen ihr in den Augen. Bach war verstummt, war fort. Aber der Kummer, den sie litt, der war ungebremst da. „Was nützen denn all die wunderbaren Predigten?“, dachte sie, „was helfen die Gottesdienste, was gibt das Klavierspiel her?“
Sie wollte einen Menschen, mit dem sie sich austauschen konnte, der auf ihre Ideen einging. Und sicher, eine Familie, wie sie etwa ihre Geschwister hatten, wäre auch ganz fein gewesen. Sie wollte liebe kleine Kinder. Sie wollte Mutter sein. Und sie spürte es genau: sie konnte eine sehr gute Mutter werden, vielleicht sogar die Beste! Aber sie hatte nicht das Gefühl, dass sie in diesem Punkt verstanden worden wäre. Wenn sie Klavier spielte, hörte er ihr bewundernd zu und lobte sie. Gewiss, das tat gut. Aber reichte das? Reichte das, um Familie zu sein, er hinter der Kanzel, sie hinter dem Klavier?
So konnte es nicht weitergehen! Es musste was geschehen! Ja, sie waren verheiratet. Und das hatte schon Bedeutung. Berta war gewissenhaft und gläubig. Der Bund der Ehe, der kann doch nicht einfach so aufgelöst werden?! Und überhaupt das in den Tagen nach dem ersten Weltkrieg. Sollte man da nicht froh sein, wenigstens irgendeinen anständigen Mann mit Beruf an seiner Seite zu haben, der einen ehrte, der einen schätzte?
Berta schluchzte ganz heftig. Es schüttelte sie durch und durch. „Wie soll es weitergehen?“, fragte sie sich. „Das macht doch keinen Sinn, hat keine Zukunft.“ So quälte sie sich in den Abend. Das Hemd war fertig. Es war perfekt. Noch nie hatte sie die Löcher so „unsichtbar“ verschlossen.
Als Johann, der Pastor, heimkam, bat sie ihn nach kurzem Austausch über seinen Arbeitstag um ein Gespräch, um ihn auf ihre Beziehung anzusprechen. Ihr Wunsch war, eine echte Begegnung zwischen ihnen zustande zu bringen. Und es gelang ihr plötzlich. Er hatte wohl verstanden, dass es ihr nun sehr ernst war und hörte zu, unterbrach nicht, ging auf sie ein. So war er noch nie ihr gegenüber gewesen. Er erkannte, dass sie völlig unterschiedliche Lebensziele hätten. Und er verstand, dass er nicht erwarten konnte, dass sie ein ganzes Leben lang an seiner Seite verbringen könne und sich selber dabei komplett negierte.
Berta hatte ja schon mit 14 Jahren ihren Kopf durchgesetzt und war aus der Katholischen Kirche ausgetreten. Man stelle sich das vor, noch in Zeiten der Monarchie, 1912, war sie als Jugendliche ausgetreten. Berta war tiefgläubig und von einer göttlichen Welt überzeugt. Aber wie es in der Kirche praktiziert wurde und wie engstirnig es gedacht wurde, das gefiel ihr gar nicht. Jetzt hatte sie Johann, den Pastor, der die Dinge anders sah und anders lebte. Und trotzdem fehlte ihr etwas an ihm. Es fehlte ihr etwas an Spiritualität, an Lebendigkeit, wie sie es später bei der alten griechischen Kultur und ihrer Mythologie finden konnte. Aber all das sollte eben in einem christlichen Sinne gelebt und gedacht werden.
Johann hatte erkannt, dass er wohl dem anderen Johann (Sebastian Bach) nicht das Wasser reichen konnte, mit dem sich Berta ständig befasste. So sagte er nach einer Schweigepause fast wie erleichtert, dass es wohl das Beste wäre, wenn jeder von ihnen seinen eigenen Weg ginge. Sie sollten sich im Einvernehmen lösen. Es gäbe keinen Schuldigen. Niemand hätte dem anderen etwas vorzuwerfen. „Auch das hätte Gott wohl so gewollt.“, sagte er und fühlte sich dabei aber förmlich erschlagen.
Danach folgte noch eine sehr lange Aussprache bis in die frühen Morgenstunden in einem wertschätzenden und versöhnlichen Ton. Berta war sehr erleichtert und entschuldigte sich dafür mehrfach, dass sie einem Pastor mit ihrem Eigenwillen solche Unannehmlichkeiten bereiten würde. Und es wäre ihr der Gedanke sehr unangenehm, was die Leute, denn nicht fortan alles zu tratschen hätten. Aber er lachte nur und meinte: „Lass sie nur reden, die Leute. Welchen Wert hat das schon gegen das Wort Christi. Wie heißt es so schön? Wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen!“ Und dann ergänzte er noch, dass er sie nur gehindert hätte, ein Leben lang und dass das auch nicht christlich sei.
So kam es bereits nach 6 Monaten Ehe zur Scheidung.
Neue Wege
Berta war eine selbstbewusste Frau mit Charakter. Wenn sie etwas wollte, so setzte sie es durch auch gegen Widerstände. Was man in der Familie dazu sagte, interessierte sie gar nicht. Und es schmälerte auch nicht ihr Selbstbewusstsein, im Gegenteil, es hob dieses, dass sie sich aus eigenen Kräften von dem Pastor getrennt hatte.
Sie suchte. Sie wusste es, und sie wusste es auch nicht so genau, was es war, was sie finden wollte. Sie interessierte sich für die Welt, für die Musik und für alles Religiöse. Das aber weniger im traditionell kirchlichen Sinne, sondern viel mehr in einem pantheistischen, goetheschen und in einem spirituellen Sinne.
Bei Bach z.B. konnte sie in seiner Musik etwas von dem Religiös-Spirituellen erleben. Hier wurde nicht oberflächlich von Religion oder von Gott gesprochen. Hier lebte in jedem Ton, und strahlte in jeder Phrase unausgesprochen etwas von einer höheren Welt. Darum liebte sie ihren Johann Sebastian so sehr. Sie studierte fleißig Klavier. Sie liebte Musik. Sie liebte aber auch den Ernst des Lebens und überdies hätte sie auch gerne eine Familie gehabt.
Da stieß sie eines Sonntags auf den Organisten und Komponisten Johann Nepomuk David.
Es war gar nicht so einfach ihn kennen zu lernen. Er war ein stiller, unnahbarer Mensch. Er beschäftigte sich intensiv mit Musik, komponierte sogar selbst. Als er einmal Bach gespielt hatte, ging sie zur Orgel hinauf und versuchte ein Gespräch zu beginnen. Wer hätte es zu wagen gehofft, es kam in Gang.
Berta blieb dran. Dieser Mensch interessierte sie. Von dem und über den wollte sie mehr wissen. Auch fragte sie einmal, ob sie auf der Orgel zu spielen versuchen dürfe, denn sie könne ja Klavier spielen. Nach dem Versuch musste sie selber recht lachen und meinte, dass sie wohl lieber beim Klavier bliebe. Aber nicht nur die Musik wurde zum Gesprächsthema. Es folgten nach der Kirche Spaziergänge, die immer länger wurden. Johann liebte zu gehen.
Da merkte sie, dass er echten Tiefgang hatte. Ihn interessierte auch alles Humanistische und Religiöse. Das Religiöse betrachtete er sehr allgemein und nicht allein auf eine Kirche beschränkt. Für ihn war die Kunst das wahre Medium, sich einer göttlichen Welt zu nähern. Darum spielte er so gerne zu den Gottesdiensten. Was Tradition und Kirchen machten, war ihm zu eng oder auch zu wenig. Die Kunst war für ihn der Schlüssel zu allem, auch zum Leben.
Nun hatte sie in ihm einen Menschen gefunden, der sie nicht nur ansprach und sich für vieles interessierte, er hatte ebenfalls den Wunsch nach Familie. Berta und Johann, ihr dritter Johann -ob das Zufall war? - fanden zueinander und beschlossen, im Winter 1924 in Wels zu heiraten.
Berta wäre gerne Pianistin geworden, eine, die in Konzerten auftrat und vor applaudierendem Publikum sich tief verneigte. Aber die Zeiten nach dem ersten Weltkrieg waren nicht einfach. Vieles war zerstört. Das Land war arm. Ein Aufschwung war so bald nicht in Sicht. Dankenswerterweise war zunächst für den Alltag gesorgt, denn sie hatte ein Ziegelwerk als Mitgift bekommen, von dessen Gewinn sie abschöpfen konnten.
Und es musste der Hausstand eingerichtet werden. Und erfreulicherweise kündigte sich bald ein Kind an.
Ein gutes Jahr nach der Hochzeit ging ihr Wusch nach Familie in Erfüllung. Berta war überglücklich, dass nun auch sie endlich Mutter werden durfte. Eine Aufgabe, der sie mit großer Freude und Erwartung entgegensah.
Da kam mitten im verschneiten Winter zwei Tage vor Weihnachten 1925 ihr erster Sohn Thomas zu Welt. Er war ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk! Berta war sehr glücklich, einen kleinen süßen und gesunden Sohn zu haben. Endlich war ihr heißersehnter Wunsch nach Familie, nach Kindern in Erfüllung gegangen. Der kleine Bursch sah gut aus und er saugte fest an der Brust und nahm bald zu.
Auch wenn eine Geburt für eine Frau alles andere als angenehm ist und man sich danach ziemlich erschlagen und hilflos fühlt, freute sich Berta am Gedeihen des kleinen Thomas so sehr, dass sie auch für sich neue Kräfte schöpfen und sich bald wieder im Alltag gut einbringen konnte.
Also sollten nach ihrem und Johanns Wunsch noch viele Kinder nachfolgen, wie es bei den Davids und Eybls üblich war. Johann z.B. hatte 11 Geschwister. Sie hatte fünf Geschwister, von denen bereits zwei verstorben waren.
Johann, der Musik studiert hatte und komponierte, verdingte ihren gemeinsamen Unterhalt als Volksschullehrer. Außerdem spielte er Orgel in verschiedenen Kirchen und gründete 1926 den Bach-Chor in Wels. Er war eher ein Mensch, der viel nachdachte über Gott und die Welt und seine Musik. Er verschwendete keine unnötigen Worte und war es nicht gewohnt, Zwischenmenschliches zu besprechen. Das soziale Leben musste einfach funktionieren, ohne viele Besprechungen und aus seiner Sicht unnötige Absprachen.
Berta hätte ein wenig mehr persönlichen Austausch gerne gehabt, war aber dann mit dem, wie es war, zufrieden. Es gab ja viele schöne Gespräche weiterhin über Kunst und Religion. Da würden sich die Inhalte nicht so schnell erschöpfen. Und sie liebte ihren Johann so sehr, dass sie gerne bereit war, das Alltägliche zu übernehmen, um den Künstler für sein Schaffen freizuspielen.
Und Thomas machte ihr große Freude. Er konnte so lieb lachen und begann früh zu brabbeln und plaudern, als wollte er sich so bald als möglich an den Gesprächen der Eltern beteiligen und natürlich auch Mamas Gedanken und Empfindungen anhören.
Die Chorarbeit machte Johann Freude. Hier konnte er im Einstudieren und Dirigieren Erfahrung sammeln. Genauigkeit und Pünktlichkeit waren seine oberste Maxime. Das bezog er nicht allein auf die Musik, die ja nur funktionieren konnte, die nur wundervoll erklingen konnte, wenn sie absolut genau wiedergegeben wurde. Die Genauigkeit bezog er auch auf das Zusammenleben.
So soll es angeblich nicht einmal vorgekommen sein, dass eine Probe nicht stattfand, weil die Sänger nicht zum vereinbarten Termin pünktlich da waren. Um Punkt ging es mit dem Arbeiten los. Man kam nicht erst um Punkt herein und wechselte ein Wort mit dem Nachbarn. In so einem Fall hatte er verärgert die angesetzte Probe verlassen und abgebrochen. Wer sich jedoch auf seine unerbittliche Genauigkeit einließ, konnte an wunderbaren und reinen Klängen mitwirken und auf diese Weise seine Freude erleben.
Zu den Gottesdiensten spielte er gerne Orgel. Er erforschte immer weiter und umfassender dieses einzigartige Instrument, für welches er eine Vielzahl an eigenen Kompositionen hervorbrachte. Diese Variabilität an Klängen und Tönen der Orgel faszinierte ihn.
Neben den Alltagsverrichtungen und der liebevollen Zuwendung zu Thomas pflegte Berta stets das Klavierspiel, vor allem dann, wenn Johann aus dem Haus war und somit nicht gestört werden konnte. Für sie war es Seelennahrung, es erfüllte sie, es versöhnte sie mit ihrem Leben, das sie für die Kunst Johanns hingab.
Diese Art von Unterhaltung liebte Thomas ganz besonders und er lauschte schon als Kleinkind gerne den Klängen bachscher, klassischer oder romantischer Musik. Am liebsten lag er unbemerkt unter dem Klavier und sog die Musik in sich auf. Für ihn war es so, als befände er sich mitten im Musikhimmel. Das mit den Geschwistern sollte leider nicht so wie bei Thomas in Erfüllung gehen. Berta wurde zwar immer wieder schwanger, die kleinen eingeladenen Gäste jedoch verabschiedeten sich nach einiger Zeit voreilig. Es brach ihr jedes Mal das Herz. Es war ihr völlig unverständlich, wieso gerade sie immer wieder Kinder verlor. Sie war jung, gesund und ernährte sich gut. Wieso sollte es nicht klappen? Wieso hatte gerade sie so ein Schicksal zu ertragen?
Johann konnte nur wenig dazu beitragen, den Schmerz und die Enttäuschung, ja manchmal die Verzweiflung seiner Frau aufzufangen oder zu lindern. Auch wenn er sie sehr schätzte und liebte, blieb er ein weitgehend Verschlossener, fühlte aber im Stillen ebenfalls einen großen Kummer. Nur war er nicht imstande, sie darauf anzusprechen, sondern setzte solche heftigen inneren Bewegungen, oft als treibende Kraft, in neue Kompositionen um.
Damit wuchs Thomas praktisch als Einzelkind auf und war der Liebling seiner Eltern. Und jedes Mal, wenn sie wieder ein Kind verloren hatte, war sie umso dankbarer, den kleinen und gesunden Thomas haben zu dürfen, ihr „Ein und Alles“! Ein aufgewecktes und interessiertes Kind, an dessen Dasein sie sich herzlich erfreuen konnte.
Als er etwas älter war, durfte er seinen Vater beim Geigen-, oder Orgelspiel begleiten, wenn dieser zu Messen spielte. Und bald fing er selber an, die ersten Töne auf dem Klavier zu spielen.
In beiden Eltern hatte er gute Musiklehrer und begann schon vor der Schule zu üben. Er war ja sehr begabt und konnte bereits lesen und schreiben, ehe die Schule los ging. So lief die Volksschule für ihn eher nebenher und die Beschäftigung mit Musik oder das Lesen zogen all sein Interesse an.
Der Vater hatte eine herrliche Bibliothek mit allerlei Literatur und Noten. Bloß, dass es im Arbeitszimmer schrecklich nach Zigarettenrauch roch. Er rauchte oft so stark, dass Thomas beim Betreten, wenn er ihm einen Kaffee bringen sollte, ihn kaum entdeckte. Diesen Beigeschmack musste man in Kauf nehmen, wollte man in den Büchern des Vaters schmökern. So etwas durfte natürlich nur dann geschehen, wenn der Vater nicht dort arbeitete oder wenn er ausdrücklich darum gebeten worden war.
Die Unbeschwertheit im wirtschaftlichen Alltag dauerte nur vier Jahre an. Das Ziegelwerk verlor in der Weltwirtschaftskrise 1929 seinen gesamten Wert. Und damit war die wichtigste unabhängige Einkommensquelle versiegt.
Johann hoffte auf eine gute Gelegenheit, Wels so bald wie möglich verlassen zu können. Er wünschte sich, in eine größere Stadt mit mehr Kultur- und