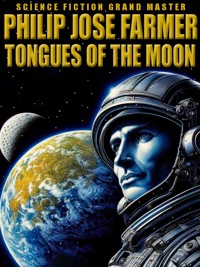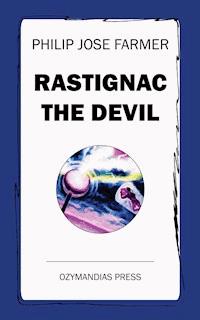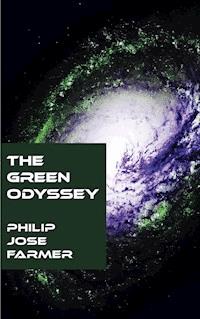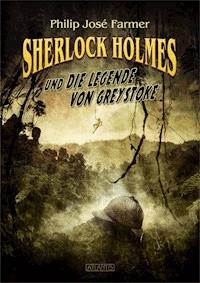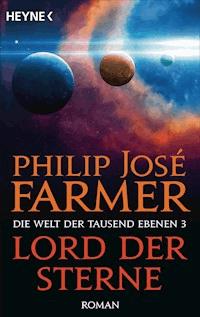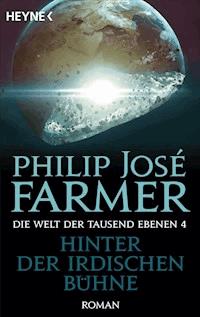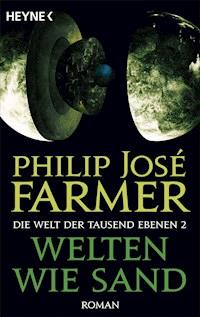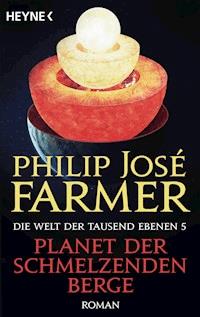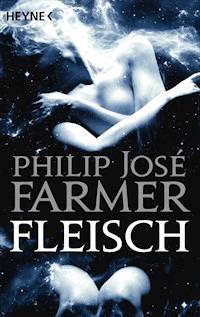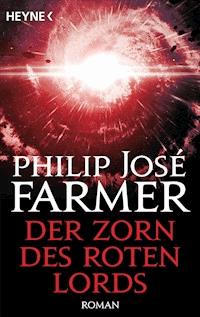3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Welt der tausend Ebenen
- Sprache: Deutsch
Portal in eine andere Welt
Robert Wolff, pensionierter Universitätsprofessor, hat sich schon lange damit abgefunden, dass sein Lebensabend sehr, sehr ruhig zu werden verspricht. Doch dann besichtigt er mit seiner Frau ein Haus und findet im Keller ein seltsames Horn, das er einsteckt. Als es ihm gelingt, tatsächlich einen Ton damit zu erzeugen, öffnet sich ein Portal durch Raum und Zeit. Wolff findet sich in der Welt der Tausend Ebenen wieder, einem künstlichen Planeten, erschaffen und kontrolliert von Lord Jadawin, dem Meister der Dimensionen. Als dieser auf den Fremden aufmerksam wird, beginnt für Wolff ein gefährliches Abenteuer quer durch alle Ebenen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
PHILIP JOSÉ FARMER
MEISTER DER DIMENSIONEN
Die Welt der tausend Ebenen Band 1
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Robert Wolff, pensionierter Universitätsprofessor, hat sich schon lange damit abgefunden, dass sein Lebensabend sehr, sehr ruhig zu werden verspricht. Doch dann besichtigt er mit seiner Frau ein Haus und findet im Keller ein seltsames Horn, das er einsteckt. Als es ihm gelingt, tatsächlich einen Ton damit zu erzeugen, öffnet sich ein Portal durch Raum und Zeit. Wolff findet sich in der Welt der Tausend Ebenen wieder, einem künstlichen Planeten, erschaffen und kontrolliert von Lord Jadawin, dem Meister der Dimensionen. Als dieser auf den Fremden aufmerksam wird, beginnt für Wolff ein gefährliches Abenteuer quer durch alle Ebenen …
Der Autor
Philip José Farmer wurde am 26. Januar 1918 in North Terre Haute, Indiana, geboren. Die Familie siedelte nach Illinois über, wo Philips Vater einen kleinen Betrieb hatte. Als dieser Mitte der 1930er Jahre pleiteging, musste Philip sein Collegestudium abbrechen und seine Familie mit allerhand Jobs finanziell unterstützen. Er studierte später neben dem Beruf und machte 1950 seinen Bachelor of Arts in Englisch. Danach arbeitete er als technischer Journalist für verschiedene Unternehmen, ehe er 1952 mit seiner Erzählung »Die Liebenden« schlagartig berühmt wurde. Die Story, die mit dem Hugo Award ausgezeichnet wurde, war zuvor von renommierten SF-Magazinen abgelehnt worden, weil sie von einer sexuellen Beziehung zwischen einem Menschen und einem Alien handelt, was im prüden Amerika der 1950er Jahre für einen Skandal sorgte. Mit Romanen wie »Fleisch« festigte Farmer sein Image als Tabubrecher; Reihen wie der Flusswelt-Zyklus, für die er seinen zweiten Hugo Award gewann, oder die »Welt der tausend Ebenen«-Saga befassen sich mit neomythologischen Themen. Philip José Farmer starb am 25. Februar 2009 in seinem Heim in Peoria, Illinois.
Eine Übersicht aller im Heyne Verlag lieferbaren Romane von Philip José Farmer finden Sie am Ende des Buches.
www.diezukunft.de
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Titel der Originalausgabe
The Maker of Universes
Aus dem Amerikanischen von Martin Baresch
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 1965 by Ace Books, Inc.
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Das Illustrat, München
Satz: Winfried Brand
ISBN 978-3-641-20270-5V003
Erstes Kapitel
Der Hauch eines Trompetensignales kam wehklagend von der anderen Seite der Türen herüber. Die sieben Töne waren seltsam kraftlos und weit entfernt, dem Umriss eines silbernen Phantoms gleich – wenn Schall überhaupt der Stoff sein konnte, aus dem Schatten gemacht sind.
Robert Wolff wusste, dass kein Horn – oder ein Mensch, der es blies – hinter einer der Gleittüren sein konnte. Vor einer Minute erst hatte er in den angrenzenden Raum geschaut. Dort war nichts außer einem zementierten Fußboden, weißgetünchten Wänden, einer Kleiderstange, Haken, einem Regal und einer Glühbirne zu sehen gewesen.
Und doch hatte er die Trompete gehört; schwach, als würde sie hinter einem Wall, der die Welt umschloss, geblasen …
Er war allein. Niemand konnte ihm also sagen, ob das, was er gehört hatte, real gewesen war oder nicht. Der Raum, in dessen Eingang er stand, war eigentlich nicht prädestiniert dafür, solch ein gespenstisches Ereignis hervorzurufen. Aber vielleicht war er, Robert Wolff, dafür prädestiniert … Kürzlich hatten ihn unheimliche Alpträume gequält. Und während des Tages waren seltsame Gedanken und fragmentarische Bilder in seiner Erinnerung materialisiert, rasch, lebhaft – und sogar erschreckend. Sie waren unerwünscht, er hatte sie nicht erwartet und konnte ihnen nichts entgegensetzen.
Er war besorgt. Er hatte vor, sich aus dem Erwerbsleben zurückzuziehen, wollte sich zur Ruhe setzen, und es erschien ihm ungerecht, ausgerechnet jetzt einen mentalen Zusammenbruch zu erleiden. Wie auch immer – es konnte ihm natürlich passieren, wie es anderen vor ihm schon passiert war. Er musste sich von einem Arzt untersuchen lassen, das war klar. Und doch konnte er nicht so handeln, wie sein Verstand es erforderte. Er hatte sich abwartend verhalten und mit keinem Menschen darüber gesprochen. Mit seiner Frau schon gar nicht.
Und jetzt stand er im Aufenthaltsraum eines neuen Hauses in der Hohokam-Wohnanlage und starrte auf die geschlossenen Türen. Wenn das Horn erneut ertönen sollte, würde er eine Tür beiseite schieben und sich davon überzeugen, dass da tatsächlich nichts und niemand war … Und dann, wenn er wusste, dass sein kranker Verstand sich alles nur einbildete, würde er nicht mehr daran denken, dieses Haus zu kaufen. Er würde den hysterischen Protest seiner Frau überhören und zuerst einen Arzt und dann einen Psychotherapeuten aufsuchen.
In diesem Augenblick brachte sich seine Frau in Erinnerung. »Robert!«, rief sie. »Bist du nicht lange genug dort unten gewesen? Komm endlich herauf! Ich möchte mit dir und Mr. Bresson reden!«
»Einen Moment noch, Liebling«, erwiderte er.
Aber sie rief wieder – so energisch dieses Mal, dass er sich umwandte.
Brenda Wolff stand am oberen Ende der Treppe, die in den Aufenthaltsraum hinunterführte. Sie war so alt wie er, Sechsundsechzig, und ihre einstige Schönheit lag nun unter Fett, zu vielem Make-up und überpuderten Falten, einer mächtigen Brille und stahlblauem Haar begraben. Wolff zuckte bei ihrem Anblick zusammen. Er tat dies auch, wenn er in den Spiegel blickte und seinen eigenen kahlen Schädel, die tiefen Furchen, die sich von seiner Nase zum Mund zogen, die welke Haut und die geröteten Augen sah.
War dies sein Problem? War er nicht fähig, sich mit dem Unabänderlichen abzufinden? Jeder Mensch alterte – ob er nun wollte oder nicht …
Oder war das, was ihm an seiner Frau und sich selbst nicht gefiel, weniger der physische Verfall, sondern das Wissen, dass weder er noch Brenda ihre Jugendträume verwirklicht hatten? Es gab keine Möglichkeit, zu verhindern, dass die Zeit ihre Spuren in das Fleisch einbrannte.
Eigentlich gab es keinen Grund für ihn, sich zu beklagen. Die Zeit hatte es gut gemeint mit ihm. Er hatte ein hohes Alter erreicht. Er konnte nicht darauf plädieren, zu wenig Zeit gehabt zu haben, um seine Psyche entsprechend zu formen. Die Welt konnte nicht dafür verantwortlich gemacht werden, weil er, Robert Wolff, er selbst war. Er allein war verantwortlich. Wenigstens war er stark genug, um dies zu erkennen und zu akzeptieren. Er machte nicht das Universum dafür verantwortlich. Im Gegensatz zu seiner Frau Brenda zeterte, schimpfte und jammerte er nicht. Dabei hatte es Zeiten gegeben, in denen es leicht gewesen wäre, zu jammern oder zu weinen. Wie viele Menschen mochte es schon geben, die sich an nichts erinnerten, was vor ihrem zwanzigsten Lebensjahr gewesen war? – Er glaubte wenigstens, dass diese magische Grenze des Sich-nicht-erinnern-Könnens sein zwanzigstes Lebensjahr war, da die Wolffs, als sie ihn adoptierten, der Meinung waren, er sähe aus wie ein Zwanzigjähriger.
Er war in den Hügeln von Kentucky, nahe der Grenze von Indiana, umhergeirrt. Der alte Wolff hatte ihn schließlich dort gefunden. Er selbst hatte damals weder gewusst, wer er war, noch, wo er herkam. Kentucky und selbst die Vereinigten Staaten von Amerika waren – ebenso wie die englische Sprache – Worte und Begriffe ohne Bedeutung für ihn gewesen.
Die Wolffs hatten ihn aufgenommen und den Sheriff benachrichtigt, aber die Ermittlungen der Behörden waren ergebnislos verlaufen. Es gelang nicht, seine Identität festzustellen. Zu einer anderen Zeit hätte diese Geschichte nationales Aufsehen erregt, aber es war Krieg, und die Nation hatte über wichtigere Dinge nachzudenken. Der alte Wolff hatte ihn Robert genannt – nach seinem verstorbenen Sohn. Und irgendwie hatte er, Robert, versucht, dem alten Wolff ein Sohn zu sein, indem er bei der Farmarbeit mithalf und zur Schule ging, da er jegliche Erinnerung – auch bezüglich seiner Ausbildung – verloren hatte.
Schlimmer als das Fehlen einer formalen Ausbildung war die Tatsache, dass er nicht wusste, wie man sich »gut« benahm. Immer wieder brachte er andere in Verlegenheit oder verwirrte sie und ließ das daraus resultierende verächtliche und manchmal grausame Verhalten der Leute über sich ergehen. Aber er lernte schnell. Seine Bereitschaft, hart zu arbeiten, sowie seine gewaltige Kraft – die er einsetzte, wenn es darum ging, sich zu verteidigen – brachten ihm schließlich Respekt ein.
In erstaunlich kurzer Zeit – als würde er alles lediglich rekapitulieren – brachte er die High-School hinter sich und bestand, obwohl ihm viele Jahre fehlten, die Aufnahmeprüfung zur Universität mühelos. Damals hatte auch sein lebenslanges Liebesverhältnis zu den klassischen Sprachen begonnen: Er bevorzugte Griechisch, da diese Sprache eine Saite in ihm erklingen ließ – und ihn seltsam berührte. Irgendwie hatte er sich in ihr wie zu Hause gefühlt.
Nach der Verleihung der Doktorwürde an der Universität von Chicago hatte er an verschiedenen Universitäten des Ostens und Mittelwestens gelehrt – und Brenda geheiratet, ein schönes Mädchen mit liebenswertem Charakter. Wenigstens war sie ihm damals so erschienen. Die Illusion war bald vergangen, aber er war trotzdem einigermaßen glücklich gewesen – und war es noch.
Immer aber hatte ihn das Geheimnis seines Gedächtnisverlustes und seiner Herkunft bedrückt. Lange Zeit hatte es ihn nicht gestört, aber jetzt, wo er alt wurde …
»Robert!«, rief Brenda lautstark. »Komm endlich herauf! Mr. Bresson ist ein vielbeschäftigter Mann.«
»Ich bin sicher, dass Mr. Bresson schon mehrere Kunden bedient hat, die eine Hausbesichtigung in aller Ruhe vorzunehmen wünschten«, antwortete er sanft. »Oder solltest du deine Meinung geändert haben? – Willst du dieses Haus nicht mehr kaufen?«
Brenda starrte ihn böse an, dann watschelte sie entrüstet davon. Wolff seufzte. Er wusste schon jetzt, dass sie ihn später beschuldigen würde, er habe sie vor dem Grundstücksmakler absichtlich lächerlich gemacht.
Wolff wandte sich wieder den geschlossenen Türen zu. Sollte er es wagen, sie zu öffnen? Es war absurd, hier wie angewurzelt oder unter Schockeinwirkung herumzustehen. Aber er konnte sich nicht bewegen …
Und dann erklang das Horn erneut. Wieder hörte Wolff die sieben Töne …
Noch immer schien es eine Barriere zu geben, aber der Klang des Hornes war mächtiger geworden. Der Bann, der ihn zur Bewegungslosigkeit verdammt hatte, war gebrochen. Wolff gab sich endlich einen Ruck.
Sein Herz hämmerte wie eine innere Faust gegen seine Rippen. Er zwang sich, an die Türen heranzutreten und eine Hand in die messingverkleidete Vertiefung zu legen, die sich in Höhe seiner Taille befand. Dann schob er die Tür beiseite. Das leise Geräusch, das die Tür dabei verursachte, übertönte das Horn.
Die weißgetünchte Wand war – verschwunden! An ihrer Stelle klaffte ein Loch und gab den Blick auf eine Szene frei, die er sich unmöglich einbilden konnte, obgleich sein Gehirn sie hervorbrachte.
Sonnenlicht flutete durch die Öffnung in den Raum hinein. Und – die Öffnung war groß genug, dass er gebückt hätte hindurchgehen können …
Vegetation war zu sehen – eine seltsame Art von Bäumen, die nichtirdischen Ursprungs waren. Die wildwuchernde, fremdartige Natur versperrte ihm teilweise die Sicht. Hinter Zweigen und Blättern konnte er einen leuchtendgrünen Himmel erkennen.
Wolff senkte den Blick, um die Szene unterhalb der Bäume in sich aufzunehmen. Sechs oder sieben Alptraumkreaturen waren am Fuß eines riesigen Felsblocks versammelt. Der Fels bestand aus grobem, rotem, quarzdurchsetztem Gestein und war wie ein giftiger Pilz geformt. Die meisten dieser Wesen hielten ihre schwarzen, pelzigen Körper von ihm abgewandt, nur eines präsentierte sein Profil gegen das grüne Firmament. Der Schädel der Kreatur wirkte brutal, nahezu tierisch, ihr Gesichtsausdruck böswillig. Beulen und hervorstehende Fleischklumpen an Körper und »Gesicht« gaben dem Etwas ein halbfertiges Aussehen. Es schien, als habe sein Schöpfer keinen Wert darauf gelegt, den Körper zu vollenden. Die kurzen Beine der Gestalt glichen den Hinterläufen eines Hundes.
Jetzt streckte die Kreatur ihre langen Arme dem jungen Mann entgegen, der auf dem Felsblock stand.
Er trug lederne Beinkleider und Mokassins, war groß, muskulös und breitschultrig, seine Haut sonnengebräunt und das lange, dichte Haar bronzefarben. Das Gesicht wirkte mit der vorgewölbten Oberlippe hart und kantig. Und – dieser Mann hielt das Instrument, das jene Töne hervorbrachte, die Wolff gehört hatte …
Der Mann trat nach dem Alptraumwesen, das zu ihm hinaufkroch, und schmetterte es zu Boden. Dann hob er das Silberhorn an die Lippen, um erneut zu blasen. Und im gleichen Augenblick traf sein Blick Robert Wolff. Ein breites Grinsen entblößte kräftige, weiße Zähne. »Du bist also endlich gekommen!«, stellte er sichtlich befriedigt fest.
Wolff stand wie erstarrt; er antwortete nicht. Er konnte nur denken: Ich bin verrückt geworden! Es sind nicht nur hörbare Halluzinationen, sondern auch sichtbare! Was wird als nächstes kommen? Soll ich schreiend davonlaufen …? Oder ganz ruhig weggehen und Brenda sagen, dass ich zum Arzt muss? – Und zwar jetzt gleich … Es darf kein Warten mehr geben und keine Erklärungen. Ich werde nur sagen: »Halt den Mund Brenda – ich gehe …«
Er trat zurück. Die Öffnung verkleinerte sich. Die weißen Wände materialisierten und festigten sich wieder. Das bedeutete, dass er wieder Fuß in der Wirklichkeit fasste …
»Hier!«, rief der Jüngling auf dem Felsen. »Fang!« Und er warf das Horn. Sonnenlicht brach sich glitzernd an dem Silber, als es sich immer wieder überschlagend heranwirbelte. Fast hatte die Wand ihre ursprüngliche Festigkeit wiedererlangt … Die Öffnung war nahezu geschlossen … Aber der Kerl hatte gut gezielt! Das Horn durchbrach die Öffnung – und traf Wolff am Knie.
Schmerzerfüllt schrie er auf, der Aufprall war überaus hart. Durch die schwindende Öffnung konnte Wolff gerade noch sehen, wie der rothaarige Mann eine Hand hochhielt, wobei Daumen und Zeigefinger ein O bildeten.
Und der Mann grinste und rief aus: »Viel Glück! Ich hoffe, dich bald wiederzusehen! Ich bin Kickaha!«
Wie ein Auge, das sich langsam zum Schlaf schließt, zog sich die Öffnung in der Wand zusammen. Das grünliche Licht wurde schwächer, die barbarische Vegetation und die Alptraumkreaturen schienen von dichtem Nebel umhüllt … Das letzte, was Wolff sah, war ein Mädchen, das seinen Kopf hinter einem Baumstamm hervorstreckte.
Es hatte unwahrscheinlich große Augen – wie die einer Katze. Ihre Lippen waren voll und karmesinrot, ihre Haut von zartem, goldenem Braun. Das dichte, gewellte Haar, das leicht auf ihre Schultern niederfiel, wies Tigerstreifen auf. Leicht berührte es den Boden, als sie sich um den Baum bewegte. Und dann waren die Wände wieder so, wie die geöffneten Augen einer Leiche. Alles war wie vorher … Beinahe alles ist wie vorher, schränkte Wolff ein. Denn jetzt tobte der Schmerz in seinem Knie … Und das Silberhorn lag zu seinen Füßen.
Er hob es auf und drehte es herum, um es im Licht des Aufenthaltsraumes zu betrachten. Obwohl er benommen war, glaubte er jetzt nicht mehr, verrückt zu sein. Er hatte in ein anderes Universum geblickt, und das Horn war ihm zugeworfen worden – warum, wusste er nicht.
Das Instrument war nur wenig kürzer als fünfundsiebzig Zentimeter und wog weniger als ein Viertelpfund. Es war geformt wie das Horn eines afrikanischen Büffels – ausgenommen das breit auslaufende Ende. Die Spitze war mit einem Mundstück aus weichem, goldenem Metall versehen, das Horn selbst war aus Silber oder versilbertem Metall. Es gab keine Ventile, aber als Wolff es herumdrehte, sah er eine Reihe von sieben kleinen Knöpfen. Einen halben Zoll innerhalb der Öffnung war ein Gespinst aus silbrigen Fäden. Hielt man das Horn in einem bestimmten Winkel zum Licht der Glühbirne, konnte man meinen, es reiche tief in das Innere hinein. Wolff sah die Schriftzeichen, die auf der halben Länge des Hornkorpus eingraviert waren. Er hätte sie beinahe übersehen. Noch nie zuvor hatte er ähnliche gesehen – obwohl er Experte für alle Arten alphabetischer Schriften, Ideogramme und Piktogramme war.
»Robert!«, nörgelte seine Frau wieder.
»Ich komme gleich, Liebes!« Wolff legte das Horn in die vordere rechte Ecke des Raumes und schloss die Tür hinter sich. Vorerst konnte er nichts anderes tun. Wenn er mit dem Horn auftauchte, würde er sowohl seiner Frau als auch Bresson zu viele neugierige Fragen beantworten müssen. Da er das Haus nicht mit dem Horn betreten hatte, konnte er auch nicht behaupten, es sei sein Eigentum. Bresson würde das Instrument, da es in einem Haus, das seine Agentur vermittelte, gefunden worden war, sicher in Gewahrsam nehmen.
Wolff litt Qualen der Unentschlossenheit. Wie konnte er es unbemerkt aus dem Haus schaffen? Wie konnte er verhindern, dass Bresson weiteren potentiellen Kunden dieses Haus zeigte – vielleicht gar heute noch? Wer die Gleittür des Raumes öffnete, sah das Horn sofort … Jeder andere Kunde konnte Bresson auf seinen Fund aufmerksam machen.
Wolff ging die Stufen hinauf in das große Wohnzimmer. Brenda funkelte ihn wütend an. Bresson, ein rundlicher Mann mit Brille, etwa fünfunddreißig Jahre alt, blickte beunruhigt drein.
»Nun, wie gefällt es Ihnen?«, erkundigte er sich.
»Großartig«, antwortete Wolff. »Es erinnert mich an die Bauten, die wir zu Hause haben.«
»Ich mag es auch«, sagte Bresson. »Ich stamme selbst aus dem Mittelwesten und kann verstehen, dass Sie nicht gern in einem Haus wohnen wollen, das wie eine Ranch gebaut ist. Womit ich natürlich nicht sagen will, dass Ranchhäuser schlecht sind … Immerhin lebe ich selbst in einem.«
Wolff trat zum Fenster und blickte hinaus. Die nachmittägliche Maisonne schien hell vom Himmel Arizonas herab. Frisches Bermudagras, drei Wochen zuvor gepflanzt, bildete den Rasen. Es war so jung wie die Häuser des Siedlungsprojekts der Hohokam-Baugesellschaft.
»Die meisten dieser Häuser sind nicht unterkellert«, erklärte Bresson. »Ausbaggern kostet bei dem harten Untergrund eine ganze Menge … Aber dieses Haus hier hat einen Keller – und es ist dennoch nicht teuer. Sie bekommen viel für Ihr Geld.«
Wolff dachte: Wenn man den Aufenthaltsraum nicht tiefer gesetzt hätte – was hätte der Mann von der anderen Seite wohl gesehen, als die Öffnung entstand? Nur Erde? Wäre ihm so die Chance verwehrt gewesen, das Horn loszuwerden? Zweifellos.
»Sie werden vielleicht gelesen haben«, fuhr Bresson fort, »dass sich dieses Projekt verzögert hat. Während der Baggerarbeiten wurde nämlich eine frühere Stadt der Hohokam freigelegt.«
»Hohokam?«, echote Mrs. Wolff. »Wer war denn das?«
»Viele Leute, die nach Arizona kommen, haben nie von ihnen gehört«, antwortete Bresson eifrig. »Aber man kann nicht lange in der Gegend von Phoenix wohnen, ohne Hinweise auf sie zu finden. Die Hohokam waren die Indianer, die vor langer Zeit im Tal der Sonne gelebt haben. Vor etwa 1200 Jahren müssen sie hierhergekommen sein und sich angesiedelt haben. Sie legten Bewässerungskanäle an, bauten Städte – sie begründeten eine Zivilisation. Aber irgendetwas ist mit ihnen geschehen, und niemand weiß definitiv, was. Vor mehreren hundert Jahren verschwanden sie spurlos. Einige Archäologen behaupten, dass die Papago- und Pima-Indianer ihre Nachfahren sind.«
Mrs. Wolff rümpfte die Nase. »Ich habe sie gesehen«, sagte sie.
»Sie sehen nicht so aus, als würden sie etwas anderes bauen können als diese heruntergekommenen Lehmhütten in der Reservation.«
Wolff drehte sich um und sagte, fast wütend: »Auch die heute lebenden Mayas sehen nicht so aus, als hätten sie diese prächtigen Tempel erbaut oder den Begriff Null eingeführt. Aber dennoch haben sie es getan.«
Brenda schnappte nach Luft. Bresson lächelte vermittelnd. »Jedenfalls mussten wir unser Bauprojekt zurückstellen, bis die Archäologen fertig waren. Es hielt die Arbeiten etwa drei Monate auf, und wir konnten nichts dagegen tun. Vom Staat aus waren uns die Hände gebunden. Schließlich könnte dies aber ein glücklicher Umstand für Sie beide sein. Wenn es die Verzögerung nicht gegeben hätte, wären die Häuser möglicherweise inzwischen längst verkauft. So wendet sich doch alles noch zum Guten, nicht wahr?« Strahlend lächelte er, und sein Blick wanderte von Robert zu Brenda Wolff.
Wolff zögerte kurz, atmete tief ein, weil er wusste, was von Brenda kommen würde, und sagte dann: »Wir werden dieses Haus kaufen und die entsprechenden Papiere sofort unterzeichnen.«
»Robert?«, kreischte Mrs. Wolff. »Du … du hast mich nicht einmal gefragt!«
»Es tut mir leid, meine Liebe. – Aber ich habe mich dazu entschlossen.«
»Aber ich habe mich noch nicht entschlossen!«, begehrte sie auf. »Bitte, meine Herrschaften … Es ist nicht so eilig«, warf Bresson beschwichtigend ein. Sein Lächeln war nun verzweifelt. »Nehmen Sie sich Zeit, sprechen Sie alles noch einmal durch. Selbst wenn jemand gerade dieses Haus kaufen wollte – was natürlich geschehen könnte, noch bevor es Abend ist, denn Häuser dieser Art sind recht begehrt … Nun, selbst dann gibt es noch eine Menge gleichartiger.«
»Aber ich will dieses Haus!«
»Robert – was ist mit dir los?«, jammerte Brenda. »Ich habe nie zuvor erlebt, dass du so gehandelt hast!«
»Ich habe dir in fast allen Dingen nachgegeben«, sagte Wolff. »Ich wollte, dass du glücklich bist … Also akzeptiere du jetzt einmal meinen Wunsch, das ist gewiss nicht zuviel verlangt. Außerdem hast du selbst heute morgen gesagt, dass dir dieser Haustyp gefällt. Und die Hohokam-Häuser sind die einzigen dieser Art, die wir uns leisten können. Wir werden jetzt die Vorverträge unterschreiben, Mr. Bresson. Ich kann Ihnen einen Scheck als Anzahlung ausstellen.«
»Ich werde nicht unterschreiben, Robert!«, sagte Brenda Wolff fest entschlossen.
»Warum … warum gehen Sie beide nicht nach Hause, um diese Angelegenheit zu besprechen?«, sagte Bresson. »Ich stehe gerne zur Verfügung, wenn Sie zu einem Entschluss gekommen sind.«
»Meine Unterschrift allein genügt also nicht …«, gab Wolff zurück.
Bresson behielt immer noch sein verzerrtes Lächeln bei und erwiderte: »Ich bedauere. Aber Mrs. Wolff muss den Vertrag ebenfalls unterzeichnen.«
Brenda lächelte triumphierend.
»Versprechen Sie mir, dass Sie dieses Haus keinem anderen Interessenten zeigen«, verlangte Wolff eindringlich. Und fügte hinzu: »Wenigstens heute nicht mehr. Sollten Sie befürchten, dass Ihnen ein Geschäft entgeht, so bin ich gern bereit, eine entsprechende Anzahlung zu leisten.«
»Oh, das wird nicht nötig sein«, wehrte Bresson ab und ging – mit einer Eile, die seinen Wunsch verriet, einer peinlichen Situation eiligst zu entkommen – zur Tür. »Ich werde das Haus heute niemandem mehr zeigen«, versprach er.
Robert Wolff nickte und ging mit seiner Frau zu seinem Wagen. Auf dem Rückweg zum Sands-Hotel in Tempe schwiegen sie sich beharrlich an. Unbeweglich saß Brenda neben ihm und starrte geradeaus durch die Windschutzscheibe. Wolff warf hin und wieder einen Blick auf sie und stellte fest, dass ihre Nase spitzer und ihre Lippen dünner geworden waren. Wenn diese Entwicklung anhielt, würde sie bald wie ein dicker Papagei aussehen … Und wenn sie schließlich in keifendes Gerede ausbrach, sich auch wie einer anhören. Die altbekannte, ermüdende und doch heftige Flut von Anschuldigungen und Drohungen würde über ihre Lippen quellen. Sie würde ihm wieder vorwerfen, sie all die Jahre nicht beachtet zu haben, ihn erneut zum tausendsten Mal daran erinnern, dass er seine Nase in Büchern vergrub, Bogenschießen oder Fechten übte oder Berge erkletterte – Sportarten, denen sie sich ihrer Arthritis wegen nicht widmen konnte. Brenda würde die Jahre aufrollen, in denen sie unglücklich gewesen war – oder unglücklich gewesen zu sein glaubte – und schließlich damit enden, heftig und bitter zu weinen.
Wolff fragte sich, warum er es so lange mit ihr ausgehalten hatte. Er konnte sich die rein rhetorische Frage nicht beantworten – nicht ganz wenigstens. Er wusste nur, dass er Brenda geliebt hatte, als sie jung war und auch, dass ihre Anschuldigungen nicht ganz unbegründet waren. Des weiteren empfand er den Gedanken an eine Trennung als schmerzlich – letztendlich sogar schmerzlicher als den, bei ihr zu bleiben.
Und doch hatte er das Recht, die Früchte seiner Arbeit als Professor für Englisch und klassische Sprachen zu ernten! Jetzt, wo er genügend Geld und Freizeit besaß, konnte er den Studien nachgehen, von denen ihn bisher seine Pflichten abgehalten hatten. Mit einem Heim in Arizona als Basis konnte er künftig sogar Reisen unternehmen. Oder doch nicht? Nun, Brenda würde sich nicht weigern, mit ihm zu kommen – im Gegenteil. Wahrscheinlich würde sie sogar darauf bestehen, ihn zu begleiten. Aber er zweifelte dennoch nicht daran, dass sie sich dermaßen langweilen würde, dass auch er schließlich die Freude an der Reise verlor. Und er konnte ihr nicht einmal Vorwürfe machen. Brenda hatte einfach nicht die gleichen Interessen. Aber sollte er Dinge, die das Leben für ihn reich und interessant machten, aufgeben – nur um ihr eine Freude zu machen? Zumal sie ohnehin niemals richtig glücklich sein würde …
Wie er erwartet hatte, wurde aus Brendas Schweigen nach dem Abendessen keifende Aktivität. Wolff hörte zu, versuchte ruhig zu argumentieren und ihr ihren Mangel an Logik sowie die Unrechtmäßigkeit und Grundlosigkeit ihrer Beschuldigungen klarzumachen. Es war sinnlos. Brenda schloss ihre Tirade wie immer: Sie weinte und drohte, ihn zu verlassen oder sich umzubringen.
Aber dieses Mal gab er nicht nach. »Ich werde dieses Haus kaufen. Und ich will das Leben so genießen, wie ich es geplant habe«, sagte er mit Bestimmtheit. »Du wirst mich nicht umstimmen, Brenda!«
Wolff zog seinen Mantel über und ging zur Tür. »Ich komme später zurück«, erklärte er und setzte hinzu: »Vielleicht.«
Sie schrie laut auf und warf einen Aschenbecher nach ihm. Wolff wich dem Geschoss aus. Der Aschenbecher krachte gegen die Tür und fiel zu Boden. Wortlos verließ er die Wohnung. Glücklicherweise folgte Brenda ihm nicht, noch machte sie auf dem Korridor eine Szene, wie es bei früheren Gelegenheiten schon vorgekommen war.
Es war dunkel geworden. Der Mond war noch nicht aufgegangen. Nur die hell erleuchteten Fenster des Motels, die Straßenlaternen und die unzähligen Scheinwerfer der Autos auf dem Apache Boulevard brachen die absolute Macht der Finsternis. Wolff fuhr seinen Wagen aus der Garage und steuerte ihn nach Osten. Später wandte er sich nach Süden. Innerhalb weniger Minuten war er auf der Straße, die zur Hohokam-Wohnanlage führte.
Der Gedanke an das, was er zu tun gedachte, ließ sein Herz schneller schlagen, und seine Haut wurde kühl. Es war das erste Mal in seinem Leben, dass er ernsthaft in Betracht zog, eine kriminelle Handlung zu begehen …
Die Hohokam-Wohnanlage war hell erleuchtet, und laute Musik und Kinderstimmen vermischten sich zu einem hektischen Ganzen. Er sah auf der Straße Kinder spielen, während ihre Eltern die Häuser besichtigten.
Wolff fuhr weiter, kam durch Mesa, wendete den Wagen schließlich, durchquerte Tempe erneut und steuerte hinunter nach Van Buren – bis nach Phoenix hinein. Er schlug sich nach Norden, dann wieder nach Osten, bis er in der Stadt Scottsdale den Wagen anhielt. Er ging in eine kleine Kneipe, schüttete vier Gläser Vat 69 hinunter und fuhr weiter. Er wollte nicht mehr trinken, auf keinen Fall wollte er betrunken sein, wenn er ans Werk ging …
Als er schließlich die Hohokam-Wohnanlage wieder erreichte, waren sämtliche Lichter erloschen und in die alles umspannende Wüste wieder Stille eingekehrt. Wolff parkte seinen Wagen hinter dem Haus, das er an diesem Nachmittag gemeinsam mit Brenda besichtigt hatte. Mit der behandschuhten rechten Faust zertrümmerte er eine Scheibe und stieg in den Aufenthaltsraum ein …
Als er schließlich in dem Raum stand, rang er keuchend nach Atem, und sein Herz schlug, als hätte er einen Dauerlauf hinter sich. Obwohl er sich fürchtete, musste er über sich selbst lächeln. Er war ein Mann, der sehr intensiv in seiner Gedankenwelt lebte, und oft hatte er sich selbst als Einbrecher gesehen … Natürlich nicht als gewöhnlichen Dieb, sondern als draufgängerischen Abenteurer. Jetzt, in dieser Sekunde, wurde ihm bewusst, dass sein Respekt vor dem Gesetz zu groß war: Nie hätte er ein Verbrecher, und erst recht kein großer, werden können. Das Gewissen plagte ihn bereits jetzt wegen dieser kleinen Tat – die er trotzdem glaubte, voll rechtfertigen zu können. Darüber hinaus ließ ihn der Gedanke, entdeckt zu werden, beinahe aufgeben. Wenn man ihn hier erwischte, war sein ruhiges, anständiges und angesehenes Leben ruiniert. War es das wert?
Wolff entschied, dass es das war. Wenn er jetzt einen Rückzieher machte, würde er sich für den Rest seines Lebens fragen, ob er etwas – und wenn ja, was – versäumt hatte …
Das größte aller Abenteuer wartete auf ihn, ein Abenteuer, wie es wahrscheinlich kein anderer Mensch vor ihm je erlebt hatte. Wenn er jetzt zum Feigling wurde, konnte er sich ebenso gut erschießen. Er würde jedenfalls nicht in der Lage sein, den Verlust des Horns oder die Selbstvorwurfe wegen seines fehlenden Mutes zu ertragen.
Es war so dunkel in dem Aufenthaltsraum, dass er sich den Weg mit den Fingerspitzen ertasten musste. Als er die Gleittüren erreichte, die er am Nachmittag geöffnet hatte, schob er sie leise, um Lärm zu vermeiden, beiseite. Dann hielt er inne, um zu lauschen.
Niemand schien ihn bemerkt zu haben.
Als die Tür vollends zurückgewichen war, nahm Wolff das Horn an sich und trat ein paar Schritte zurück. Er hielt das Mundstück an die Lippen und blies leise hinein.
Der schmetternde Laut, der plötzlich erklang, erschreckte Wolff so sehr, dass er das geheimnisvolle Horn fallen ließ. Tastend fand er es schließlich in einer Ecke des Raumes wieder.
Beim zweiten Mal blies er kräftiger. Weder erklang ein Ton, aber er war nicht lauter als der erste. Irgendeine Vorrichtung – vielleicht das silbrige Gespinst? – regulierte den Schallpegel.
Einige Minuten lang stand Wolff unbeweglich da und hielt das Horn fest an seine Lippen gepresst. Er versuchte, sich die genaue Folge der sieben Töne, die er gehört hatte, ins Gedächtnis zurückzurufen. Offensichtlich bestimmten die sieben kleinen Knöpfe an der Unterseite des Instruments die verschiedenen Harmonien … Aber er konnte nicht herausfinden, welcher Knopf welchen Ton aktivierte, ohne es auszuprobieren – und damit Aufmerksamkeit zu erregen. Wolff zuckte die Schultern. »Zum Teufel!«, murmelte er.
Dann blies er erneut und drückte die Knöpfe, wobei er den, der ihm am nächsten war, zuerst betätigte. Sieben laute Töne erklangen. Sie waren so, wie er sie in Erinnerung hatte – nur die Reihenfolge stimmte nicht. Noch nicht.
Als der letzte Laut erstorben war, erklang in der Ferne ein Ruf.
Wolff brach fast in Panik aus. Er fluchte, setzte das Horn wieder an die Lippen und drückte die Knöpfe in einer Reihenfolge, von der er hoffte, dass sie das Sesam-öffne-dich darstellte – den musikalischen Schlüssel zu einer anderen Welt …
Im gleichen Moment huschte der Lichtstrahl einer Taschenlampe über das zerbrochene Fenster des Raumes. Dann verschwand er. Wolff blies wieder. Der Lichtstrahl kehrte zum Fenster zurück, zerschnitt die Dunkelheit im Raum. Weitere Rufe ertönten.
Verzweifelt probierte Wolff andere Tonfolgen aus. Und … der dritte Versuch schien die Wiedergabe der Melodie zu sein, die der Jüngling auf dem pilzförmigen Felsblock gespielt hatte!
Jemand leuchtete durch das zerbrochene Fenster zu ihm hinein. Eine tiefe Stimme rief: »Kommen Sie heraus! Kommen Sie heraus, oder ich schieße!«
Im gleichen Moment erschien ein grünliches Leuchten an der Wand, durchbrach sie und wurde mächtiger. Ein Loch entstand … Mondlicht schien hindurch. Die Bäume und der Felsblock waren nur als dunkle Schemen hinter silbergrünem Licht zu erkennen. Es kam von einem riesigen Mond, von dem nur der Rand zu sehen war.
Wolff hielt sich nicht länger auf. Vielleicht hätte er gezögert, wenn er unbemerkt geblieben wäre … Aber jetzt wurde ihm klar, dass er sich beeilen musste. Die fremde Welt bot Unsicherheit und Gefahr. Aber seine eigene bot ihm endgültig und unausweichlich nur noch Schmach und Schande.
Im gleichen Augenblick, in dem der Wachmann seine grimmige Aufforderung wiederholte, ließ Wolff ihn und seine Welt hinter sich zurück.
Er musste sich bücken und einen hohen Schritt machen, um das sich bereits wieder zusammenziehende Loch zu passieren.
Als er sich auf der anderen Seite umdrehte und einen letzten Blick zurückwarf, war die Öffnung nicht mehr größer als das Bullauge eines Schiffes. Und wenige Sekunden später war auch sie verschwunden, als hätte sie nie existiert.
Zweites Kapitel
Wolff atmete aufgeregt und heftig und setzte sich ins Gras, um auszuruhen.
Er dachte daran, welche Ironie des Schicksals es gewesen wäre, wenn diese Aufregung seinem sechsundsechzigjährigen Herzen den Rest gegeben hätte. Bei der Ankunft in einer neuen Welt gestorben …
Sie – wer immer »sie« auch sein mochten – hätten ihn beerdigen und auf seinen Grabstein Dem unbekannten Erdenmenschen schreiben müssen.
Dann fühlte er sich wieder besser. Er lachte sogar, als er sich erhob. Mit Mut und Zuversicht sah er sich um. Die Luft war angenehm warm, etwa siebzig Grad Fahrenheit nach seiner Schätzung, und war geschwängert mit seltsamen, aber sehr angenehmen, fast würzigen Gerüchen. Vogelgezwitscher – er hoffte, dass es das war – kam von überall her. Und aus der Ferne kam ein schwaches, monotones Grollen. Aber Wolff empfand keine Furcht. Er war sicher – ohne dafür einen vernünftigen Grund zu haben –, dass es sich hierbei lediglich um das von der Entfernung gedämpfte Donnern einer Brandung handelte.
Der Mond, der am Himmel stand, war voll und gigantisch, gut zweieinhalbmal so groß wie der der Erde.
Der Himmel hatte das leuchtende Grün des Tages verloren und war so schwarz geworden wie der nächtliche Himmel der Welt, die Wolff gerade verlassen hatte.
Eine Vielzahl großer Sterne zog mit einer solch großen Geschwindigkeit ihre Bahn, dass Wolff vor Furcht und Verwirrung schwindlig wurde. Einer dieser Sterne fiel auf ihn zu, wurde größer und größer, heller und heller – bis er wenige Zentimeter über ihm die Richtung änderte. Durch das orangegelbe Glühen an seinem hinteren Teil konnte Wolff vier große elliptoide Flügel, herabhängende dünne Spinnenbeine und – ganz kurz – einen Schädel mit Fühlern erkennen. Es war eine Art Leuchtkäfer mit einer Flügelspannweite von mindestens drei Metern.
Wolff betrachtete das Hin und Her, das Ausschwärmen und Zusammenkommen der lebenden Sterne, bis er sich einigermaßen daran gewöhnt hatte. Er fühlte sich plötzlich tatendurstig und überlegte, in welche Richtung er gehen sollte.
Das Geräusch der Brandung …
Er entschloss sich, den Weg zur Küste einzuschlagen. Die Küste bot einen guten Ausgangspunkt. Dort angekommen, würde er seinen weiteren Weg bestimmen.
Wolff brach auf. Er kam nur langsam voran. Oft machte er halt, um zu lauschen und die Schatten der Nacht zu beobachten.
Ein dumpfes Grunzen erklang – es war sehr nahe. Wolff warf sich in das im Schatten eines dichten Gestrüpps wuchernde Gras, machte sich klein und versuchte, langsam zu atmen.
Ein raschelndes Geräusch …
Ein Zweig brach knackend …
Wolff hob seinen Kopf gerade hoch genug, um auf die mondbeschienene Lichtung blicken zu können. Eine große, massige Gestalt, die aufrecht ging und zweibeinig, dunkel und behaart war, schob sich, ein paar Meter entfernt, an ihm vorbei.
Und plötzlich blieb dieses Wesen stehen. Wolffs Herz setzte einen Schlag lang aus. Der Schädel der Kreatur bewegte sich vor und zurück. Wolff konnte die an einen irdischen Gorilla erinnernden Züge deutlich sehen. Aber es war kein Gorilla – jedenfalls kein irdischer. Das Fell dieses Wesens war nicht durchgehend schwarz. Abwechselnd zogen sich breite schwarze und schmale weiße Streifen im Zickzack über Körper und Beine. Die Arme waren viel kürzer als die seines Gegenstücks auf der Erde, und die Beine nicht nur länger, sondern auch gerader. Darüber hinaus war die Stirn dieses »Gorillas« – obwohl sie mit vorstehenden Knochen über den Augen versehen war – hoch.
Eine Folge von klar modulierten Silben brach jetzt über seine Lippen – kein tierisches Geschrei oder Knurren. Der »Gorilla« war nicht allein. Das grünliche Licht des Mondes enthüllte auf der Wolff abgewandten Seite – nackte Haut. Eine Frau ging an der Seite des Tierwesens! Ihre Schultern wurden durch seinen riesigen Arm verdeckt.
Wolff konnte zwar ihr Gesicht nicht sehen, aber schlanke Beine, ein gewölbtes Hinterteil, einen wohlgeformten Arm und langes, schwarzes Haar, und er fragte sich, ob sie wohl von vorn ebenso schön war …
Die Frau sprach mit dem Gorilla – mit weicher, silberheller Stimme. Und der Gorilla antwortete ihr.
Sekunden später war das seltsame Paar in der Dunkelheit des Dschungels verschwunden.
Wolff stand nicht sofort auf, denn er war zu erschüttert. Schließlich aber erhob er sich doch und stieß durch das Unterholz vor, das nicht so dicht wie das eines irdischen Dschungels war. In der Tat standen Büsche, Sträucher und Bäume weit voneinander entfernt, und wäre nicht die exotische Umgebung gewesen, hätte er die Flora nicht einmal für die eines Dschungels gehalten. Sie schien eher der eines Parks zu ähneln – auch das weiche Gras, das so kurz war, als sei es erst vor kurzem gemäht worden, unterstrich diesen Eindruck.
Wolff war nur ein paar Schritte gegangen, als er zusammenzuckte. Schnaubend brach ein Tier vor ihm aus dem Gestrüpp und floh. Wolff sah ein rötliches Geweih, eine weißliche Nase, riesige, bleiche Augen und einen gepunkteten Körper … Das Tier preschte durch das Dickicht und verschwand. Wenige Sekunden später hörte er tapsende Schritte hinter sich.
Wolff wandte sich um und sah den gleichen »Hirsch« einige Meter von ihm entfernt stehen. Langsam trat das Tier vor und schob seine feuchten Nüstern in Wolffs ausgestreckte Hand. Schließlich schnurrte es und versuchte, seine Flanke an ihm zu reiben. Da der Hirsch gute fünf Zentner wog, wurde Wolff beiseite gestoßen. Er stemmte sich gegen den Körper, streichelte das Tier hinter den großen, tassenförmigen Ohren, betatschte seine Nüstern und klopfte leicht gegen seine Flanke. Das Tier beleckte ihn mehrmals mit einer langen, feuchten Zunge, die so rau war wie die eines Löwen. Wolffs Hoffnung, der Hirsch möge seiner Zuneigung bald überdrüssig werden, verwirklichte sich bald. Er verschwand mit einem Sprung, der genauso plötzlich und unerwartet erfolgte wie der, der ihn in seine Reichweite gebracht hatte.
Jetzt fühlte sich Wolff weniger gefährdet. Würde ein Tier so zutraulich zu einem völlig Fremden sein, wenn es Fleischfresser oder Jäger zu fürchten hatte?
Das Rollen und Stampfen der Brandung wurde lauter. Wolff beeilte sich jetzt – und zehn Minuten später hatte er den Strand erreicht. Dort kauerte er sich unter einen breiten, hoch aufragenden Farnwedel und beobachtete die mondüberflutete Landschaft.
Der Strand selbst war weiß und bestand, wie er feststellte, aus sehr feinkörnigem Sand. Er erstreckte sich in beide Richtungen so weit, wie er sehen konnte, und seine Breite zwischen Wald und Meer mochte etwa zweihundert Meter betragen. Zu beiden Seiten flackerten in einiger Entfernung Feuer, und die Silhouetten von tanzenden Männern und Frauen waren zu sehen. Ihr Lachen – obgleich es wegen der Entfernung gedämpft und leise klang – bekräftigte Wolff in seinem Glauben, dass sie menschlich sein mussten.
Sein Blick glitt zurück zum Strand. Dort, etwa dreihundert Meter entfernt und fast im Wasser, erkannte er zwei Wesen. Ihr Anblick raubte ihm den Atem.
Nicht das, was sie gerade taten, schockierte ihn, sondern ihre Körper! Von der Taille an aufwärts waren die beiden ebenso menschlich wie er selbst. Aber an der Stelle, wo ihre Beine hätten beginnen sollen, gingen ihre Körper in – die Formen eines Fisches über!
Wolff war nicht fähig, seine Neugier zurückzuhalten. Nachdem er das Horn in dem weichen Gras versteckt hatte, kroch er am Rande des Dschungels entlang. Schließlich war er den beiden Wesen ziemlich nah und hielt an, um sie zu mustern. Der Mann und die Frau lagen jetzt Seite an Seite und unterhielten sich. Wolff konnte sie eingehend mustern. Er war überzeugt davon, dass sie ihn weder zu Lande verfolgen konnten noch Waffen besaßen. Er konnte sich ihnen also gefahrlos nähern. Vielleicht waren sie sogar freundlich …?
Als er noch etwa zwanzig Meter von ihnen entfernt war, hielt er an, um sie erneut zu betrachten. Auch wenn sie Meereswesen waren: zur Hälfte erschienen sie ihm menschlich. Die Flossen am Ende ihrer langen Schwänze waren in horizontaler Lage – nicht wie die von Fischen, die vertikal angebracht sind. Und sie schienen nicht geschuppt zu sein. Glatte, braune Haut bedeckte ihre Hybridenkörper.
Wolff hustete.
Die Meereswesen blickten auf. Der Mann schrie und die Frau rief etwas. In einer Bewegung, die so blitzschnell war, dass Wolff sie unmöglich in allen Einzelheiten wahrnehmen konnte, erhoben sie sich auf ihren Schwanzenden, schwangen sich hoch und warfen sich in die Wellen.
Im Mondlicht waren kurz ein dunkler Kopf, der sich sekundenlang aus den Wellen hob, und ein emporschießender Schwanz zu sehen.
Die Brandung rollte und krachte auf den weißen Sand. Eine vom Meer her kommende Brise kühlte Wolffs schwitzendes Gesicht. Aus der hinter ihm liegenden Dunkelheit kamen ein paar seltsame, unheimliche Schreie, und vom Strand her waren nach wie vor die Geräusche menschlicher Festlichkeit zu vernehmen.
Für eine Weile war Wolff in Gedanken versunken. Die Sprache der Meermenschen hatte etwas Bekanntes an sich gehabt wie auch die des Zebrilla – so hatte er den seltsamen Gorilla inzwischen »getauft« – und seiner schönen Begleiterin. Wolff hatte keine einzelnen Worte erkennen können – aber die Klänge und damit verbundenen Betonungen hatten etwas in seinem Gedächtnis aufgerührt. Aber was?
Mit Sicherheit verwandten sie keine Sprache, die er jemals zuvor gehört hatte. Er grübelte weiter. Glich ihre Sprache möglicherweise einer irdischen? Hatte er sie auf Tonband oder vielleicht in einem Film gehört?
Er fand keine Antwort – denn in diesem Augenblick legte sich eine Hand grob auf seine Schulter, packte zu und drehte ihn herum! Die groteske Schnauze und die tiefliegenden Augen eines Zebrilla waren dicht vor seinem Gesicht. Nach Alkohol duftender Atem schlug ihm entgegen.
Der Zebrilla sagte etwas in der fremden Sprache, und die Frau trat aus den Büschen hervor. Langsam kam sie näher. Zu jeder anderen Zeit hätte Wolff der Anblick ihres großartigen Körpers und schönen Gesichts den Atem geraubt.
Unglücklicherweise hatte er jetzt aus einem anderen Grunde Schwierigkeiten zu atmen. Der riesige Affe – das wusste Wolff instinktiv – konnte ihn jederzeit mit einer noch größeren Leichtigkeit und Schnelligkeit, als sie die Meermenschen vorhin bewiesen hatten, ins Meer schleudern. Oder seine mächtige Hand einfach schließen … Zerquetschtes Fleisch und zermalmte Knochen – mehr würde nicht von ihm übrigbleiben.
Die Frau sagte etwas, und der Zebrilla antwortete. Und – jetzt verstand Wolff mehrere Worte!
Ihre Sprache ähnelte dem vorhomerischen Griechisch, dem Mykenischen.
Wolff blieb ruhig, um ihnen zu zeigen, dass er harmlos und seine Absichten nicht böse waren. Außerdem war er zu überrascht, um klar genug denken zu können – und seine Kenntnis des Griechischen jener Periode war begrenzt, auch wenn es nahe an das Aolisch-Ionische des blinden Barden herankam.
Schließlich gelang es ihm, ein paar Sätze hervorzustoßen, deren Sinn nicht übermäßig wichtig war … Hauptsache, sie verstanden, dass er sich nicht in böser Absicht hier aufhielt.
Der Zebrilla grunzte überrascht und sagte etwas zu dem Mädchen. Dann setzte er Wolff in den Sand ab. Wolff seufzte vor Erleichterung, gleichsam aber registrierte er seine schmerzende Schulter und verzog das Gesicht. Die riesige Hand des Ungetüms war ungeheuer kräftig. Abgesehen von der Größe und den vielen Haaren war sie allerdings menschlich.
Das Mädchen zupfte an Wolffs Hemd. Leichter Widerwille zeigte sich auf ihrem Gesicht. Erst später sollte Wolff erfahren, dass er sie abstieß, denn sie hatte noch nie zuvor einen dicklichen, alten Mann gesehen. Aber seine Kleider schienen ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Sie zog weiter an seinem Hemd, und Wolff zog es aus – bevor sie dem Zebrilla Anweisung gab, ihm dabei zu helfen.
Neugierig betrachtete sie es, roch daran, sagte »Puh!« und machte dann eine Geste.
Obwohl Wolff es vorgezogen hätte, sie nicht zu verstehen, wusste er, was sie nun von ihm erwartete. Und er beschloss, ihr zu gehorchen. Es gab keinen Grund, sie zu frustrieren – und so möglicherweise den Zebrilla zu verärgern. Er legte also seine Kleidung ab und wartete auf weitere Befehle.
Die Frau lachte schrill auf.
Der Zebrilla bellte und schlug mit seiner riesigen Hand gegen seine Schenkel. Er erzeugte dabei ein Geräusch, das sich anhörte, als würde eine Axt Holz schlagen. Die beiden so ungleichen Wesen umarmten sich und taumelten – weiterhin hysterisch lachend – zum Strand hinunter.
Aufgebracht, erniedrigt, beschämt – aber auch dankbar, dass er dieses Abenteuer unverletzt überstanden hatte, zog Wolff sich wieder an. Er hob Unterwäsche, Strümpfe und Schuhe auf und trottete durch den Sand und zurück in das Unterholz des Dschungels.
Nachdem er das Horn wieder an sich genommen hatte, saß er noch lange da und überlegte, was er nun unternehmen sollte. Schließlich schlief er ein.
Am nächsten Morgen erwachte er mit schmerzenden Muskeln und verspürte Hunger und Durst.
Der Strand war belebt. Zahlreiche große Robben mit orangefarbenem, leuchtendem Fell jagten bernsteinfarbenen Bällen nach, die ihnen von den Meermenschen zugeworfen wurden.
Ein Mann mit Widderhörnern, fellüberzogenen Beinen und einem kurzen, ziegenähnlichen Schwanz hetzte hinter einem Mädchen her, das der Gefährtin des Zebrilla sehr ähnlich sah. Sie rannte, bis der gehörnte Mann sich auf sie warf und lachend in den Sand niederzwang. Was dann geschah, zeigte Wolff, dass die Eingeborenen dieser Welt von Sünde und Verboten so wenig wussten wie einst Adam und Eva …
Das war zwar mehr als interessant – aber der Anblick einer essenden Meerjungfrau weckte in ihm andere, vordringlichere und forderndere Bedürfnisse. Das Mädchen hielt eine große, ovale, gelbe Frucht in einer Hand und in der anderen eine Halbkugel, die an eine Kokosnussschale erinnerte. Eine Widderfrau kauerte an einem Feuer nur ein paar Meter von ihm entfernt und briet einen Fisch. Der Duft ließ Wolff das Wasser im Munde zusammenlaufen, und sein Magen knurrte.
Zuerst brauchte er etwas zu trinken. Und da nur das Wasser des Ozeans zu sehen war, ging er über den Strand auf die Brandung zu. Der Empfang war so, wie er erwartet hatte: Überraschung, Rückzug, bis zu einem gewissen Grad Furcht. Alle hielten in ihren Tätigkeiten inne – ganz gleich, wie sehr sie auch damit beschäftigt gewesen waren – und starrten ihn an.
Als er sich einigen von ihnen näherte, gafften sie ihn mit weiten, offenen Augen und Mündern an – und zogen sich noch weiter zurück. Ein paar Männer blieben stehen, aber auch sie sahen aus, als würden sie fortlaufen, wenn er nur »Buh!«, sagte.
Aber natürlich hatte Wolff nicht die Absicht, sie zu bedrohen, denn sogar der kleinste von ihnen wirkte stark und gewandt. Und er selbst würde mit seinem müden, alten Körper ein leicht zu überwältigender Gegner sein.
Wolff watete ins Meer, bis ihm das Wasser zur Taille reichte, und kostete es. Er hatte gesehen, dass die Männer und Frauen davon getrunken hatten, und hoffte, dass es auch für ihn genießbar war. Tatsächlich war das Wasser rein und frisch. Es besaß einen ihm unbekannten Beigeschmack.
Nachdem er getrunken hatte, fühlte er sich wie nach einer Transfusion jungen Blutes und watete an den Sandstrand zurück – und tauchte im Dickicht des Dschungels unter. Die menschlich wirkenden Wesen fuhren fort zu essen und zu spielen, und obwohl sie ihn mit kühnen, direkten Blicken beobachteten, sagten sie nichts zu ihm.
Wolff lächelte ihnen zu, ließ es aber bleiben, als sie zu erschrecken schienen.
Im Dschungel suchte und fand er Früchte und Nüsse, wie die Meerfrau sie gegessen hatte. Die gelbe Frucht schmeckte nach Pfirsichpastete und das Fleisch der Pseudokokosnuss wie sehr zartes, mit kleinen Walnussstücken vermischtes Rindfleisch.
Danach fühlte sich Wolff sehr zufrieden. Nur – er vermisste seine Pfeife. Aber Tabak war etwas, das in diesem Paradies zu fehlen schien.
Die folgenden Tage streifte Wolff durch den Dschungel oder verbrachte sie im oder in der Nähe des Ozeans. Inzwischen hatte sich die Strandhorde – wie er die am Meeresufer lebenden Frauen und Männer insgeheim nannte – an ihn gewöhnt, und einige lächelten sogar, wenn er morgens erschien.
Eines Tages sprangen ein paar Männer und Frauen auf ihn zu und nahmen ihm – lauthals lachend – seine Kleidung ab. Wolff hetzte der Frau, die seine Hose an sich gerissen hatte, nach. Aber sie eilte in den Dschungel. Und als sie später wieder erschien, kam sie mit leeren Händen.
Inzwischen konnte sich Wolff gut genug verständigen. Man verstand ihn, wenn er langsam sprach. Die Jahre seines Lehrens und Lernens hatten ihn mit einem großen griechischen Wortschatz versehen, und so brauchte er nur die Aussprache und eine Reihe von Wörtern zu bewältigen, die nicht in seinem Autenreith standen.
»Warum hast du das getan?«, fragte er die schöne schwarzäugige Nymphe.
»Ich wollte sehen, was du unter diesen Lumpen verbirgst. Nackt bist du hässlich – aber diese Sachen haben dich noch schlimmer aussehen lassen«, antwortete sie einfach.
»Obszön?«, sagte er, aber sie verstand das Wort nicht.
Er zuckte die Schultern und dachte: Einst, im alten Rom … Aber dies schien eher der Garten Eden zu sein. Die Temperatur war Tag und Nacht angenehm und schwankte höchstens um etwa sieben Grad. Man gelangte problemlos an eine Vielzahl von essbaren Früchten und Pflanzen. Es gab keine Arbeit, keine Miete, keine Politik, keine nationalen oder rassistischen Feindseligkeiten – nur eine leicht zu befriedigende sexuelle Spannung. Und es gab keine Rechnungen, die bezahlt werden mussten. Oder doch?
Es war das Grundprinzip des Universums und der Erde, dass man nichts geschenkt bekam. War dies hier ebenso? Irgendjemand musste doch die Zeche bezahlen …
Nachts schlief Wolff auf einem Haufen Gras in einer großen Baumhöhle, von denen es zahllose gab, denn eine spezielle Art von Bäumen bot diesen natürlichen Unterschlupf geradezu an.
Wolff erhob sich jeden Morgen sehr früh. An einigen Tagen stand er kurz vor dem Morgengrauen auf und beobachtete, wie die Sonne ankam. »Ankommen« war in diesem Fall tatsächlich treffender als »aufgehen«, denn die Sonne dieser Welt – das glaubte er definitiv sagen zu können – ging nicht auf.
Jenseits des Meeres erhob sich eine wuchtige Bergkette, die sich scheinbar endlos ausdehnte. Wenn die Sonne hinter den Bergen hervorkroch, stand sie bereits hoch am Himmel, setzte ihre Wanderschaft fort, zog ihre Bahn geradeaus weiter und verschwand schließlich wieder hinter den Bergen.
Etwa eine Stunde später erschien dann der Mond. Auch er kam hinter den Bergen hervor, glitt in gleicher Höhe über den Himmel und verschwand wieder hinter dem Gebirge.
Jede zweite Nacht prasselten etwa eine Stunde lang heftige Regenschauer hernieder, die Wolff gewöhnlich weckten. Die Luft wurde dann merklich kühler, und er zog sich tiefer in die Höhlung zurück, drückte sich tiefer in das Laub, fröstelte und versuchte, wieder einzuschlafen.
Mit jeder weiteren Nacht fand er das zunehmend schwieriger, und manchmal dachte er an seine eigene Welt, an die Arbeit, die Freunde und den Spaß, den er dort gehabt hatte. Und manchmal auch an Brenda.
Was mochte sie jetzt tun? – Zweifellos trauerte sie um ihn. Auch wenn sie ihm gegenüber allzu oft bitter, gemein und keifend gewesen war – so liebte sie ihn doch. Sein Verschwinden musste ein Schock für sie gewesen sein … und gleichsam einen Verlust darstellen. Allerdings war gut für sie gesorgt. Brenda hatte immer darauf bestanden, dass er eine weit höhere Lebensversicherung abschloss, als er sich eigentlich hatte leisten können. Mehr als einmal hatten sie sich deshalb gestritten.
Dann fiel ihm ein, dass Brenda lange Zeit keinen Pfennig von der Versicherung bekommen würde, da man seinen Tod nicht einwandfrei würde nachweisen können. Doch selbst wenn sie warten musste, bis man ihn gesetzlich für tot erklärte, konnte sie von der Sozialhilfe leben. Das bedeutete zwar eine drastische Einschränkung ihres Lebensstandards, aber sie würde zumindest nicht verhungern.
Sie würde davon leben müssen – weil er, Robert Wolff, um keinen Preis zurückkehren würde!
Er gewann seine Jugend zurück. Obwohl er gut aß, verlor er an Gewicht, und seine Muskeln wurden stärker und fester. Er spürte Elastizität in den Beinen und eine Fröhlichkeit, die er irgendwann in den frühen Zwanzigern verloren hatte.
Am siebten Morgen nach seiner »Ankunft« hatte Wolff seine Kopfhaut gerieben und festgestellt, dass kleine Borsten darauf wuchsen. Am zehnten Morgen erwachte er mit schmerzendem Zahnfleisch. Er rieb das geschwollene Fleisch. Wurde er krank? Er hatte vergessen, dass es so etwas wie Krankheiten gab, denn es war ihm äußerst gut gegangen. Niemand von der Strandhorde schien jemals krank zu werden.
Sein Zahnfleisch schmerzte auch weiterhin – eine Woche lang –, bis er sich daran machte, den natürlich gegorenen Saft der Punschnuss, die in großen Büscheln in den Kronen schlanker, mit malvenfarbenen Zweigen und tabakpfeifenförmigen gelben Blättern versehenen Bäumen wuchs, zu trinken. Schlug man die lederartige Rinde dieser »Nuss« mit einem scharfen Stein auf, entströmte ihr ein Duft wie von fruchtigem Punsch. Sie schmeckte wie Gin-Tonic mit einem Schuss Kirschwasser und hatte die berauschende Wirkung eines Gläschens Tequila. Der Saft linderte die Schmerzen in seinem Zahnfleisch und den Ärger, den er hervorgerufen hatte.
Und dann, neun Tage nachdem die Schmerzen begonnen hatten, stießen zehn winzige, weiße, harte Zähne durch das Fleisch. Die Goldfüllungen in den anderen wurden durch die Wiederkehr der natürlichen Substanz abgestoßen. Dichtes, schwarzes Haar bedeckte Wolffs ehemals kahlen Schädel.
Das war nicht alles. Das Schwimmen, Laufen und Klettern hatte sein Fett hinwegschmelzen lassen. Die hervortretenden Altersvenen waren in glattes, festes Fleisch zurückgegangen. Er konnte weite Strecken laufen, ohne außer Atem zu geraten oder sein Herz wie verrückt schlagen zu hören.
Natürlich erfreute er sich seiner neuen Jugend. Aber gleichzeitig auftauchende Zweifel führten ihn zu der Frage, woran dies alles lag.