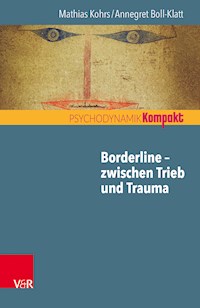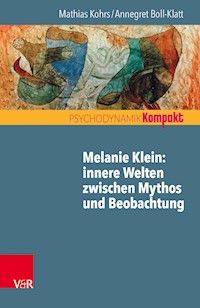
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Psychodynamik kompakt
- Sprache: Deutsch
Melanie Klein polarisiert. Als eine der Begründerinnen der Kinderpsychoanalyse entwarf sie eine radikale Entwicklungspsychologie, deren Implikationen für das Verständnis der komplexen Psychodynamik und für die Behandlung schwerer Persönlichkeitsstörungen bis heute von großer Bedeutung sind. Klein sieht das Seelenleben des Säuglings und damit das Unbewusste aller Menschen in permanenter Auseinandersetzung mit hoch destruktiven Triebkräften, insbesondere Neid und Hass, und steht damit zunächst einmal im scharfen Widerspruch zu Erkenntnissen der auf der Methode der Direktbeobachtung basierenden Säuglings- und Kleinkindforschung. Die Autoren zeigen, dass die Konzeptionen Melanie Kleins in einer modernen Lesart auch verblüffende Übereinstimmungen mit den Ergebnissen der Säuglingsforschung aufweisen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben vonFranz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Mathias Kohrs/Annegret Boll-Klatt
Melanie Klein:Innere Weltenzwischen Mythosund Beobachtung
Mit einer Abbildung
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,Theaterstraße 13, D-37073 GöttingenAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlichgeschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällenbedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Paul Klee, Fänger, 1930/akg-images
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Damatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2566-6401ISBN 978-3-647-99909-8
Inhalt
Vorwort zur Reihe
Vorwort zum Band
1Einführende Überlegungen
2Melanie Klein
2.1Warum Melanie Klein? – Ein Plädoyer für Abgründe
2.2Wer war Melanie Klein?
2.3Verfolgende Objekte und schwierige Patienten
3Der psychoanalytische Säugling – Kindheit als Narrativ!
4Von Freud zu Klein: Unbewusste Phantasien und frühe Objektbeziehungen
5Unwiderstehliche Ängste – die paranoid-schizoide Position: Sprechen über Unsagbares
6Die depressive Position – Trauer, Schuld und ganze Objekte
7Bion – die Entwicklung des Denkens aus der Not
8Fallbeispiel
9Innere Welten als Ergebnis von Direktbeobachtung und Experimenten
10Unterschiedliche Forschungsmethoden – das Spannungsfeld zwischen den klassischen psychoanalytischen Entwicklungstheorien und der psychoanalytisch inspirierten empirischen Säuglings- und Kleinkindforschung
11Der kompetente Säugling – die Psychologie Sterns zur Entwicklung des Selbst
11.1Phase des auftauchenden Selbstempfindens
11.2Phase des Kernselbstempfindens
11.3Phase des subjektiven Selbstempfindens
11.4Phase des Empfindens eines verbalen Selbst
12Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Ansätze von Melanie Klein und Daniel Stern
13Wie viel Integration ist möglich und sinnvoll?
14Bedeutung der Säuglings- und Kleinkindforschung für die psychotherapeutische Arbeit
Literatur
Vorwort zur Reihe
Zielsetzung von PSYCHODYNAMIK KOMPAKT ist es, alle psychotherapeutisch Interessierten, die in verschiedenen Settings mit unterschiedlichen Klientengruppen arbeiten, zu aktuellen und wichtigen Fragestellungen anzusprechen. Die Reihe soll Diskussionsgrundlagen liefern, den Forschungsstand aufarbeiten, Therapieerfahrungen vermitteln und neue Konzepte vorstellen: theoretisch fundiert, kurz, bündig und praxistauglich.
Die Psychoanalyse hat nicht nur historisch beeindruckende Modellvorstellungen für das Verständnis und die psychotherapeutische Behandlung von Patienten und Patientinnen hervorgebracht. In den letzten Jahren sind neue Entwicklungen hinzugekommen, die klassische Konzepte erweitern, ergänzen und für den therapeutischen Alltag fruchtbar machen. Psychodynamisch denken und handeln ist mehr und mehr in verschiedensten Berufsfeldern gefordert, nicht nur in den klassischen psychotherapeutischen Angeboten. Mit einer schlanken Handreichung von 70 bis 80 Seiten je Band kann sich die Leserin, der Leser schnell und kompetent zu den unterschiedlichen Themen auf den Stand bringen.
Themenschwerpunkte sind unter anderem:
–Kernbegriffe und Konzepte wie zum Beispiel therapeutische Haltung und therapeutische Beziehung, Widerstand und Abwehr, Interventionsformen, Arbeitsbündnis, Übertragung und Gegenübertragung, Trauma, Mitgefühl und Achtsamkeit, Autonomie und Selbstbestimmung, Bindung.
–Neuere und integrative Konzepte und Behandlungsansätze wie zum Beispiel Übertragungsfokussierte Psychotherapie, Schematherapie, Mentalisierungsbasierte Therapie, Traumatherapie, internetbasierte Therapie, Psychotherapie und Pharmakotherapie, Verhaltenstherapie und psychodynamische Ansätze.
–Störungsbezogene Behandlungsansätze wie zum Beispiel Dissoziation und Traumatisierung, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, Borderline-Störungen bei Männern, autistische Störungen, ADHS bei Frauen.
–Lösungen für Problemsituationen in Behandlungen wie zum Beispiel bei Beginn und Ende der Therapie, suizidalen Gefährdungen, Schweigen, Verweigern, Agieren, Therapieabbrüchen; Kunst als therapeutisches Medium, Symbolisierung und Kreativität, Umgang mit Grenzen.
–Arbeitsfelder jenseits klassischer Settings wie zum Beispiel Supervision, psychodynamische Beratung, Soziale Arbeit, Arbeit mit Geflüchteten und Migranten, Psychotherapie im Alter, die Arbeit mit Angehörigen, Eltern, Familien, Gruppen, Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie.
–Berufsbild, Effektivität, Evaluation wie zum Beispiel zentrale Wirkprinzipien psychodynamischer Therapie, psychotherapeutische Identität, Psychotherapieforschung.
Alle Themen werden von ausgewiesenen Expertinnen und Experten bearbeitet. Die Bände enthalten Fallbeispiele und konkrete Umsetzungen für psychodynamisches Arbeiten. Ziel ist es, auch jenseits des therapeutischen Schulendenkens psychodynamische Konzepte verstehbar zu machen, deren Wirkprinzipien und Praxisfelder aufzuzeigen und damit für alle Therapeutinnen und Therapeuten eine gemeinsame Verständnisgrundlage zu schaffen, die den Dialog befördern kann.
Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Vorwort zum Band
Dieses Buch versucht, das Spannungsfeld zwischen Entwicklungstheorien und Entwicklungspsychologien zu veranschaulichen, mit dem wir uns heute auseinandersetzen müssen, wenn wir Psychoanalysen und psychodynamische Therapien konzeptualisieren und durchführen. Auf Rekonstruktion beruhenden retrograden Beschreibungen, die den sogenannten »Säugling im Patienten« abbilden, steht der »Säugling der Beobachtung« gegenüber. Exemplarisch für die vielen Kontroversen zu dieser Thematik ist die Auseinandersetzung zwischen Daniel Stern und André Green zu nennen. Melanie Kleins Theorie wird als paradigmatisch für das deduktive Vorgehen der klassischen psychoanalytischen Entwicklungstheorie betrachtet und den Ergebnissen des induktiven Vorgehens der Säuglings- und Kleinkindforschung gegenübergestellt. Eine erkenntnistheoretische Integration unterschiedlicher methodischer Ansätze der Beobachtung und Introspektion wird von Psychoanalytikern und psychodynamischen Psychotherapeuten gefordert. Auch Einfühlung beruht auf guter Beobachtung. Dennoch ist es in Zeiten, in denen integrativem Denken ein hoher Wert beigemessen wird, unverzichtbar, auch das Unvereinbare, wesensmäßig komplett Unterschiedliche zu benennen bzw. einzufordern, dass die im psychotherapeutischen Feld Tätigen diese Diskrepanzen und deren Komplexität in ihrem psychischen Binnenraum halten können.
Was können wir von Melanie Klein lernen? Sie zeigt uns, wie sehr unser frühes Leben bestimmt ist vom existenziellen Ringen um das Überleben des infantilen Selbst in Zuständen, die immer wieder zwischen Todesangst und seligem Triumph oszillieren. Im späteren Leben tauchen solche archaischen Erfahrungen wie archäologische Fundstücke auf und konfrontieren uns mit der Ungültigkeit lieb gewordener Annahmen, dass das Abgründige im Normalen nicht zugegen sei. Die Grenzen zwischen seelischer Gesundheit und Psychopathologie werden dadurch aufgehoben und verwirrende und destruktive Prozesse auch im normalen Seelenleben sichtbar gemacht. Das wird immer wieder von uns Therapeutinnen und Therapeuten als Zumutung empfunden, wobei die Autoren dieses Buches dies eine »zumutbare Unzumutbarkeit« nennen.
Projektion, Introjektion, projektive Identifizierung (vgl. Frank u. Weiß, 2017) sind heute in das therapeutische Allgemeinverständnis übergegangen, ohne dass man sich der gedanklichen Quelle, des Ausgangspunkts bewusst wird. Diese Begriffe für komplexe intrapsychische Prozesse erlauben uns Zugang zu Patienten, welche sich dem »klassischen Szenario in gewisser Weise widersetzen«.
Um die kleinianische Konzeption besser zu verstehen, muss man sich mit der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie auseinandersetzen. Der psychoanalytische Säugling ist gleichsam das Produkt eines retrograd als Narrativ erfassten Kindheitsgeschehens. Im Gegensatz zu Freud setzte sich Klein ausführlich mit der Phantasiewelt kindlicher Patienten auseinander und kam zu dem wichtigen Schluss, dass die Ich-Struktur und intellektuelle Leistungsfähigkeit von Kleinkindern weit unterschätzt werden. Sie erkannte, dass unbewusste infantile Phantasien als frühe Abwehr- und Bewältigungsmechanismen aufzufassen seien. Innere Objekte sind nicht Abbilder von Bezugspersonen, sondern Repräsentanten intensiver Affekte, Impulse, Bedürfnisse und Ängste des kindlichen Selbst. Der umstrittene Begriff der »paranoid-schizoiden Position« versucht, diese frühen emotionalen Turbulenzen und die daraus resultierende Objektbeziehungsdynamik zu formulieren. Er stellt den Versuch dar, das »ungedachte Bekannte« der Frühzeit des kindlichen Selbst mit impliziten Gedächtnisspuren in Worte zu fassen.
Bion hat diese Ideen weiterentwickelt und das »Denken aus der Not« konzeptualisiert. Die emotionale Einbettung im »Containing« bildet die Entwicklungsgrundlage des kindlichen Denkens. So ist das Kind nicht seinen Befindlichkeiten ausgeliefert, solange es diese noch nicht verstehen kann.
Ganz andere Zugänge zur Entwicklung liefern die Beobachtungen der Säuglings- und Kleinkindforschung. Ausgehend von den Beobachtungsergebnissen, die einen »kompetenten Säugling« beschreiben, der von Beginn des Lebens an auf die ihn umgebende Welt bezogen ist, hat Daniel Stern ein Modell der frühen Selbstentwicklung entworfen, in deren Mittelpunkt das somato-affektive Selbstempfinden steht. An Beispielen wird die Bedeutung der Säuglings- und Kleinkindforschung für die psychotherapeutische Arbeit hervorgehoben. Daran anschließend wenden sich die Autoren noch einmal der Frage zu, wie viel Integration sinnvoll und möglich ist, und fokussieren u. a. auf die Bedeutung körperlicher Prozesse, Zustände und Empfindungen als eine Klammer der so unterschiedlichen Ansätze. Konkrete Fallbeispiele bereichern dieses lesenswerte und um konzeptuelle Offenheit bemühte Buch.
Inge Seiffge-Krenke und Franz Resch
»Weil die Psychoanalyse keine Psychologie und die Triebtheorie unsere Mythologie ist und weil die Mythen zuweilen der Weg sind, Wahrheiten auszusprechen, die auf andere Weise nicht gesagt werden können«(Green, 2000a, S. 285).
1Einführende Überlegungen
Als wir gebeten wurden, dieses Buch als Einführung und ersten Überblick über die grundlegenden Gedanken im Werk Melanie Kleins – dazu noch im Gegenlicht der Säuglings- und Kleinkindforschung – zu entwerfen, waren wir spontan interessiert. Dann folgten Zweifel.
An Melanie Kleins Werk, ihrem Gedankengebäude und den daraus folgenden therapeutischen Konzepten scheiden sich die Geister. Auf der einen Seite bildet die kleinianische Community im weiten Feld der inzwischen hoch diversifizierten Landschaft psychoanalytischer Schulen eine besonders abgeschottete Bastion psychoanalytischer Orthodoxie. Es entsteht häufig der Eindruck einer Glaubensgemeinschaft, die ungern in Kontakt mit der übrigen psychodynamischen Welt gerät und noch weniger bereit ist, sich mit wissenschaftlichen Resultaten sonstiger Provenienz, etwa der Säuglingsforschung, auseinanderzusetzen.
Auf der anderen Seite stehen viele psychodynamische Praktiker dem kleinianischen Gedankengut skeptisch bis ablehnend gegenüber, um es sehr vorsichtig zu formulieren. Tatsächlich kommt es häufig zu massiven gegenseitigen Entwertungen, und all diese Phänomene weisen natürlich üblicherweise darauf hin, dass es hier um Wesentliches geht, das aber überwiegend nicht verhandelt werden kann.
Was möchte also dieses Buch?
Die Autoren sind vor dem Hintergrund ihrer langen Erfahrung in der Ausbildung junger Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten davon überzeugt, dass das kleinianische Konzept unverzichtbare Axiome für ein psychodynamisches Denken und therapeutisches Arbeiten bereithält. Viele dieser Axiome haben im Übrigen häufig längst Eingang in zahlreiche Konzeptionen anderer Schulen gefunden und werden von Psychodynamikern selbstverständlich genutzt, ohne dass der kleinianische Ursprung immer genannt oder auch nur mitgedacht wird. Als Beispiel sei das Konzept der projektiven Identifizierung genannt, das inzwischen in zahlreichen theoretischen Systemen genutzt wird und etwa in der modernen intersubjektiven Psychoanalyse unverzichtbar geworden ist (vgl. Bohleber, 2018, S. 718 ff.). Es geht aber noch um mehr.
Es besteht im Rahmen des Mainstreams psychodynamischer Psychotherapie eine gewisse Tendenz – und aus Sicht der Autoren die Gefahr –, unter dem Druck unterschiedlicher Faktoren sehr zielorientierte, störungsspezifische Konzeptionen zu entwickeln. Diese lassen sich unter Umständen manualisieren, gut lehren und lernen, allerdings geht dabei manchmal auch etwas substanziell Psychoanalytisches verloren: das Wissen um das ganz Andere des Unbewussten, mit dem sich jeder Mensch in einer existenziellen Auseinandersetzung befindet, und das ein Leben lang (vgl. Boll-Klatt u. Kohrs, 2018a, S. 3 ff.). Wie Freud es für die Entwicklung unserer Psychosexualität nachgewiesen hat, liegt am Urgrund unserer Seele der nicht auflösbare Konflikt zwischen dem triebhaften Streben mit all seinem regressiven Potenzial und den Anforderungen der Realität, Kultur und Moral.
In der Auseinandersetzung mit kleinianischem Denken lässt sich vermutlich besonders deutlich – und hoffentlich fruchtbar – diskutieren, was nach Auffassung der Autoren in der heutigen Ausbildung junger Psychotherapeutinnen und -therapeuten unverzichtbar ist: die Diversifizierung und der Pluralismus der psychodynamischen Konzeptionen in ihrer Doppelgesichtigkeit als ungeheurer Reichtum einerseits und als ungeheuerliche Zumutung andererseits. Zumutung eben deshalb, weil die zahllosen Konzeptionen unterschiedliche Perspektiven bieten, die aber häufig nicht zu integrieren sind, die unvereinbar bleiben. Daher kann man sich eben nicht auf die behagliche Position eines vielschichtigen Theoriegebäudes zurückziehen, aus dem man sich je nach Bedarf bedienen könnte. Es handelt sich eher um eine »Pluralität der Orthodoxien« (Bohleber, 2019, S. 12), und das schließt eben auch moderne Orthodoxien ein, die häufig nicht bereit oder fähig sind, den komplexen, nicht leicht zu operationalisierenden Reichtum der Konzepte des Unbewussten anzuerkennen.
Das Problem wird wohl nirgends so deutlich wie in der Konfrontation unterschiedlicher Entwicklungstheorien. Sosehr »Klinik und das klinische Denken der Mutterboden der Psychoanalyse« waren und sind (Bohleber, 2019, S. 11), das heißt, die Auseinandersetzung mit den Problemen der Behandlung schwieriger Patienten das Umdenken der psychoanalytischen Theorien immer wieder geradezu erzwungen hat, ist die Grundierung, ja Verwurzelung dieser Konzeptionen in je spezifischen und häufig nicht zu vereinbarenden entwicklungstheoretischen Vorstellungen ein davon nicht zu lösendes Phänomen.