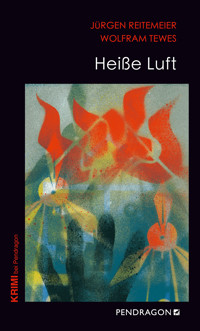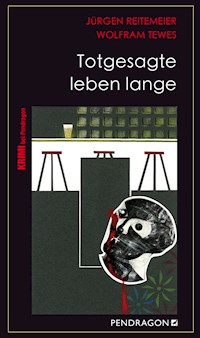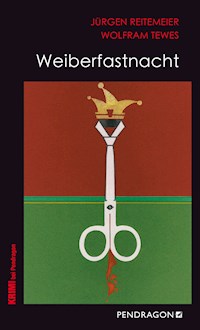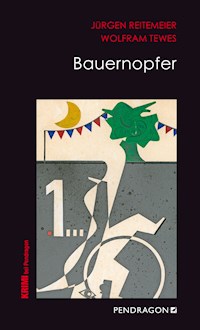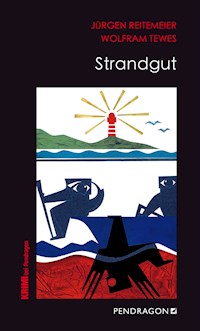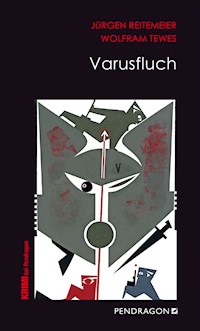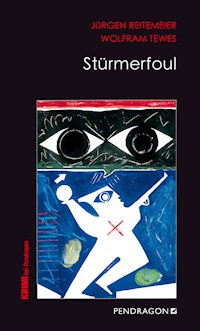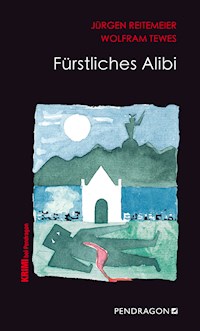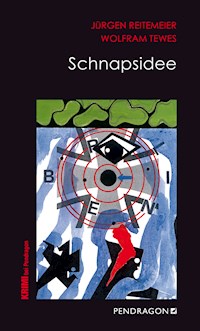Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Regionalkrimis aus Lippe / Jupp Schulte ermittelt
- Sprache: Deutsch
Direkt vor der Dienststelle von Jupp Schulte fallen Schüsse. Er kennt den Mann, der gerade zu Boden ging: Günther Sauer, ein kleiner Gauner, mit dem er schon oft zu tun hatte. Eigentlich ist das ein Fall für die Kreispolizeibehörde in Detmold, doch Schulte pfeift darauf und will auf eigene Faust ermitteln. Dummerweise zwingt eine neue Dienstanweisung Schultes Team dazu, mit der Kreispolizeibehörde zusammenzuarbeiten. Ausgerechnet unter der Leitung seiner Ex-Freundin und Oberkommissarin Maren Köster. Nach und nach enthüllen sie einen groß angelegten Wettbetrug im Profifußball, bei dem es um sehr viel Geld geht. Und plötzlich tauchen auch noch finstere Ganoven auf dem Hof von Bauer Fritzmeier auf - dem Zuhause von Schulte und seiner Familie …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reitemeier / Tewes · Mies gezockt
JÜRGEN REITEMEIER
WOLFRAM TEWES
Mies gezockt
PENDRAGON
1
„Knapp daneben ist auch vorbei!“
Jupp Schulte, von Beruf Polizist und in seiner Freizeit Fußballfan, schrie seine Erleichterung heraus und klatschte vor Begeisterung seinen Enkel Linus ab. Wieder kein Tor für die Arminia aus Bielefeld, wieder hatten die Amateurkicker des DJK Heidental das Glück auf ihrer Seite. Eine Laune der Auslosung hatte den Dorffußballern aus Heidental die Profis von Arminia Bielefeld im DFB-Pokal beschert. Dass die Heidentaler überhaupt so weit gekommen waren, hatten sie jenem Zufall zu verdanken, dass vor vier Jahren etliche Flüchtlinge im Dorf untergebracht worden waren. Schnell hatte sich herausgestellt, dass drei von den jungen Männern hervorragende Fußballer waren. Der Vereinsvorsitzende, ein Bauunternehmer aus dem Ort, hatte sofort die Gelegenheit beim Schopf gepackt und die drei sowohl in seine Firma als auch in die örtliche Fußballmannschaft integriert. Seitdem war es mit dem DJK Heidental stetig bergauf gegangen. Erst ein Durchmarsch von der dritten in die erste Kreisklasse, dann entwickelten sie sich zum Pokalschreck für etliche höherklassige Mannschaften. Mit Arminia Bielefeld war nun ein Höhepunkt erreicht, das Spiel des Jahrhunderts für die Heidentaler. Da es im Dorf keinen Fußballplatz gab, der diesen Namen wirklich verdient hätte, war man nach Detmold umgezogen. Auf den Platz, auf dem normalerweise Post Detmold in der Bezirksklasse kickte und auf dem nun viele Detmolder neidvoll zuschauen mussten, wie sich das kleine Nachbardorf gegen den übermächtigen Gegner erstaunlich wacker schlug. Schulte, der in Heidental wohnte, wollte sich dieses Event natürlich nicht entgehen lassen und stand nun mit seinem Enkel Linus im Fanbereich der Heidentaler. Fast das ganze Dorf war gekommen, jeder wollte bei dieser patriotischen Angelegenheit dabei sein. Selbst Anton Fritzmeier, ein zweiundachtzigjähriger Landwirt, auf dessen Hof Schulte zur Miete wohnte und der sich im normalen Leben nicht die Bohne für Fußball interessierte, fieberte mit. Das hier war nicht das normale Leben, das hier war klein gegen groß, David gegen Goliath, Dorf gegen Großstadt. Da zählte jeder Mann, jede Frau und jedes Kind.
Schulte blickte schadenfroh zum Trainer der Bielefelder, der nicht weit von ihm entfernt am Spielfeldrand stand und einigermaßen ratlos wirkte.
Das Pokalspiel hatte für den Mann aus der Stadt denkbar schlecht begonnen, seine Profikicker taten sich schwer gegen die absoluten Underdogs aus der lippischen Kreisklasse. Nach einem von den Bielefeldern verkrampft und unmotiviert geführten Spiel hatte es lange kein Tor gegeben. Dies hatte sich in der 43. Spielminute beinahe geändert, als die Heimmannschaft durch einen dummen Zufall oder auch durch eine krasse Fehlentscheidung des Schiedsrichters, das war eine Frage der Perspektive, an einen Freistoß gekommen war, der um ein Haar den Bielefelder Abwehrspielern durch die Beine geflutscht wäre.
Welch eine Demütigung für die Profis, wenn dieses Spiel verloren gehen sollte. Ganz Deutschland würde über die Bielefelder lachen, kein Fernsehsender, keine Zeitung würde auf einen höhnischen Kommentar verzichten. Wahrscheinlich war der Trainer froh, als Frank Holzer, der Schiedsrichter, endlich zur Halbzeitpause pfiff, dachte Schulte. Wenn Schulte der Trainer wäre, dann würde er seinen verwöhnten Jungs nun eine Predigt halten, die sie so schnell nicht vergessen würden. Rote Ohren würden sie kriegen, sich in Grund und Boden schämen. Da er aber nicht der Trainer war, und auch sonst hier keinerlei Pflichten zu erfüllen hatte, holte er für alle drei je eine Bratwurst und für sich und Fritzmeier ein Halbzeitpausen-Bier.
Offenbar hatte die übliche Halbzeitansprache des Bielefelder Trainers wenig genutzt, denn die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte. Die Profis schoben sich mutlos den Ball zu, niemand traute sich, die Initiative zu ergreifen. Der Trainer rannte an die Seitenlinie, schrie seine Spieler an, gestikulierte, als müsse er Fliegen vertreiben. Und endlich kam Schwung ins Spiel. Langsam, aber unaufhaltsam übernahmen die Bielefelder die Herrschaft über den Platz. Die Dorfkicker versuchten tapfer, ihnen hinterherzulaufen. Aber sie waren platt, sie kamen kaum noch an den Ball. Die deutlich stärkere Physis der Profis setzte sich durch und das Spiel begann einseitig zu werden. Nur ein Tor wollte nicht fallen. Das weiße Viereck war wie vernagelt. Bis zu der Sekunde im letzten Drittel der zweiten Halbzeit, als der Ball von der rechten Seitenlinie hoch in den Strafraum der Amateure geflogen kam. Der bullige Mittelstürmer der Bielefelder bündelte all seine Energie, schraubte sich hoch, höher als alle Heidentaler jemals in ihrem Leben gesprungen waren und nickte den Ball ins Netz. 0:1. Der Bielefelder Trainer wirkte schlagartig etwas ruhiger. Der Drops ist gelutscht, dachte Schulte. Jetzt drehen die Profis auf und machen unsere Jungs platt. Aber was war das? Was zum Teufel machte denn dieser Schiedsrichter da? Holzer ging nicht etwa zur Mittellinie, wie zu erwarten gewesen wäre. Nein, er wedelte wie eine Windmühle mit den Armen und schüttelte den Kopf. Die Bielefelder Spieler liefen zu ihm, bildeten einen dichten Pulk um ihn herum und schrien auf ihn ein. Doch der Mann in Schwarz war unnachgiebig. Selbst der Linienrichter fasste sich an den Kopf, als der Schiedsrichter auf Abseits entschied. Einen Videobeweis konnte man natürlich bei diesem Spiel nicht abrufen und so konnten die Bielefelder schimpfen, sie konnten Gift und Galle spucken – die Schiedsrichterentscheidung war bindend. Es gab Abstoß vom Tor der Heidentaler und das Spiel war plötzlich nicht wiederzuerkennen. Die Profis spielten nun nicht nur ihre überlegene Kondition aus, nun lenkte pure Wut ihre Aktionen. Ein Heidentaler Spieler nach dem anderen wurde nun Opfer der körperlichen Unterlegenheit. Die Pfeife des Schiedsrichters bleib nicht mehr still. Jede Aktion der Bielefelder wurde abgepfiffen, es kam kein zusammenhängender Spielzug mehr zustande. Schultes Nerven wurden böse strapaziert. Linus, der neben ihm mehr zappelte als stand, war überhaupt nicht mehr zu beruhigen. Nur Fritzmeier schien das alles nicht zu berühren. Er schaute vielmehr, für den alten Landwirt ein lebenslänglich eingeübter Reflex, in den Himmel und studierte die Wolken. „Chibt chleich ’n Schauer“, brummte er und nahm den letzten Schluck aus der Bierflasche. In diesem Moment zückte der Schiedsrichter zum ersten Mal die rote Karte gegen einen Bielefelder. Ein Mann weniger, aber auch das nützte den Heidentalern nichts. Sie gingen immer stärker in die Knie und hätte der Schiedsrichter nicht alles getan, um den Spielfluss zu bremsen, das Ergebnis wäre bereits zweistellig. Im gleichen Maße, wie die Kraft der Amateurfußballer schwand, wuchs die Wut der Profis. Fünf Minuten später flog der nächste Bielefelder vom Platz. Linus, durch sein zartes Alter noch unverdorben und als aktiver Jugendfußballer auch ein ausgewiesener Fachmann, sagte empört: „Aber das war doch gar kein Foul. Der hat den doch sauber vom Ball getrennt.“
„Bist du wohl ruhig!“, schimpfte Schulte. „Ist doch gut für uns.“
Sein Enkel schaute ihn prüfend an. Wahrscheinlich hatte er gerade die letzten kindlichen Illusionen über die Erwachsenen im Allgemeinen und über seinen Opa im Besonderen verloren.
Nur noch wenige Minuten zu spielen. Eine Verlängerung würden die Heidentaler nicht überleben, schon rein körperlich nicht.
Der Bielefelder Trainer machte den Eindruck, jeden Moment auf den Platz rennen und den Schiedsrichter vom Feld prügeln zu wollen. Dann donnerte ein Bielefelder den Ball mit brachialer Gewalt nach vorn. Der Ball prallte einem bedauernswerten Heidentaler gegen die Brust, der ging zu Boden, während der Ball wieder in Richtung des Bielefelder Tores kullerte. Ein Heidentaler Spieler bekam das Leder direkt vor seine Füße, nahm seine letzte Energie zusammen und lief mit dem Ball in Richtung Tor. Aber so schnell er auch lief, zwei Bielefelder Abwehrspieler waren schneller und kurz vor der Strafraumgrenze lernte der Heidentaler den bitteren Geschmack des Rasens kennen. Eine saubere Abwehraktion fanden die Bielefelder Fans und klatschten Beifall. Doch …, was denn jetzt? Es gab einen Pfiff und der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. Wieder Rudelbildung, wieder ließ Frank Holzer keinen Einwand gelten. Ein Heidentaler trat an – der Bielefelder Torwart hielt. Doch wieder pfiff der Schiedsrichter und zeigte erneut auf den Punkt. Wiederholung. Angeblich habe sich der Torwart zu früh bewegt. Nun herrschte Lynchstimmung bei den Bielefelder Spielern und den mitgereisten Fans. „Das pfeift doch heute kein Mensch mehr!“, schrie der Bielefelder Trainer sich die Kehle wund. Wieder lief der Heidentaler Spieler an, trat mit aller noch verbliebenen Kraft hinter den Ball – und der zappelte im Netz. Sekunden später pfiff der Schiedsrichter ab und rannte um sein Leben, er erreichte die Kabine nur knapp.
Zwanzig Minuten später waren Jupp Schulte, Linus und Anton Fritzmeier auf dem Weg zu Schultes Auto, um wieder zurück ins Dorf zu fahren. Sie beeilten sich, denn die Wolken wurden immer dichter und dunkler. Jeden Moment konnte der Regen herunterprasseln. Immer wieder trafen sie auf feiernde, johlende, ihr Glück kaum fassen könnende Heidentaler Bürger, denen der drohende Regen völlig gleich war. Jung und Alt, männlich wie weiblich, alle trunken vor Siegestaumel. Auf dem Parkplatz angekommen, wollte gerade eine kleine Gruppe niedergeschlagener Bielefelder Fans neben Schultes Auto einen Kleinbus besteigen.
„Na Jungs“, begrüßte Anton Fritzmeier den traurigen Haufen. „Pech chehabt, was?“
„Pech?“, ein Mann in Schultes Alter schrie den alten Landwirt fast an: „Das war kein Pech. Wir sind so was von verpfiffen worden. Dieser Schiedsrichter wollte, dass wir verlieren. Das ganze Spiel war ein Skandal und müsste eigentlich wiederholt werden. So eine Sauerei!“
„Stimmt dat?“, fragte ein leicht schockierter Fritzmeier später im Auto. „War dat wirklich Betruch?“
„Na ja“, antwortete Schulte nach einigem Zögern. „Wer weiß das schon so genau.“
2
Seit fünfunddreißig Minuten war Günther Sauer ein reicher Mann.
Zärtlich strich er über das weiche, schwarze Leder seines flachen Aktenkoffers. Es war nicht der Koffer selbst, der ihn so glücklich machte, sondern dessen Inhalt. Es nahm ihm fast den Atem, als er an die vielen großen Geldscheine dachte. Ganz frische Banknoten, die noch knisterten, die noch nicht von tausend Händen abgegriffen waren. Banknoten im Wert eines Einfamilienhauses. Mit zitternden Fingern klaubte er einen dünnen Zigarillo aus einer dunkelroten Schachtel und zündete es an. Nach einigen Zügen wurde er langsam ruhiger.
Er unterdrückte den Impuls, zum wiederholten Male den Koffer zu öffnen und hineinzuschauen. Nicht hier auf der Straße, wies er sich selbst zu recht. Nicht, wenn du beobachtet werden kannst. Er zwang sich, so lässig wie möglich durch die Bielefelder Altstadt zu gehen. Bummeln, sagte er sich. Du musst aussehen wie Einer, der einfach einen lockeren Nachmittagsbummel macht. Okay, es war nicht gerade das Wetter für einen entspannten Bummel. Regen und Sturm waren in diesen Tagen, es war Anfang März, mehr die Regel als die Ausnahme. Er zog den Kopf zwischen die Schultern, schlug den Mantelkragen hoch und so langsam wie seine Nerven dies zuließen, ging er Richtung Bielefelder Westen. Bereits nach wenigen Metern spuckte er den Zigarillo, den ein dicker Regentropfen nass und unbrauchbar gemacht hatte, achtlos auf den Bürgersteig.
Vor etwa einer Stunde war er den Weg umgekehrt gegangen. Er hatte sein Auto, einen uralten grellroten Škoda Octavia, irgendwo in der Nähe des Siegfriedplatzes geparkt und sich zu Fuß in die Altstadt aufgemacht. Da hatte sich in seinem Köfferchen neben der Packung Zigarillos nur der Wettschein befunden. Klein und völlig unscheinbar, aber ungeheuer wertvoll. Mit Magenkrämpfen hatte er das Wettbüro betreten und versucht, den Wettschein so lässig wie möglich auf den Tresen zu legen. Immer in der Hoffnung, dass niemand ihm ansah, wie flau ihm zumute war. Ein junger Angestellter hatte den Schein entgegengenommen, ihn mehrfach überprüft und war dann zu seinem Computer gegangen, um die Daten des Wettscheines einzugeben. Daraufhin war er aufgesprungen und mit dem Schein in der Hand in ein Hinterzimmer gestürmt. Sauer hatte immer wieder erregte Männerstimmen hören können, die klangen, als würden sie streiten. Irgendwann kam der junge Angestellte zusammen mit einem anderen, etwas älteren Mann wieder nach vorn. Sauer wurde aufgefordert, seinen Personalausweis vorzulegen. Als der überprüft war, hatte der Ältere resigniert mit den Achseln gezuckt und seinen Mitarbeiter angewiesen, die Summe auszubezahlen. Sauers Herz schlug Salti, als der Angestellte zu einer Art Automat ging, den Wettschein in einen Schlitz steckte und der Apparat kurz darauf begann, einen Geldschein nach dem anderen auszuspucken. Zweihundertachtzigtausend Euro, so viel Geld hatte Günther Sauer noch nie in seinen dreiundsechzig Lebensjahren auf einem Haufen gesehen. Wie in Trance hatte er die Scheine in den Koffer gepackt, mit zittriger Hand einen Beleg signiert und dann das Wettbüro verlassen. Draußen auf der Straße war er nach einigen hastigen Schritten stehen geblieben, um wieder einen klaren Gedanken fassen zu können. Sein erster Impuls war gewesen, in eine der zahlreichen Kneipen der Altstadt zu gehen, um die Nerven zu massieren. Doch dann war der Drang, eine möglichst große Distanz zwischen dem Wettbüro und sich selbst zu schaffen, immer stärker geworden. Fast fluchtartig war er dahingestürmt. Erst als er die trostlose Unterführung des Ostwestfalendamms durchschritten hatte, war er wieder zur Besinnung gekommen.
Wieder zurück im Bielefelder Westen stellte sich ein Glücksgefühl ein. Er war so reich wie noch nie in seinem Leben. Schon bevor er den Gewinn abgeholt hatte, waren seine Gedanken nur um dieses Thema gekreist. Was würde er mit all dem Geld anfangen? Ein Haus kaufen? So etwas kam für einen wie ihn, den seine Freunde den Windhund nannten, nicht infrage. Günther Sauer war nicht der Mann, der den Rest seines Lebens mit Vorsicht und Vernunft vergeuden würde. Er wollte leben, wollte Spaß haben, es so lange richtig krachen lassen, bis ein völlig erschöpfter Schutzengel eines Tages den Stecker rausziehen würde. Fast wollüstig malte er sich seine Zukunft in den schönsten Farben aus. Dass es immer noch regnete, dass die Feuchtigkeit ihm aus den Haaren ins Gesicht tropfte und sein Mantel immer schwerer an ihm hing, war ihm nicht bewusst. Doch auf Höhe des Cafés Wunderbar verdunkelte ein Gedanke sein Gemüt, wie eine aus dem Nichts kommende Wolke an einem Sonnentag. Das Geld war zwar in seinem Koffer, aber es gehörte ihm nicht. Und immer stärker drängte sich die Frage in den Vordergrund, wie der Mann, dem der Gewinn eigentlich zustand, wohl reagieren würde. Es war nur eine Frage von Stunden, bis er bemerkte, dass der Windhund ihn hintergangen hatte. Und dann?
Als Sauer die Fahrertür des altersschwachen Škodas aufschloss, wusste er, was zu tun war. Verschwinden würde er. So schnell wie möglich und so weit weg wie nötig.
3
Es regnete und regnete und das seit Wochen. So eine graue Suppe, die da draußen herrschte, machte schwermütig. Außerdem verbrachte sie seit Tagen die Zeit in ihrer neuen Wohnung mit Tapeten abreißen, Wände streichen und Farbreste von Fußleisten kratzen. Das waren sowieso schon Arbeiten, die jedes Zufriedenheitsgefühl niedermachten. Und dann noch dieser widerliche Dauerregen.
„Kind, du musst dir deine neue Wohnung erarbeiten“, hatte ihre Mutter ihr geraten. Meine Mutter, Zoé Stahl schnaubte, die hatte zu allem einen guten Rat. Na, sagen wir einen Rat, korrigierte sie ihren Gedanken.
Ihre Mutter und sie, ja, das war auch so eine Geschichte. Nachdem diese sich damals von Zoés Vater getrennt hatte, arbeitete sie eine Zeit lang in Detmold und ordnete ihr Leben neu. Ohne Zoé, die war bei ihrem Vater in Hamburg geblieben.
Ihre Mutter war gegangen, alleine, sie hatte der Großstadt und der Familie den Rücken gekehrt und sich für dieses Kaff, für dieses Detmold entschieden. Anscheinend hatte Zoés Mutter viele schöne Momente in dieser Stadt erlebt, denn sie redete oft über diese Zeit. Sie hatte jemanden kennengelernt, einen Polizisten. Ihre Mutter hatte den Namen mal erwähnt. Zoé hatte ihn vergessen.
Als Zoé ihr am Telefon berichtet hatte, dass sie jetzt in Lippe eine neue Anstellung bekommen habe, da kam die Mutter ins Schwärmen.
„Detmold, die schönste Stadt, die ich kenne“, hatte sie erfreut gerufen. „Kind, dort hatte ich die glücklichste Zeit meines Lebens.“
Zoé wusste, was jetzt kam. Ihr war die Hommage, die ihre Mutter dieser Stadt entgegenbrachte, schon immer auf die Nerven gegangen.
„Das war früher“, hatte Zoé missmutig geantwortet. „Heute ist dieses Dorf der Inbegriff der Langeweile.“
„Dorf, also Kind, ich bitte dich …“, hatte ihre Mutter erneut zu einer Jubeltirade angesetzt. Doch Zoé beendete wütend das Telefongespräch. Sie wollte weder Kind genannt werden, noch wollte sie die nächste Lobhudelei auf dieses lippische Kaff hören. Zoé wollte nicht in die Provinz, nicht nach Detmold und auch in keine andere Kleinstadt. Doch was sollte sie machen? Sie war Beamtin, jung und ungebunden dazu, da war es manchmal nicht so einfach mit der Ortswahl des Arbeitsplatzes.
Vor Kurzem war hier in Detmold unverhofft eine Stelle frei geworden. Ein Kollege war von heute auf morgen, im Rahmen eines EU-Austauschprogrammes, nach Bulgarien oder Rumänien versetzt worden. Wohin genau wusste Zoé nicht. Das war ihr auch egal. Doch sie war sicher, dass sich für so einen Austausch keiner freiwillig gemeldet hatte. Also eine Strafversetzung, vermutete sie. Und was war diese neue Stelle für sie? Was hatte sie angestellt, um auf diesen Arbeitsplatz versetzt zu werden? Detmold oder Bulgarien? Wo ist der Unterschied, fragte sich Zoé resigniert. Auf die Schnelle fiel ihr keiner ein. Für sie waren beide Orte eine Höchststrafe. Dabei hatte sie sich nichts zuschulden kommen lassen und doch wurde sie, wie sie es empfand, strafversetzt. Strafversetzt nach Detmold.
Drei Jahre war sie in Köln Staatsanwältin auf Probe gewesen. Immerhin: Köln! Ihr Plan danach war es gewesen, die Welt kennenzulernen. Daher wollte Zoé, nach dieser Anstellung als Beamtin auf Probe, so schnell wie möglich in eine andere bundesdeutsche Metropole wechseln. Sie liebte die Hektik, die Emsigkeit und sogar das Laute der großen Städte.
Doch dann wurde die Stelle in Detmold frei und der Generalstaatsanwalt hatte ihr ziemlich unmissverständlich zu verstehen gegeben: „Die oder keine, Frau Stahl.“
Zoé hatte sich dieser Offerte widerwillig gebeugt. Als sie dem Angebot ihres Chefs zugestimmt hatte, war der plötzlich nicht mehr streng gewesen, sondern hatte ihr hocherfreut die Hand geschüttelt und ihr eine glänzende Karriere in Aussicht gestellt. In diesem Moment war Zoé sicher, dass der Generalstaatsanwalt gerade ein Problem weniger hatte und froh darüber war, dass er die Stelle in Detmold endlich besetzt hatte. Und sie war dem Kerl auf den Leim gegangen.
So ihren Gedanken nachhängend starrte Zoé durch die Fensterscheibe der Terrassentür in die Dunkelheit. Dicke Regentropfen prasselten unaufhörlich gegen das Glas. Und wieder packte Zoé das Selbstmitleid. Die Dauerbaustelle in ihrer Wohnung, das widerliche Wetter, die fremde Stadt, in der sie niemanden kannte, all das zusammengenommen, war für Zoé der Inbegriff der Ungemütlichkeit. Diese Atmosphäre war kaum noch zu ertragen, fand sie.
Zoé kramte in ihrer Arbeitshose nach einer zerknüllten Packung Zigarillos. Fingerte einen heraus und steckte sich den Tabakstängel in den rechten Mundwinkel. Dann sah sie wieder durch die Fensterscheibe der Terrassentür nach draußen. Der Regen hatte noch einmal an Intensität zugelegt. Sollte sie wirklich da draußen ihrer Sucht frönen? Oder besser ihren gerade getätigten Schwur brechen und in ihrer Wohnung rauchen?
Niemals, bestätigte sie sich mit fester Stimme ihren vor drei Tagen gefassten Beschluss, der da lautete: Rauchen? Nicht in dieser Wohnung!
Zoé zog den Zigarillo wieder aus ihrem Mundwinkel und versuchte, ihn zurück in die Schachtel zu stopfen, was natürlich nicht gelang. Ärgerlich zerdrückte sie den Glimmstängel und warf ihn in den Mülleimer.
Verdammtes Detmold! Zoé hatte das Gefühl, dass sie immer schwermütiger wurde. In den letzten Tagen hatte sie durch erhöhten Fernsehkonsum ihre Einsamkeit zu bekämpfen versucht. Also griff sie auch heute auf dieses scheinbar bewährte Mittel zurück. Doch es gab keinen Programmbeitrag, an dem sie wirklich Interesse hatte.
Bei der Diskussionssendung „Hart aber fair“ beendete Zoé ihren Rundgang durch das Programmangebot. Gerade leitete der Moderator, Frank Plasberg, die Schlussrunde mit einem kleinen Videospot ein. Es wurde Innenminister Seehofer gezeigt, der der Bundeskanzlerin ob dieses neuen Virus, Corona, den Händedruck verweigerte. Die Runde lachte.
„Zum Ende dieser Sondersendung ‚Hart aber fair‘ mit dem Thema: Zwischen Hysterie und begründeter Angst vom 2. März, was nehmen Sie, meine Damen und Herren, als Erkenntnis mit aus dieser Runde?“
Zuerst antwortete Professor Dr. Bandelow, ein renommierter Angstforscher und Psychiater: „Man sollte mit gesundem Fatalismus an die Sache gehen und denken, dass schon nichts passieren wird. Ich denke, das kann man vielen Leuten ans Herz legen“, versuchte er den Druck aus der Situation zu nehmen.
Als Nächstes äußerte sich Frau Dr. Johna, Mitglied des Vorstandes der Bundesärztekammer, zu dem Thema: „Ich habe mitgenommen, dass es, so glaube ich, sinnvoll ist, die Situation jeden Tag neu zu bewerten, weil sie sich schnell verändern kann. Zum jetzigen Zeitpunkt brauchen wir uns, glaube ich, überhaupt keine Sorgen zu machen. Das kann sich aber ändern.“
Der NRW-Gesundheitsminister Karl Josef Laumann bedankte sich bei Plasberg artig, dass die Sendung einen kleinen Beitrag dazu geleistet habe, dass sich die Leute nicht ganz so viele Sorgen machen müssten. Ansonsten würde er sich jetzt öfter die Hände waschen.
Genervt schaltete Zoé den Fernseher wieder ab. Dieses Corona-Virus war seit einigen Tagen mehr und mehr ein Thema in den Medien. Aber wenn man den Fachleuten, die gerade ihre Meinung zum Besten gegeben hatten, Glauben schenken konnte, dann lautete die Quintessenz: ernstnehmen, aber nicht die Pferde scheu machen. Hin und wieder mal die Hände waschen und die Selbigen weniger schütteln, ansonsten locker bleiben.
Neben dem beschissenen Alltag, den Zoé gerade durchlebte, war dieses Thema Corona auch keine Erleichterung für sie. Sie beschloss, die Strategie ‚Fernsehen gegen Niedergeschlagenheit‘ nicht weiter zu ihren Lösungsansätzen zu zählen. Sie musste raus, raus aus dieser ungemütlichen Wohnung, weg von dieser Baustelle. Mit Menschen reden, das wäre jetzt genau das Richtige. Und wo fand man Menschen, wenn man neu in einer Stadt war? Genau, sie hielten sich in Kneipen auf. Eine gute Kneipe, das war fast immer eine Lösung.
Eine halbe Stunde später stapfte Zoé entschlossen durch den Regen den Bandelberg hinunter. Die junge Frau zog den dicken Parka enger um ihren Körper, so konnte sie sich einigermaßen vor dem Regen und dem nasskalten Wind schützen. Während Zoé die Straße entlangtrottete, starrte sie auf den regennassen Asphalt. Dabei fluchte sie unentwegt vor sich hin. Die Unflätigkeiten, die die Frau dem Sauwetter entgegenschleuderte, wurden jedoch immer wieder von einem Satz unterbrochen, den sie wie ein Mantra zwischen die Schimpftiraden platzierte. Es lautete: „Irgendwo in dieser verdammten Stadt muss es doch eine Kneipe geben.“
Es gab einige. Das musste Zoé Stahl wenige Minuten später zugeben. Sie hatte keine besondere Vorstellung, was für eine Art Lokal es sein sollte, in dem sie ihr Bier trinken wollte, und so nahm sie eine der ersten Gaststätten, die an ihrem Weg lagen. Cosmo Lounge stand auf einem beleuchteten Schild geschrieben. Zoé fackelte nicht lange. Cosmo Lounge, klingt gut, dachte sie und trat entschlossen ein.
Eine Minute später blätterte sie bereits in einer Getränkekarte. Zoé trank Bier! Meistens jedenfalls. Heute stand ihr der Sinn nach etwas anderem, nach Sonne, nach Karibik. Genau, bei diesem Scheißwetter war ein Cocktail genau das richtige Getränk, um das Lebensglück zurückzuholen. Sie entschied sich für einen Caipirinha. Zwar nicht Karibik, aber immerhin Südamerika, dachte Zoé, als sie den ersten Schluck des fruchtig süßen Limettencocktails genoss.
Sie stand an der Theke und musterte die Gäste. Ein Mann unbestimmten Alters, der sie stark an einen Fernsehschauspieler erinnerte, fiel ihr auf.
In einem der dritten Programme wurde derzeit eine Kultserie aus den Achtzigerjahren wiederholt, Monaco Franze, der ewige Stenz. Und genau an diesen Kerl erinnerte Zoé der Mann, der sie mittlerweile mit seinen Blicken auszog.
Schleimiger Typ, dachte Zoé. Und ging nach draußen, um zu rauchen. Während sie ihren Zigarillo anrauchte, hing sie weiter ihren Gedanken nach. In der Fernsehserie, die sie sich angesehen hatte, war der Typ, dieser Monaco Franze, erst Kommissar und später Privatdetektiv gewesen.
Wäre ja verrückt, wenn der Mann da, dieser Schulte wäre, dieser Hauptkommissar, den ihre Mutter immer wieder erwähnte, dachte Zoé. Doch nein, das konnte wirklich nicht sein. Dieser Schulte, der musste deutlich älter sein als der Kerl da drinnen.
Der Glotzer war irgendwas zwischen vierzig und fünfzig Jahre alt. Der Typ wirkte ziemlich aus der Zeit gefallen mit seiner Bundfaltenhose, Sakko und einer Lederkrawatte aus den Achtzigern. Das ganze Outfit wurde von der Frisur noch getoppt. Die Haare zu lang, der Seitenscheitel zu exakt.
„Darf ich mich dazustellen?“, wurde Zoé aus ihren Gedanken gerissen. Vor Schreck ließ sie ihren Zigarillo fallen. Als der in der Pfütze zu ihren Füßen landete, war ein kurzes leises Zischen zu hören. Der ist hin, dachte Zoé und blickte noch eine Sekunde auf die im Wasser dümpelnde Rauchware. Dann bückte sich der Mann, der ihr den Blutdruck vor wenigen Sekunden auf zweihundert getrieben hatte, um das braune Etwas aus der Wasserlache zu fischen und es ihr mit den Worten: „Ich glaube, den sollten Sie nicht mehr weiter rauchen“, unter die Nase zu halten.
Zoé blickte in das lässige, arrogante Grinsen dieses Monaco Franze. Der kramte jetzt in seiner Sakkotasche und förderte eine Schachtel Ernte 23 zutage. Er klappte den Deckel auf und bot ihr eine Zigarette an.
Zoé rauchte normalerweise nur Zigarillos. Aber Ernte 23, das hatte was. Die hatte ihr Opa damals schon geraucht. Da war es natürlich naheliegend, dass auch Zoés erste Zichte eine Ernte 23 gewesen war. Denn leichter als bei ihrem Opa war an die verbotene Ware nicht heranzukommen.
Zoé nahm eine aus der Schachtel und ließ sich von dem Kerl Feuer geben.
„Henry Fischer“, sagte der Mann, als der das silberne Feuerzeug zuschnappen ließ.
Zoé verstand nicht „Wie bitte?“, fragte sie verdattert nach.
„Henry Fischer“, antwortete der Mann. „Ich heiße Henry Fischer.“
„Ach so, ja“, Zoé nickte und nahm einen tiefen Zug. Sie wollte nicht mit dem Mann reden und versuchte, Distanz zu schaffen. Doch das schien diesen Monaco Franze nicht weiter zu stören.
„Sind Sie zum ersten Mal hier in diesem Lokal?“, fragte er.
Zoé antwortete nicht. Sie rauchte.
„Warum ich frage?“, gab die Nervensäge sich Zoés vermeintliche Antwort selbst.
Zoé rauchte.
„Na, ich habe Sie noch nie hier gesehen“. Er grinste frech. „Und Sie wären mir aufgefallen.“
Zoé drückte ihre Zigarette in einem Aschenbecher aus, der auf einem Tischchen stand. „Ich gehe wieder rein“, sagte sie knapp.
Hastig warf auch der Mann seine Zigarette in den Ascher und eilte ihr hinterher. „Ich auch“, sagte er scheinbar völlig unbekümmert und schob ein „Scheiß Wetter“ nach.
Zoé ging zurück an die Theke und trank den letzten Schluck aus ihrem Glas.
So als würden sie sich schon hundert Jahre kennen, stellte sich der Mann zu ihr und bestellte bei dem Kellner, der gerade vorbeiging. „Noch zwei Caipi“, sagte er betont lässig und hob zur Bekräftigung zwei Finger wie ein Victoryzeichen in die Luft.
Zoé starrte den Mann verblüfft an. Wie dreist war der denn, fragte sie sich und laut sagte sie zu ihrem Gegenüber: „Was machen Sie hier eigentlich?“
Der blähte kurz die Backen und ließ geräuschvoll die Luft entweichen. „Ach, ich war mit einem Geschäftspartner verabredet.“ Er zuckte mit den Schultern. „Aber ich schätze, der kommt nicht mehr. Ich habe schon zehn Mal versucht, ihn zu erreichen. Der Kerl meldet sich einfach nicht. Ziemlich unangenehme Geschichte.“ Es folgte eine bedeutungsvolle Pause, die mit einem Seufzer beendet wurde. „Das wird Ärger geben“, sagte er mit einem traurigen Ton in der Stimme. „Aber, na ja, heute kann ich da eh nichts mehr machen.“
Der Kellner stellte zwei Cocktails auf den Tresen. „Gehen die auf deinen Deckel, Heinrich?“, fragte er. Der Angesprochene nickte, nahm sein Glas und sagte dann aber fast im Plauderton: „Mit einer schönen Frau aus Brasilien wollte ich schon immer mal einen Cocktail trinken. Prost!“
4
Wieder warf Günther Sauer einen Blick in den Rückspiegel. Hatte er seinen Verfolger endgültig abgehängt? Oder nur aus den Augen verloren? Bei diesem Dauerregen war es nicht leicht, hinter sich etwas zu erkennen. Er beschleunigte den Škoda, so gut es ging, wurde aber umgehend durch eine rote Ampel in Höhe der Kreispolizeibehörde Detmold wieder ausgebremst. Nervös hämmerte er mit den Fingern auf das Lenkrad, warf immer wieder einen Blick in den Spiegel. Aber der taubenblaue Ford Mondeo Kombi war nicht zu sehen. Während er quer durch die Detmolder Innenstadt gefahren war, hatte ihn dieses Auto verfolgt. Mal näher, mal weiter entfernt. Sauer, ohnehin mit den Nerven am Ende, fühlte sich verfolgt. Zwei, vielleicht auch drei Straßen, okay, aber durch die ganze Stadt? Das konnte kein Zufall sein. Und sein knallroter Škoda war natürlich auch leicht zu verfolgen, wie ein Leuchtfeuer stach er aus dem grauen, weißen und schwarzen Einerlei der anderen Autos heraus.
Als die Ampel umsprang, drückte er das Gaspedal durchs Bodenblech. Der Škoda heulte auf, konnte aber kaum schneller fahren, weil sich vor ihm eine Schlange gebildet hatte. Wieder ein hastiger Blick in den Rückspiegel. Kein taubenblaues Auto zu sehen. Sauer atmete tief durch. Langsam beruhigte er sich. Offenbar hatte er sich die Verfolgung doch nur eingebildet. Er würde dringend etwas für seine Nerven tun müssen, nahm er sich vor. Aber erst wollte er mit dem Polizisten Jupp Schulte sprechen. Er hatte sich umgehört und wusste nun, dass Schulte nicht mehr in der Kreispolizeibehörde arbeitete.
Günther Sauer brauchte dringend Hilfe, und die würde er hoffentlich bei diesem ungewöhnlichen Polizisten finden, der ihm schon mehrfach aus der Patsche geholfen hatte.
Es war nicht mehr weit bis zu der ehemaligen Gaststätte Obernkrug, in der Schultes neue Dienststelle untergebracht war. Sauer beschloss, den Octavia nicht direkt vor der Gaststätte zu parken, um den Verfolger nicht dadurch auf seine Spur zu locken. Aber gab es ihn überhaupt? Immer noch war hinter ihm kein taubenblauer Ford Mondeo zu sehen. Trotzdem, dachte er, sicher ist sicher. An der großen Kreuzung Bielefelder Straße/Heidenoldendorfer Straße fuhr er auf den Parkplatz eines kleinen russischen Supermarktes. Von hier aus war es zwar noch ein kleiner Fußmarsch, aber per pedes würde er nicht so auffallen, wie mit dem leuchtendroten Škoda. Falls er wirklich beobachtet wurde, würde man ihn vermutlich in dem Supermarkt suchen. Bei diesem Gedanken lachte er schadenfroh in sich hinein. Er war bereits wieder, da die Gefahr offenbar nur eingebildet war, auf dem Wege zu einem gewissen seelischen Gleichgewicht. Kurz überlegte er, ob er den schwarzen Aktenkoffer, der unter dem Beifahrersitz versteckt lag, mitnehmen sollte, entschied sich aber dann dagegen. Zu gefährlich, ihn mitzuschleppen. In diesem alten Auto lag er sicherer. Kein Autoknacker dieser Welt würde darin ein kleines Vermögen vermuten. Ein feiner, aber kalter Nieselregen empfing ihn auf dem Parkplatz. Sauer schlug den Mantelkragen hoch und machte sich mit eingezogenem Kopf auf den Weg.
Auf der Höhe des kleinen Arnimsparks überquerte er die viel befahrene Bielefelder Straße. Fußgänger waren hingegen so gut wie keine unterwegs, was sicherlich dem Regen geschuldet war. Auf dem Bürgersteig der anderen Seite angekommen, blieb er kurz stehen, schaute sich um und … erschrak. Ein taubenblauer Ford Mondeo fuhr in diesem Augenblick an ihm vorbei. Am Lenkrad saß ein kleiner Mann mit Sonnenbrille, was angesichts des Nieselregens völlig absurd war, und schaute ihn aufmerksam an. Für Sekunden stand Sauer schreckensstarr im Regen, unfähig sich zu bewegen. Er sah, wie der Mondeo abbremste und nach links in die schmale Gasse Am Heidenbach einbog, genau da, wohin auch Sauer wollte. Es war völlig ausgeschlossen, dass der Mann mit der Sonnenbrille dies wusste. Er wollte sicherlich dort, vielleicht vor der Bäckerei, anhalten, um Sauer dort aufzulauern. Sauers Schockstarre ließ nach und er begann zu laufen. So schnell er konnte. Der Sonnenbrillenmann würde einige Zeit brauchen, um einen freien Platz zu finden. Dann musste er noch aussteigen. Dies alles würde Zeit kosten. Diese Zeit musste Sauer für sich nutzen und an ihm vorbeikommen. Es waren nur noch hundert Meter bis zum Obernkrug, das musste doch zu schaffen sein. Trotz seiner dreiundsechzig Jahre fühlte sich Sauer noch gut in Schuss. Er trug den Spitznamen Windhund nicht ohne Grund. Er achtete nicht auf den Regen, rannte durch tiefe Pfützen, war schon an der Bäckerei vorbei, als er sah, dass der Mondeo einen Parkplatz gefunden hatte und sein Fahrer dabei war, auszusteigen. Sauer beschleunigte noch einmal, obwohl seine Lunge bereits jetzt zu zerspringen drohte. Dann sah er die Natursteinfassade des Obernkrugs vor sich. Noch fünfzig Meter. Er wagte nicht, sich nach seinem Verfolger umzuschauen. Noch dreißig Meter. Dann endlich hatte er die unterste Stufe der Treppe, die zum Eingang führte, erreicht. Ein Gefühl von Triumph schwappte hoch, ließ ihn die Anstrengung vergessen und mobilisierte letzte Kräfte. Auf der Plattform direkt vor dem Eingang angekommen, konnte er der Versuchung nicht widerstehen, sich nach seinem Gegner umzusehen. Was er sofort bereute. Denn etwa zwanzig Meter vor der Treppe stand ein kleiner Mann mit einem viel zu großen Mantel und mit Sonnenbrille, hielt den rechten Arm hoch, wobei seine Faust direkt auf Sauer zeigte. Und nicht nur seine Faust, sondern auch der Lauf einer Pistole. Als Sauer gerade den letzten und rettenden Satz zur Eingangstür machen wollte, löste sich der Schuss.
Die fünf Beamten, die in der ehemaligen Kneipe ihren Dienst versahen, saßen bei einer Besprechung zusammen. Zumindest nannten sie es so, wenn sie wieder mal nicht wussten, was sie tun sollten und sich, dank fehlender Aufgaben, zu einer Runde Kaffee trafen. Die vier Männer und die eine Frau waren Verdammte, Verstoßene, Ausgesonderte. Allesamt Querköpfe, die nicht in das normale Schema des Polizeiapparates passten und damit zum Störfaktor geworden waren. Jedenfalls hatten ihre Vorgesetzten dies so empfunden und sie in diese sogenannte Dienststelle abkommandiert, die von ihren Insassen anfangs verächtlich, mittlerweile liebevoll Lippisch-Sibirien genannt wurde.
Manfred Rosemeier, der sich wie kein anderer hier gemütlich eingerichtet hatte, stellte gerade eine neue Kanne Kaffee auf den Tisch. Adelheid Vahlhausen zeichnete, ohne sich am Gespräch der anderen zu beteiligen, eine Skizze ihrer neuen Wohnung, um die Position der Möbel festzulegen. Hubertus von Fölsen, der Grandseigneur der Truppe, berichtete begeistert, dass er nun endlich einen Verlag für sein Buch gefunden habe. Marco van Leyden lungerte wie immer schlecht gelaunt auf seinem Stuhl und warf hin und wieder einen bissigen Kommentar ein. Jupp Schulte, der einzige Einheimische, machte sich ebenfalls über das Buch von Fölsens, in dem es um eine Reform der Polizeiarbeit in NRW ging, lustig. Rosemeier, der an solchen Debatten kein Vergnügen fand, stellte sich vor das Fenster.
„Was für ein Mistwetter“, sagte er nach einer Weile. „Regen, Regen. Wo kommt das ganze Wasser nur her und wo will es eigentlich hin?“
Da die anderen ihn mit dieser philosophischen Frage allein ließen, starrte er weiter in den Regen und auf die Treppe, die zum Hauseingang führte.
„Was macht der denn da?“ Plötzlich wirkte der sonst immer so entspannte Rosemeier aufgeregt. „Warum rennt der denn so? Wegen des bisschen Regens?“
Die anderen redeten einfach weiter. Niemand achtete auf das, was Rosemeier kommentierte.
„Der kommt hierher“, rief Rosemeier, immer lauter werdend. „Wer das wohl ist?“
„Von wem redest du denn?“, wollte Schulte genervt wissen.
„Von diesem Mann, der, wie von tausend Teufeln gehetzt, durch den Regen läuft, direkt auf uns zu. Muss jede Sekunde hier reinplatzen. Und da kommt noch einer. Häh, der trägt ja eine Sonnenbrille. Und dass bei dem Wetter.“
Nun war auch Schulte aufmerksam geworden und stellte sich neben Rosemeier. Fast direkt vor ihnen nahm gerade ein Mann im Mantel die letzten Stufen der Treppe. Aber anstatt direkt die Tür zu öffnen, blieb er auf dem Podest vor der Tür stehen und schaute sich um. Dort stand zwanzig Meter von ihm entfernt eine weitere Person.
„Was macht der denn?“, rief Rosemeier so aufgeregt, dass sich nun auch Marco van Leyden neben ihn stellte. Alle zusammen sahen sie, wie der kleine Mann in seine Manteltasche griff, plötzlich eine Pistole in der Hand hielt und damit direkt auf den Mann zielte, der auf dem Podest stand. Alle zuckten zusammen, als der Schuss fiel. Sofort drehte sich der Sonnenbrillenträger um und rannte davon. Wie ein Blitz startete van Leyden, um ihn zu verfolgen. Schulte folgte ihm sofort. Dem zusammengekrümmten Körper des Opfers, das stark blutend direkt vor der Tür lag, wich er aus. Um den würden sich die Kollegen schon kümmern, dachte er und beeilte sich, mit dem viel jüngeren und besser trainierten van Leyden Schritt zu halten. Doch der war schon weit voraus. Vor der Bäckerei Hallfeld traf Schulte auf seinen Kollegen, der sich wütend im Kreis drehte und nach dem Mann suchte, der wie vom Erdboden verschluckt war. Schulte lief die Bielefelder Straße nach links und van Leyden nach rechts. Irgendwann gab Schulte auf und kehrte zurück zum Parkplatz vor der Bäckerei. Van Leyden traf kurz darauf ein und schüttelte ebenfalls frustriert den Kopf. Auf dem Parkplatz standen mehrere Autos. In keinem der Autos saß eine Person.
„In der ganzen Zeit ist von hier kein Auto gestartet“, sagte Schulte. „Entweder ist er zu Fuß gekommen oder er hat sein Auto bei der Flucht stehen lassen. Ich mache mal sicherheitshalber von allen Autos, die hier herumstehen, ein Foto mit dem Handy.“
Dann gingen die beiden Männer zurück zum Obernkrug. Auf dem Podest kniete Adelheid Vahlhausen neben dem unbekannten Mann, auf den geschossen worden war. Sie hatte ihn auf die Seite gedreht und drückte ein Handtuch oder etwas Ähnliches an seine Schulter. Um seinen Oberkörper herum hatte sich eine große Blutlache gebildet. In der ehemaligen Kneipe stand Hubertus von Fölsen und telefonierte.
„Er lebt“, sagte Adelheid Vahlhausen. „Aber er ist nicht bei Bewusstsein. Ich versuche, die Blutung zu stillen. Von Fölsen ruft gerade den Notarzt.“
„Kennt einer diesen Mann?“, fragte Rosemeier und schaute seine Kollegen an. Einer nach dem anderen schüttelte den Kopf. Auch Schulte. Aber bei ihm entsprach das nicht der Wahrheit. Er kannte den Mann mit dem mächtigen Schnauzbart, kannte ihn sogar schon recht lange.
5
Sollte er oder sollte er nicht? Henry Fischer hatte lange überlegt, was wohl der richtige Weg wäre. Sollte er den Windhund suchen oder nicht? Aber 10 000 Euro, die er dem Kerl anvertraut hatte, wollte er nicht in den Wind schreiben und auch nicht das Geschäft, das mit den 10 000 Euro verknüpft war. Nein, da konnte er die Füße nicht stillhalten. Nein, dazu war er zu sehr Lipper. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Da kannte er keine Verwandten.
Doch wie sollte er vorgehen? Wenn der Windhund verschwunden war, dann war der sicher untergetaucht. Sein Entschluss stand fest. Er musste ihn ausfindig machen. Aber wo sollte er anfangen? Zunächst stellte sich die Frage, „Wie hieß der Windhund überhaupt mit bürgerlichem Namen?“. Henry Fischer musste überlegen. Alle nannten den Kerl nur Windhund. Nach reichlichem Nachdenken fiel ihm der Name ein. Günther hieß der Mann, Günther Sauer.
Zunächst hatte Henry Fischer seinen Kumpanen immer wieder angerufen. Doch der hatte das Handy wohl abgeschaltet oder der Akku hatte keinen Saft mehr. Naheliegend wäre es, den Windhund zu Hause aufzusuchen. Leider wusste er nicht, wo der Kerl wohnte. Darüber hatten sie nie geredet.
So kam Henry Fischer also nicht weiter. Die nächste Maßnahme, die Henry in Erwägung zog, war die, sich an den Orten umzusehen, an denen der Windhund sich oft aufhielt.
Also bummelte Henry durch die Stadt, durchstöberte die Cafés. Anschließend ging er mehrfach über den Wochenmarkt. Auch hier hatte er den Windhund nicht angetroffen. Er versuchte es bei Rudolf an der Bratwurstbude. Eine der Frauen, die dort arbeitete, kannte Henry. Der gab er seine Telefonnummer und bat sie, ihn anzurufen, sobald der Windhund auftauchen würde.
Am späten Nachmittag hatte Henry alle Möglichkeiten, die ihm einfielen, abgearbeitet. Den Windhund aber hatte er nicht gefunden.
Henry sah auf die Uhr. Heute war Champions League. Es spielte unter anderem der FC Bayern gegen den FC Chelsea. In dem Wettbüro, das Henry Fischer betrieb, war heute sicher einiges los. Da musste er auf jeden Fall noch mal nach dem Rechten schauen. Er selbst stand nicht hinter dem Tresen und nahm die Tippscheine entgegen. Für solche niederen Arbeiten hatte er ein paar Aushilfskräfte eingestellt, die sich etwas zu ihrem kargen Einkommen dazu verdienten.
Es gab an solchen Tagen wie diesem zwar mehr Andrang als an normalen Wochentagen, doch die Angestellten würden auch heute nicht ins Schwitzen kommen. Denn die meisten Wetten wurden online aufgegeben. Selbst bei einem so kleinen Krauter wie ihm. Und genau da lag das Problem. Die großen Anbieter steckten Unsummen allein in die Werbung. Gegen eine solche Übermacht konnte ein Mann wie Henry Fischer nicht anstinken. Er musste seine Kundschaft in der Region suchen, musste interessante Wettangebote lancieren. Darin lag seine geringe Chance, etwas Geld zu verdienen.
Aber Henry Fischer hatte größere Ziele. Er wollte den Bodensatz der Wettanbieter verlassen. Er wollte ins Mittelfeld. Doch schon das war ein fast aussichtsloses Unterfangen. Vielleicht schwieriger als von dort, also dem Mittelfeld, in die Spitzengruppe zu kommen.
Das Mittelfeld der Wettanbieter wurde vom organisierten Verbrechen beherrscht. Nicht alle Büros waren in der Hand der Mafia oder anderer verbrecherischer Organisationen, aber viele. Henry Fischer wollte aufsteigen, er wollte richtiges Geld verdienen, weg von den Brosamen – hin zum Kuchen.
Als er in das Ladenlokal seines Wettbüros eintrat, liefen einige Fernseher, auf den verschiedenste Sportwettkämpfe zu sehen waren. Henry Fischer überlegte. Der Windhund war doch auch Fußballfan. Wo sah der sich eigentlich immer die Spiele an?
Hinter dem Tresen agierte eine Frau, die den Mann kannte, nach dem Henry den halben Tag vergeblich gesucht hatte. „Sag mal, Elvira, du kennst doch diesen Günther Sauer, oder?“, fragte Henry sie.
„Wen?“, die Frau runzelte ihre Stirn.
„Na, den Windhund “, versuchte Henry es erneut.
„Ach den, sag das doch gleich.“ Dann, nach kurzem Nachdenken, schob sie nach: „Günther Sauer heißt der? Hm, da kennt man jemanden schon über zwanzig Jahre und weiß nicht mal den richtigen Namen von dem Mann. Ja, klar kenne ich den Windhund. Was ist mit dem?“
„Ich such ihn“, entgegnete Henry. Um es dringend zu machen, schob er nach, „ich krieg noch Geld von ihm.“
„Geld“, der Frau verschlug es einen Moment die Sprache. „Geld. Bist du wahnsinnig Chef! Wie kannst du dem Windhund Geld leihen? Was meinst du wohl, warum der Windhund Windhund heißt?“
Sie schüttelte verständnislos den Kopf. „Dem Windhund Geld leihen, unfassbar.“
„Na egal“, entgegnete Henry patzig. „Ich hab’s ihm nun mal geborgt, das kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen.“
Die beiden schwiegen einen Moment.
„Weißt du, wo ich den Kerl finden kann?“, stellte Henry die nächste Frage.
Elvira zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung, so gut kenne ich ihn jetzt auch wieder nicht.“
Ein Mann, der vor einem Geldautomaten saß, hatte das Gespräch anscheinend belauscht, denn er nuschelte: „Heute spielt doch Bayern, die Spiele von denen guckt der Windhund sich mit absoluter Sicherheit an. Du musst mal zum Alten Schlachthof gehen, zu dem Bowlingcenter, das ist doch hier gleich um die Ecke. Da gibt es verschiedene Gruppen, die sich da regelmäßig die Spiele ansehen. Zu einer Truppe von denen geht der Windhund regelmäßig hin. Der ist mit Sicherheit heute da. Ein Bayernspiel lässt der sich nicht entgehen.“
„Elvira, gib dem Mann was zu trinken!“, rief Henry Fischer seiner Angestellten zu. „Ich muss noch mal weg!“
6
„Ich denke, wir sollten die Kollegen vom K1 informieren“, sagte Adelheid Vahlhausen in die Stille hinein. Immer noch standen sie um den reglos daliegenden Körper des angeschossenen Mannes herum, während sie auf den Notarzt warteten. Da ihr niemand antwortete, übernahm sie die Initiative und hängte sich ans Telefon.
„Maren Köster ist schon unterwegs“, verkündete sie, als sie mit einer Decke und einem kleinen Kissen zurückkam. Sie bettete den Kopf des Mannes darauf und legte die warme Decke über ihn. Fast im gleichen Augenblick hörten sie das Martinshorn. Sekunden später hielt der Notarzt vor der Treppe, dicht gefolgt von einem Krankenwagen, und hastete zu ihnen hoch. Während er kniend den Mann untersuchte, machte Adelheid Vahlhausen Fotos vom Verletzten aus allen möglichen Perspektiven. Schulte grübelte über mögliche Zusammenhänge zwischen dem ihm bekannten Mann und aktuellen Entwicklungen im kriminellen Milieu Lippes. Von Fölsen beobachtete aufmerksam das Wirken des Notarztes, der gerade versuchte, die Blutung zu stoppen. Dabei machte von Fölsen den Eindruck eines Ausbilders bei einer Prüfung, der darauf achtgab, dass sein Lehrling keinen Fehler fabrizierte. Marco van Leyden, der einfach nie untätig sein konnte, suchte bereits die Umgebung ab, um das Projektil zu finden. Manfred Rosemeier ging zurück in die ehemalige Gaststube und schenkte sich einen Kaffee ein.
Dann gab der Notarzt den Rettungssanitätern einen Wink und richtete sich auf. Die beiden Sanis zogen dem Verletzten vorsichtig den blutgetränkten Mantel aus, legten ihn auf eine Trage, brachten ihn in den Krankenwagen und brausten wieder mit Martinshorn davon. Mit spitzen Fingern nahm Adelheid Vahlhausen den Mantel an sich.
„Der Kerl hat mehr Glück als Verstand gehabt“, sagte der Notarzt, als er wieder aufrecht stand. „Durchschuss in der rechten Schulter. Ging glatt durch, wahrscheinlich ein Vollmantelgeschoss. Dummerweise hat das Projektil dabei ein größeres Blutgefäß verletzt. Deshalb der hohe Blutverlust und auch die Ohnmacht. Die medizinischen Einzelheiten erspare ich Ihnen. Genaueres kann man auch erst sagen, wenn der Mann wirklich gründlich untersucht worden ist. Befragen werden Sie ihn aber erst mal nicht können, das kann ich schon mal sagen.“
Während der Arzt seinen Koffer zusammenpackte, fuhr ein blau-weißes Polizeiauto vor, aus dem zwei Frauen in Zivil ausstiegen und zu ihnen kamen. Eine Frau von Mitte fünfzig mit langen roten Haaren, sehr fit und sehr energisch wirkend und eine jüngere blonde Frau, die deutlich entspannter daherkam. Schulte kannte sie beide sehr gut. Die Blonde war Pauline Meyer zu Klüt, seine ehemalige Mitarbeiterin, als er noch Leiter der Mordkommission in Detmold vor. Vor seiner Strafversetzung. Neuerdings war Pauline auch mit Schultes Tochter Ina befreundet. Ihm war immer noch nicht so richtig klar, welcher Art diese Freundschaft war. Aber er mochte diese freundliche und natürliche junge Frau. Maren Köster, die Rothaarige, war seine Nachfolgerin geworden. Mit dieser immer noch attraktiven Frau verband ihn eine sehr lange Beziehung. Zwei Jahre lang waren sie sogar ein Paar gewesen, das hatte aber nicht gut funktioniert. Immer wieder hatten die beiden einander angezogen und abgestoßen. Und das würde sich wohl auch bis ans Ende ihrer Tage nicht mehr ändern. Schulte ahnte, was jetzt kommen würde.
„Das hier fällt in unsere Zuständigkeit“, blaffte Maren Köster ihn an. „Nur, damit das gleich klar ist.“
Dabei hatte Schulte noch gar nichts Gegenteiliges gesagt. Niemand kannte ihn so gut wie diese Frau, und vermutlich hatte sie ihm angesehen, dass seine Gedanken ihrer Ermittlung bereits ein paar Schritte voraus waren.
„Ist ja gut“, brummte Schulte und fühlte sich ertappt.
Maren Köster wandte sich an den Notarzt. Der gab in knappen Worten seinen Bericht ab und verwies für alles Weitere auf seine Kollegen im Detmolder Klinikum. Danach stieg er in sein Auto und ließ die Polizisten allein. Maren Köster übernahm nun die Initiative. „Kennen wir die Identität dieses Mannes?“ Diese Frage von ihr ging zwar an alle, aber sie schaute dabei Schulte an.
Als Schulte nur mit den Schultern zuckte, mischte sich Adelheid Vahlhausen ein, die mittlerweile die Taschen des Mantels untersucht hatte.
„Hier ist sein Personalausweis. Der Mann heißt Günther Sauer und wohnt in der Südholzstraße in Detmold.“
Marco van Leyden hatte seine Suche nach dem Projektil aufgegeben und baggerte nun Pauline Meyer zu Klüt an, von Maren Köster argwöhnisch beobachtet.
„Hatte er sonst noch irgendwas Interessantes in seinen Manteltaschen?“, wollte Köster wissen. Adelheid Vahlhausen schüttelte den Kopf.
„Nur einen Autoschlüssel, Zigarillos, Taschentücher und ein Feuerzeug.“
Wieder warf Maren Köster Schulte einen langen, prüfenden Blick zu.
„Was ist mit dir, Jupp? Du siehst aus, als läge dir etwas auf der Seele. Los, raus damit. Mir kannst du nichts vormachen.“
Doch Schulte blieb verschlossen.
„Mit mir ist nichts“, antwortete er mit leicht trotzigem Tonfall. „Ich weiß über diesen Mann auch nichts wirklich Bedeutendes. Okay, ich habe ihn schon ab und zu mal gesehen. Hatte dienstlich mit ihm zu tun. Er hat kein Fettnäpfchen ausgelassen und ist immer wieder auf die Nase gefallen. Hält sich für einen Schlauberger. Ist er aber nicht. Mehr weiß ich auch nicht.“
Ihr spöttischer Blick ließ keine Fragen offen, sie glaubte ihm kein Wort.
„Und ich werde mich auch nicht bemühen, mehr zu erfahren“, legte Schulte nach. „Das ist dein Fall, ganz klar. Ich mische mich da nicht ein. Verlass dich drauf !“
Daraufhin wandte sie sich wieder an die ganze Runde.
„Okay, ich brauche eure Zeugenaussagen. Ihr habt schließlich alle den Schützen und die Tat gesehen. Kommt, wir gehen jetzt ins Warme. Dort schildert mir einer nach dem anderen, was er oder sie gesehen hat.“
Dann wies sie Pauline Meyer zu Klüt an, die sich gerade lachend der Zudringlichkeit durch Marco van Leyden erwehren musste: „Die Spurensicherung muss jeden Moment kommen. Ich überlasse das alles dir. Ach ja, bitte kümmere dich auch darum, dass der Verletzte im Klinikum Polizeischutz erhält. Schließlich läuft der Schütze noch frei herum und wer weiß, was der jetzt unternimmt, um sein Werk zu vollenden.“
7
Rosemeier war heute, wie fast jeden Morgen, der Erste der Sondereinheit Think-Tank in Heidenoldendorf.
Verantwortlich hierfür war der ehemalige Staatssekretär Erpentrup, der mit dieser Standortwahl und einigen anderen arglistigen Maßnahmen einen persönlichen Rachefeldzug gegen seinen Lieblingsfeind, Polizeirat Schulte, eingeleitet hatte, um ihn endgültig zu demontieren.
Auf den Zug, den der damalige Staatssekretär ins Rollen gebracht hatte, waren gleich noch mehrere andere Führungskräfte der nordrhein-westfälischen Polizei aufgesprungen und hatten ebenfalls Beamte, die sie loswerden wollten, in diese Abteilung versetzen lassen.
„Wieder so ein regnerischer Tag“, brummelte Rosemeier, als er zum Briefkasten ging, um die Post zu holen. Ein bisschen Sonne würde seinem Gemüt guttun. Doch der Tag brachte mal wieder nur schlechtes Wetter und wieder keine Post, das dachte Rosemeier noch, als er den Schlüssel im Schloss des Kastens drehte.
Doch mit der Vermutung, keine Post, hatte sich Rosemeier diesmal geirrt. Im Briefkasten lag ein Brief. Die erste Zustellung seit drei Monaten, wenn man mal von der Gewerkschaftszeitung der Polizei absah. Er drehte den Briefumschlag aus Umweltschutzpapier in seinen Händen.
„Sieht nach was Offiziellem aus“, knurrte Rosemeier, warf noch einen Blick auf die verregnete Umgebung und zog sich dann fix zurück in den gemütlichen, warmen Schankraum des Obernkruges.
Hier angekommen, schaltete er wie jeden Morgen das Radio ein, machte sich einen Kaffee, kramte nach seinem Taschenmesser und öffnete das Kuvert. Doch bevor er das Dokument aus der Hülle zog, um es zu lesen, nahm Rosemeier einen ordentlichen Schluck. Lieber erst mal was trinken, dachte er, bevor mir die Nachricht, die uns hier erreicht hat, auf den Magen schlägt. Post von Behörden enthielten nie gute Nachrichten, das war Rosemeiers feste Überzeugung. In manchen Dingen war er nun mal Pessimist. Und das zu Recht, wie sich eine Minute später herausstellte. Nach der Lektüre des Schreibens faltete Rosemeier das Blatt wieder zusammen und steckte es zurück in den Umschlag. Den warf er dann mit mürrischem Gesichtsausdruck auf die Theke. Über dieses Schreiben würde man reden müssen. Heute war ein Scheißtag, befand er und schüttete den mittlerweile lauwarmen Kaffee in den Ausguss.
8
Als Schulte die Treppenstufen zu seiner Dienststelle hinaufstieg, konnte er eine leise Beklommenheit nicht unterdrücken. Dort, wo gestern der angeschossene Mann in seinem Blut gelegen hatte, erinnerte ein großer, dunkler Fleck an das brutale Geschehen. Schulte mied diese Stelle, auch wenn keine Gefahr bestand, dadurch wertvolle Spuren zu verwischen. Es war einfach ein Akt der Pietät. Er hätte das Gefühl gehabt, den armen Mann noch einmal zu verletzen, wenn er einfach platt und gedankenlos darüber gelatscht wäre.
Wie immer war Schulte der Letzte, der zum Dienst erschien. Es gab ja keine wirkliche Aufgabe für sie. Nach dem Willen des Innenministeriums sollten sie nur unhörbar und unsichtbar bleiben, bis zu ihrer Pensionierung. Bis man sie dann endlich mit einem Blumenstrauß und ein paar warmen Worten ins Vergessen schicken konnte. Als seien sie nie da gewesen. Manfred Rosemeier war der Einzige in der Truppe, der sich damit abgefunden und sich mit den neuen Verhältnissen arrangiert hatte. Sein freundliches, positives und flexibles Gemüt schaffte es spielend, stets das Beste aus jeder Situation zu machen. Schulte beneidete seinen Kollegen um diese Fähigkeit, die ihm selbst vollkommen abging. Am stärksten litt Marco van Leyden, der Jüngste und Ehrgeizigste unter dieser Verbannung aus dem regulären Polizeiapparat. Er machte stets den Eindruck eines Vulkans, der jeden Moment in die Luft fliegen kann. Hubertus von Fölsen hatte der Ministerialbürokratie diese Strafversetzung bis heute nicht verziehen und setzte alle Energie daran, es ihr heimzuzahlen. Das Instrument seiner Rache war ein Buch, in dem er gnadenlos, wie er sagte, die Fehler der Polizeiarbeit in Nordrhein-Westfalen aufzeigen und Vorschläge für eine dringend notwendige Reform machen wollte. „Wenn dieses Buch veröffentlicht wird, dann werden Köpfe rollen“, versprach er jedem, der es hören und der es nicht hören wollte.
Adelheid Vahlhausen wirkte gelegentlich wie ein Geist, wenn sie fast geräuschlos ihre Tage verbrachte. Sie zog sich stundenlang in ein ehemaliges Gästezimmer des Obernkrugs, das sie sich als Büro eingerichtet hatte, zurück. Nur selten kam sie zu einer Kaffeerunde in die ehemalige Kneipe herunter und sprach mit den Kollegen. Schulte hatte sich schon mehrfach große Sorgen um sie gemacht. Er mochte diese stille, enorm kluge und ernsthafte Frau, die, wie er wusste, immer noch unter den Folgen eines harten Alkoholentzugs litt. Neuerdings war ihm aber aufgefallen, dass Adelheid Vahlhausen etwas lebendiger wirkte, dass sie wieder Ziele hatte und sich auf die Zukunft freuen konnte. Das mochte damit zusammenhängen, dass sie in Kürze Schultes Nachbarin werden würde. Schulte, der seit über zwanzig Jahren als Mieter in einem Nebengebäude des Hofes von Anton Fritzmeier wohnte, hatte dies vermittelt. Anton Fritzmeier war ein alter Mann und wohnte mutterseelenallein im „Herrenhaus“, wie er das Hauptgebäude seines Hofes gern nannte. Mit Treppensteigen hatte er es aber nicht mehr so und für ihn und seine bescheidenen Ansprüche war im Erdgeschoss Platz genug. Das gesamte weiträumige Obergeschoss stand leer, mit herrlichem Blick auf die umliegenden Wiesen. Außerdem war Fritzmeiers Vorstellung von einem angemessenen Mietpreis für Adelheid Vahlhausen, die aus der Großstadt Münster kam, einfach atemberaubend günstig gewesen. Schulte freute sich auf die neue Nachbarin. Er fand es beruhigend, dass der alte Herr demnächst eine verantwortungsvolle Person im Haus hatte.