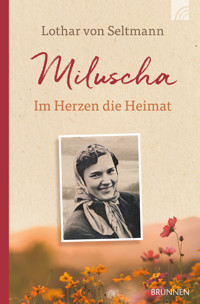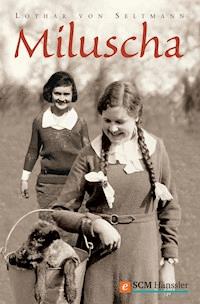
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brockhaus, R
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Miluscha wächst mit ihren sechs Geschwistern in Nedbarewka,einem idyllischen Dorf in der Ukraine auf. Doch in diese Welt bricht in den Dreißiger Jahren das kommunistische Regime herein. Miluscha und ihre Familie werden deportiert und zur Zwangsarbeit verurteilt. Doch der Glaube gibt ihnen Kraft, die Entbehrungen und Härten der Zeit zu ertragen. Nach dem Ende des Krieges gelingt Miluscha die Flucht in den Westen. Zwei Bände in einem Buch. Stand: 1. Auflage 2011 (7. Gesamtauflage)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 731
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Name „Nedbarewka“ für das ukrainische Dorf, in dem Miluscha aufwuchs, ist erfunden, um die Identität verschiedener Personen zu schützen.
INHALT
I. Teil
Das Heimatdorf
Goldener Oktober
Miluschas Geburt
Dunkle Wolken
Badefreuden und Kinderleid
Folgenschwere Post
Auf der Kolchose bei Cherson
Wieder zu Hause
Behördenwillkür
Deportation
Kasachische Steppe
Zurück in die Heimat
Weihnachten in Nedbarewka
Kuhstallbrigade
»Welch Glück ist’s, erlöst zu sein«
Onkel Albert
Liebesglück in böser Zeit
Pflichtjahrmädchen
Kriegsende
Westwärts in die Freiheit!
II. Teil
Geburtstag in der Freiheit
Reiseabenteuer
Als Hausmädchen in Bad Pyrmont
Ins märkische Jerusalem
Karlchen Gerhardt
Endlich in der Schule
Kleine Blüten im Brief
Das Dorf im Hinterland
Jung gefreit hat selten gereut
Eine neue Familie
Mutterglück
Schlimme Nachrichten
Eine schwierige Geburt
Du bist nicht allein, Miluscha
»Über dir Flügel gebreitet«
Aber Gott kann
Ein Abschied
Nachwort
Der SCM-Verlag ist eine Gesellschaft der Stiftung Christliche Medien, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
Dieses E-Book darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, E-Reader) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das E-Book selbst, im von uns autorisierten E-Book Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
ISBN 978-3-7751-7215-8 (E-Book)ISBN 978-3-7751-5348-5 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book:CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
1. Auflage 2011 (7. Gesamtauflage)
Der vorliegende Titel erschien zuvor bei SCM R.Brockhaus unter der ISBN 978-3-417-24828-9 und setzt sich zusammen aus den beiden Einzelbänden »Miluscha« (ISBN 978-3-417-24688-9)und »Du bist nicht allein, Miluscha« (ISBN 978-3-417-24703-9).
© der deutschen Ausgabe 2011 SCM Hänssler im SCM-Verlag GmbH & Co. KG · 71088 Holzgerlingen Internet: www.scm-haenssler.de; E-Mail: [email protected]
Umschlaggestaltung: LineDesign Ursula Stephan, Wetzlar
Bilder im Innenteil: Familie Beer
Miluschas Vater, Karl Beer, als junger Mann (links oben). Miluscha mit 18 Jahren (rechts oben). Die Familie in der Nähe von Cherson/Süd-Ukraine, wo sie Zwangsarbeit leisten mussten. Milusch a auf dem Schoß des Vaters (unteres Bild).
Miluscha und ihre beiden Brüder Hugo (links) und Erhard.
Miluschas und Hugos Taufe in Schitomir/Ukraine, am 1. Aug. 1942.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Das Heimatdorf
Nedbarewka – ein wolhynisches Dorf in den Weiten der Ukraine, im Großraum Schitomir, westlich von Kiew, umgeben von großer Feld- und Wiesenflur, die im sanft hügeligen Gelände immer wieder von kleinen Birken- und Mischwäldern unterbrochen wurde.
Nedbarewka – ein Straßendorf, eigentlich ein Doppel-Straßendorf, denn ein kleiner Fluss trennte den Ort über mehrere Kilometer in zwei Teile, die durch Brücken und Stege miteinander verbunden waren. Wohl fünfhundert Einwohner lebten auf ihren weit auseinander liegenden Höfen, je nach Reichtum verschieden groß und die Gebäude mit Stroh, Holzschindeln oder auch mit Blech gedeckt, umgeben von großen Obst- und Gemüsegärten und der zugehörigen Feldflur, die sich weit nach hinten erstreckte. Die Menschen waren fast ausschließlich Deutsche, einige Juden und wenige Ukrainer. Die meisten waren Bauern und Landarbeiter, dazu gab es einige Händler und Handwerker wie den Schuster Hirsekern und den Tischler Patt. Auch ein Arzt war da, der zugleich Zahnarzt und Apotheker war. Doktor Mand behandelte einfach alles, und für jede Krankheit und für jedes Zipperlein wusste er eine Tinktur zu brauen oder eine Salbe zu rühren.
Nedbarewka – das war die Heimat. Hier lebten die Beers, seit sich die Vorfahren, aus dem Ostpreußischen kommend, unter Zarin Katharina der Großen in der Region niedergelassen und einige von ihnen mit anderen Menschen aus verschiedenen deutschen Gegenden ein Dorf gegründet hatten, zu dem natürlich auch ein Schulhaus gehörte.
Letzteres lag etwas abseits von der Dorfstraße auf einer kleinen Anhöhe und war seit 1915 der Wohn- und Arbeitsplatz des Lehrers Karl Beer und seiner Familie. Die Schule mit dem einen Klassenraum war flankiert vom Wohngebäude der Lehrersfamilie und von Stallungen und Scheunen der zugehörigen Landwirtschaft. Im Hof des Anwesens befand sich ein Ziehbrunnen, der das Wasser für Mensch und Vieh spendete. Das Vieh des Lehrers bestand aus einem Pferd, zwei Kühen, ein paar Schweinen, einigen Hühnern und Enten.
Das alles war umgeben von etwa fünf Hektar Obst- und Gemüsegarten und Ackerland für den Anbau von Kartoffeln, Roggen, Weizen und Futtergetreide, dazu ein bisschen Wiese zum Heuen für den Winter.
Pappelreihen säumten die gut fuhrwerksbreite Auffahrt zu diesem Kinderparadies, zu dem auch die beiden kleinen Teiche gehörten, die sich unten an der Dorfstraße rechts und links der Allee befanden. Im Sommer wurde in ihnen gebadet, und im Winter konnten sich die Kinder des Dorfes oft monatelang auf dem Eis tummeln, wie sich auch der Schulhügel vorzüglich als Gelände zum Schlittenfahren eignete.
Hier auf dem Hügel pulsierte seit einigen Jahren das Leben der Familie Beer mit dem Schulbetrieb und der zu versorgenden Landwirtschaft. Bis diese Zeit 1933 eine jähe Unterbrechung fand und später dann auch ihr Ende.
Aber bis dahin dauerte es noch zehn ereignisreiche Jahre. Und Miluscha musste ja auch erst einmal geboren werden.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Goldener Oktober
Nun hat jede Geburt ihre eigene Vorgeschichte. Die Vorgeschichte der Geburt Miluschas nahm ihren Anfang an einem wunderschönen Oktobersonntag des Jahres 1923. Bäume und Sträucher standen in voller Pracht des bunten Herbstlaubes. Die Wiesen leuchteten im matten Grün des letzten Grases, gesprenkelt vom blassen Violett unzähliger Herbstzeitlosen, zwar giftig, aber doch schön. Zwischendrin an vielen Stellen das Braun der abgeernteten Kartoffel- und Rübenfelder.
Die Luft war erfüllt vom Duftgemisch verglommener Kartoffelfeuer, pflückreifer Äpfel, frisch umgepflügter Ackerböden, satt blühender Astern und anderer Herbstblumen, auf denen tausende Bienen und andere Insekten summten, als wäre es die letzte Gelegenheit des Jahres, Nektar zu ernten. Selbst die Vögel sangen heute noch einmal, so als hätten sie alle für diesen Tag ein besonderes Konzert einstudiert. Die vom fast wolkenlosen Himmel strahlende Sonne verbreitete milde Wärme und gab dem Tag etwas besonders Festliches.
Ein Sonntag, wie aus dem Bilderbuch, unbeschwert und heiter.
Den beiden Menschen, die sich bereits eine Weile schweigend in der großen Stube des Lehrerhauses gegenüberstanden, war es freilich nicht ganz so leicht ums Herz. Der Tag hatte schon sein Gewicht, und die Entscheidung, die die beiden heute öffentlich vor der versammelten Gemeinde und vor dem Pastor besiegeln wollten, lag schwer auf ihren Schultern und Seelen.
Ein wenig förmlich wirkte die Frage schon, mit der der große, dunkelhaarige und schnauzbärtige Mann das Schweigen beendete: »Bist du wirklich bereit, Elsa Lohreder, mich alten Mann zu heiraten und zugleich die Mutter meiner Kinder zu werden?« Mit tiefem Ernst und doch großer Zärtlichkeit schaute Karl Beer der jungen Frau in die Augen, deren Hände er fest in den seinen hielt. »Noch kannst du zurück.«
»Nein, Karl Beer«, – die Antwort klang ähnlich förmlich -, »ich will nicht zurück und ich bin bereit, deine Frau zu werden und deinen Kindern eine gute Mutter.«
Fest erwiderte die kaum Zweiundzwanzigjährige den Blick des um gut einen Kopf größeren Mannes, der ihr Vater hätte sein können. Leise, aber bestimmt kam ihre Antwort: »Und denk nur nicht, ich heiratete dich nur deshalb, weil ich gegenüber meiner Schwester ein Versprechen einzulösen hätte. Nein, ich mag dich wirklich, und ich hab dich lieb, Karl Beer.« Die letzten Worte der jungen Frau klangen fast ein wenig trotzig.
Der Mann nahm seine Schwägerin in die Arme, drückte sie fest an sich und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Es ist schon gut, mein liebes Elschen, ich weiß, dass du mich lieb hast, und du weißt, dass ich dich inzwischen genauso liebe, wie ich Emilie geliebt habe. Und ich weiß auch, dass du meinen Kindern eine gute Mutter sein wirst. Du bist es ja eigentlich schon lange. Sie sind doch schon wie deine eigenen Kinder geworden, seit du dich um sie kümmerst und sie versorgst. Und wer weiß«, der angehende Ehemann nahm Elsas Kopf zärtlich in seine großen Hände, »vielleicht schenkt Gott den dreien ja auch noch ein Geschwisterchen.«
Über Elsas hübsches Gesicht huschte eine leichte Röte und sie entzog sich seinen Händen. »Wir müssen hinaus. Draußen wartet der Wagen und in der Kirche warten Pastor Uhler und die Gemeinde.«
Hand in Hand traten die beiden Hochzeitler vor das Haus und in die strahlende Herbstsonne. Niemand war mehr auf dem Hof. Sie waren wohl alle schon vorausgefahren, um das Brautpaar vor der Kirche im wenige Kilometer entfernten Hainau zu empfangen. Um den sechsjährigen Georg, die vierjährige Olga und Klein-Waldemar kümmerten sich liebe Frauen aus der Gemeinde.
Vor dem Haus wartete Hans, der Sohn des Schuhmachers Hirsekern – gelegentlich half er mit seiner Frau Lenchen schon einmal in der Schullandwirtschaft, besonders wenn Not am Mann war -, mit der Kutsche, einem kleinen Einspänner, mit dem schon viele Brautpaare von Nedbarewka nach Hainau zur Kirche gefahren waren, um dort in Anwesenheit der Gemeinde den Bund fürs Leben zu schließen und sich den Segen Gottes zusprechen zu lassen.
Hans hatte die Kutsche geputzt und mit frischem Grün geschmückt und dazu eine saubere Decke auf den Sitz gelegt. Das Pferd – es hieß bei den Leuten auf dem Schulhügel nur »Brauner« – hatte er frisch gestriegelt und in seine Mähne eine leuchtende Schleife gebunden. Er selbst hatte seinen besten Anzug aus dem Schrank genommen und sich dem Ereignis gemäß gekleidet.
Karl half seiner Elsa auf die Kutsche hinauf. Das war nicht schwer. Da musste kein Rüschenrock gerafft und gehalten und hineingezwängt werden. Die junge Braut, eher klein und etwas rundlich, trug nur ein schlichtes Kleid in hellen Farben und einen dazu passenden Hut. Auf ein aufwendiges Hochzeitskleid hatte sie bewusst verzichtet. Und neben Karl in seinem dunklen Dienstanzug sah sie auch so hübsch und adrett aus. Den Umhang, den sie über dem Arm trug, brauchte sie jetzt nicht umzulegen. In der Sonne war es noch warm genug.
»Wir sind soweit, Hans. Du kannst fahren«, gab der Bräutigam dem Freund der Familie auf dem Bock das Zeichen. Still und in sich gekehrt saßen die Brautleute auf ihrem Gefährt, das gemächlich vom Hof und die Allee hinunter rollte. Fest hielten sie sich bei den Händen.
Das war schon ein denkwürdiger Tag heute …
In den letzten Jahren war es Karl Beer häufig selbst gewesen, der mit Genehmigung der Kirche gewissermaßen als Pastor des Dorfes Trauungen durchgeführt hatte, wenn der Weg nach Hainau nicht möglich war oder wenn Pastor Uhler nicht herüberkommen konnte, um die Amtshandlung im Schulhaus vorzunehmen.
Für heute hatte Karl Beer natürlich seinen Freund und »Amtsbruder« im Nachbarort gebeten, den Dienst zu übernehmen. Gerne hatte der zugesagt, einen würdigen Gottesdienst vorzubereiten, hatte er doch schon viele Jahre Anteil genommen am Geschick der Beerschen Familie, die zuletzt durch die Tuberkulose der Hausfrau und Mutter großes Leid erfahren hatte.
Freilich hatte Elsa seit der Erkrankung und noch mehr seit dem Tod ihrer Schwester mit allen Kräften versucht zu arbeiten, zu ordnen, zu pflegen und zu versorgen. Sie war aber doch nur die Haushaltshilfe gewesen und die Tante der Kinder.
Das sollte sich heute ändern. Heute sollte mit der Heirat von Karl und Elsa ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Der Vater würde wieder eine Frau und eine Mutter für seine drei Kinder bekommen. Wen die fast dreißig Jahre Altersunterschied störten, den sollten sie stören. Wenn nur die beiden sich selbst in ihrer Entscheidung einig waren. Sie hatten sich lange geprüft und auch vor Gott gefragt, ob das der richtige Weg für sie sei. Sie waren sich schließlich darin einig, dass Gott ihre Entscheidung bestätigte und mit ihnen war.
So heiter und fröhlich, wie dieser Oktobertag sich zeigte, so heiter und fröhlich wunschten sich die beiden ihre gemeinsame Zukunft.
Der Einstieg in die neue Zeit sah auch schon recht gut aus. Da war dieser strahlende Herbstsonntag. Und da war diese herrliche Kulisse, die die beiden vorfanden, als sie mit Hans und der Kutsche in die Dorfstraße Richtung Hainau einbogen. Viele Dorfbewohner warteten dort mit ihren Fuhrwerken, die sie zu Personenfahrzeugen umgerüstet hatten, um ihren Lehrer und seine junge Braut zum Traugottesdienst zu begleiten. Sie waren also noch gar nicht vorausgefahren. Und auf dem ersten Wagen befanden sich auch die drei Kleinen. Sie mussten doch auch dabei sein an diesem denkwürdigen Tag ihrer Eltern.
Georg und Olga wären wohl am liebsten in die Kutsche umgestiegen, und die Frauen hatten Mühe, sie zu beruhigen und auf später zu vertrösten. Klein-Waldemar, erst wenig älter als ein Jahr, wusste natürlich noch gar nicht, was hier heute geschah.
So bewegte sich also eine fröhliche Karawane von Nedbarewka nach Hainau, um dort einen ernsten und doch auch fröhlichen Traugottesdienst mit einer großen Gemeinde in der gut gefüllten Kirche zu feiern.
Drei Stunden später bewegte sich eine ebenso fröhliche Karawane wieder zurück ins Dorf. Die Menschen waren noch beeindruckt von Pastor Uhlers Predigt über die beiden Worte aus Josua 1, Vers 5 und 6: »Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt!« und aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7: »Alle eure Sorge werfet auf IHN, denn ER sorget für euch!« In den Ohren hatten sie wohl auch noch den mächtigen Gesang vom Ende des Gottesdienstes: »Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke …«
Jetzt auf der Heimfahrt saßen Georg und Olga zwischen ihrem Vater und ihrer neuen Mutter, und Elsa hielt den Jüngsten auf ihrem Schoß, wie im vergangenen Jahr so häufig. Nur dass die Familie jetzt wieder eine richtige Familie war.
Am Fuße der Allee, die hinauf auf den Schulhügel führte, hielt Hans die Kutsche an. Die vielen Wagen der Dörfler fuhren an den Brautleuten vorüber, in aufrichtiger Mitfreude noch einmal winkend und gratulierend und Glück und Segen wünschend.
Nachdem das letzte Fahrzeug vorbeigefahren war, lenkte Hans Hirsekern die Kutsche in die Allee hinein und fuhr unter den nur noch spärlich belaubten Pappeln hinauf auf den Schulhügel und damit die »junge« Familie auf dem hinteren Sitz gewissermaßen hinein in eine neue Zeit …
Ob diese Zeit einen so strahlenden Verlauf nehmen würde, wie es dieser herrliche Tag zu verheißen schien? Wie auch immer, Karl Beer und die junge Elsa, nun seine Ehefrau, wussten sich mit den Kindern und ihrer gemeinsamen Zukunft in Gottes Händen geborgen und gut aufgehoben. Gott würde bei ihnen sein, und er würde für sie sorgen!
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Miluschas Geburt
Einige Jahre waren inzwischen ins Land gegangen. Die drei Kinder aus Karl Beers erster Ehe hatten tatsächlich inzwischen ein Geschwisterchen bekommen.
Wohl ein Jahr nach der Hochzeit brachte Elsa Hugo zur Welt, ein strammes Kerlchen, das seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten war. Mit seinem ruhigen Wesen, das er auch von seinem Vater mitbekommen hatte, machte er seinen Eltern viel Freude. Und die drei »Großen« hatten Hugo gerne und lieb in ihren Kreis aufgenommen. Elsa musste schon aufpassen, dass Hugo von seinen Geschwistern nicht allzu sehr verwöhnt wurde.
Freilich war durch die größer gewordene Familie nun auch das Pensum der täglichen Arbeit für Elsa erheblich gewachsen. Im Stall und auf den Feldern konnte sie kaum noch mitarbeiten. Die Anforderungen in Haus und Familie füllten sie völlig aus.
Wie gut, dass Hans und Lenchen Hirsekern immer wieder auf den Schulhügel kamen, um dem Dorflehrer und der viel beschäftigten Mutter bei der Arbeit zu helfen und den beiden manchen Handgriff abzunehmen.
Denn Karl Beer lag die Hausarbeit überhaupt nicht. Er hatte auch ohnehin genug mit dem Unterricht zu tun und damit, nach den Schulgeschäften das Vieh zu versorgen und Stall und Scheune in Ordnung zu halten. Immer wieder musste er auch selbst mit hinaus aufs Feld, auf die Wiese und in den Obstgarten, um Hand anzulegen. Schließlich lebte die Familie von den Erträgen der Landwirtschaft. Gehaltszahlungen gab es noch nicht. Das Einkommen musste erwirtschaftet werden. Nur blieb dem Lehrer dazu nach einem normalen Schultag nicht viel Zeit. Vormittags vier Stunden Unterricht für die Klassen drei und vier, nachmittags vier Stunden für die Klassen eins und zwei.
In der hellen Jahreszeit blieben dann schon noch ein paar Stunden, aber im Winterhalbjahr wurde es bereits dunkel, wenn der Nachmittagsunterricht gerade zu Ende ging.
Freilich verlegte der sehr naturverbundene Lehrer den Unterricht so oft wie möglich nach draußen. So lernten die Kinder des Dorfes in den Sommermonaten, außerhalb der langen Ferien natürlich, sehr viel Praktisches über die Arbeit im Garten, auf dem Feld, im Stall und auf der Weide. Dadurch wurde natürlich auch schon mancher Handgriff durch die Schulkinder erledigt, wobei der Lehrer immer sehr darauf achtete, dass niemand in seinen Kräften überfordert wurde.
Im Winterhalbjahr lernten die Kinder dann, was der Mensch sonst zum Leben braucht, wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Das war bei einigermaßen großem Fleiß in vier Schuljahren zu schaffen. Wer mehr lernen wollte, musste weiter nach Hainau oder nach Schitomir zur Schule gehen. Dort ging es in den Schulen bis zur siebten Klasse oder auch noch weiter.
Etwas anderes wurde auch sehr gepflegt und das in allen Jahreszeiten: Das war das Singen und Musizieren. Der Lehrer hatte im Unterricht – ob drinnen oder draußen – immer seine Geige dabei, und bei jeder passenden Gelegenheit sang er mit den Kindern weltliche und vor allem geistliche Lieder. Das war ihm wichtig, dass auch mit dem geistlichen Lied das Gemüt geformt würde.
Wenn die Arbeit in der Schullandwirtschaft gar zu dringend wurde, gab es neben Hans und Lenchen Hirsekern auch noch andere Leute im Dorf, die zur Hilfe bereit waren. Manchmal kam auch Hilfe von der Familie von Marie, einer Schwester von Elsa. Loskes – wie sie hießen – bewirtschafteten einen der größten Höfe von Nedbarewka.
Karl Beer sprach einigermaßen gut Englisch, Polnisch und Russisch. So brachte er diese Kenntnisse und seine Fähigkeiten, zu formulieren und zu verhandeln, Streit anzuhören und zu schlichten, ein und stellte seinen Rat in vielen Lebensfragen zur Verfügung. Fast täglich kam irgendjemand aus dem Dorf ins Lehrerhaus hinauf, um seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und selten ging jemand den Schulhügel hinunter, ohne dass ihm geholfen worden wäre.
Die Leute von Nedbarewka mochten ihren Lehrer. Viele verehrten ihn wegen seiner ruhigen und freundlichen Art, in der er selbst mit den größten Hitzköpfen umging. Selten erlebte ihn jemand böse oder zornig. Viele schätzten auch seinen geistlichen Rat, den er immer wieder aus einem tiefen Glauben schöpfend weitergab. Nicht nur in den Andachten, die er sonntags oder auch an einem Abend in der Woche im Schulraum anbot – in Absprache mit Pastor Uhler, wenn der nicht selbst von Hainau herüber kommen konnte -, sondern auch in persönlichen Gesprächen. Es war ihm viel daran gelegen, dass die Menschen des Dorfes im Glauben lebten und im Glauben wuchsen. Die Zeiten würden schlechter werden. Wer dann keinen inneren Halt hatte …
Andernorts war der Druck der kommunistischen und atheistischen Regierung der Sowjetunion nämlich schon spürbar, seitdem Jossif Wissarionowitsch Stalin der mächtigste Mann im Staat geworden war und mit eiserner Hand regierte. Hier in der Region Schitomir ließ man die Leute noch in Ruhe. Sie konnten noch ungestört als Deutsche leben und sich als Christen versammeln. Wer weiß, wie lange noch.
Der Winter 1927/28 war ein Winter wie die meisten im Land. Seit Ende Oktober lag die Flur unter einer dichten Schneedecke, und die Temperaturen blieben einige Grade unter dem Gefrierpunkt. Die Arbeit in der Schullandwirtschaft war reduziert auf Stall und Scheune. Karl Beer war jetzt häufiger im Haus und hatte mehr Zeit für seine Kinder und für seine Frau. Aber Elsa brauchte seine Hilfe jetzt auch häufiger, war sie doch wieder schwanger. Um die Jahreswende sollte ihr zweites Kindchen zur Welt kommen. Die Hausarbeit fiel ihr zunehmend schwerer, und so musste Karl ihr das eine oder andere abnehmen, zum Beispiel Feuerholz aus dem Schuppen in die Wohnung tragen, die Fußböden putzen, die Wäsche im großen Holzzuber auf dem Waschbrett schrubben, sie nach dem Spülen in der Scheune zum Trocknen aufhängen und später auch wieder hereinholen. Auch wenn ihm solche Arbeiten gar nicht lagen, tat er sie doch um seiner Elsa willen gern.
Die Arbeit für den Unterricht ließ er bis zum Abend, wenn die Kinder in ihren Betten lagen und Ruhe in der großen Stube eingekehrt war. Dann saß er beim spärlichen Licht einer Petroleumlampe in seinem großen, Leder bezogenen Lehnstuhl am Schreibtisch, um Hefte durchzusehen, Arbeiten zu korrigieren und den nächsten Unterricht vorzubereiten. Elsa saß in seiner Nähe und hatte immer irgendeine Handarbeit zu tun, wie das so ist, wenn vier Kinder einigermaßen gut angezogen sein und in der Kälte des Winters nicht frieren sollen. Dann war ja auch bald Weihnachten, wofür es vieles vorzubereiten galt. Und irgendwann in den Tagen danach sollte das Kind geboren werden. Dafür gab es noch einiges zu stricken und zu häkeln.
Manchmal, wenn Elsa müde und abgespannt und ein wenig bekümmert schien, setzte Karl sich ans Harmonium und spielte und sang seiner Frau ein paar Mut machende Strophen wie diese:
»Wenn des Feindes Macht uns drohet
und manch Sturm rings um uns weht,
brauchen wir uns nicht zu fürchten,
stehn wir gläubig im Gebet.
Da erweist sich Jesu Treue,
wie er uns zur Seite steht
als ein mächtiger Erretter,
der erhört ein ernst Gebet.«
Oder auch:
»Was dein Herze auch bewegt,
ob sich Schmerz, ob Wonne regt,
flieh zu Jesus früh und spät,
mach aus allem ein Gebet.«
Danach stand Karl wohl für eine Weile hinter ihrem Stuhl, hielt ihr die Schultern und strich ihr über ihre vollen, dunklen Haare. »Du sollst dich nicht bekümmern, Elschen, sei getrost und unverzagt. Gott wird sorgen.«
Es war in den ersten Januartagen. Elsa spürte die ersten Wehen, die bald in immer kürzeren Abständen auftraten und auch immer heftiger wurden. Dann hielt sie sich ihren Bauch und stöhnte leise auf. Die Kinder sollten nichts merken. Aber was sollte sie tun? Karl war mit Waldemar zum Unterricht der ersten beiden Klassen im Schulhaus, Hugo saß auf einer Decke in seinem Laufstall, spielte mit Holzklötzen und brabbelte vor sich hin. Die beiden Großen, Georg und Olga, saßen am Esstisch und waren mit Schulaufgaben beschäftigt. Sie schienen Mamas Zustand nicht zu bemerken.
Als wieder eine heftige Wehe kam und Elsa den Schmerz nicht unterdrücken konnte, schauten die beiden von ihren Arbeiten auf.
»Mama, ist dir nicht gut?«
»Nein, Kinder, mir ist nicht gut. Georg, zieh dich rasch an und lauf zu Mutter Kühn. Sie soll bald kommen. Ich glaube, es ist nicht mehr lang bis zur Geburt. Aber zieh die warmen Sachen an. Es ist kalt draußen.«
Georg tat sofort, wie die Mutter ihm aufgetragen hatte. Bald schon stand er dick vermummt in der Tür. »Ich gehe, Mama.«
»Ja, geh rasch, mein Junge. Beeil dich bitte und halt dich nicht auf. Es wird auch bald dunkel.«
»Halt, warte!«, rief sie dem Jungen noch hinterher. »Sag auch Lenchen Bescheid. Sie soll bitte rasch kommen!«
»Ja, Mama, mach ich. Ich bin schon weg, und ich komme auch sofort zurück.«
Über Mittag hatte es frisch geschneit, und es flogen immer noch einzelne Flocken. Georg griff den Schlitten, der in diesen Tagen immer vor der Haustüre stand, eilte ums Haus und fuhr so schnell es im Neuschnee ging den Schulhügel hinunter. Unten angekommen stellte er das Gefährt an eine Pappel und lief zu Fuß weiter. Die Hebamme, die im Dorf nur Mutter Kühn hieß – wie vielen Kindern sie in Nedbarewka zum Leben verholfen hatte, konnte sie wohl selbst kaum sagen -, wohnte auf der anderen Seite des Dorfbaches einen guten Kilometer aufwärts. Der Weg zu ihr führte bei Hirsekerns vorbei, die auf dieser Seite des Baches wohnten. Georg öffnete dort nur die Haustüre und rief in den Flur: »Lenchen, musst kommen. Die Mutter braucht dich!«, und schon war er wieder auf der Straße. Hoffentlich hatte die Frau den Ruf auch gehört.
Bald hatte der Junge das Haus von Mutter Kühn erreicht. Er klopfte hastig an die Türe, die auch bald geöffnet wurde.
»Mutter Kühn!« Ganz aufgeregt war Georg und auch ein wenig außer Atem. »Mutter Kühn, musst dich beeilen. Das Kind will kommen. Die Mutter weht schon.«
»Willst wohl sagen, die Mutter hat schon Wehen. Aber komm rein, mein Junge. Wärm dich einen Moment auf, bis ich mich fertig gemacht habe. Auf dem Tisch steht auch noch ein Bratapfel. Den darfst du derweil essen. Dann bist du gleich auch wieder frisch für den Heimweg.«
Georg hatte kaum genug Zeit, die gezuckerte Köstlichkeit zu essen, da stand Mutter Kühn schon in Mantel und Mütze mit ihrer Tasche in der Tür.
»Komm, Georg, wir gehen. Wenn die Mutter schon Wehen hat, müssen wir uns wohl beeilen. Manchmal kommt so ein Kind ganz rasch auf die Welt.«
Die beiden beeilten sich, so gut es eben für einen Zehnjährigen und eine fast Sechzigjährige bei den Schneeverhältnissen ging.
Als sie die Allee des Schulhügels hinaufstapften – Georg hatte jetzt seinen Schlitten natürlich am Seil -, kamen ihnen die rund vierzig Jungen und Mädchen der ersten beiden Schulklassen johlend und jauchzend entgegen. Elsa hatte wohl doch ihrem Mann Nachricht gegeben, und der hatte seine Schulkinder ein paar Minuten früher als sonst nach Hause entlassen.
So war es tatsächlich. Karl war bereits aus dem Schulhaus herübergekommen und hatte seiner Frau gut zugesprochen. »Wirst sehen, mein Elschen, Gott sorgt.«
»Ja«, konnte Elsa nur zurückhauchen, und dabei krümmte sie sich unter dem Schmerz der nächsten Wehe.
Lenchen Hirsekern war aber auch schon da und kümmerte sich um die Vorbereitung des kommenden Ereignisses. Sie hatte inzwischen ein paar zusätzliche Petroleumlampen angezündet, damit es auch hell genug war in der Stube. Dann richtete sie die Wiege und die Säuglingswäsche her, so dass Mutter Kühn gleich an ihre Arbeit gehen konnte.
Jetzt nahmen Karl und Lenchen die Kinder und gingen mit ihnen in deren Schlafkammer, um sie dort zu beschäftigen und abzulenken. Während der Geburt sollten sie doch nicht in der Stube sein. Alle setzten sich auf die Bettkanten und legten wie selbstverständlich die Hände ineinander, als hätten sie die Worte des Vaters schon erwartet: »Kinder, jetzt ist ein Gebet für Mama nötig, damit Gott alles gut macht.«
Und dann ging alles ganz schnell. Mutter Kühn hatte Elsa kaum in der großen Stube auf die Liege gebettet – in der Elternschlafkammer war es zu kalt und zu dunkel – und Tücher und warmes Wasser bereitgestellt, da schrie die Gebärende zweimal laut vor Schmerzen auf. Dann folgte auch schon ein etwas verzerrter, aber dennoch erkennbarer Jauchzer der Befreiung und Freude. Und auch das kräftige Stimmchen des Neugeborenen wurde im Nebenraum deutlich gehört und mit leisem Jubel registriert. Laute Beifalls- und Begeisterungsbekundungen ließ der Vater mit Rücksicht auf Mutter und Kind nicht zu.
Also, Miluscha war da.
Eigentlich hieß sie Emilie, nach Karls erster Frau; so hatten es die Eltern vorher festgelegt. Alle würden das Mädchen ohnehin nur Miluscha nennen. 49 Zentimeter groß war das Kind und 3850 Gramm schwer, mit kohlrabenschwarzem Haar und sonst allem dran. Zwar noch ein bisschen runzlig, wie Neugeborene zu sein pflegen, aber das würde sich ja bald geben.
Wie groß war die Freude beim Vater, als er nach einer angemessenen Weile, in der die Hebamme die doch arg erschöpfte Mutter und ihr Neugeborenes versorgt hatte, seine Frau in die Arme schließen konnte. Er tat es zärtlich und voller Inbrunst: »Danke, mein liebes Elschen! Und Dank an den Vater im Himmel!«
Groß war die Freude auch bei den Kindern, als sie zum ersten Mal das neue Schwesterchen anschauen durften, das inzwischen friedlich schlafend in seiner Wiege lag, kaum dass das Gesichtchen zu sehen war.
Und groß war die Freude auch bei der Hebamme, die dankbar registrierte, dass wieder einmal eine Geburt ohne nennenswerte Komplikationen abgelaufen war.
Lenchen, die sich auch herzlich mit ihrer Freundin mitfreute, kamen freilich dabei ein paar Tränen der Wehmut, weil ihr dieses Glück bisher versagt war.
Karl Beer erhob sich schließlich, nahm seine große Bibel vom Schreibtisch und begann zu lesen. Er hatte einen Psalm Salomos aufgeschlagen: »Siehe, Kinder sind eine Gabe des HERRN, und Leibesfrucht ist ein Geschenk.«
Er unterbrach sich selbst, blätterte in dem heiligen Buch ein paar Seiten zurück und las dann weiter, diesmal von David: »Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.«
Wieder nach ein paar Augenblicken des Schweigens las der Vater zum dritten Mal, nachdem er näher an die Wiege herangetreten war. Diesmal las er nicht aus den Psalmen, sondern aus dem vierten Buch Mose einen Text, den er schon oft gesprochen hatte und den er eigentlich auch auswendig hätte sagen können. Aber vielleicht befürchtete er, in seiner inneren Erregung den Text nicht zu Ende sprechen zu können. Und so las er denn über seinem jüngsten Kind den Segen Aarons:
»Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.«
Eine feierliche Stille hatte sich über den Raum gelegt. Selbst von den Kindern war nichts zu hören, nicht einmal ein Flüstern. Alle waren sich wohl des Ernstes dieser Minuten bewusst.
Schließlich brach Karl Beer die Stille ab: »Und jetzt dürfen wir ein fröhliches Abendessen einnehmen und ein bisschen feiern. Wir haben alle eine Stärkung nötig und verdient. Lenchen, du kennst dich aus. Deck uns den Tisch. Georg und Olga können dir dabei helfen.«
So geschah es dann auch. Es wurde ein fröhliches Mahl am großen Tisch. Die erschöpfte Mutter auf ihrer Liege und den Säugling in seinem Bettchen störte es nicht, dass die Tischrunde verhalten laut war. Jeder war einfach glücklich und dankbar.
Bis die größeren und kleineren Kinder schließlich in den Betten lagen und Mutter Kühn und Lenchen endlich das Haus verlassen und sich durch die kalte, klare Winternacht auf den Weg nach Hause gemacht hatten, waren ein paar Stunden vergangen, Stunden der Freude, der Dankbarkeit und des Familienglücks.
Karl Beer saß noch eine Weile bei seinem Elschen. Ohne viel zu reden, hielt er ihr einfach die Hand und strich ihr über das Haar.
Er befahl Mutter und Kind noch einmal der Gnade Gottes. Dann sorgte er dafür, dass das Feuer im Herd über Nacht nicht ausging, und löschte die Lichter bis auf eins. Ganz dunkel sollte es in der Stube nicht werden, denn Klein-Miluscha würde sich sicher bald melden.
Schließlich legte der Vater sich auch ins Bett. Wer weiß, wie unruhig die Nacht werden würde. Und morgen war wieder Schule. Gut, dass Lenchen gleich in der Frühe wieder zur Hilfe auf den Schulhügel kommen wollte.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Dunkle Wolken
Sommerzeit, Ferienzeit. In diesen Julitagen war Karl Beer Landwirt. Jetzt widmete er sich dem Vieh, den Feldern und Wiesen. Hier konnte er die größeren seiner Kinder um sich haben. Sie fassten ja auch schon kräftig mit an, gerade in diesen Tagen, wo es darum ging, das Heu mit dem Rechen immer wieder zu wenden, abends auf Kegel zu häufen, es morgens mit der Gabel wieder auseinander zu streuen und es wieder zu wenden, bis es genügend getrocknet war, um es einzubringen.
Auch die Kleinen – Hugo war inzwischen vier und Miluscha schon anderthalb Jahre alt – konnten mit draußen sein. Sie liebten es, auf dem Hof zwischen Hühnern und Enten zu spielen oder auf dem Feld und der Wiese. Und es gefiel ihnen, wenn sie dann abends am Brunnen in den großen Zuber steigen konnten, um den Schmutz des Tages abzuwaschen.
Die ganze arbeitsfähige Familie war auf der Heuwiese zwischen Schulhügel und benachbarter Mühlenanhöhe beschäftigt. Vater, Mutter, Georg und auch schon Waldemar waren dabei, das gut getrocknete Heu auf lange Reihen zu rechen, damit es nachher in die Scheune gefahren werden konnte. Hugo und Miluscha spielten zwischen den Großen und hatten ihren Spaß, wenn sie über die fertigen Mahden steigen konnten. Dabei lag Miluscha mehr auf der Nase, als dass sie auf ihren strammen Beinchen stand.
Nur Olga fehlte. Die Mutter hatte sie ins Dorf geschickt, damit sie beim Kaufmann Nähgarn und Knöpfe holen sollte. Am Abend wollte Elsa einige Arbeitskittel in Ordnung bringen. Wenn die Tochter zurück war, sollte sie auch auf die Wiese kommen. Beim Zusammenrechen des Heus konnte sie dann gut noch helfen. Lange konnte sie eigentlich nicht mehr ausbleiben.
Schon vom Hof her hörten die Heuarbeiter das Mädchen rufen. Heftig winkte sie schon von weitem mit beiden Händen. Irgendeine wichtige Sache schien sie mitzubringen und möglichst bald loswerden zu wollen.
»Papa, Papa!«, rief sie schon vom Wiesenrand her. »Ich soll vom Bürgermeister ausrichten …«
Olga blieb bei ihrem Vater stehen, der ihr ein paar Schritte entgegengekommen war, und holte erst einmal tief Luft.
»Was ist, mein Kind?«, beruhigte der Vater das aufgeregte Mädchen.
»Also, ich soll vom Bürgermeister ausrichten, dass heute Abend bei ihm in seiner Mühle eine Versammlung ist, wo du dabei sein sollst. Es wär ganz wichtig, und du musst unbedingt kommen.«
»Und er hat dir sonst nichts dazu gesagt?«
»Nein, nur dass es um ganz was Wichtiges geht.«
»Und die Versammlung ist nicht wie sonst bei ihm zu Hause?«
»Nein. Herr Blum hat es zweimal gesagt, dass die Versammlung in der Mühle ist. Und du sollst nicht vor neun Uhr kommen, eher später. Du hättest es ja nicht weit, hat er noch gesagt.«
»Danke für die Nachricht, Oluscha. Geh jetzt hinüber und hilf der Mutter und deinem Bruder, das Heu fertig zusammenzurechen. Ich will derweil den Wagen holen.«
Merkwürdig, dachte Karl Beer, eine Versammlung erst nach Einbruch der Dunkelheit und dann in der Mühle. Die große Windmühle friesischer Bauart stand wenige Minuten vom Schulhügel entfernt auf einer anderen Anhöhe. Sie gehörte einem der Brüder Blum, dem wohlhabendsten Bauern im Dorf, der zugleich der Bürgermeister war.
Irgendetwas war wohl im Gange. Ob das etwas mit der Schule zu tun hatte und den Neuerungen, von denen er gehört hatte? Der Deutschunterricht sollte reduziert werden; es sollte Russisch als Pflichtfach eingerichtet werden; der Religionsunterricht sollte eingeschränkt werden; alle Schüler sollten zu Pionieren gemacht werden … Sein Bruder August, der in Hainau Schuldirektor war, hatte ihm neulich einmal von solchen Dingen berichtet, die den Deutschen an der Wolga von der Regierung in Moskau bereits zur Auflage gemacht worden seien. Sollten diese Bestimmungen jetzt auch hier im Wolhynischen eingeführt werden?
Dem Lehrer war es, als liefe ihm trotz der Sommerhitze ein kalter Schauer über den Rücken. Es war klar, er würde zu der Versammlung gehen. Und die Aufforderung, erst nach Einbruch der Dunkelheit zu kommen, hatte sicherlich auch ihre Bedeutung.
Aber jetzt musste erst einmal das Heu eingefahren werden.
Wenig später kam Karl Beer mit dem Braunen vor dem Leiterwagen auf die Wiese gefahren. Georg kletterte auf den Wagen, um das Heu, das der Vater ihm mit einem Dreizink anreichte, zu verteilen und festzudrücken. Elsa und Waldemar besorgten das Zusammenrechen der Heureste. Olga konnte sich jetzt ein wenig um die Kleinen kümmern.
Als der Wagen hoch genug gefüllt war, fuhr der Vater mit dem Ältesten auf den Hof, um das Heu in der Scheune wieder abzuladen. Zwei weitere Fuhren würde es wohl noch geben. Elsa ließ die Kinder auf der Wiese zurück und ging hinter dem Wagen her. Sie wollte Kaffee und Kuchen für eine Pause holen. Im Freien auf der Wiese würde die Pause besondere Freude machen.
Das Abladen ging den Männern recht schnell von der Hand, zogen Vater und Sohn das Heu doch nur vom Wagen. Auf den Heuboden konnte man es morgen noch hinaufreichen. Die beiden waren bald gemeinsam mit Pferd und Wagen wieder auf der Wiese, und Elsa war mit dem Verpflegungskorb auch wieder da. Jetzt wurde sich erst einmal gestärkt, nachdem der Vater ein Dankgebet gesprochen hatte.
Es war ein schönes Bild, die ganze Familie dort auf der Wiese im Kreis sitzen zu sehen bei Kaffee, Saft und Kuchen. Eine richtige Idylle.
»Kinder, keine zu lange Pause«, mahnte der Vater nach einer Weile. »Es muss weitergehen mit der Arbeit. Schaut mal dort an den Horizont. Die Wolken deuten auf ein Gewitter hin. Ehe das hier ankommt, sollte das Heu doch möglichst unter dem Dach sein. Es wäre zu schade, wenn es da noch hineinregnen würde. Also ran ans Werk!«
Das Arbeitstempo wurde ein wenig erhöht, und so war die nächste Fuhre schnell beladen und dann auch bald in der Scheune versorgt. Die letzte Fuhre konnte geholt werden. Aber da war die Sonne bereits hinter den ersten Wolken verschwunden und Wind kam auf.
Die letzte Fuhre war noch nicht lange abgeladen, Pferd und Mensch waren kaum in Stall und Haus, da begann es auch schon, zu donnern und zu blitzen, und der Wind fegte heftig über den Hof und das Land, zauste die Bäume und wirbelte die liegen gebliebenen und die unterwegs verloren gegangenen Heureste durch die Luft.
Zunächst regnete es nur wenig, doch bald goss es in Strömen. Wie gut, dass das Heu trocken in der Scheune lag.
Nur kurz dauerte das Unwetter. Schaden hatte es keinen angerichtet. Und als der Regen etwas nachgelassen hatte, durften die Kinder auch wieder hinaus und sich nass machen lassen. Welche Freude die Kinder dabei hatten! Das sparte außerdem die Dusche und das Zuberbad am Brunnen.
Gegen neun am Abend – um diese Zeit war es hier im Osten bereits fast Nacht – machte Karl Beer sich auf den Weg zur Mühle. Was Hannes Blum wohl für Neuigkeiten mitzuteilen hatte?
Ob das Gewitter am späten Nachmittag wohl ein Zeichen war für ein ganz anderes Gewitter, das sich nordöstlich von hier zusammenbraute und bald über Region und Dorf hinwegfegen würde? Und wenn, welche Schäden würde es anrichten?
Karl Beer überkam ein Anflug von Bangigkeit, als er mit diesen Fragen die frisch gemähte Wiese überquerte, deren Heu schon eingebracht war. Doch er verscheuchte diese Gedanken rasch. Stand doch über seinem Leben und dem der Familie die göttliche Zusage: »Sei getrost und unverzagt!«
Nach wenigen Minuten Weg hatte der Lehrer sein Ziel erreicht. Als er die Mühle betrat, hörte er rufen: »Komm herauf. Wir sind auf dem Körnerboden.« Das war ja noch geheimnisvoller! Warum war das Treffen nicht unten im Mehllager? Der Raum war doch viel größer.
Karl begab sich die Stiege hinauf. Im Schein einiger Petroleumlampen saßen ein paar Männer des Dorfes, die alle zum Gemeinderat gehörten, aber auch zwei Bauern, die zu den Großen zählten.
»Gut, dass du da bist«, begrüßte Bürgermeister Blum den Angekommenen. »Es geht auch um dich in den Dingen, die auf uns zukommen.«
»Sagt mir, was los ist«, forderte Karl die Anwesenden auf. »Ich hoffe nicht, dass sich meine Ahnungen bestätigen.«
»Wahrscheinlich wird es noch viel schlimmer kommen, als du ahnst«, gab Hannes Blum zurück. »Ich hatte heute unangenehmen Besuch. Ein Verwaltungsoffizier aus Kiew. Und ich weiß nicht, ob der noch irgendwo in der Gegend herumspioniert. Deshalb unser Treffen hier in der Mühle. Bis auf die große Wiese ist mir der Kerl mit seiner Knatterkiste nachgefahren, um seinen Brief loszuwerden. Hier, das ist der Wisch.« Hannes Blum zog umständlich einen Brief aus einem braunen Umschlag.
»Nun sag schon, was drin steht«, forderten die Männer ihren Bürgermeister auf.
»Nichts Gutes«, seufzte der hörbar auf. »Die Zeiten ändern sich. Neue Regierungen, neue Gesetze, neue Bestimmungen. Und nichts, was uns hier gefallen könnte.«
»Halt nicht so eine lange Vorrede, Hannes. Davon werden die Nachrichten nicht besser«, mahnte August Loske, der Schwager von Karl Beer.
»Gut«, seufzte der Bürgermeister noch einmal auf. »Es geht in der Hauptsache um die Schule und den Unterricht und zum anderen um unsere Höfe. Also um unsere Kinder und um unsere Familien.«
Ein Raunen ging durch den Kreis der Männer, und Hannes Blum bat um Ruhe.
»Nach den Sommerferien muss unsere Schule umorganisiert werden. Ab der Klasse drei muss in russischer Sprache unterrichtet werden. Weil das unser geschätzter Lehrer nicht leisten kann, wird uns ein Lehrer aus der Hauptstadt geschickt. Ein Russe natürlich, den wir irgendwo einzuquartieren haben. Der Deutschunterricht wird dafür gekürzt, und …« – der Bürgermeister zögerte, wohl, um der folgenden Aussage ein größeres Gewicht zu geben – »der Religionsunterricht ist ersatzlos zu streichen. Außerdem wird es untersagt, irgendwelche Themen zu behandeln, die von deutscher Kultur und Zivilisation handeln oder auch nur danach riechen.«
»Ich habe es geahnt!« Karl Beer war sehr betroffen von dem, was er da gehört hatte. »Ich habe es geahnt. Aber mit mir ist eine solche Umstellung nicht so ohne weiteres zu machen.«
»Was denkst du zu tun?«, fragte einer der Männer, der gleich drei Kinder im Unterricht der Dorfschule sitzen hatte.
»Ich werde den Behörden einen Brief schreiben und mitteilen, dass ich selbst Russisch spreche, was ja auch die Wahrheit ist. Und dann werde ich schreiben, dass es also nicht erforderlich ist, einen Russischlehrer aus der Hauptstadt hier aufs Land zu schicken. Wir kämen da schon allein zurecht. Und ich werde diesen Brief in Russisch schreiben. Das wird Eindruck machen. Natürlich das alles nur, wenn ihr einverstanden seid. Wie ich dann meine Schule führe, wird hoffentlich so bald keiner kontrollieren.«
Karl Beer hatte diese Worte sehr fest gesprochen, aber im Innersten war ihm nicht ganz wohl dabei. Ob solch ein Brief wirklich Eindruck machte und Erfolg hatte? Aber er wollte es versuchen.
»Natürlich sind wir einverstanden, wenn du das so machst, Karl. Schreib den Brief bald, damit er auch bald ankommt bei dieser Moskau-Bande. Wir lassen uns nicht einfach so von denen in den Sack stecken.«
Der so gesprochen hatte, war der Tischler, Johann Patt, der zweite Bürgermeister, der zwar seinen Beruf beherrschte, der aber manchmal ein wenig hitzköpfig sein konnte und nicht immer in vornehmer Art mit den Leuten umging. Seine Frau wusste davon das lauteste Lied zu singen.
»Gut, Karl, wenn du denkst, das geht so, dann schreib den Brief. Wir werden sehen, was er bewirkt«, sagte der Bürgermeister auf seine ruhige Art. Dann wurde seine Stimme erregter. »Das andere Kapitel trifft uns wohl noch härter. Es geht um unsere Höfe und um unser Land.« Blum brach ab, als hätte er Schwierigkeiten weiterzusprechen. Er atmete tief und schwer ein.
»Der russische Staat will sein Kolchoswesen auch in unserer Region durchsetzen, wie er es andernorts schon getan hat. Zwischen Nedbarewka und Nikolaital soll gebaut werden. Was das für uns bedeutet, zumindest einmal für die, die auf dieser Seite des Baches ihr Land haben, muss jedem klar sein.«
»Und was bedeutet das für uns?«
»Diese Frage kannst auch nur du stellen, Schuster«, regte sich August Loske auf. »Du hast nicht viel Land, brauchst ja auch nicht viel. Und außerdem liegt dein Land auf der anderen Seite, die zunächst wohl gar nicht betroffen ist.«
»Ruhig, Männer, Aufregung hilft nicht weiter«, versuchte Karl Beer zu besänftigen.
»Hast du auch hierzu einen Vorschlag?«, fragte ihn der Bürgermeister.
»Ich weiß nicht. Überraschend kommt mir das alles nicht. Mein Bruder August in Hainau hat schon im Frühjahr einmal von solchen Sachen gesprochen. Die Hainauer werden übrigens wohl die gleiche Post bekommen haben. Also, ich denke, wir sollten auch dieser Entwicklung vielleicht ein Stück zuvorkommen. Kolchose bedeutet für die, die das Land haben, Enteignung. Die Russen fackeln da nicht lange. Vielleicht sollten wir ihnen anbieten, dass wir hier in Nedbarewka eine Genossenschaft gründen. Die ist dann so etwas Ähnliches wie ein Kolchosbetrieb. Wir tun unser Land auf dem Papier zusammen, bearbeiten es gemeinsam, rechnen gemeinsam ab, und so weiter.«
»Und was ist mit denen in Nikolaital?«, wollte einer wissen.
»Nun, die müssten da mitziehen, möglicherweise in einer gemeinsamen Genossenschaft.«
»Ich werde morgen einmal hinüberfahren«, schlug Hannes Blum vor, »und mit dem Bürgermeister dort sprechen. Wahrscheinlich hat er den gleichen Brief bekommen. Vielleicht können wir die Entwicklung ja tatsächlich noch ein paar Jahre aufhalten.« Und direkt an Karl Beer gewandt fragte er: »Du wirst doch dann auch diesen Brief schreiben?«
Die Antwort war, wie sie jeder erwartet hatte: »Selbstverständlich. Und auch in Russisch. Gib mir Nachricht, wann ich es machen soll.«
Es ging noch eine Weile hin und her unter den Männern dort auf dem Körnerboden der Blumschen Mühle. Und leicht war es ihnen allen nicht gerade ums Herz, als sie endlich gegen Mitternacht ihren Heimweg durch die Dunkelheit suchten. Der Moloch Russland hatte sein Maul aufgerissen und war bereit, alles zu verschlingen, was nicht seinen Kommandos folgte. Das war den Männern allen klar.
Jeder fühlte es, dass sich hier eine Entwicklung vielleicht verzögern ließ, nicht aber aufhalten oder gar verhindern. Und jeden bedrängte in seinem Innersten wohl schon die Frage, wie das alles werden würde und wie die Zukunft ihres Dorfes und seiner Leute wohl aussehe.
Als Karl Beer nach Hause kam, lag seine Frau schon im Bett. Aber sie war noch wach.
»Du hast schlechte Nachrichten, mein Lieber, stimmt’s?«, fragte sie ihn, als er zu ihr unter die Decke kam.
»Ja, mein Elschen, schlechte Nachrichten. Aber lass uns morgen darüber sprechen. Nach der Nacht ist der Kopf wieder etwas klarer.«
Der nächste Morgen zeigte sich wieder von seiner schönen Sommerseite. Die Kinder konnten draußen sein, sich beschäftigen und spielen. Nachdem Karl das Vieh versorgt und noch einiges auf dem Hof gerichtet hatte und nachdem Elsa die Stuben in Ordnung hatte, setzten die beiden sich auf die Bank unter dem großen Apfelbaum, und Karl erzählte seiner Frau mit wenigen Sätzen, was möglicherweise auf ihn als Lehrer des Dorfes zukam. Das Stichwort Kolchose erwähnte er nicht.
Elsa wollten die Tränen kommen über dem Gehörten und über dem Leid, das sich ergeben könnte.
Sofort versuchte Karl sie zu trösten: »Nicht bekümmern, mein Liebes, Gott wird sorgen!« Er drückte die junge Frau fest an sich und sagte ihr dann, was er vorhatte.
»Ich werde jetzt den Brief an die Schulbehörde in Kiew aufsetzen, danach fahre ich nach Hainau, um die Sache mit August und Friedrich zu besprechen und den Brief auf den richtigen Gebrauch der russischen Grammatik prüfen zu lassen. Dann fahre ich noch bei der Post vorbei. Zum Abend werde ich wieder hier sein. Wenn du irgendetwas aus Hainau brauchst, sag es mir. Ich bringe es dir mit.«
Karl ging ins Haus, um seinen Brief zu formulieren. Elsa kam ein wenig später nach, um sich um das Mittagessen zu kümmern, das heute früher als sonst eingenommen werden musste.
Gleich nach dem Essen spannte Karl Beer das Pferd vor die Kutsche.
»Papa, darf ich mitfahren?«, bettelte Georg. »Ich kann doch dann auf den Braunen aufpassen, wenn du mit den Onkeln sprichst.«
»Das ist keine schlechte Idee«, gab der Vater zurück. »Frag Mama, ob sie dich für irgendeine Arbeit braucht. Wenn nicht, dann komm rasch, damit wir keine Zeit verlieren.«
Mit einem Jauchzer kam der Elfjährige aus dem Haus, die Mütze in der Hand und eine leichte Jacke über dem Arm. »Mama sagt, ich darf mitfahren. Und ich soll gut auf dich aufpassen.«
Schon saß er neben seinem Vater auf dem Bock und los ging die Fahrt.
Elsa, Miluscha auf dem Arm und Hugo an der Hand, konnte den beiden gerade noch ein »Gott behüte euch!« nachrufen, ehe sie unter den Bäumen der Allee aus dem Blickfeld kamen.
In Hainau traf Karl seine beiden Brüder im Haus von August an. Die drei führten miteinander ein langes und ernstes Gespräch über die Lage, die sich nun auch für die Region Schitomir anbahnte. Auch in den anderen Gemeinden hatten die Bürgermeister Post bekommen. Die Briefe, die Kuriere überall abgeliefert hatten, klangen alle gleich. Und sie erzeugten überall die gleiche Unruhe unter den Leuten und die gleichen Befürchtungen für die Zukunft.
Die drei Männer waren sich einig darin, dass die Entwicklung, die sich gegen alles Deutsche und gegen alles Christliche richtete, nicht aufzuhalten sein würde, weil es niemanden gab, der sie hätte aufhalten können. Die Nachrichten aus dem Wolgagebiet waren zu eindeutig. Da war von Enteignung die Rede, von Verhaftung der Männer, Vergewaltigung der Frauen, von Trennung der Familien, Verbannung und Deportation. Nein, das waren keine guten Aussichten für die kommenden Jahre.
»Und dennoch«, sagte Karl. »Ich werde den Brief abschicken. Und auch später den für unsere Bauern. Vielleicht kann ich wenigstens Zeit gewinnen für andere Lösungen.«
»An was für andere Lösungen denkst du?«, fragte Friedrich.
»Nun, für die Schule hoffe ich, dem Sowjetstaat entgegenzukommen, wenn ich, wie geschrieben, den russischen Unterricht anbiete. Ihr habt meinen Brief ja für gut befunden. Vielleicht wäre das auch für andere Schulen eine mögliche Lösung. Viele von unseren Kollegen sprechen doch Russisch. Ihr könnt euch ja auch einmal umhören, wie andere denken. Und in der anderen Sache kann der eine oder andere vielleicht sein Land verkaufen, ehe es enteignet wird, und dann nach Deutschland zurückkehren. Es wird hier auch Bauern geben, die niemals an eine Auswanderung nach Deutschland denken würden, weil sie noch länger in diesem Land sind als wir. Die würden ihre Höfe vielleicht gerne vergrößern. Vielleicht gibt es aber auch in der großen Sowjetunion noch Gebiete, die der Moloch übersehen hat. Ich für meinen Teil werde schon einmal Kontakt mit meinem Freund Paul Schröger in Cherson aufnehmen. Wenn die Luft in Nedbarewka wirklich nicht mehr zu atmen ist, könnten wir in die Südukraine gehen. Aber ich denke, das sind alles noch ungeschriebene Blätter.«
»Deine Worte in Gottes Ohren, lieber Bruder«, beschloss August das Gespräch. »Grüß deine liebe Elsa und auch die Kinder.«
»Ja, tu das«, schloss Friedrich sich an. »Und wir wollen uns und die Unsrigen täglich der treuen Fürsorge Gottes anbefehlen.«
»Ja, so ist es. Gott wird für uns alle sorgen, Brüder.« Mit diesen Worten und einem herzlichen Händedruck für die beiden verabschiedete sich Karl und verließ das Haus.
Georg hatte derweil treu auf den Braunen aufgepasst, der mit seinem Hafersack vor dem Maul am Zaun angebunden war, und sich dabei mit ein paar Jungen unterhalten, die er von früheren Fahrten nach Hainau her kannte.
Diese Burschen ahnten noch nichts von dem Unheil, das sich für die Deutschen der Region am Horizont abzeichnete. Sie sollten ihre Kinderjahre unbeschwert verleben, solange das eben ging.
Karl Beer wäre es am liebsten gewesen, Georg hätte ganz still neben ihm auf dem Kutschbock gesessen. Er hätte so gerne weiter nachgedacht über die Lage und über die Konsequenzen für seine Familie. Aber der Mund des Jungen stand nicht still. Eine Frage folgte der anderen, und immer wieder wusste der Vater Antworten, die den Jungen in Erstaunen versetzten.
»Ich möchte auch so klug werden wie du, Papa, und so groß und so stark.«
»Na, das werden wir dann sehen, mein Lieber. Wenn du immer fleißig lernst und wenn du immer kräftig mithilfst im Haus und im Garten und auf dem Hof, dann könnte das was werden.«
Noch während er so sprach, ging dem Vater die Frage durch den Kopf, ob wohl Georg überhaupt eine Chance für eine solche Entwicklung hätte. Und was wohl dann aus seinem Elschen und den anderen Kindern werden würde, vor allem aus Miluscha, die ihm ganz besonders nah war.
Wie hatte er seiner Frau heute Morgen noch gesagt und Trost zu geben versucht?
Nun sagte er sich selbst: »Nicht bekümmern, Karl Beer, Gott wird sorgen!«
Ja, daran wollte er festhalten, wie es auch immer werden würde mit der Schule und der Familie. Auf jeden Fall würde er zunächst einmal die Antwort der Schulbehörden aus Kiew oder auch aus Moskau abwarten und erst danach handeln.
Als die Familie abends wieder vereint am Tisch saß, war dem Vater nicht anzumerken, dass ihn schwere Fragen belasteten. Er hatte sie auch ein Stück weit abgeben können und freute sich jetzt, mit seinen großen und kleinen Lieben Abendbrotgemeinschaft zu haben.
Nach dem Dankgebet wollte Karl seinen Kindern schon eine gute Nacht wünschen, als sie ihn von allen Seiten bedrängten. »Papa, es ist ein so schöner Abend. Wir wollen noch ein bisschen vor dem Haus unter dem Apfelbaum singen. Das haben wir so lange nicht mehr gemacht.«
Olga war die Wortführerin der anderen. Die stimmten sofort ein. »Ja, Papa, nimm die Geige.«
»Ja, Papa, bitte singen!«
»Singen, singen, singen.« Das war Klein-Hugo.
Miluscha drehte sich bereits in der Stube im Kreis und sang, in ihre kleinen Hände klatschend: »Lei la, lei la, lei la.«
Die Eltern mussten nun doch lachen ob dieser Kinderwünsche und der musikalischen Aufforderung ihrer Jüngsten. Und so stand denn der Vater auf, nahm seine Geige von der Wand neben dem Schreibtisch, wo sie immer ihren Platz hatte, und dann gingen alle freudig hinaus.
Das wurde ein fröhliches Singen. »Konzert ist heute angesagt im frischen grünen Wald …«, »Geh aus, mein Herz, und suche Freud …«, »Und wieder blühet die Linde …«, »Die beste Zeit im Jahr ist mein …« und viele andere Lieder klangen über den Hof.
Inzwischen wurde es dämmrig, und der Vater mahnte: »Nun muss es genügen, Kinder. Zum Schluss noch das schöne Abendlied von Matthias Claudius.« Und alle sangen es aus vollem Herzen, soweit sie es denn konnten, bis hin zu der Strophe, die auch des Nachbarn gedachte:
»So legt euch denn, ihr Brüder,
in Gottes Namen nieder,
kalt ist der Abendhauch.
Verschon uns, Gott, mit Strafen
und lass uns ruhig schlafen
und unsern kranken Nachbarn auch.«
»Und jetzt gute Nacht, alle meine Lieben«, verabschiedete der Vater das kleine Völkchen. »Ihr Großen helft der Mutter, die Kleinen ins Bett zu bringen. Ich gehe noch den Tieren gute Nacht sagen.«
Jedes der Kinder bekam noch einen Gute-Nacht-Kuss. Klein-Miluscha umarmte der Vater noch besonders innig, und dann verschwand die Familie im Haus.
Karl Beer machte seinen abendlichen Rundgang über den Hof und durch den Stall. Dabei ging ihm wieder durch den Kopf, was denn wohl aus dem allen werden würde, wenn …
Aber er sagte es sich selbst noch einmal mit Nachdruck: »Nicht selbst sorgen, Karl Beer, alles liegt in Gottes Händen!«
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Badefreuden und Kinderleid
»Mama, dürfen wir baden gehen?«, rief Olga von draußen durch die offene Haustüre in die Stube, in der Elsa mit irgendetwas beschäftigt war. »Es ist so schön warm, und es sind schon viele Kinder am Teich.«
»Fragt Papa, ob er es erlaubt«, kam es zurück.
»Papa ist aber nicht da. Den können wir nicht fragen.«
»Nun gut, dann geht. Aber seid bitte vorsichtig, und passt vor allem auf die Kleinen auf.« Elsa war immer ein wenig ängstlich, wenn sie die Kinder nicht in der Nähe wusste.
»Keine Bange, Mama, wir passen schon auf, dass nichts passiert.«
»Und wir nehmen auch den Zuber mit. Damit können wir gut Boot fahren.« Dieser Vorschlag kam von Georg, der den Holzzuber bereits auf den kleinen Handwagen gewuchtet hatte.
»Aber Miluscha lasst ihr hier; die kann im Hof spielen.«
»Oh, schade, wir wollten sie doch so gerne über den Teich fahren«, bedauerten Georg und Olga fast einstimmig.
»Nein, Kinder, das ist mir doch zu gefährlich«, bestand die Mutter auf ihrer Entscheidung. »Vielleicht kommt Papa ja mit Miluscha an den Teich, wenn er wieder da ist.«
»Au, das wäre fein. Sag ihm, er soll unbedingt mit Miluscha kommen. Das gibt einen Spaß!« Und weg waren Georg, Olga und Waldemar mit dem Handwagen.
»Ihr habt Hugo vergessen«, rief Elsa den Kindern nach.
»Angeschmiert, angeschmiert!«, riefen die fröhlich zurück. »Der sitzt im Zuber.« Und dann waren sie wirklich weg und bald mit ihrer Fracht am Teich, wo sie sich gleich den anderen Kindern des Dorfes zugesellten.
War das ein Spaß, sich halbnackt oder nackt ins Wasser zu stürzen, darin zu toben, den Zuber zu schieben, dessen Besatzung ständig wechselte, sich dann wieder auf der Wiese zu tummeln mit Spielen aller Art!
Miluscha hatte den Auszug ihrer Geschwister offenbar gar nicht registriert. Sie spielte derweil im Hof mit Eimerchen und Schaufel-chen, mit Sand und Steinen, mit Hölzchen und Stöckchen. Die Kleine war da sehr genügsam. Wenn ihr eins der Hühner zu nahe kam – das Federvieh auf dem Hof lief immer frei herum und war durch die ständige Nähe zu den Menschen sehr zutraulich -, dann lief sie ihm hinterher und hatte ihren Spaß, wenn die Tiere gackernd davonstoben.
Elsa schaute immer wieder einmal aus der Tür, um nach ihrer Jüngsten zu sehen. Und wenn sie sie dann spielen sah, ging sie beruhigt wieder in die Stube.
Dann hatte sie wohl irgendwie die Zeit vergessen und eine längere Weile nicht nach draußen gesehen. Und als sie dann schaute, erschrak sie heftig. Wo war Miluscha? Das Kind war nirgendwo zu sehen.
»Miluscha, Miluscha! Wo bist du?«
Aufs Höchste erregt lief Elsa ums Haus, lief um die Scheune, schaute die Allee hinunter, lief in den Garten, auf die Obstwiese. Miluscha war nicht zu finden. Und auf ihr Rufen bekam die Mutter keine Antwort.
Elsa geriet schier in Panik. »Die Jauchegrube!«, schoss es ihr durch den Kopf.
Welch ein Glück, der Deckel auf der Grube war geschlossen. Elsa atmete tief durch. Aber wo konnte das Kind nur sein?
Da erst bemerkte sie, dass die Schweine in ihrem Pferch Krach machten, wie sie es sonst um diese Tageszeit nicht taten. Es war ja nicht Fressenszeit.
Elsa lief eiligst und in fast panischem Schrecken um den Stall herum und – blieb für Sekunden wie erstarrt stehen. Sie wusste nicht, ob sie lachen sollte oder sich entsetzen. Saß doch das kleine Ding im Pferch mitten unter den Schweinen und war damit beschäftigt, Futterreste aus dem Trog zu angeln und zu verspeisen. Und das schien ihr auch noch zu gefallen.
Elsa stürmte in das Gehege, so dass die Schweine in den hintersten Winkel flohen, und griff sich das Kind. »Miluscha, Kind, was machst du? Du kannst doch nicht bei den Schweinen spielen und dann auch noch ihr Futter essen.«
Miluscha schien das Eindringen der Mutter in ihr augenblickliches Reich nicht zu gefallen. Sie schrie und sträubte sich gegen ihren Griff. Sie wäre wohl lieber noch ein wenig im Schlamm sitzen geblieben und hätte weiter von den Pellkartoffelresten gegessen. Aber alles Schreien, Sträuben und Zappeln half nichts. Die Kleine musste mit.
»Wie schmutzig du bist und wie du stinkst! Mama muss dich erst einmal waschen und dir andere Sachen anziehen.«
Elsa trug das Kind bis zum Brunnen, darauf bedacht, dass sie ihr eigenes Kleid nicht auch noch beschmierte. Dann zog sie Miluscha aus und setzte sie in den Trog am Brunnen, der immer mit Wasser gefüllt war. Wie gut, dass die Sonne das Wasser erwärmt hatte. Frisches Brunnenwasser wäre zu kalt gewesen für das notwendige Bad.
Das gefiel dem Kind ausgezeichnet. Hier im Wasser zu plantschen, ließ das Erlebnis bei den Schweinen rasch vergessen.
Dann kam der Vater auf den Hof. Er hatte nach dem Weizen sehen wollen und auf dem Weg Hannes Blum getroffen. Das Gespräch mit dem Bürgermeister hatte ihn dann länger aufgehalten, als es ihm selbst recht war.
»Was macht denn ihr beide da? Ein Bad im Trog am hellen Nachmittag?«
Elsa erzählte ihrem Mann, warum das notwendig war.
»Na, nur gut, dass die Schweine friedlich geblieben sind«, kommentierte Karl den Ausflug der kleinen Tochter. »Schweine können auch anders. Aber wo sind die Großen?«
»Im Badeteich. Sie würden sich freuen, wenn du noch für eine Stunde zu ihnen hinunterkämst. Du sollst mit ihnen baden und Bottich fahren.«
»Wie? Die haben den Bottich mit hinuntergenommen?«
»Ja, Georg und Olga haben ihn auf die Karre geladen, dann haben sie Hugo hineingesetzt, und dann sind sie ab, die vier.«
»Na schön, dann mache ich den Kindern die Freude und gehe noch für eine Weile hinunter. Ich nehme Miluscha mit. Du kannst dich derweil ein wenig erholen von dem Schrecken der letzten halben Stunde.«
Der Vater sprach’s, nahm sich Miluscha, nackt wie sie war, und eilte mit raschen Schritten ums Haus und die Allee hinunter. Elsa hatte gerade noch ein großes Handtuch von der Wäscheleine ziehen und es ihm über die Schulter werfen können. »Das Kind wird nachher frieren. Wickle es gut ein, wenn du zurückkommst.«
Miluscha auf dem Arm ihres Vaters jauchzte vor Freude. Das liebte sie, beim Vater zu sein, auf seinem Schoß zu sitzen oder von ihm getragen zu werden, seinen Bart zu streicheln und die Ärmchen um ihn zu schlingen.
Unten am Teich gab es ein großes Hallo. »Papa, Papa!« »Herr Lehrer, Herr Lehrer!« So scholl es durcheinander aus vielen Kehlen.
Ihren Lehrer liebten sie alle. Auch die, die noch gar nicht zur Schule gingen. Sie lernten von ihren älteren Geschwistern schon, den Lehrer zu lieben. Und die Eltern unterstützten ihre Kinder darin.
»Hallo, Kinder, hier bin ich«, begrüßte Karl Beer die Meute der Jungen und Mädchen, die ihn alle freudig umringten. »Ich muss doch mal sehen, ob auch noch niemand untergegangen ist und ob ihr auch alle fleißig das Schwimmen übt.«
»Tun wir, Herr Lehrer, und wer noch nicht schwimmen kann, dem bringen wir es bei. Dann brauchen Sie es nicht mehr zu tun.«
Er hatte Recht, der Sohn vom Arzt. Den meisten Kindern des Dorfes hatte der Lehrer das Schwimmen beigebracht, und nur unter den Älteren, die noch nicht bei ihm in der Schule gewesen waren, gab es Einzelne, die das Schwimmen nicht gelernt hatten.
»Holt mal den Zuber ans Ufer«, gab Karl Beer den Kindern den Auftrag, und schon stürzte die ganze Meute ins Wasser. »Ich möchte Miluscha hineinsetzen.«
»Sie müssen auch hinein, Herr Lehrer.«
»Ja, wir fahren den Lehrer über den Ozean.«
»Schiff ahoi!«