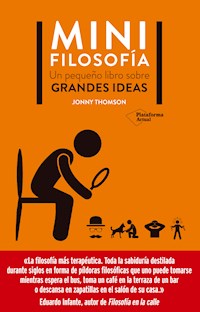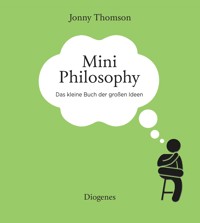
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In ›Mini Philosophy‹ befragt Jonny Thomson die schlausten Köpfe der letzten 2500 Jahre zu den brennenden Themen unserer Zeit. Sei es wahre Liebe, Mutter Natur, Langeweile, Kosmopolitismus oder die Frage nach der Existenz von Außerirdischen – die Philosophie leistet zu jedem Stoff ihren bereichernden und oft überraschenden Beitrag. Thomson bringt alte und moderne Ideen auf den Punkt und weiß sie humorvoll auf unseren Alltag anzuwenden. Unterhaltsame Texte für einen spielerischen Einstieg in die spannende Welt der Philosophie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Jonny Thomson
Mini Philosophy
Das kleine Buch der großen Ideen
Aus dem Englischen von Peter Klöss
Mit Piktogrammen des Autors
Diogenes
Für Tanya und Freddie,
meine Lieblingsphilosophen
Einführung
Die Philosophie umgibt sich manchmal mit einer Aura, die uns abschreckt. Vielleicht liegt es daran, dass Philosophinnen und Philosophen Wörter wie »Fehlschluss« verwenden, wenn sie »falsch« meinen, oder in jedem zweiten Satz wie selbstverständlich Zitate aus dem Altgriechischen einfließen lassen. Das muss nicht sein, und genau deshalb habe ich dieses Buch geschrieben.
Philosophie sollte nachvollziehbar sein, praktisch, lesbar und zugänglich. Und vor allem sollte sie Spaß machen.
In Mini Philosophy versuche ich philosophische Ideen so zu erklären, dass sie verständlich bleiben und eben nicht abschrecken, sondern Interesse hervorrufen. Natürlich kann ich nicht versprechen, dass ich keine langen, komplizierten und ungewohnten Wörter verwende, doch wenn ich es tue, werde ich mich bemühen, sie so einzubetten, dass sie am Ende des jeweiligen Kapitels einen Sinn ergeben. Dieses Buch ist für Leserinnen und Leser gedacht, die zwar schon einmal die Namen Platon, Descartes oder de Beauvoir gehört haben, aber kaum etwas über ihre Ideen wissen. Es ist ein Buch für Leute, die erfahren wollen, was Strukturalismus, Phänomenologie oder Existenzialismus bedeuten, ohne sich durch dicke Wälzer arbeiten zu müssen, nach deren Lektüre man oftmals noch verwirrter ist als vorher. Meine Hoffnung ist, die Philosophie aus ihrem unnahbaren Elfenbeinturm zurück ins Wohnzimmer zu bringen, ins Café oder in den Zug zur Arbeit.
Menschen, die sich für ein Thema begeistern, tun sich oft schwer damit, es verständlich zu erklären. Vielleicht denken sie, es würde dadurch irgendwie in seiner Bedeutung abgewertet. Doch manchmal braucht es einfach diesen ersten Schritt, einen Einstieg und Wegweiser. Deshalb wird dieses Buch, wenn alles nach Plan läuft, die Ideen der Philosophen auf eine Art und Weise darlegen, die Lust auf mehr macht.
Es ist meine feste Überzeugung, dass jeder Mensch philosophische Fragen hat und jeder, der es will, ein Philosoph sein kann. Lassen wir uns also von einigen der größten Denkerinnen und Denker der Geschichte auf die Sprünge helfen.
ETHIK
Tagtäglich treffen Sie eine Vielzahl ethischer Entscheidungen. Alles, was Sie tun und andere Menschen betrifft, ist in gewisser Weise ethisch. Einerseits geht es um das Richtig und Falsch von Handlungen wie Stehlen, Töten, Lügen, Helfen oder Umsorgen. Andererseits geht es um den eigenen Charakter. Es geht um Mut, Loyalität, Ehrlichkeit, Liebe und Tugendhaftigkeit.
In der Ethik geht es um gutes und schlechtes Verhalten. Oder anders ausgedrückt: um gute und schlechte Menschen.
Platon
und die Unsichtbarkeit
Sie befinden sich auf einem Spaziergang und begegnen einer hässlichen alten Vettel, die Ihnen ein kleines, aber erstaunliches Geschenk macht: einen magischen Ring! Der Ring hat die Kraft, Sie vollkommen unsichtbar zu machen. Sie können überallhin gehen und alles tun, was Sie wollen, nichts und niemand kann Sie sehen. Da stellt sich natürlich die Frage: Was werden Sie damit anstellen? Wie werden Sie die Macht des Rings nutzen?
Eine ganz ähnliche Frage wirft auch das Gleichnis vom Ring des Gyges auf, wie es in der Politeia zu finden ist, dem um 375 v. Chr. verfassten, bekanntesten Werk des griechischen Philosophen Platon. Darin wird die von Platons Lehrer Sokrates aufgestellte These diskutiert, nach der Gerechtigkeit mehr sei als das, was Machthaber und Tyrannen als gerecht definieren. Auch gehe sie über das schiere Eigeninteresse hinaus. Von dieser idealistischen, hochfliegenden These nicht überzeugt, führt Platons älterer, zynischer Bruder Glaukon das Gleichnis ins Feld, um die Idee des ehrlichen, gerechten Menschen zu attackieren.
Denn ausnahmslos jeder, so Glaukon, der einen solchen Ring besitze, würde ihn zum eigenen Vorteil nutzen. Einmal im Besitz seiner Kräfte, würden Gerechtigkeit, Moral, Gesetze und Anstand schnell beiseitegeschoben. »Denn wenn einer«, lässt Platon Glaukon sagen, »dem eine solche Macht zufiele, gar kein Unrecht begehen wollte noch fremdes Gut berühren: So würde er denen, die es merkten, als der Allerelendeste vorkommen und als der Allerunverständigste.«
Fragen Sie Ihre Freunde, was sie tun würden. Fragen Sie sich selbst. Die Antworten dürften lustig oder kurios ausfallen – oder beunruhigend. Hand aufs Herz: Würden Sie wirklich nicht stehlen, in fremde Wohnungen eindringen, andere angreifen … oder vielleicht sogar noch viel, viel Schlimmeres tun? Auch wenn die meisten es vermutlich nicht zugeben würden – es erwägen oder darüber fantasieren würden sie bestimmt.
Die Moral des Gleichnisses ist nicht, dass Macht korrumpiert, sondern dass Macht unsere wahre Natur offenbart. In jedem von uns lauert ein kleiner Tyrann. Gesellschaftliche Bewertung, der Nachbar, der uns über den Gartenzaun hinweg beobachtet – nur das hält uns dazu an, gut zu sein. Das Einzige, was uns auf dem Pfad der Tugend hält, ist das Urteil der anderen.
Wenn Glaukon richtigliegt, hätte das großen Einfluss darauf, wie wir Politikern, Führungskräften oder Weltkonzernen begegnen sollten. Nicht nur sie, wir alle brauchen Kontrollinstanzen oder irgendeine Form von Autorität, die uns im Zaum hält. Gerechtigkeit ist darauf angewiesen, permanent auf transparente Weise durchgesetzt zu werden. Ist es möglich, dass all die Staatsgeheimnisse, unternehmerischen Winkelzüge und aalglatten Lügen der Politiker am Ende nichts anderes sind als die sehr reale, moderne Konsequenz der Geschichte vom Ring des Gyges?
Bentham
und die Berechnung der Moral
Wäre es nicht großartig, eine Methode an der Hand zu haben, mit der man kinderleicht herausfinden kann, was richtig und was falsch ist? Ein einfaches Werkzeug, das einem sagt, wie man sich in dieser oder jener Situation verhalten sollte?
An einer solchen Methode versuchte sich der englische Philosoph Jeremy Bentham im 18. Jahrhundert mit seinem Hedonistischen Kalkül.
Bentham ist der Vater der normativen (also die Handlungsweise betreffenden) ethischen Theorie, die als Utilitarismus bekannt ist: Ob eine Handlung richtig oder falsch ist, bemisst sich demnach allein an ihren sozialen Folgen. Geht daraus Nutzen oder Freude hervor, ist sie gut; führt sie zu Not oder Schmerz, ist sie schlecht. In Benthams Worten: »Das größte Glück der größten Zahl ist der Maßstab für Recht und Unrecht.«
Konkret hieße das, Robin Hood handelte moralisch; Butch Cassidy eher nicht. Der Zweite Weltkrieg war gut (für die Alliierten); Dschingis Khan war es nicht. Einen Menschen zu töten, um zehn anderen das Leben zu retten, ist richtig; einen Krieg zu beginnen, um eine Prinzessin zu befreien, ist es nicht. Einfach ausgedrückt: Mach die Menschen glücklich, und minimiere das Elend. Bedenke stets die Folgen deines Handelns.
So weit, so gut, doch eine Frage bleibt: Wie können wir mit Sicherheit sagen, ob das Ergebnis unserer Handlungen positiv oder negativ ausfällt? Bentham weiß die Antwort: durch das Hedonistische Kalkül!
Dabei werden die Vor- und Nachteile einer jeden Handlung auf der Grundlage von sieben Kriterien aufgelistet: Intensität, Dauer, Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens, zeitliche Nähe, Fruchtbarkeit (wird sie weitere positive Aspekte nach sich ziehen?), Reinheit (wie wahrscheinlich ist es, dass eine Befriedigung zu Schmerzen führt?) und Verbreitung. Je mehr Informationen wir über die Kriterien und die Konsequenzen unseres Tuns haben, desto besser.
Nun müssen Sie nur noch die einzelnen Werte zusammenzählen – et voilà! Jetzt wissen Sie, wie Sie handeln sollten. Nichts einfacher als das. Moral nach den Vorgaben des mathematischen Zeitalters: Ethik für Rationalisten. Klar wie Kloßbrühe!
Bleibt zu hoffen, dass Sie auch jedes Mal, bevor Sie zur Tat schreiten, ein, zwei Stündchen Zeit haben, um das alles fein säuberlich auszurechnen.
Aristoteles
und die goldene Mitte
Wir alle wollen das Richtige zur richtigen Zeit tun, wir alle wollen tugendhaft sein. Doch wie können wir erkennen, was in einer bestimmten Situation das Richtige ist? Wo verläuft die Grenze zwischen Mut und Leichtsinn? Wo die zwischen höflicher Zurückhaltung und Wortkargheit? Wann kippt Selbstvertrauen in Arroganz, wann Großzügigkeit in Herablassung?
Mit genau diesen Fragen befasst sich Aristoteles, ein Schüler Platons, in seiner Nikomachischen Ethik. Seine Lösung: die goldene Mitte.
Ethisches Handeln (also das Richtige tun) ist für Aristoteles tugendhaftes Handeln. Durch Übung, Wiederholung und Nachahmung können wir uns in allen Tugenden auszeichnen. Sie wollen freundlich sein? Dann tun Sie oft freundliche Dinge. Sie wollen tolerant sein? Eifern Sie einem toleranten Menschen aus Ihrem Bekanntenkreis nach. Tugenden erwirbt man, indem man sie ausübt. Oder prägnanter: »Wir sind das, was wir wiederholt tun. Vorzüglichkeit ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit.«
Trotzdem ist es nicht in jeder Situation einfach zu wissen, was die angemessene tugendhafte Handlung wäre. Jede moralische Entscheidung, jede Wahl ist einzigartig. Was in dem einen Kontext mutig war, ist es in einem anderen nicht. War Ehrlichkeit gestern noch höflich, kann sie heute schon grausam sein. Wie können wir uns also sicher sein?
Laut Aristoteles finden wir die gute Handlung in der Mitte zwischen zwei Extremen. Die tugendhafte Tat liegt zwischen zwei Lastern: Übermaß und Mangel. Mut ist die Mitte zwischen Leichtsinn und Feigheit. Höflichkeit liegt zwischen Wortkargheit und Überschwang. Großzügigkeit ist weder Geiz noch Verschwendung. Kurz gesagt: »Mäßigung in allen Dingen«, wie der griechische Dichter Hesiod schrieb.
Schon Aristoteles wusste natürlich, dass es schwierig sein kann, die goldene Mitte zu treffen. Dazu bedarf es der Klugheit der Erfahrung, das, was er Phronesis nannte. Üben wir uns ausdauernd in Tugendhaftigkeit, verfeinern wir diese Fähigkeit, wie wir im Fitnessstudio unsere Muskeln definieren. Phronesis ist die intuitive Kraft, die uns den Weg zur goldenen Mitte weist. So werden wir zu perfekten moralischen Bürgern, die stets wissen, was zu tun und zu sagen ist. Und wer weiß, vielleicht werden wir einst selbst zu Vorbildern, die es gilt nachzuahmen, um dem Ideal der Tugendhaftigkeit zu entsprechen.
Kant
und der kategorische Imperativ
Wenn jeder auf der Welt so handeln würde wie Sie – wäre diese Welt dann eine gute, freundliche und glückliche? Oder eine, in der niemand gern leben würde, nicht einmal Sie selbst? Wenn alles, was Sie tun, zur Regel für die ganze Menschheit werden würde, inwieweit würde das Ihr Verhalten beeinflussen?
Das ist der Grundgedanke hinter der ersten Formulierung des kategorischen Imperativs des deutschen Philosophen Immanuel Kant, der im 18. Jahrhundert lebte.
Zwei Dinge, schrieb Kant, erfüllen das Gemüt mit Ehrfurcht: »der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir«. Er glaubte, in jedem von uns existiere eine absolute Moral, die zu erkennen wir alle fähig seien. Den Zugang zu diesem Moralgesetz biete allein unsere wunderbare menschliche Vernunft. Anders ausgedrückt: Wenn wir moralisch handeln wollen, müssen wir die Vernunft gebrauchen (und nicht etwa unsere Leidenschaften oder unsere Intuition).
Laut Kant identifiziert unsere Vernunft bestimmte »Maximen« (moralische Gesetze oder Verhaltensmaßregeln), nach denen wir leben können. In jeder beliebigen Situation stehen uns mehrere Maximen zur Verfügung, und wir, die moralisch Handelnden, müssen entscheiden, welche wir befolgen wollen. Richtig eingesetzt, sagt uns die Vernunft, welche dieser moralischen Optionen »Imperative« (oder Pflichten) werden sollten, sprich: Was wir tun müssen.
Drei Wege (oder »Formeln«, wie Kant sie nennt) führen dorthin, am bekanntesten ist aber der erste, die Allgemeingültigkeit oder Universalisierung. Im Wesentlichen verbirgt sich dahinter die Frage: Was, wenn das alle tun würden? Man sieht sie buchstäblich vor sich, die Zeigefinger erhebenden Eltern dieser Welt.
Nehmen wir zum Beispiel einmal an, es gäbe eine Maxime, die da lautet: Lüge, wann immer dir danach ist. Nun, wenn jeder so handelte, dann würde der Akt des Lügens zu einer völlig alltäglichen Angelegenheit. Wahrheit und Falschheit wären bedeutungslos – und Lügen (also absichtliche Nicht-Wahrheiten) damit unmöglich. Die ursprüngliche Maxime implodiert. Dasselbe gilt, wenn niemand sich an eine Quarantäne hält, denn dann löst sich die Idee der Quarantäne in definitorischen Rauch auf. Ähnliches lässt sich für Ehebruch oder Diebstahl durchexerzieren.
Wenn derartige Maximen zum universalen Gesetz für jedermann würden, würden sie sich selbst zerstören. Daher ist es zwingend erforderlich, die Wahrheit zu sagen oder eine Quarantäne einzuhalten. »Vollkommene Pflichten« nennt Kant diese selbstzerstörerischen Logik-Typen.
Demgegenüber gibt es die »unvollkommenen Pflichten«. Unvollkommen sind sie, weil sie nicht von der Vernunft abhängen, sondern von unseren Bedürfnissen und Neigungen. Die Maxime ›Hilf niemals einem anderen‹ beispielsweise führt zwar nicht geradewegs in die logische Selbstzerstörung, wenn aber jeder sie befolgte, wäre die Welt doch reichlich trostlos.
Das Wort »kategorisch« bedeutet um seiner selbst willen, etwa einen Film anschauen, einfach, weils einem Spaß macht. Jetzt verstehen wir schon etwas besser, was Kant uns mit dem kategorischen Imperativ sagen will.
Wenn Sie also das nächste Mal in einem moralischen Dilemma stecken, behelfen Sie sich mit Kant. Halten Sie einen Augenblick inne und überlegen Sie: Was, wenn das alle tun würden?
Rand
und Egoismus
Wozu etwas Gutes tun, wenn man damit nicht in den sozialen Medien prahlen kann? Warum wohltätig sein, wenn niemand da ist, der einen dafür lobt? Wer Nettes tut, sollte dafür sorgen, dass jemand zuschaut!
Willkommen in der Welt des rationalen Egoismus. Genießen Sie Ihren Aufenthalt, und achten Sie (nur) auf sich.
Nur auf sich selbst zu schauen sei überaus vernünftig und entspreche dem Wesen des Menschen, so zumindest sah das die Schriftstellerin Ayn Rand, die Anfang des 20. Jahrhunderts aus Russland in die USA emigrierte. Jede Beziehung, jede Handlung, jedes Bedürfnis sollten Sie danach beurteilen, inwieweit Sie davon profitieren. Je mehr etwas Ihre Interessen befriedigt, desto größer ist Ihre Motivation zu handeln.
Wenn Sie Geld für wohltätige Zwecke spenden, tun Sie dies nur, um vor anderen gut dazustehen. Wenn Sie Ihrem Nachbarn dabei helfen, seinen Zaun zu reparieren, so nur, weil Sie nach dem nächsten Sturm auf seine Hilfe angewiesen sein könnten. Wenn Sie heiraten, dann aus dem einzigen Grund, um sich Ihren Wunsch nach Sicherheit, Glück oder Kindern zu erfüllen. Jede unserer Entscheidungen will wohlkalkuliert sein, daher müssen wir manchmal innehalten und uns die Frage stellen: Was nützt mir in dieser Situation am meisten? Der rationale Egoismus klopft jede Handlung darauf ab, welchen Vorteil sie bereithält.
Würde eine Handlung dazu führen, dass Ihr Leben sich verschlechtert, wäre es schlicht unvernünftig, diesen Weg einzuschlagen. Das eigene Leben zu opfern ist immer unangemessen (es sei denn, so Rand, Sie sind lebensmüde). Kurz, alles wird unter dem Gesichtspunkt des Eigennutzes betrachtet. In Rands Welt gleicht jede Interaktion einer Vertragsverhandlung, bei der beide Parteien versuchen, das Beste für sich herauszuholen (was natürlich nicht ausschließt, dass alle profitieren).
Ayn Rands Thesen polarisieren: Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Manchmal werden sie auch verdreht oder für ganz andere Zwecke instrumentalisiert. So räumte sie durchaus ein, es sei schon »psychopathisch«, gegenüber einem verletzten Hund oder Menschen nicht den moralischen Impuls zu helfen zu verspüren. Ihr ging es jedoch darum, herauszuarbeiten, dass dieser Impuls letztlich einer simplen Überlegung folgt: Man erntet, was man sät. In den meisten Fällen ist es eben besser für alle, wenn man sich gegenseitig hilft. Was fast schon an eine Art Karma erinnert, ähnlich wie bei Epikur(siehe Epikur).
Sollte jemand Sie also dazu auffordern, sich in irgendeiner Form zu opfern oder auf irgendeinen Segen oder Vorteil zu verzichten, dann fragen Sie, warum. Denn was, bitte schön, soll daran vernünftig sein, sich selbst hintanzusetzen? Welches intelligente Wesen würde sich selbst aufgeben?
Comte
und Altruismus
Weihnachten zu Hause, alle sehen im anderen Zimmer fern. Sie sind auf der Suche nach einem süßen Snack und entdecken eine Schachtel mit edlen Pralinen. Eine ist noch übrig. Ihre Lieblingssorte. Das Problem ist nur, dass alle eine Vorliebe dafür haben. In Ihnen tobt eine Schlacht zwischen zwei Großmächten: Egoismus vs. Altruismus. Wer wird gewinnen? Werden Sie die Praline essen?
Folgt man dem französischen Philosophen Auguste Comte, der das Wort Altruismus geprägt hat, müssen Sie all Ihre geistigen Kräfte aufbieten, um Ihren Egoismus niederzuringen. Altruismus kann siegen, aber nur, wenn wir uns die Zeit nehmen, ihn zu trainieren und zu stärken.
Comte glaubte, die menschliche Natur ganz gut zu kennen, und viele seiner Argumente basieren auf dem, was wir heute Evolutionspsychologie nennen (obwohl er bereits 1857 starb, also zwei Jahre bevor Darwin sein monumentales Werk Über die Entstehung der Arten veröffentlichte). Wir alle, so Comte, sind getrieben von mächtigen »affektiven Kräften«, die allein unser Eigenwohl im Sinn haben; es entspreche unserer Natur, uns zuallererst um uns selbst zu kümmern und abzugreifen, was wir können.
Dennoch hielt Comte den Menschen nicht für einen Sklaven seiner Biologie, dessen Triebe für alle Zeiten festgelegt sind. Vielmehr seien wir alle mit einem bewunderungswürdigen Verstand gesegnet, der es uns erlaube, jeden genetischen Fatalismus zu überwinden. Das ist auch der Grund, weshalb scheinbar ein Kampf tobt zwischen unserer Persönlichkeit – oder dem, was wir Individualismus nennen könnten – und dem Kollektivismus, also der Sorge um die Allgemeinheit. Das Ich kämpft gegen das Wir.
Um den Kampf zu gewinnen, müssen wir uns darin üben, unseren natürlichen Egoismus zu bezwingen und uns mehr um unsere Mitmenschen zu kümmern. Tatsächlich tun wir dies mit vielen alltäglichen Gesten, zum Beispiel, indem wir anderen die Tür aufhalten. Das bringt uns selbst keinerlei Vorteil, hilft aber dem anderen. Für die meisten ist das so selbstverständlich, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken. Auf diese Weise implementieren wir uns selbst Altruismus, was sich fortan auch in sehr viel bedeutenderen Zusammenhängen bemerkbar machen kann.
Für Comte war das alles andere als trivial, denn er sah darin die Grundlage für ein erfülltes Leben voller Glück und Stabilität. Der Egoist, der »nichts liebt außer sich selbst«, ist zu »unkontrollierbarer Erregung« verurteilt, er giert immerzu nach mehr (ein Gedanke, den auch Schopenhauer aufgreift, siehe Schopenhauer. Für wahre Zufriedenheit muss man seine Individualität, die nur auf ihre eigenen, unersättlichen und launenhaften Begierden schaut, verleugnen und sein Leben ganz in den Dienst eines anderen oder einer Sache stellen. Vollkommenheit erlangt, wer seine Sympathien in die Welt hinausträgt.
Um auf die begehrte Praline zurückzukommen: Wenn Sie im Widerstreit mit sich selbst liegen, ob Sie sie essen sollen oder nicht, halten Sie sich an Ihre höheren menschlichen Fähigkeiten. Ihr Instinkt drängt Sie vielleicht dazu, sich das süße Stück in den Mund zu stopfen, aber Sie haben mehr drauf. Sie sind keine biologische Maschine, die sklavisch darauf programmiert ist, alles an sich zu raffen, was nicht niet- und nagelfest ist. Altruismus hebt uns auf eine höhere Ebene und schenkt uns ein sehr viel nachhaltigeres Glück.
Abaelard
und die Absicht
Eine Frau und ein Mann stehen vor Gericht. Die Frau hat aus Spaß eine Pistole abgefeuert, die Kugel ist von einem Gebäude abgeprallt und hat ihre Freundin getötet. Der Mann ist seiner Ex-Freundin nach Hause gefolgt und hat auf sie geschossen, aber nicht gut genug gezielt und sie verfehlt, woraufhin er von seinem Vorhaben abließ. Wer von beiden sollte härter bestraft werden? Muss die Frau lebenslang ins Gefängnis für ein maximal unglückliches Versehen? Kommt der Mann für sein ›moralisches Glück‹ mit einem Klaps auf die Hand davon?
Mit dieser Problematik setzte sich schon der Theologe und Philosoph Petrus Abaelardus, kurz: Abaelard, auseinander.
Im 12. Jahrhundert, als Abaelard darüber nachdachte, herrschte in der Kirche – dem damals allmächtigen, allgegenwärtigen moralischen Zentrum der Gesellschaft – die Ansicht vor, alle Handlungen könnten nur entweder richtig oder falsch sein. Inzest, Diebstahl oder Blasphemie seien immer falsch, unabhängig von den Absichten oder dem Vorwissen des Handelnden.
Abaelard fand das absurd und postulierte, der moralische Wert einer Handlung hänge ausschließlich von den ihr zugrunde liegenden Absichten ab. Zur Erläuterung führte er das Beispiel von zwei Geschwistern an, die gleich nach der Geburt getrennt wurden. Jahre später finden sie sich wieder und verlieben sich ineinander, ohne von ihrer Verwandtschaft zu wissen. Für Abaelard lebten die beiden nicht in Sünde. Für die Kirche fielen sie in jedem Fall der Verdammnis anheim.
Heute erscheint uns Abaelards Sichtweise als selbstverständlich, doch zu seiner Zeit war sie revolutionär. Zumal er sich sogar zu der Aussage hinreißen ließ, Sex sei keine Sünde! Wenn die Kirche fleischliche Lust innerhalb der Ehe billige, außerhalb der Ehe aber plötzlich zur Sünde erklärte, dann könne der Akt an sich augenscheinlich nicht das moralisch relevante Element sein.
Noch unerhörter war seine These, dass jene, die Christus getötet hatten, nicht schuldig seien, da sie ja nicht gewusst hätten, dass er Gottes Sohn war. Hatte nicht Jesus selbst noch im Angesicht des Todes gesagt: »Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun«?
Natürlich ist die Sache, wie immer in der Ethik, so eindeutig nicht. Denn wie können wir uns der Absicht eines Handelnden jemals sicher sein? Ein Mörder wird kaum zugeben, dass er vorsätzlich gehandelt hat, weil er genau weiß, welche Folgen sein Geständnis hätte. Abaelards Antwort lautete: »Gott wird es wissen.« Doch das genügt uns heutzutage nicht mehr. Aus diesem Grund versuchen moderne säkulare Gerichte, sich ein Bild vom Charakter des Angeklagten zu machen, alle Beweise auf Stimmigkeit zu untersuchen und die Plausibilität der Tatsituation zu prüfen, was naturgemäß keine leichte Sache ist und einen großen Spielraum für Fehlurteile lässt.
Und wie sieht es aus mit der feinen Grenze zwischen Unwissenheit und Fahrlässigkeit? Ist die Aussage »Ich wusste nicht, dass Waffen gefährlich sind!« eine akzeptable Verteidigung? Welches Wissen verlangen wir von den Menschen (siehe Clifford)? Inwieweit kann man von uns erwarten, dass wir uns über die Auswirkungen unseres Handelns im Klaren sind?
Trotz dieser Vorbehalte ist Abaelards Beitrag zur Ethik und zum späteren weltlichen Recht enorm. In einem abergläubischen, willkürlichen Zeitalter war er ein rationales Licht, und wir können uns glücklich schätzen, auf seinen Schultern zu stehen.
Singer
und die Bevorzugung
Das Konzept der Gleichheit ist eine einzige Lüge. Wir behaupten zwar, alle gleich zu behandeln und dass alle gleich seien, aber das ist scheinheilig, denn regelmäßig benachteiligen wir Menschen und ziehen andere vor. Und das ohne jedes Unrechtsbewusstsein.
Stellen Sie sich bitte folgende Fragen: Sie können nur eine Person retten, einen Fremden oder Ihre Mutter – wen würden Sie retten? Wem werden Sie Ihr Vermögen vermachen? Warum würden Sie jederzeit Ihrem eigenen Kind eine Niere spenden, nicht aber einem Unbekannten?
Stets stufen wir manche Menschen höher ein als andere und bedenken sie ungleich. Wenn das keine Diskriminierung ist, was dann?
Mit der offensichtlichen Unmoral der Bevorzugung von Freunden und Familienangehörigen setzt sich der australische Philosoph Peter Singer in seinem 1981 erschienenen Buch The Expanding Circle auseinander, in dem er das Konzept des »sich erweiternden Kreises« entwickelt.
Dabei handelt es sich um eine Erwiderung auf das 1976 erschienene Buch Das egoistische Gen des britischen Biologen Richard Dawkins, in dem dieser die These aufstellt, die Fürsorge für die eigenen Angehörigen sei ein natürlicher Bestandteil der Evolutionspsychologie, um unsere Gene und die unserer Familie zu schützen. Altruistisch handelten wir daher nur in einem eng begrenzten Kreis, und diese Handlungen dienten ausschließlich evolutionären Zwecken. Daraus folgert Dawkins zwar nicht unverblümt, dass wir stets das tun sollten, wozu uns die Evolution verleitet – aber dass dies natürlich und vernünftig sei, behauptet er schon.
Dagegen wendet Singer ein, dass eine biologische oder evolutionäre Tatsache noch lange nicht zu einer Moral führt. Aus einem Faktum an sich entsteht noch keine Pflicht. Aus einem Ist lässt sich kein Soll ableiten.
Unser Verhalten beruhe auf mehr als bloßem Priming, sagt Singer, denn wir besitzen darüber hinaus noch eine einzigartige Fähigkeit: die Vernunft. Die verbissene Konzentration auf die Evolutionspsychologie reduziere die menschliche Existenz. Wir aber könnten den biologischen Determinismus sprengen.
Im Lauf ihrer Geschichte hätten die Menschen die Vernunft genutzt, um »ihre Kreise zu erweitern«. Während wir uns laut Dawkins streng genommen nur um uns selbst und unsere näheren Verwandten kümmern dürften, haben die Menschen doch mithilfe der Vernunft seit jeher Werte und Systeme geschaffen und den Kreis unserer Empathie ausgedehnt. Zuerst haben wir für die Sippe gesorgt, dann für den Stamm und schließlich für die Nation. Warum nicht auch für die Welt?, fragt Singer. Mit Vernunft und Moral im Gepäck können wir nach Werten leben, die die Würde aller Menschen achten, unabhängig von etwaigen genetischen Beziehungen.
Wir alle seien in der Lage, unseren empathischen Kreis auszudehnen und die soziobiologisch verankerte Neigung zur Diskriminierung anderer in echten Altruismus und die Sorge um immer mehr und schließlich alle Menschen zu verwandeln, meint Singer. Ethik bedeute nicht Vernunft vs. Gefühle, vielmehr baue die Vernunft auf unserem natürlichen Mitgefühl auf und erweitere es auf immer mehr Menschen.
Ist es also falsch, seinen Bruder einem anderen vorzuziehen? Ist es gut, den eigenen Kindern Geld zu hinterlassen? Natürlich mag es sein, aber ist es deshalb auch richtig?
Kant
und die Frage, wie man Menschen nicht behandeln soll
Sie essen mit Kollegen zu Abend, einer schnippt mit den Fingern und ruft: »Garçon! Hierher!« Jemand verlässt ein Taxi, ohne dem Fahrer auch nur Hallo, Auf Wiedersehen oder Danke gesagt zu haben. Ein Entführer kidnappt einen kleinen Jungen, um eine Million Dollar zu erpressen. Ein Diktator lässt einen vermeintlichen Verräter töten, um andere davon abzuhalten, sich gegen ihn aufzulehnen. Was haben all diese Menschen gemeinsam?
Laut Immanuel Kant behandeln sie ihre Mitmenschen als bloßes Mittel zum Zweck und tun damit Unrecht.
Kant war ganz vernarrt in die menschliche Vernunft, sie sei unser höchstes Gut. Und das Tollste an ihr ist natürlich, dass wir dank ihr erkennen können, was richtig ist und was falsch. Etwas weiter vorne (siehe »Kant und der kategorische Imperativ«) haben wir gesehen, wie Kant die erste Formulierung seines kategorischen Imperativs allein auf der Vernunft gründet, und die hier behandelte zweite Formulierung gilt als eine Erweiterung der ersten. Allerdings müsste man sich schon ein wenig anstrengen und dieses Buch zur Mega Philosophy ausbauen, um genau zu erkennen, wie Kant dabei vorgeht.
Ihm zufolge gibt es eine unbedingte Würde, die damit einhergeht, dass wir vernünftige Wesen sind. Daher sollten alle Menschen diese Würde stets respektieren: »Handle so, dass du die Menschheit … jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.« Anders ausgedrückt: Menschen sind keine Werkzeuge, die wir benutzen, oder Schachfiguren, die wir nach Belieben verschieben und opfern können, um unsere Ziele zu erreichen, sie besitzen immer einen eigenen Wert. Jeder Mensch zählt.
Wie kam Kant darauf? Wir alle halten uns subjektiv für den Mittelpunkt der Welt: Ich jedenfalls finde mich ziemlich wichtig und Sie sich doch bestimmt auch, oder? Und da die Welt sich aus uns allen als subjektive Wesen zusammensetzt, können wir allgemeingültig behaupten, dass ein jeder Anspruch auf eine solche Wertzuschreibung hat. Wenn wir uns alle – ohne Einschränkung – als wertvoll betrachten, dann muss die Welt kollektiv aus wertvollen menschlichen Wesen bestehen.
Natürlich war Kant nicht naiv. Die Gesellschaft beruht darauf, dass wir einander dienen, helfen und füreinander arbeiten. Deshalb ist seine Formulierung bewusst so gefasst, dass wir andere nicht bloß oder ausschließlich als Mittel behandeln sollen. Erkenne stets den Menschen im Kellner, im Taxifahrer, im Kriminellen, denn sie alle haben einen Wert an sich. Kant selbst begegnete seinem Diener Martin Lampe übrigens stets mit Achtung und bedachte ihn sogar in seinem Testament.
Falls Sie also einmal unsicher sind, wie Sie sich einer Person gegenüber verhalten sollen, fragen Sie sich einfach: Respektiere ich diese Person als Menschen? Oder benutze ich sie lediglich wie ein Werkzeug? Ist das nicht eine simple und praktikable Lebensregel?
Aquin
und der Krieg
Wann ist für ein Land der Zeitpunkt gekommen, einem anderen den Krieg zu erklären? Wann, wenn überhaupt, ist die Anwendung von Gewalt gerechtfertigt? Warum finden die meisten Menschen die Eroberung der Neuen Welt durch die Spanier falsch, während der D-Day als ein Akt des Heldentums gilt? Unter welchen Bedingungen würden Sie in den Krieg ziehen?
Der italienische Mönch und Gelehrte Thomas von Aquin beschäftigte sich im 13. Jahrhundert mit genau diesen Fragen und gilt als einer der wichtigsten Theoretiker des jus ad bellum (des gerechten Krieges). Aufbauend auf Augustinus argumentiert Aquin in seiner Summa theologica, ein Krieg sei gerecht oder moralisch akzeptabel, wenn er drei Bedingungen erfülle:
Er muss von der »Vollmacht des Prinzeps« (heute würden wir sagen: eines anerkannten Staates) genehmigt sein und darf nicht um privater Ambitionen willen geführt werden. Nach dieser Definition wäre die Schlacht der Ostindien-Kompanie 1757 bei Plassey gegen die einheimischen Bengalen ungerecht, da es sich um ein privates Unternehmen handelte, das nur auf den Profit seiner Direktoren aus war.
Er muss im Interesse der Gerechtigkeit geführt werden, und zwar gegen jene, die es »verdienen, wegen irgendeiner Schuld, die sie begangen haben, angegriffen zu werden«. Die NATO-Intervention in Bosnien im Anschluss an das Massaker von Srebrenica war demnach gerecht, ebenso wie jede humanitäre Intervention.
Er muss mit einem Minimum an Leid und mit dem Ziel eines dauerhaften Friedens geführt werden, der »das Gute fördern oder das Böse vermeiden« soll. Als Arnold Amalrich 1209 nach seinem Sieg über die französischen Katharer die gesamte Einwohnerschaft der Stadt Béziers mit den Worten »Tötet sie alle, Gott wird die Seinen erkennen!« massakrieren ließ, lag er damit also völlig falsch.
Heutzutage sprechen wir statt von einem gerechten Krieg eher von legitimer Gewaltanwendung, doch oft sind die Argumente der verantwortlichen Politiker für einen Krieg noch immer Variationen der Kriterien des heiligen Thomas. Die modernen Definitionen der UNO für einen gerechten Krieg sind ziemlich eng gefasst: Ein Krieg sei nur dann gerechtfertigt, wenn er der Selbstverteidigung dient, heißt es in Artikel 51 der UN-Charta, niemals aber als Akt der aktiven Aggression (was Thomas von Aquin zumindest nicht gänzlich ausschloss). Doch ist das nicht vielleicht allzu eng gefasst? Ist wirklich kein Szenario denkbar, in dem ein Angriffskrieg oder eine militärische Intervention gerechtfertigt ist? Oder sollte der Krieg, wie es die UNO fordert, tatsächlich nur als letztes Mittel der Verteidigung eingesetzt werden?
Singer
und Speziesismus
Wofür werden künftige Generationen uns verdammen? Meinen Sie, unsere Enkelkinder werden geschockt sein, wenn wir ihnen von unserem heutigen Leben erzählen? Wird in den Fernsehsendungen der Zukunft ein niedliches Kind vorwurfsvoll fragen: »Oma, warum hat denn keiner den Mund aufgemacht und gesagt, dass das falsch war?«
Einer der Bereiche, die stark kritisiert werden würden, prognostiziert Peter Singer, dürfte unser Umgang mit Tieren und die Heuchelei sein, die wir dabei an den Tag legen. Welche ethischen und philosophischen Rechtfertigungen können wir für dieses Verhalten vorbringen? Warum tun wir ganz überwiegend so, als wären Menschen mehr wert als Tiere?
Speziesismus ist eine Richtung der Umwelt- und Tierethik, die von Singer in den 1970er-Jahren populär gemacht wurde. In seinen eigenen Worten geht es dabei um »eine Haltung der Voreingenommenheit zugunsten der Interessen der Mitglieder der eigenen Spezies und gegen die Interessen der Mitglieder anderer Spezies«.
Wie alle diskriminierenden »Ismen« erscheint auch diese Voreingenommenheit durch Gewohnheit und das Versäumnis, unsere Überzeugungen kritisch zu prüfen, wie in Stein gemeißelt.
Singer behauptet keineswegs, alles Leben sei gleich viel wert (er hebt das Selbstbewusstsein durchaus hervor); wohl aber seien die Erfahrung von Schmerz und der Wille zum Leben bei allen Arten gleich. Jede ethische Theorie, die das Für und Wider der Folgen einer Handlung abwägt, müsse daher alle Arten berücksichtigen und nicht nur unsere eigene.
Singers Speziesismus ist in seinen Utilitarismus eingeflossen (wonach eine Handlung je nach zu erwartendem Schmerz oder zu erwartendem Wohlergehen als richtig oder falsch bewertet wird): Bei allen moralischen Entscheidungen müssten die Auswirkungen nicht nur für die Menschen, sondern auch für Tiere, Pflanzen und die Natur an sich berücksichtigt werden. Stattdessen aber kalkulieren wir allzu oft nur das menschliche Wohlergehen mit ein.
Allerdings scheinen die Menschen des 21. Jahrhunderts sich Singers Sichtweise immer mehr zu eigen zu machen. Blutige Volksbelustigungen wie Stier- oder Hundekämpfe betrachten wir als unmoralisch. Ein Tier sollte nicht allein zum Vergnügen der Menschen Leid ausgesetzt sein. Tiere spielen in manchen unserer moralischen Gleichungen also durchaus eine Rolle. Dennoch glauben viele nur zu gern, ihr persönlicher Genuss beim Verzehr eines Steaks sei höher zu bewerten als der Lebenswille des Rinds. Singer würde da die Frage in den Raum werfen: Welches moralische Kalkül erlaubt es uns, die Bärenhatz zu verbieten, gleichzeitig aber Legebatterien für Hühner zu billigen?
Umstrittener als das ist vielleicht Singers These, Speziesismus sei ein schädliches und antiquiertes Vorurteil, auf das wir dereinst mit demselben Abscheu zurückblicken werden wie heute auf Rassismus und Sexismus. Wenn Vorurteile und Traditionen unsere einzigen Rechtfertigungen für die schlechte Behandlung von fühlendem Leben sind – Leben also, das zu Schmerz und sozialen Bindungen fähig ist –, sollten wir dann nicht damit aufhören?
Zimbardo
und der Ursprung des Bösen
Haben Sie sich schon mal gefragt, wie Sie sich verhalten hätten, wenn Sie im »Dritten Reich« gelebt hätten? Glauben Sie wirklich, Sie hätten anders gehandelt als die meisten anderen? Haben Sie noch nie etwas getan, das falsch war, nur weil man es Ihnen befohlen hat oder weil Sie dazugehören wollten? Was meinen Sie, wozu Sie fähig wären, wenn man Ihnen eine Uniform, einen Rang und freie Hand geben würde? Seien Sie ehrlich zu sich selbst, in Ihrem Kopf kann Sie niemand verurteilen.
Als Reaktion auf die Geschehnisse in Nazideutschland sind nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Sozialpsychologen genau diesen Fragen nachgegangen. Wie, wollten sie herausfinden, konnte sich »das Volk der Dichter und Denker« so schnell verändern?
In dem berühmten Stanford-Prison-Experiment des amerikanischen Psychologen Philip Zimbardo aus dem Jahr 1971 wurden fünfundsiebzig erwachsene Männer in eine gefängnisähnliche Umgebung gebracht, wobei vierundzwanzig von ihnen Wärter mit den entsprechenden Ausrüstungen und Befugnissen sein sollten, die übrigen Gefangene. Das ursprünglich auf zwei Wochen angesetzte Experiment musste jedoch nach nur sechs Tagen abgebrochen werden, nachdem einige der Wärter ein zunehmend autoritäres und brutales Verhalten an den Tag gelegt hatten. Laut Zimbardo wies ein Drittel der Wärter klinisch-sadistische Züge auf.
Seither verweisen Philosophen und Psychologen immer wieder auf dieses Experiment, um zu belegen, dass viele unserer vermeintlichen moralischen Grundsätze eng an gesellschaftliche Vorgaben gebunden sind. Zimbardo selbst schloss daraus, individuelle Veranlagung und Moral seien überschätzt worden, der soziale Kontext beziehungsweise Druck sei wohl sehr viel bedeutender als angenommen. Unter bestimmten Umständen hätten wir alle Wächter in Auschwitz sein können.
Inzwischen ist allerdings heftige Kritik am Stanford-Prison-Experiment laut geworden.
Erstens sei Zimbardo nicht unparteiisch gewesen und habe sogar die Rolle des »bösen Aufsehers« eingenommen, der seine Probanden zu hartem Durchgreifen ermunterte. Unter anderem gab er den Wärtern verspiegelte Pilotenbrillen, wie sie der äußerst sadistische Wächter in dem Film Der Unbeugsame trug. Wie schrecklich das Experiment aus dem Ruder lief, erkannte Zimbardo erst, als seine Forschungspartnerin (und spätere Ehefrau) Christina Maslach ihn darauf hinwies.
Zweitens sei nicht klar, wie viele Wärter sich tatsächlich in Sadisten verwandelt haben. Das bösartigste Verhalten ging wohl von einem einzigen Wärter aus, einem Mann namens Dave Eshelman, der später behauptete, er habe seine Rolle bewusst so interpretiert, um den Forschern Material an die Hand zu geben. Die anderen machten sich eher der Untätigkeit schuldig, als dass sie sich aktiv an den Misshandlungen beteiligten.
Dennoch wirft Zimbardos Experiment eine wichtige Frage für uns alle auf, über die ehrlich und gründlich nachzudenken lohnenswert ist: Hätten wir eine unangreifbare Machtposition inne, welche Grenzen würden uns unsere Moralvorstellungen und Werte tatsächlich setzen?
Clifford
und die Ethik des Glaubens
Ist es moralisch falsch, bestimmte abstoßende Überzeugungen zu haben? Sind wir nur für unser Verhalten und unsere Taten verantwortlich, nicht aber für das, was wir denken? Oder sind bestimmte Überzeugungen und Denkweisen für jedermann eine Pflicht – eine sogenannte epistemische Pflicht?
Ja, forderte 1877 der englische Philosoph William Kingdon Clifford in seinem Aufsatz The Ethics of Belief.
Doch zunächst eine kleine Geschichte. Stellen Sie sich einen Schiffseigner vor, der Tickets für eine sensationelle Traumreise verkauft. Er vermutet, dass sein Schiff eigentlich nicht sicher genug ist, doch die Reparaturen wären ziemlich kostspielig und würden seinen Gewinn erheblich schmälern. Also denkt er nicht weiter darüber nach und drückt ein Auge zu … Schließlich hat er es ja nur vermutet. Kann man dem Reeder seine Ignoranz moralisch vorwerfen? Hätte er sich Gewissheit verschaffen müssen? Durchaus, meinte Clifford.
Denn es sei »zu jeder Zeit, an jedem Ort und für jeden falsch, etwas auf der Grundlage unzureichender Evidenz anzunehmen«. Dieses Prinzip bildet das Fundament des Evidenzialismus, der besagt, dass wir nur glauben sollten, wofür wir Beweise haben.
In Cliffords Logik hat der Schiffseigner sich ins Unrecht gesetzt, unabhängig davon, ob die Traumreise glücklich oder tragisch endet, weil er nicht die angemessenen Schritte unternahm, um die Wahrheit herauszufinden. Anders ausgedrückt, er hat nicht sein »epistemisches Bestes« gegeben, um sich Gewissheit zu verschaffen.
Entsprechend wären Rassisten stets unmoralisch, ob sie nun rassistische Dinge tun oder nicht, denn sie müssten ihre Überzeugungen gründlicher überprüfen. Beweise zu ignorieren, zu entkräften, zu verdrehen oder misszuverstehen ist dabei keine Entschuldigung: Vorsätzliche Ignoranz ist immer und überall falsch.
In diesem Sinne wären auch Anhänger der Theorie, die Erde sei eine Scheibe, Impfgegner, Verschwörungsgläubige und Astrologen unmoralisch, weil sie möglichen Gegenbeweisen ihrer Vorstellung nicht genug Aufmerksamkeit widmen.
Natürlich ist es so einfach nicht. Denn wer entscheidet, wann die Prüfung von Beweisen ausreichend genug war? Was ist mit der Bestätigungsverzerrung, die uns von Natur aus dazu verleitet, die Augen vor Belegen zu verschließen, die unseren Ansichten widersprechen? Wie viel Gewicht sollten wir den Intentionen einer Person beimessen (siehe dazu auch Abaelards Gedanken siehe dazu auch Abaelards Gedanken? Und warum sind Überzeugungen ethische Angelegenheiten, abgesehen davon, was Clifford dazu zu sagen hat?
Cliffords Ideen werfen die heikle Frage nach dem Verhältnis von Überzeugungen und Handlungen auf, und es ist nicht ganz klar, worin der moralische Unterschied zwischen beiden besteht. Sind Sie für Ihre Ansichten moralisch zur Verantwortung zu ziehen? Und wen ernennen wir zur Gedankenpolizei?
Lovelock
und Mutter Natur
Zoomen Sie hinaus. Stellen Sie sich vor, Sie sehen sich selbst von oben, wie Sie dieses Buch lesen. Zoomen Sie noch weiter hinaus. Jetzt sehen Sie das Gebäude, in dem Sie sich befinden. Noch weiter, und Sie sehen die Stadt, die Landschaft, die Krümmung des Planeten und schließlich das Universum, als wären Sie selbst die Erde.
Hier verharren Sie, ganz so wie es der britische Wissenschaftler James Lovelock in seiner Gaia-Hypothese (benannt nach der griechischen Erdgöttin) vorschlägt.
Betrachten Sie die gesamte Menschheit, und stellen Sie sich eine einfache Frage: Was, wenn wir gar nichts Besonderes sind, sondern nur ein winziges Rädchen in einem riesigen Ökosystem? Versuchen Sie, uns nicht nur im Jetzt zu betrachten, sondern über all die Jahrmilliarden hinweg, seit sich das Leben entwickelt hat. Sind wir für die Welt vielleicht nicht mehr als eine kurzlebige Darmbakterie? Diese Idee, ganze Ökosysteme aus dem Blickwinkel der Erde zu betrachten, nennt Lovelock »Gaia«.
Gaia (die Erde) versteht er dabei als eine Regulierungsinstanz, die mithilfe von Rückkopplungsmechanismen und Veränderungen des Ökosystems das Ganze bewahrt. Indem es die Temperaturen, den Salzgehalt der Ozeane, den Sauerstoffgehalt der Luft und andere homöostatische Faktoren steuert, gewährleistet das Gaia-Prinzip das Fortbestehen des Lebens. Uns mögen Öko- und Wettersysteme grässlich komplex erscheinen, für Gaia aber sind sie schnöder Management-Alltag. Gaia zieht die Fäden und sorgt dafür, dass alles läuft, wie es soll.