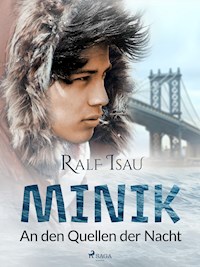
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
New York, 1897: Der sechsjährige Minik wird gemeinsam mit anderen Inuit vom Nordpolentdecker Robert E. Peary in die amerikanische Metropole gebracht. Sie sollen lebendige Forschungsobjekte sein. Im Naturkundemuseum können Minik und seine Familie für 25 Cent bestaunt werden. Doch die Unterbringung der Inuit im Keller des Museums bringt ein tagisches Ende: Alle außer Minik sterben. Zehn Jahre später stößt Minik im Museum auf das Skelett seines Vaters, das dort ohne sein Wissen ausgestellt wird. Eine emotionale Suche nach Identität und Wahrheit beginnt. Ein spannender Roman rund um eine beeindruckende Lebensgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Isau
Minik – an den Quellen der Nacht
Saga
Minik – an den Quellen der Nacht
Copyright (c) 2022 by Ralf Isau, vertreten von AVA international GmbH, Germany
(www.ava-international.de)
Die Originalausgabe ist 2008 im Thienemann Verlag erschienen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 2008, 2022 Ralf Isau und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728390436
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Für Karin
»Wenn du in das Land der Weißen kommst, pass auf,
dass du nicht zu viel von ihrem Geist aufnimmst.
Wenn du das tust, wird es zu vielen Tränen führen,
weil du ihn dann nicht mehr loswirst.«
Eqariusaq (Tochter von Nuktaq)
1. Das Skelett
New York (USA), 8. Juni 1906
Die Welt hatte sich in einen Traum verwandelt. In einen Albtraum. Miniks Füße schlurften über den Boden, als habe er Blei in den Schuhen. Trotzdem keuchte und stolperte er so hastig die Treppen hinauf, als sei eine Meute Bluthunde hinter ihm her. Etliche Museumsbesucher drehten sich nach ihm um. Was sie wohl von ihm dachten? Ob sie ihn von den Zeitungsfotos wiedererkannten?
Von hinten hätte man ihn für einen ganz normalen amerikanischen Schuljungen halten können. Minik hatte rabenschwarzes, kurzes Haar, war schlank, knapp eins siebzig groß und tadellos gekleidet: hellgraues Hemd, marineblaue Knickerbocker und dazu passende Kniestrümpfe. Sein Benehmen indes musste den Beobachtern Rätsel aufgeben. Ihn kümmerte das wenig. Nicht in diesem Moment. Er war aufgewühlt, seine Nerven lagen blank. Eine ungeheuerliche Ahnung stemmte sich gegen die Pforte seines Verstandes, scharrte und kratzte daran wie ein wildes Tier. Aber noch konnte er die Bestie zurückhalten. Vielleicht war ja alles nur ein Irrtum.
Im ersten Stock wechselte er zur nächsten Treppe. Ein Besucherpaar versperrte ihm den Weg. Galant führte der geschniegelte Mann – grauer Ausgehanzug, weißes Hemd, gestärkter Kragen und Krawatte – seine Frau – Wespentaille, Rüschenbluse und knöchellanger Rock – am Arm die Stufen hinab.
Minik preschte wie ein Berserker mitten durch sie hindurch, geriet ins Stolpern und konnte sich gerade noch mit den Händen vor einem Sturz retten. Erst jetzt wurde ihm seine Rücksichtslosigkeit bewusst. Doch als er sich zu einer Entschuldigung umwandte, hatte der Angerempelte seiner Empörung schon Luft gemacht.
»Unverschämtheit!«
Die Dame, die von seinem Arm gerissen wurde, sah mitleidig in die schwarzen Abgründe von Miniks Augen und sagte: »Lass doch, Edward. Mit dem Armen stimmt etwas nicht. Hast du nicht gehört, wie er wimmert?«
Ihr Begleiter schnaubte angewidert. »Schon, aber ich finde Männer erbärmlich, die sich nicht in der Gewalt haben. Selbst als Chinese sollte der Rüpel wissen, was sich in diesem Land gehört.«
Sie griff nach seiner Hand und kräuselte die Lippen. »Ich korrigiere dich nur ungern, Darling, aber seine Haut war nicht gelb, sondern eher bronzefarben. Er muss ein Indianer sein. Als Kind habe ich mehrere Vorstellungen von Colonel Codys Show Buffalo Bill’s Wild West gesehen. Ich kenne mich mit den Wilden aus.«
Beide irrten. Minik war weder Chinese noch Indianer, sondern gehörte dem Volk der Inuit an, war also ein »Eskimo«, wie man im New York des frühen zwanzigsten Jahrhunderts zu sagen pflegte. Überdies stand der vermeintliche Rüpel mit seinen sechzehn Jahren erst an der Schwelle zum Mannesalter.
Minik rappelte sich wieder hoch und strebte weiter dem Obergeschoss des Naturkundemuseums entgegen. Auf dem oberen Treppenabsatz hatte er das Paar schon wieder vergessen, weil die Bestie im Kerker seines Unterbewusstseins immer heftiger an der Pforte rüttelte.
»Bitte mach, dass es nicht stimmt!«, wimmerte er.
Aus den Augenwinkeln sah er eine bekannte Gestalt: Walter Schlesinger, den beleibten grauhaarigen Museumswächter. Als Dreikäsehoch hatte Minik das American Museum of Natural History oft besucht und von Mr Schlesinger Süßigkeiten zugesteckt bekommen. Alle mochten den kleinen Polareskimo, besonders die Anthropologen und Ethnologen, die nach Herzenslust an ihm herummaßen, ihn – mal in Pelzkleidung, mal im Adamskostüm – fotografierten, sich mit ihm unterhielten und sein Verhalten studierten. Dank Minik hatten die Wissenschaftler Feldforschung betreiben können, ohne ins eisige Feld zu müssen.
Ohne auf das Winken des Museumswärters zu achten, lief Minik nach rechts, zum Saal Nummer drei. Wie betrunken wankte er und nahm seine Umgebung nur verschwommen wahr, weil ihm schreckliche Bilder durch den Kopf spukten: eine von Speckkäfern abgenagte Hand, ein ausgestopftes Inuit-Mädchen in einem Glaskasten ...
Vor ihm tauchte ein hoher Durchgang auf. In dem Raum dahinter brannte elektrisches Licht. Die Schilderungen seiner Mitschüler schossen ihm durch den Kopf.
Wir haben in der Zeitung gelesen, dass Qisuk oben im dritten Saal ...
Ein Schauer lief Minik über den Rücken. Nein, er mochte es sich lieber nicht vorstellen. Auf der Türschwelle versperrten ihm eine dicke rote Kordel und ein Schild den Weg. Er las die Aufschrift.
Anatomische Ausstellung vorübergehend geschlossen.
Bald werden wir Ihnen an dieser Stelle
neue, aufregende Exponate zeigen.
Wir danken für Ihr Verständnis.
Im Raum hinter der Barriere herrschte reges Treiben. Minik hörte laute Stimmen. Irgendwo hämmerten Handwerker. Er tauchte unter der Kordel hindurch.
Sein Blick schweifte durch den großen, rechteckigen Saal, in dem etliche Glasvitrinen mit Skeletten standen. Neben jedem Schaukasten befand sich ein Schild zur Erläuterung des Inhalts. Links vom Eingang war eine Handvoll Arbeiter mit der Aufstellung neuer Exponate beschäftigt. Minik suchte weiter. Er sah das Knochengerüst eines Eisbären, eines Seehundes, eines Narwals – und dann erstarrte er.
In einer Ecke rechts von ihm stand ein menschliches Gerippe.
Seine Füße setzten sich wieder in Bewegung, ohne dass er ihnen den Befehl dazu gegeben hatte. Unerbittlich trugen sie ihn näher an den hohen Glaskasten heran. Aber jeder Schritt fiel ihm schwerer, jeden Moment konnten ihm die Beine einknicken. Er spürte, wie seine Willenskraft erlahmte und er die Bestie hinter der Pforte nicht länger zurückhalten konnte. Dennoch sträubte sich sein Verstand immer noch zu akzeptieren, was seine Augen sahen. Fortwährend schüttelte er den Kopf und wimmerte: »Nein, nein. Bitte, Gott, lass es nicht wahr sein!«
Das Skelett schien ihm zuzulächeln, als wolle es ihm Mut machen. Minik schleppte sich bis zu dem Kasten. Die Pforte zu seinem Unterbewusstsein gab einen Spaltbreit nach und weitere unheimliche Erinnerungen quollen hervor: von einer Knochenbleichfabrik, von einem Zwillingsmädchen, das angeblich für das Museum präpariert wurde ...
Minik sah zu der Beschriftung an der Wand. Sein Blick war von Tränen verschleiert. Er wischte sich mit dem Hemdsärmel über die Augen. Jetzt erst konnte er das Schild lesen.
Nr. 5: Das Skelett von Qisuk,
einem Polareskimo
»Nein!«, schrie Minik. Seine Stimme hallte durch das ganze Geschoss. Er spürte, wie die Pforte zu den verdrängten Schrecknissen seiner Kindheit endgültig aufgestoßen wurde. Eine Woge von Übelkeit brandete durch ihn hindurch. Aus der Tiefe seiner Seele wirbelten Schmerz, Bitternis, Enttäuschung und Ohnmacht empor, bis nur noch die dunkle Leere der Einsamkeit blieb. Verzweifelt streckte er die Arme nach der Vitrine aus. Er zitterte am ganzen Leib. Sein Herz pochte so wild, als wolle es ihm aus der Brust springen. Kraftlos sackte er auf die Knie und sein Magen stülpte sich um.
Nachdem er sich übergeben hatte, weinte er hemmungslos. Minik fühlte sich verraten, betrogen, alleingelassen. Vage nahm er Schritte wahr. Vermutlich die Arbeiter. Plötzlich legte sich von hinten eine Hand auf seine Schulter.
»Was ist mit dir, Junge?«
Minik schaute zu dem Mann auf. Es war der alte Schlesinger. Der Museumswächter half ihm unter gutem Zureden auf die Beine.
»Warum weinst du, Junge?«
Minik spürte, wie abermals Übelkeit in ihm hochstieg. Es gelang ihm zwar, das Würgen zu unterdrücken, nicht aber die Tränen. Fahrig deutete er auf die Vitrine und antwortete: »In dem Kasten. Da steht mein Vater.«
Der Alte riss Augen und Mund auf. »Dein ... Vater?«
»Ja!«, schrie Minik voller Wut und Trauer. Speichel, Rotz und Schleim zogen Fäden auf seinen Lippen. Der Zeigefinger wanderte etwas nach rechts. »Da auf dem Schild steht’s doch: ›Das Skelett von Qisuk‹.«
Der Museumswächter legte ihm wieder die Hand auf die Schulter. »Das heißt noch gar nichts, Junge. Schau, mein Name ist Walter, und es gibt noch Tausende andere, die so heißen. Ich erinnere mich gut an deinen Vater. Er hatte den Spitznamen ›der Lächelnde‹. Leutnant Peary nannte ihn den ›Walrosstöter von Itilleq‹. Aber weder das eine noch das andere steht dort auf dem Schild. Bestimmt ist der Eskimo hinter der Scheibe ein ganz anderer Qisuk.«
Miniks Gesicht war eine schmerzerfüllte Grimasse. Er schüttelte den Kopf. »Nein. Unser Dorf hatte weniger als dreihundert Seelen. Das ist nicht irgendein Qisuk. Sie haben meinen Vater gehäutet und ihn hier aufgestellt.«
»Du musst dich irren, Minik«, widersprach Schlesinger. »Dein Vater wurde im Garten des Museums beigesetzt. Du warst doch selbst dabei und hast es mit eigenen Augen ...«
»Ich weiß, was ich gesehen habe, aber offenbar hat man ihn später wieder ausgegraben«, fiel Minik ihm ins Wort. Seine Stimme bebte vor Zorn. Er deutete abermals mit dem Finger auf die Vitrine und sagte: »Sehen Sie die Verletzung da, am Knochen seines linken Unterarms? Daran erkenne ich ihn. Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als er beim Verladen des Meteoriten verletzt wurde. Danach hat Leutnant Peary meinen Vater und die anderen überredet, ihn nach New York zu begleiten. Ich verfluche diesen Tag und ich verfluche Peary, diesen Stiefelputzer des Teufels. Mein Volk nennt ihn zu Recht den ›großen Peiniger‹. Er hat mich von meinen Spielkameraden fortgerissen und für einen Stein, der vom Himmel fiel, das Leben von sechs Menschen zerstört.«
2. Die Eiseninsel
Cape York (Grönland), 12. August 1897
»Tikeqihunga!« Der Ruf hallte über das in der Sonne glitzernde Wasser am Cape York, als ritte er auf den Schwingen einer Raubmöwe. Er kam von der SSHope, einem Dampfschiff mit drei Masten, das im Vergleich zu den es umschwärmenden Kajaks so riesig war wie ein Wal inmitten von Lachsen. Minik stand am Ufer, umgeben von zahlreichen anderen Kindern und Frauen; die meisten Männer hatten sich schon bei der ersten Sichtung der Segel in ihren Booten aufs Meer hinausbegeben.
Schiffe wie die Hope waren ein vertrauter und durchaus willkommener Anblick für die Inuit von Avanersuaq, dem »Platz im entlegensten Norden« von Westgrönland. »In ihrer Heimat gibt es das ganze Jahr Licht«, hatte Qisuk einmal seinem Sohn erklärt. »Deshalb kommen diese rastlosen Leute zu uns und schöpfen aus den Quellen der Nacht.« Mit dieser poetischen Umschreibung pflegte er das angestammte Gebiet der Inuit zu umschreiben, weil hier zwischen Herbst und Frühjahr vier Monate lang Dunkelheit herrschte. Auf den Mann, dessen feste, Ehrfurcht gebietende Stimme sich da gerade mit ihrem »Da bin ich!« Gehör verschafft hatte, traf Qisuks Feststellung zweifellos zu – zwei der vier letzten Winter hatte er bei den Inuit verbracht.
Leutnant Robert Edwin Peary bediente sich nur selten des Inuktitut, der »Sprache der Menschen«, um sich verständlich zu machen. Er hatte sich nie mehr als ein paar Brocken des Wortschatzes der Polareskimos angeeignet. Vielleicht war diese Enthaltsamkeit der Ausdruck einer inneren Distanz. Gleichwohl ging er bei jeder ihm passenden Gelegenheit mit ihnen auf Tuchfühlung und griff in ihr Leben ein, wann immer es ihm gefiel. Für ihn waren sie »seine Leute«. Er betrachtete sie und ihr Land als seinen persönlichen Besitz – und sich gewissermaßen als ihren König.
Die meisten Inuit konnten mit seiner besitzergreifenden Art leben. Früher hatten sie Hunger gelitten, wenn sich das Jagdglück einmal von seiner launischen Seite zeigte. Vor sechs Jahren – kurz nach Miniks Geburt – erschien dann plötzlich Peary in ihrer Welt und vieles wandelte sich zum Besseren. Sie gaben ihm, wonach ihm gelüstete – Pelze wie auch Elfenbein von Narwalen und Walrössern –, er versorgte sie dafür mit so nützlichen Dingen wie Messern, Fingerhüten oder Zwieback. Manchmal verschenkte er zum Dank für treue Dienste sogar ein Stück Holz – in der baumlosen Welt der Polareskimos ein unvergleichlich kostbarer Schatz.
Obwohl dieser qallunaaq ‒ der »weiße Mann« – unter den Nordleuten seine Bewunderer hatte, waren ihm beileibe nicht alle wohlgesonnen. Einige nannten ihn »den großen Peiniger«, weil er ziemlich unerbittlich sein konnte, gegenüber sich selbst und gegenüber solchen, die unter seinem Kommando standen. Ihm zu gefallen bedeutete für Einzelne bisweilen unsägliche Qualen. Besonders gefürchtet war seine Reizbarkeit. Rücksichtslos wie ein General im Feldzug, manchmal mit Drohungen und Zwang, pflegte er seinen Willen durchzusetzen. Meistens genügte allerdings seine schiere Präsenz, um den bedingungslosen Gehorsam der Expeditionsteilnehmer einzufordern. Peary war zäh, stark und ein Meter fünfundachtzig groß – im Kreis seiner Inuit-Jäger wirkte er stets wie ein Riese.
Minik und viele der Jüngeren am Strand kannten ihn nur aus den Geschichten, die Aleqatsiaq und andere Jäger während der langen Polarnächte erzählten. Für die Kinder hätte der Leutnant der US Navy ebenso gut von der Sonne oder vom Mond kommen können, so fremd erschien er ihnen. Umso aufgeregter waren sie jetzt, als sie ihn leibhaftig zu Gesicht bekamen, wenn auch vorerst nur winzig klein aus der Ferne.
»Piuli, Piuli!«, rief Minik im Chor mit den anderen Kindern – kaum einem Inuk gelang es, den Namen des Entdeckers richtig auszusprechen. Neben ihm hüpfte sein liebster Spielkamerad, Oki. Die beiden Jungen versuchten sich an Lautstärke gegenseitig zu übertreffen.
Auch die Frauen stimmten in das Geschrei mit ein. Einige waren mit ihren Familien aus nördlicher gelegenen Lagern nach Cape York gekommen, das weit im Süden von Avanersuaq lag. Sie wollten Peary ihre Dienste anbieten und mit ihm Handel treiben. Nicht wenige Frauen arbeiteten als Näherinnen für ihn, weil er auf seinen arktischen Expeditionen die Vorzüge der einheimischen Fellkleidung nicht missen wollte. Früher hatte auch Miniks Mutter Mannik für den weißen Mann Hosen und Jacken angefertigt, aber sie war im letzten Jahr gestorben; eine Krankheit hatte sie und dreißig andere des Stammes dahingerafft. Minik vermisste ihre Lieder in dem Zelt aus Walrosshaut, das er nun allein mit seinem Vater bewohnte.
»Da! Da!«, quietschte Oki aufgeregt und zeigte zum Segelschiff hinüber, wo drei Jäger sich anschickten, über eine Strickleiter aufs Oberdeck zu klettern.
»Das ist mein Vater. Er wird mit Piuli verhandeln«, erklärte Minik mit wichtiger Miene.
»Und Nuktaq. Und Aleqatsiaq«, sagte Oki. Er war erst sechs, fast ein Jahr jünger als Minik.
Peary hatte die Stärke, Ausdauer und Erfahrung dieser Männer in den letzten Jahren schätzen gelernt und würde sich bestimmt auch in diesem Sommer wieder ihrer Dienste versichern wollen. Miniks Vater Qisuk gehörte zu seinen Lieblingen. Er nannte ihn den »Walrosstöter von Itilleq«. Bestimmt wird der weiße Mann auf Vater nicht verzichten wollen, dachte Minik und sah sich der Erfüllung seines Traumes schon ganz nah – ein eigenes Messer zu besitzen war sein größter Herzenswunsch.
Mit einem Mal konnte er die Jäger auf dem Oberdeck des Seglers nicht mehr sehen. Vermutlich palaverten sie mit Piuli. Im Stammesrat wurde manchmal ganze Ewigkeiten lang geredet. Minik setzte sich auf einen Felsen. Mit seinem kleinen Bogen aus Moschusochsenhorn hatte er schon manches scheue Wild erlegt, weil er als Siebenjähriger bereits die Kunst der großen Jäger beherrschte: das Warten.
Geduld war auch bitter nötig, denn Peary unterhielt sich lange mit den Inuit. Das Anstarren des Schiffes wurde den meisten am Strand bald zu langweilig. Daher liefen die Frauen und Kinder auseinander, um sich wichtigeren Beschäftigungen zuzuwenden. Dazu gehörte auch das Verstecken von Fellen und Elfenbein – die Gier des weißen Mannes nach diesen Dingen war unersättlich.
Irgendwann erschöpfte sich auch Okis Geduld. »Kommst du mit spielen, Minik?«
Dieser zuckte die Achseln. »Ich bleibe noch hier und warte auf meinen Vater.«
»Na gut. Ich gehe zu den Zelten, falls du mich später suchst.«
Minik nickte. Eine Weile folgte er seinem davonhüpfenden Freund mit den Augen, dann blickte er wieder zu Pearys Schiff hinüber. Sein ganzes Wissen über den Amerikaner verdankte er den Erinnerungen anderer Familien- oder Stammesmitglieder. Der große qallunaaq Piuli habe ihm schon als Säugling die Händchen getätschelt, hatte Qisuk einmal erzählt. Andere Erwachsene meinten, Peary sei geradezu besessen von den savikuse, den »großen Eisen«, welche viele Generationen lang das Metall für die Harpunen und Messer der Inuit geliefert hatten.
Vor zwei Jahren hatte Peary »den Hund« und »die Frau«, zwei kleinere, nach ihrer Form so benannte Eisenbrocken auf sein Schiff geladen und war damit in den Süden gefahren. Nicht wenige Inuit betrachteten den Verlust ihrer Eisenquellen mit Sorge, aber was sollten sie machen? Peary hatte einen starken Willen, dem sich niemand zu widersetzen wagte. Außerdem belieferte er ganz Avanersuaq mit Tauschwaren. Sie waren abhängig von dem Mann. Und jetzt wollte »der große Peiniger« ihnen auch noch das letzte und größte Eisen nehmen. Die Inuit nannten es »das Zelt«. Peary behauptete, die savikuse seien vom Himmel gefallen und für die Menschen in seiner Welt von großem wissenschaftlichen Interesse. Was immer er damit meinte, wollte er »seine Leute«, die Inuit, doch nicht bestehlen. Um sie für den Verlust zu entschädigen, versprach er ihnen Messer, Gewehre, Nadeln, Fernrohre und andere Schätze des weißen Mannes.
An Deck der Hope tat sich etwas. Minik erklomm seinen Sitzstein, um die Bucht besser überblicken zu können.
Ein größeres Beiboot wurde zu Wasser gelassen. Sein Vater und die anderen beiden Jäger stiegen unterdessen in ihre Kajaks. Qisuk paddelte sofort los. Seine Gefährten warteten noch auf ein Fass, das vom Deck zu ihnen hinabgelassen wurde. Vermutlich ein großzügiges Willkommensgeschenk Piulis, dachte Minik. Nuktaq und Aleqatsiaq hatten ihre Boote mit einem hautbespannten Knochenrahmen verbunden, auf dem sie die Tonne in Empfang nahmen. Nachdem der Behälter wie in einer straffen Hängematte lag, machten sie sich auf den Weg zum Strand. In der Zwischenzeit war auch das Beiboot einsatzbereit und wurde mit mehreren Seeleuten bemannt. Zum Schluss kletterte auch Leutnant Peary über das Fallreep in die Pinasse.
Minik sah schon von weitem, wie sein Vater übers ganze Gesicht strahlte – im Stamm nannte man ihn »der Lächelnde« –, und rief voller Ungeduld: »Hast du ein Messer für mich?«
Qisuk antwortete nicht sofort, sondern lenkte das Kajak zunächst ans Ufer. Sein schulterlanges, schwarzes Haar flatterte im Wind. Er war einer der besten Jäger des Stammes, nicht nur von seinem Sohn bewundert und geliebt. Nachdem er das Boot ein Stück weit den steinigen Strand hinaufgezogen hatte, richtete er sich zur vollen Größe von einem Meter sechzig auf, gab seinem Sprössling einen Nasenkuss und drückte ihn hiernach an sich, als seien sie wochenlang getrennt gewesen.
Während das Gesicht des Jungen noch in Qisuks Felljacke vergraben war, kam er abermals auf die Frage aller Fragen zurück. »Wann bekomme ich ein Messer, Vater?«
Qisuk lachte. »Du bist ein Quälgeist, Minik. So schnell geht das nicht. Erst müssen wir für Piuli arbeiten und danach bekommen wir unseren Lohn.«
Minik befreite sich aufgeregt aus der Umarmung. »Dann nimmt dich der weiße Mann wieder mit?«
»Ja. Er will ›das Zelt‹ auf sein Schiff verladen. Wir helfen ihm dabei, und weißt du was, kleiner Jäger?«
»Nein.«
»Diesmal kommst du mit.«
»Ich ...?« Miniks Augen wurden groß. »Du meinst, ich muss nicht bei den Frauen bleiben?«
»Nein. Piuli hat nichts dagegen, wenn wir unsere Familien mitnehmen.« Qisuk seufzte. »Nach dem Tod deiner Mutter bist du meine ganze Familie, kleiner Jäger.«
Minik war viel zu aufgeregt, um die leisen Töne seines Vaters zu bemerken. Er stellte sich vor, was für ein Abenteuer es sein würde, mit dem großen Segelschiff übers Meer zu fahren.
Inzwischen hatten Nuktaq und Aleqatsiaq das Fass ans Ufer balanciert. Ihre Rückkehr war nicht unbemerkt geblieben, so dass der Strand sich rasch mit Inuit füllte.
»Ist das ein Geschenk von Piuli? Was ist da drin?«, fragte Minik.
»Zwieback«, antwortete Qisuk.
Sein Sohn sah ihn verständnislos an. »Und wozu ist das gut?«
»Zum Essen.«
»Ist Zwieback ein anderes Wort für Fisch, Robbe oder Karibu?«
»Weder noch. Es wird in einem Ofen gebacken. Lass dich überraschen.«
Nuktaq und Aleqatsiaq hievten das Fass ans Ufer, öffneten den Deckel und streuten den Inhalt auf den Strand. Dabei rief Aleqatsiaq: »Hier, probiert das. Es ist ein Geschenk des großen weißen Führers für euch.«
Das ließen sich die Kinder, Frauen und Männer nicht zweimal sagen. Mit begeistertem Geschrei stürzten sie sich auf die Leckerbissen. Minik hätte auch gerne ein Stück Zwieback ergattert, aber gerade als er sich den anderen anschließen wollte, wischte sein Blick über die Bucht und blieb an dem sich nähernden Beiboot hängen.
Die mit acht Ruderern bemannte Pinasse von Peary war nur noch einen Steinwurf weit vom Ufer entfernt. Der Leutnant ragte aus dem Bug auf wie das Horn eines Narwals. Als das hölzerne Boot auf den Strand schabte, schwang er sich behände über das Dollbord und lief geradewegs auf Qisuk und seinen Sohn zu. Zwei andere weiße Männer folgten ihm.
Je näher die Fremden kamen, desto unwohler fühlte sich Minik, Vor allem Pearys Anblick ließ ihn erschauern. Er war ein Riese, der mit jedem Schritt sogar noch zu wachsen schien. Als er schließlich vor Vater und Sohn stehen blieb, musste der Junge den Kopf weit nach hinten neigen, um zu Peary aufzuschauen. Huldvoll lächelte dieser auf ihn herab.
Nie zuvor hatte Minik einen größeren Menschen gesehen. Sofern er überhaupt ein Mensch war. Obwohl er die Kapuzenjacke und auch sonst die typische Fellkleidung der Polareskimos trug, kam er dem Jungen eher vor wie ein Besucher aus einer anderen Welt: Pearys Haut war bleich, der Schnurrbart ungewöhnlich dicht, das helle Haar hatte einen rötlichen Schimmer und die Augen – graublau – blickten kalt wie Gletschereis; sie schienen geradewegs durch ihn hindurchzusehen. Ängstlich griff Minik nach der Hand seines Vaters. Als der Hüne dann auch noch gänzlich unverständlich zu sprechen begann, stand für den kleinen Polareskimo fest, ein überirdisches Wesen vor sich zu haben.
»Piuli sagt: Junge gewachsen. Wangen rund. Junge schön fett«, übersetzte einer der beiden Männer aus Pearys Gefolge eher schlecht als recht.
Qisuk bedankte sich lächelnd für das Kompliment.
Wieder richtete der Leutnant das Wort an ihn und sein Begleiter übertrug die Frage in die Sprache der Polareskimos. Es ging um Aleqasina, Piugaattoqs blutjunge Gefährtin. Offenbar sollte »die Schöne des Stammes« Peary wieder das Bett wärmen – bei den Inuit galt es als Gebot der Höflichkeit, dem Gast eine Frau zu leihen.
Miniks Vater wiederholte ihren Namen und kratzte sich am Kopf. »Sie müsste in Piugaattoqs Zelt zu finden sein. Es steht dort hinten.« Er deutete zum nördlichen Ende des Lagers.
»Anirsalu«, sagte Peary, um sich zu bedanken. Er ließ Vater und Sohn stehen, um sich in die angezeigte Richtung zu entfernen. Sein Gefolge schloss sich ihm an. Einer der Männer sagte etwas, das ziemlich fröhlich klang. Dabei deutete er auf die Inuit, die immer noch über den Boden krochen und die letzten Zwiebäcke auflasen. Die drei Fremden lachten.
»Warum freuen sich die weißen Männer so?«, fragte Minik.
Qisuk hatte aufgehört zu lächeln. Mit starrer Miene antwortete er: »Sie machen sich über uns lustig.«
»Aber warum tun sie das, Vater?«
»Denk nicht weiter drüber nach, kleiner Jäger. Der weiße Mann tut ständig verrückte Sachen. Stell dir vor, Piuli will eine Reise zum Nordpol unternehmen. Das ist der Gipfel unserer Welt, ein Ort, an dem jeder Wind aus Süden weht. Dort gibt es nichts als Schnee, Sturm, Eis und Kälte. Alles zum Überleben Nötige muss man dorthin mitbringen, und wer zu lange bleibt, der stirbt unweigerlich.«
Minik verzog das Gesicht. Das war tatsächlich das Dümmste, was er je gehört hatte. »Warum will Piuli dahin?«
»Weil noch niemand vor ihm dort gewesen ist.«
»Verstehe ich nicht.«
»Er will Ruhm, Minik.«
»Warum erlegt er nicht einen starken Eisbären? Dann werden alle Jäger ihn achten.«
»Das genügt Piuli nicht. Er möchte der größte Entdecker sein, ein Mann, über den in allen Iglus seiner Heimat bewundernd gesprochen wird. Außerdem sollen sein Land und sein Volk durch seine Heldentat besser, größer und stärker als alle anderen Länder und Völker werden.«
»Und wozu?«
»Ich habe keine Ahnung. So ist der weiße Mann nun mal.«
Minik schüttelte verständnislos den Kopf. Nach einer Weile fragte er besorgt: »Sollst du mit Piuli zu diesem Pol-Dings gehen?«
Qisuk konnte mit einem Mal wieder lachen. »Nein. Keine Sorge, kleiner Jäger. Mit uns hat er etwas weniger Beschwerliches vor. Hast du je von dem Märchen gehört, das sich die weißen Männer über die ›großen Eisen‹ erzählen?«
»Ja. Sie dachten, wir holen unsere Harpunenspitzen aus einem Berg, der ganz und gar aus Eisen besteht.«
»Richtig. In diesem Jahr ist Piuli nur deswegen nach Avanersuaq gekommen. Er sagte: ›Jetzt fahren wir nach Bushnan Island und holen uns den Eisernen Berg.‹«
»Darf Oki auch mitkommen?«
»Du wirst wohl für eine Weile ohne ihn auskommen müssen. Sein Vater ist dagegen, dass Piuli das letzte der großen Eisen von hier fortnimmt.«
»Warum denn?«, lachte Minik. »Wir brauchen sie doch nicht mehr. Piuli hat dir ein Gewehr gegeben und Messer kriegen wir auch von ihm.«
»Okis Vater meint, die Geister der Steine würden jeden verfluchen, der sich mehr als ein kleines Stück Metall nimmt. Du kennst doch die Geschichte von den Inuit, die sich die anstrengende Reise nach Saviksiivik – dem Ort, an dem man das Eisen findet – ersparen wollten. Sie haben der ›Frau‹ den Kopf abgeschlagen und ihn auf einen Schlitten geladen. Als sie das Eis überquerten, brach es unter ihnen auf und verschlang den Schlitten samt den Hunden und dem Kopf der Frau.«
Minik gefor das Lachen auf dem Gesicht. Mit einem Mal fand er es gar keine so gute Idee mehr, zur Eiseninsel zu fahren und Peary beim Verladen des »Zeltes« zu helfen.
Die Legende vom Eisernen Berg war noch keine achtzig Jahre alt. Sie ging auf John Ross zurück, einen britischen Marineoffizier, der sich im Jahr 1818 auf die Suche nach einer Nordwestpassage um den amerikanischen Kontinent herum begeben und dabei die Polareskimos entdeckt hatte. Anfangs hielten die Inuit seine beiden Schiffe für riesige Vögel und flohen vor ihm. Bald aber lockte ihre Neugierde sie zurück zur Küste. Sie zeigten Ross die groben Klingen ihrer Messer und Harpunen, welche von savikuse stammten, den »großen Eisen«, wie sie ihm erklärten. Er hatte nur einen Dolmetscher aus Südgrönland dabei, der einen anderen Inuktitut-Dialekt sprach und die Schilderungen seiner nördlichen Verwandten nur ungenau übersetzte. So kam es, dass Ross nach England zurückkehrte und von einem »Eisernen Berg« im arktischen Hochland berichtete.
Später fand man heraus, dass die von ihm mitgebrachten Inuit-Waffen nicht nur Eisen, sondern auch beträchtliche Anteile von Nickel enthielten. Wissenschaftler äußerten die Vermutung, es könne sich um Bruchstücke von Meteoriten handeln. Hierauf begann eine fieberhafte Suche nach dem Eisernen Berg, aber erst Robert Edwin Peary konnte Qisuk überreden, das Geheimnis der Eisenquelle seines Volkes zu verraten, und Aleqatsiaq führte ihn schließlich zum Schatz der Inuit.
Ihrer Form wegen nannten sie die Meteoritentrümmer »Frau«, »Hund« und der größte hieß »Zelt«. Letzteren widmete Peary seiner im Dezember 1893 in Grönland geborenen Tochter Marie. Ihr zweiter Name – Ahnighito – sollte auf ewig mit dem vom Himmel gefallenen Riesen verbunden sein.
»Frau« und »Hund« hatte der selbst ernannte König von Avanersuaq gleich 1895 mitgenommen. Ahnighito lag etwa vier Meilen von ihnen entfernt auf Saviksoah, einer Insel, die von den Amerikanern Bushnan Island genannt wurde. Das »Zelt« war zu schwer gewesen, um es nur mit Muskelkraft abzutransportieren. Ein Jahr später hatten Pearys Helfer den sechsunddreißig Tonnen schweren Meteoriten immerhin bis zur Küste wälzen können. Ein Wetterumschwung machte das Verladen des Kolosses dann aber unmöglich. Das Versäumte sollte jetzt, im dritten Anlauf, nachgeholt werden.
Die Melville Bay, von den Inuit Qimusseriarsuaq genannt, war in diesem Sommer fast eisfrei. Doch jeder wusste, wie schnell die Witterung umschlagen konnte. Um sich nicht noch einmal von Schnee und Eis in Fesseln legen zu lassen, vergeudete Peary am Cape York keine Zeit. Er rekrutierte Hilfskräfte und traf weitere Vorbereitungen. Fernerhin überredete er die Stammesführer, ihm die sterblichen Überreste von ein paar kürzlich dahingeschiedenen Polareskimos zu überlassen. Mit einigen der Toten hatte er gefährliche Abenteuer bestanden. Er versprach, ihre Gebeine in schöne Kisten zu betten, in denen sie fortan sicher aufgehoben wären.
Ein Sprichwort der Inuit lautete: »Unser Körper ist nichts als eine Hülle unserer Lebenskraft.« Nach ihrem Glauben besaß jeder Mensch mehrere Seelen. Wenn er starb, endete zwar die Existenz von nappan, der persönlichen Seele, aber der Schatten tarrak verweilte weiter an dem Ort, an dem der Leichnam aufgebahrt lag. Wie alle Bereiche der menschlichen Existenz, so wurde auch deren Ende, der Tod, von Tabus geregelt, Verboten, die sowohl dem Leben des Einzelnen wie auch dem gemeinschaftlichen Gefüge Stabilität verliehen. Um mit den Geistern keine Scherereien zu bekommen, hielten sich die Inuit streng daran. Aber wenn die Gebeine des Toten erst einmal ordnungsgemäß begraben waren, lebte dieser befreit im Himmel, unter dem Meer, über den Wolken oder er band sich an einen neuen Körper, den eines Kindes oder eines Tieres. Die sterblichen Überreste dagegen verloren ihre Bedeutung. Im Jahr 1822 war der Entdecker William Parry einigermaßen schockiert gewesen, als er Schlittenhunde dabei beobachtete, wie sie sich an den gerade erst beerdigten Toten eines Stammes gütlich taten. Andere Polarforscher störten sich daran, dass Kinder mit einem Menschenschädel spielten oder die Knochen der Verstorbenen rund um das Lager verstreut lagen. Die Polareskimos fanden die empörten Proteste der qallunaaq ziemlich kindisch.
Pearys Bitte um die Gebeine ihrer Stammesbrüder und -schwestern rief unter den Inuit nicht gerade Begeisterungsstürme hervor, aber sie waren darüber alles andere als entrüstet. Letztlich willigten sie ein, die Steingräber zu öffnen, die Knochen in fünf große Fässer zu füllen und an Bord der Hope zu verladen.
Als die Stunde der Abreise zur »Eiseninsel« kam, war Minik furchtbar aufgeregt. Sein Vater hatte ihn in den vergangenen Tagen bewusst von den weißen Männern ferngehalten. »Spiel mit deinen Freunden. Wer weiß, wann du sie wiedersiehst«, hatte er gesagt.
Jetzt fuhren Vater und Sohn zur Hope hinüber. Sie saßen zusammengepfercht in Qisuks Kajak, das eigentlich nur für einen Jäger gebaut war. Je näher sie dem Segler kamen, desto stiller wurde Minik. Unter dem Dreimaster fühlte er sich wie ein Zwerg.
»Geh schon mal an Bord. Ich kümmere mich noch um die Verladung des Kajaks«, sagte Qisuk, nachdem er es neben dem Fallreep längsseits gebracht hatte.
Minik drückte sich an die Brust seines Vaters. »Ich möchte lieber warten und wir gehen nachher zusammen.«
Qisuk legte schützend den Arm um ihn. »Hast du Angst?«
Der Junge schüttelte entschieden den Kopf. »Ich will nur bei dir bleiben, Vater.«
»Das wirst du auch. Deshalb nehme ich dich ja mit. Und nun los! Klettere nach oben. Die anderen warten schon auf dich. Ich komme gleich nach.«
Widerstrebend gehorchte Minik. Er schulterte seine Jagdausrüstung und machte sich an die Ersteigung der Leiter. Die Schiffswand war dunkel und ihr Geruch biss Minik in die Nase. Er blickte nach oben. Über der Reling erschienen zwei Gesichter. Sie gehörten Nuktaq und Aviaq. Die Adoptivtochter des von allen geachteten Jägers war schon zwölf, und seit sie Uisaakassak zur Ehe versprochen worden war, behandelte sie Minik wie einen Säugling. Um sich vor ihr keine Blöße zu geben, drückte er die Brust heraus und machte ein grimmiges Gesicht, als stehe er im Begriff, ein Walross mit bloßen Händen zu erwürgen.
»Hat dir dein Vater noch schnell den Po abgewischt?«, spöttelte Aviaq von oben.
Minik blitzte sie wütend an.
»Oder musste er dem Kleinen erst das Essen vorkauen?«, setzte das Mädchen hinzu und kicherte. Die Heiterkeit endete jäh, als ihr Ohr von einer Hand gepackt und heftig geschüttelt wurde. Aviaq schrie, weniger der Schmerzen wegen, sondern weil sie sich erschrocken hatte.
»Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst Minik nicht ärgern!«, rief eine strenge Stimme. Sie gehörte Atangana, Nuktaqs Frau, einer mächtigen Schamanin, mit der man sich besser nicht anlegte.
Nuktaq streckte dem Jungen die Hand entgegen. »Komm, ich helfe dir.«
Mit Schwung wurde Minik über das Schiffsgeländer gezogen. Aviaqs Ziehvater war ungemein stark. Vom Scheitel bis zur Sohle maß er gerade ein Meter fünfundfünfzig, aber er hatte die kräftige Statur eines Moschusochsen. Er war Anfang vierzig, etwa fünf Jahre jünger als seine Frau. Sein glattes schwarzes Haar hatte noch keine Schneefäden, auch nicht sein Schnurrbart und das komische Büschel, das auf seinem Kinn wucherte.
Er verzog sein dunkles Gesicht zu einem Grinsen. »Hör nicht auf sie, Minik, Die kleine Möwe schreit zwar laut, aber sie frisst nur, was der Falke fallen lässt.«
Nuktaq hatte die heikle Situation geschickt entschärft, indem er Minik an seine Ehre als Jäger erinnerte. Der Junge rückte seinen Hornbogen und den Pfeilköcher auf der Schulter zurecht und strafte das Mädchen mit Nichtachtung.
»Wann heiratet Aviaq endlich?«, fragte er stattdessen Atangana.
Die lachte. »Wieso willst du das wissen?«
»Eqariusaq hat auch früh geheiratet«, antwortete er ausweichend, womit er auf Nuktaqs leibliche Tochter anspielte, die vor drei Jahren für einige Monate mit Peary nach Amerika gereist war.
»Du bist ein Schlingel, Minik. Es geht dir doch nur darum, die Sticheleien einer gewissen jungen Frau nicht länger ertragen zu müssen, habe ich recht?«
Er fühlte sich ertappt. Atangana war etwa eine Handbreit kleiner als ihr Mann und so rundlich wie eine schwangere Robbe, aber man durfte sich von ihrem gemütlichen Äußeren nicht täuschen lassen. Sie hatte den Verstand eines Fuchses und ihre Zunge war so flink wie eine Seeschwalbe. Während Minik noch überlegte, wie er seinen Hals aus der von ihm selbst gelegten Schlinge ziehen konnte, meldete sich plötzlich hinter ihm ein Fremder zu Wort.
»Wen haben wir denn da? Ist das etwa der kleine Jäger, von dem Qisuk mir so viel erzählt hat?«
Die Stimme ließ Minik erschauern. Sie klang so fremd – tief und voll –, fast so dumpf wie in einem Schneehaus. Obwohl ihr Besitzer fließend Inuktitut sprach, klangen die Worte völlig anders als bei jedem anderen im Stamm. Minik drehte sich um – und erschrak sich fast zu Tode.
Vor ihm stand ein schwarzer Mann.
Das musste Matthew Alexander Henson sein. Minik hatte zwar schon von dem »rabenschwarzen« Diener Pearys gehört, sich darunter aber nichts vorstellen können. Im Vergleich zu Henson waren er oder Nuktaq tatsächlich weiße Männer. Nicht dass die Hautfarbe für sie irgendeine Rolle spielte. Die Polareskimos kannten keine Rassenvorurteile. Sie pflegten zu sagen, um einen Menschen gernzuhaben, müsse er nur freundlich und von dieser Erde sein. Henson sprach nicht nur fließend ihre Sprache, er behandelte sie auch wie inuit, wie »Menschen« also, und nicht nur wie nützliche Werkzeuge. Deshalb schätzten sie ihn auch weit mehr als seinen Herrn.
Der schwarze Mann trug Fellkleider wie die umstehenden Polareskimos. Er lächelte Minik freundlich an. Seine Zähne blitzten dabei wie frisch gefallener Schnee. Er war etwa dreißig Jahre alt, drahtig und nicht ganz so beängstigend groß wie Peary. Trotzdem musste Minik den Kopf weit in den Nacken zurücklehnen, um Henson ins Gesicht sehen zu können. Am liebsten wäre er vor ihm weggelaufen, aber drei oder vier Schritte von ihm entfernt stand Aviaq und wartete nur darauf, sich über den kleinen Hasenfuß lustig zu machen.
»Hast du deine Zunge verschluckt? Wie heißt du?«, fragte Henson.
Minik nahm all seinen Mut zusammen und nannte seinen Namen.
Der schwarze Mann ging vor ihm in die Hocke und antwortete mit einem Lächeln: »Also doch Minik, der Sohn des Walrosstöters von Itilleq. Wie ich sehe, bist du auch ein Jäger.« Er deutete auf Miniks Jagdausrüstung.
»Ich schieße Vögel«, erklärte der Junge stolz.
Sein Gegenüber nickte ernst. »Ach, so ist das. Solche Burschen wie dich können wir auf unserer Fahrt gut gebrauchen.« Henson streckte ihm die Hand entgegen. »Es freut mich, dich kennenzulernen, Minik. Ich bin Matthew Henson, der Assistent von Leutnant Peary. Du darfst Onkel Matt zu mir sagen.«
Der Junge starrte argwöhnisch auf Hensons Pranke. Vielleicht brachte es Unglück, einen schwarzen Mann zu berühren ... Dann aber entdeckte er etwas, das alle seine Ängste wie frisch gefallenen Schnee fortwehte: Die Innenfläche von Hensons Hand war so hell wie seine eigene. Er steckte also nicht nur in den Kleidern eines Inuk und sprach wie einer, sondern er war auch auf dem besten Weg, sich in einen Polareskimo zu verwandeln.
Miniks Gesicht erstrahlte unter einem befreiten Lächeln und er legte seine Rechte in die warme Hand des schwarzen Jägers.
Bushnan Island lag nicht ganz fünfundzwanzig Meilen östlich von Cape York. Die Eisverhältnisse waren günstig und so dampfte die Hope in nur knapp drei Stunden zu der kleinen Insel. Obwohl die Seereise also ziemlich kurz war, bedeutete sie für Minik das bislang größte Abenteuer seines Lebens. Das riesige hölzerne Schiff, der schwarzen Qualm spuckende Schornstein hinter dem Fockmast, die weißen Männer, die vielen seltsamen Gegenstände an Bord, die schrillen Klänge der Schiffsglocke und der Ziehharmonika, die schillernden Gerüche von Rum und gekochtem Essen – all das sog er mit allen Sinnen gierig in sich auf.
Als Kapitän John Barlett vor Saviksoah – der Eiseninsel – Anker werfen ließ, stand die Sonne immer noch über dem Horizont. Es war die Jahreszeit der Mittsommernächte, in denen es nie dunkel wurde. Minik stand an der Reling und spähte auf die Melville Bay hinaus. Die trockene klare Luft schien die lang gestreckte Bucht geschrumpft zu haben, so weit konnte er sie überblicken. Das gelbrote Licht der Sonne meißelte feinste Konturen aus den Felsen der Insel.
Kaum hing die Hope an der Ankertrosse, da wurden auch schon Männer, Frauen und Kinder sowie die Ausrüstung an Land geschafft. Am Ufer der Eiseninsel hatten Pearys Leute im letzten Jahr eine Hütte errichtet, die den Weißen Schutz bot. Die Inuit schlugen einfach ihre Zelte auf.
Die folgenden Tage waren angefüllt mit Schwerstarbeit. Peary meinte, Ahnighito brächte neunzig bis einhundert Tonnen auf die Waage. Auch wenn er damit weit über dem tatsächlichen Gewicht des Meteoriten lag, konnten selbst die stärksten Inuit ihn nicht allein mit Muskelkraft auf das Schiff hieven. Das »Zelt« war ein Eisenbrocken von mehr als drei Metern dreißig Länge, zwei Metern Höhe und fast einem Meter sechzig Tiefe. Wegen seiner gestreckten Form hatten die Inuit-Helfer ihn im letzten Jahr nur bewegen können, indem sie ihn um seine eigene Achse wälzten, immer und immer wieder.
Als Minik den mit Eis überzogenen Stein zu Gesicht bekam, wurde ihm angst und bange. Er musste an den Fluch der »Frau« denken, der man den Kopf abgeschlagen hatte. Was, wenn dieser eiserne Koloss seinen Vater in die eisige See hinabzog? Qisuk versuchte seinen Sohn zu beruhigen. Piuli habe Hebevorrichtungen mitgebracht, Wunder des weißen Mannes, die hydraulisch funktionieren. Er vermochte zwar nicht zu erklären, was darunter zu verstehen war, aber mit seiner unerschütterlichen Zuversicht zerstreute er schließlich Miniks Zweifel.
Den schuftenden Stammesgenossen bei der Arbeit zuzusehen, verlor für den Jungen schon bald seinen Reiz. Er vermisste Oki. Unter den anderen mitgereisten Kindern fand sich kein einziges, mit dem er sich so gut verstand wie mit seinem liebsten Spielkameraden. Einige gingen ihm sogar aus dem Weg, weil, so meinten sie, Qisuk im Rang eines Anführers stehe und sie nur Söhne einfacher Jäger seien. Polareskimos hatten zwar keine richtigen Häuptlinge, aber Erfahrung und Besonnenheit wogen im Stammesrat schwerer als der Übermut junger Heißsporne. Vermutlich plapperten die Kinder nur die Worte irgendwelcher Neider nach.
Ohne seinen besten Freund blieb Minik als letzter Ausweg nur Aviaq. Wie sich herausstellte, war Nuktaqs Tochter gar nicht so unausstehlich wie ursprünglich gedacht. Nachdem er erst einmal Waffenstillstand mit ihr geschlossen hatte, verzichtete sie auch auf ihre Sticheleien. Binnen kurzem waren die zwei unzertrennlich. Sie erzählten sich viele Geschichten, unternahmen lange Streifzüge über die Insel und beobachteten die Tiere.
Jedes Mal, wenn sie wieder zum Lager zurückkehrten, hatte sich hier etwas verändert. Kapitän Barlett ließ den Segler zu einer Klippe bringen, deren Oberkante fast auf gleicher Höhe mit dem Großdeck der Hope lag. Während die Inuit das »Zelt« noch zu dem Felsen bugsierten, bauten die weißen Männer dort bereits eine Art Brücke. Diese bestand aus dicken Stahlträgern, die wie Schienen zum Schiff hinüberführten. Der Meteorit wurde in Position gebracht und mit Hilfe der hydraulischen Hebevorrichtungen auf einen Schlitten aus dicken Holzbohlen bugsiert.
»Morgen werden wir das ›Zelt‹ über die Brücke aufs Schiff verladen«, erklärte Qisuk am Abend des 11. August seinem Sohn. Peary hatte die Inuit zu einer kleinen Feier bei der Schutzhütte eingeladen. Männer, Frauen und Kinder saßen um ein prasselndes Lagerfeuer herum. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung. Im Wechsel ließen die Seeleute von der Hope ihre Shantys und die Inuit ihre Kehlkopfgesänge erklingen. Anders als bei den sich plackenden Jägern war die Unbeschwertheit für Minik und Aviaq in den letzten Tagen ein Dauerzustand gewesen. Jetzt aber stieg in dem Jungen wieder die Angst vor den Eisengeistern hoch.
»Warum machst du ein so griesgrämiges Gesicht, kleiner Mann?«, rief Matt Henson über das Lagerfeuer hinweg.
Minik hatte zwar in den letzten Tagen Vertrauen in den schwarzen Mann gefasst, aber es war ihm unangenehm, vor allen anderen über seine Furcht zu sprechen. Deshalb schwieg er.
»Ich glaube, er muss an den Fluch der ›Frau‹ denken«, sagte Qisuk an seiner statt.
Matt kannte die Geschichten vom versunkenen »Kopf«, nahm sie aber offensichtlich nicht sehr ernst. Mit einem Lachen übersetzte er Qisuks Worte in die qallunaaq-Sprache, die er »Englisch« nannte. Die Schilderung der Besorgnisse eines kleinen »Eskimos« löste allgemeine Heiterkeit aus. Am liebsten wäre Minik vor Scham im Boden versunken.
Schließlich zeigte aber doch einer der zu Pearys Tross gehörenden Wissenschaftler Mitgefühl für den Jungen und machte einen Vorschlag, den Matt so übersetzte: »Ich verspreche demjenigen Kind ein Klappmesser, das mir als Erstes eine Schnee-Eule bringt.«
Minik traute seinen Ohren nicht. Ein Klappmesser? Für eine Eule? Allein der Gedanke an die Belohnung schillerte in seinem Kopf wie ein Nordlicht, in dessen buntem Schein sämtliche Eisengeister verblassten. Ein Messer für eine uppissuaq – das war ein Handel, dem er nicht widerstehen konnte. Und das Beste war: Er konnte sich seinen größten Herzenswunsch mit eigenem Mut und Geschick erfüllen! Während er mit Aviaq über die Insel gewandert war, hatte er alle möglichen Vögel gesehen. Auch eine Schnee-Eule.
»Das Messer gehört mir«, rief er mit fester Stimme.
Ein vielstimmiges Lachen hallte hinaus in die Mittsommernacht.
Vor lauter Aufregung hatte Minik nur wenige Stunden geschlafen. Zum Glück brauchte er nicht zu warten, bis der Morgen graute und er sich auf die Pirsch begeben konnte ‒ die Sonne war gar nicht erst untergegangen. Um Qisuk nicht zu wecken, bewegte er sich so leise wie ein Polarfuchs durchs Zelt. Er raffte seine Kleidung zusammen, griff sich die Jagdwaffen und schlich nackt ins Freie hinaus.
Im Lager herrschte eine große Ruhe. Nur hier und da drang ein Schnarchen aus einem Zelt. Wenn es eine Bärenwache gab, dann hatte sie sich gut versteckt. Ein kühler Wind wehte vom Meer zu ihm herüber, aber Minik fror nicht – Inuit-Kinder waren abgehärtet. Mit der Sorgfalt eines erfahrenen Jägers zog er seine mehrlagige Pelzkleidung an. Zuletzt hängte er sich die Schneeschuhe sowie Pfeilköcher und Hornbogen um. Dann lief er landeinwärts.
Die uppissuaq hauste gewöhnlich in schwer zugänglichen Höhen, von wo aus sie mit ihren großen Augen nach Lemmingen Ausschau halten konnte. Die letzte Schnee-Eule hatte Minik in der Nähe eines Berges gesehen, der etwa eine Stunde weit entfernt lag. Mit festen Schritten hielt er auf die Höhe zu. Zu dieser frühen Stunde pirschte bestimmt nur er allein über die Insel. Jetzt musste er nur noch zum Schuss kommen und das Klappmesser war ihm sicher.
Während er mit federleichten Schritten hangaufwärts marschierte, suchten seine Augen unentwegt den Himmel ab. Hier und da erspähte er einen verirrten Eistaucher oder die kleinen Schneeammern, sperlingsgroße Singvögel, doch von der uppissuaq ließ sich nicht die Spitze einer Schwanzfeder ausmachen. Er war schon ziemlich hoch gestiegen, als er über sich einen hellen Schrei vernahm. Sofort blieb er stehen. Sein Blick folgte dem Geräusch und dann entdeckte er den Vogel. Es war ein Gerfalke. Der Greif hatte ein weißes Gefieder mit schwarzen Flecken, das aus der Ferne zu Grau verschmolz. Wäre der Falke unter Wolken entlanggeflogen, hätte der junge Jäger ihn trotz seiner scharfen Augen womöglich übersehen, aber vor dem blauen Morgenhimmel hob sich das Tier deutlich ab.
In Minik machte sich Enttäuschung breit. Sein Messer würde er nur für eine Eule bekommen. Andererseits, überlegte er sich, besaß ein Gerfalke nicht einen viel größeren Wert? Zumindest war der große, kraftvolle, ungemein schnelle Vogel ein besserer Jäger. Er schlug nicht nur Kaninchen und Schneehühner, sondern sogar Bussarde. Und Eulen!
»Du gehörst mir«, flüsterte Minik und setzte seinen Aufstieg fort. Nun hatte er ein Ziel. Der Falke kreiste über einer bestimmten Stelle am Berg. Dorthinauf musste er klettern, um in Schussweite des Vogels zu gelangen.
Ungeachtet der Gefahr stieg Minik über Felsen und Geröll dem Gipfel entgegen. Je höher er kam, desto öfter musste er Schneefelder überqueren. In einer geschützten Lage wurde der Untergrund so tief, dass er sich die Schneeschuhe umbinden musste. Ihr in einem tropfenförmigen Rahmen gespanntes Netz verteilte sein Körpergewicht auf eine größere Fläche, wodurch er kaum noch einsank. Sein Blick wanderte wieder zum Himmel. Der Falke hatte ihn entweder noch nicht bemerkt oder das Menschenkind interessierte ihn nicht. Als Beute war es zu groß und als Gefahr wohl zu klein.
»Ich kriege dich«, flüsterte Minik und flitzte wie ein Polarhase über den weichen Untergrund. Er musste noch höher hinauf und der Anstieg wurde immer steiler. Ohne Steigeisen würde er bald keinen Halt mehr finden. Ein Stück voraus entdeckte er einen von der Sonne beschienenen, schneefreien Hang. Rasch lief er darauf zu. Er hatte die felsige Stelle schon fast erreicht, als plötzlich der Boden unter seinen Füßen nachgab.
Minik schrie. In einem Reflex riss er die Arme auseinander, um irgendwo Halt zu finden, aber es war zu spät. Er fiel steil nach unten.
Doch ebenso jäh, wie sein Sturz begonnen hatte, endete er auch – mit einem heftigen Ruck, der ihm die Luft aus den Lungen presste. Durch sein schnelles Herumwirbeln musste sich sein Pfeilköcher an einer vorspringenden Felsnase verhakt haben. Jetzt baumelte Minik wie eine Jagdtrophäe in der Luft und versuchte zu begreifen, was mit ihm geschehen war. Instinktiv vermied er jedes wilde Herumzappeln. Dadurch könnte sich der schmale Lederriemen des Köchers losreißen und er würde in die enge Kluft stürzen, die ihn verschluckt hatte. Dann wäre er entweder sofort tot oder schwer verletzt, und er würde elendig sterben.
Als Erstes musste er sich orientieren. Unter ihm gähnte ein finsterer Schlund. Weiter oben war er von stumpfem Zwielicht umgeben. Weder hüben noch drüben konnte er ein Ende des Felsspalts ausmachen – es war die perfekte Falle. Er legte den Kopf in den Nacken und fühlte sich mit einem Mal wie im Rachen der Kajutaijuq, eines bösen Geistes, der nur aus Kopf und Beinen bestand – durch ihr halb geöffnetes Maul sah er den strahlend blauen Himmel. Der Schnee war auf einer Länge von etwa fünf Schritt aufgerissen. Die Bruchkante lag dicht über ihm und trotzdem unerreichbar fern. Die gegenüberliegende Wand der Kluft konnte er sogar mit den Fingerspitzen berühren, doch auch das genügte nicht, um sich an dem nackten Fels hochzuziehen. Und was war hinter ihm? Um das festzustellen, müsste er sich umdrehen. Er beneidete die Schneeeule, die ihren Kopf auf den Rücken drehen konnte ...
Plötzlich hörte er hinter sich ein Knacken. Gleichzeitig rutschte er ein winziges Stück nach unten. Ihm wurde mit Bangen bewusst, dass der Riemen sich langsam vom Köcher löste. Wenn er nicht sofort etwas tat, würde er abstürzen.
Um sich aus der misslichen Lage zu befreien, musste er klettern – mit Schneeschuhen eine Unmöglichkeit. Also schnallte er sie ab und ließ sie einfach ins Dunkel unter seinen Füßen fallen. Es dauerte erschreckend lang, bis er ihren Aufprall am Grund der Spalte hörte.
Wieder ruckte er einen Fingerbreit tiefer.
Minik stieß einen spitzen Schrei aus. Er wollte noch nicht sterben. Schon um seines innig geliebten Vaters willen nicht, der nach Mutters Tod im letzten Jahr dann ganz allein wäre.
Mit einem Mal merkte Minik, dass er sich immer noch bewegte. Beim Lösen der Schneeteller hatte sich sein Körper zu drehen begonnen. Er verrenkte den Hals, um hinter sich blicken zu können, und diesmal sah er die Felswand, an der er hing. Etwa eine Armlänge unter ihm gab es einen Vorsprung. Er konnte sein Glück kaum fassen. Wenn es ihm gelang, dorthin zu kommen, würde er auch einen Weg zurück ans Licht finden, zurück zu seinem Vater.
Nach einer halben Drehung stupste er mit der Zehenspitze gegen den Fels, wodurch er seinen Körper ins Pendeln versetzte. Abermals ruckte er ein Stückchen nach unten. Jetzt ist alles aus!, zuckte es ihm durch den Kopf. Aber noch hielt der Riemen. Jeden Moment konnte er jedoch ganz vom Köcher abreißen.
Minik versuchte ein Gefühl für den Rhythmus der Bewegung bekommen. Als er zum dritten Mal über den Vorsprung schwang, riss er beide Arme nach oben, die Schwerkraft zog ihn aus der Riemenschlinge heraus und er fiel auf den schmalen Grat.
Zwar kam er mit den Füßen zuerst auf, aber sein Oberkörper war gefährlich weit zurückgebeugt. In dem verzweifelten Kampf ums Gleichgewicht durchpflügten seine Hände die Luft, verletzten sich an rauem Stein, fanden aber keinen Halt. Als er endgültig die Balance verlor, entlud sich seine Angst in einem schrillen Schrei ...
Aber dann fand er mit einem Mal doch einen festen Griff und zog sich keuchend an die Wand heran.
Sein Herz raste wie wild. Ein paar Augenblicke lang schmiegte er die Wange an den kühlen Fels, schloss die Augen und dankte den Geistern des Berges, dass sie ihn nicht verschlungen hatten.
Als sein Atem wieder ruhiger war, sah er sich abermals um. Dicht über ihm hing immer noch der Köcher. Kein einziger Pfeil war herausgefallen. Minik wollte das Futteral nicht zurücklassen. Seine Mutter hatte es ihm genäht. Also machte er sich ganz lang, bekam es zu fassen und konnte es mühelos von der Felsnase ziehen. Hätte er noch zwei- oder dreimal mehr gependelt, wäre der Riemen vermutlich abgerutscht und ...
Minik schob den Gedanken an die Folgen eines solchen Sturzes beiseite. Er hängte sich den Köcher wieder um, atmete noch einmal tief durch und begann mit dem Aufstieg.
Jetzt ließ er sich Zeit. Unter seinen Freunden gab es keinen geschickteren Kletterer als ihn. Sorgsam suchte er sich Spalten, Tritte und Haltepunkte und kam dem Himmel so Stück für Stück näher. Zuletzt grub er mit Hilfe seines Bogens eine Mulde in die brüchige Schneekante, schob sich behutsam in diese hinein und robbte bäuchlings weiter nach oben, bis er schließlich mit dem Kopf durch die weiße Decke brach wie ein Küken, das seine Eierschale sprengt, um hinauszuschlüpfen in eine fremde Welt. So kam er sich auch vor: müde und abgekämpft wie ein Neugeborenes.
Sein erster Impuls war, umzukehren und ins Lager zurückzumarschieren. Dann aber wurde ihm bewusst, dass er sich auf der anderen Seite der Kluft befand, und er verspürte wenig Lust, das trügerische Schneefeld noch einmal zu überqueren. Grübelnd wandte er sich dem Gipfel zu.
Über ihm schrie der Gerfalke. Lachte er ihn etwa aus? Miniks Blut geriet erneut in Wallung. Ich bin der Sohn eines großen Jägers, machte er sich klar, und darf Vater keine Schande bereiten. Na ja, und über den Verlust der Schneeschuhe wird er auch nicht gerade erfreut sein. Ich brauche etwas, um ihn zu beeindrucken. Um ihn zu besänftigen. Auf keinen Fall darf ich mit leeren Händen zu ihm zurückkehren.
Und so stapfte Minik trotzig weiter den Hang hinauf.
Nach etwa einer Stunde war er tief ins Revier des fliegenden Jägers vorgedrungen. Er nutzte jede Deckung, um für die scharfen Augen des Falken unsichtbar zu bleiben. Der Vogel zog seine Kreise dicht am Berg, wo er sich ohne Kraftanstrengung von den Aufwinden tragen lassen konnte. Während der Junge sich an seine Beute heranpirschte, entsann er sich einer Lektion des Vaters. »Nur wer seinen Gegner kennt, kann ihn besiegen«, hatte Qisuk ihm eingeschärft. Minik brachte sich unterhalb einer Steilwand in Stellung, über die der Falke schon mehrmals hinweggestrichen war. Er legte einen Pfeil auf die Sehne und übte sich in der großen Tugend erfolgreicher Jäger: dem geduldigen Warten.
Es dauerte geraume Zeit, bis der Vogel sich endlich wieder der Steilwand näherte. Aber dann glitt er wie an einem unsichtbaren Faden gezogen heran. Minik handelte schnell und entschlossen. Er spannte den Bogen, zielte und schoss.
Der Pfeil tötete den Gerfalken noch in der Luft, wie ein Stein fiel er zu Boden und landete fast direkt vor den Füßen des Schützen. Der wollte gerade ein Triumphgeheul anstimmen, als er aus den Augenwinkeln eine Bewegung bemerkte. Miniks Kopf flog herum und sein Mund blieb offen stehen.
Es war die Schnee-Eule! Mit ausgebreiteten Schwingen glitt sie ein Stück oberhalb von ihm auf den Berg zu, wo sie aus seinem Blickfeld verschwand.
Er schnappte sich den toten Falken und eilte weiter den Hang hinauf. Was würden die anderen wohl sagen, wenn er mit zwei Raubvögeln ins Lager zurückkehrte? Vielleicht bekäme er einen neuen Namen: »Der Greiftöter von Saviksoah« wäre nicht schlecht. Während Minik sich die schillerndsten Ehrentitel ausdachte, bekam er eine Ahnung von dem, was sein Vater kürzlich Ruhm genannt hatte, jenes alles überstrahlende Heldentum, auf das Leutnant Robert Edwin Peary so versessen war.
Nach ungefähr einer Viertelmeile mühseligen Kletterns entdeckte Minik über sich in einer steilen Felswand das Nest der uppissuaq. Es war für ihn unerreichbar. Er konnte nicht einmal erkennen, ob sich Jungtiere darin befanden. Die Alte jedenfalls war nicht zu Hause. Er versteckte sich hinter einem Felsen unterhalb des Nestes. Und wartete.
Diesmal wurde seine Geduld auf keine allzu harte Probe gestellt. Die Eule kehrte bald zurück. In ihren Krallen hielt sie einen Vogel, einen jungen Alk, soweit Minik erkennen konnte. Einmal mehr spannte er seinen Bogen und schoss.
Als der gefiederte Jäger kurz vor dem Nest merkte, dass er selbst zum Gejagten geworden war, hatte ihn Minks Pfeil bereits durchbohrt. Die Eule schrie auf, prallte gegen den Fels und rollte an der Wand herab. Wenige Schritte von Minik entfernt blieb sie liegen.
Nun endlich durfte er jubeln, und er tat es so laut, als wolle er allen Tieren der Insel seinen neuen Namen verkünden. Jetzt war er der Greiftöter von Saviksoah! Mit den zwei Vögeln würde ihm niemand mehr das Klappmesser streitig machen.
Bevor er mit seiner Beute talwärts zog, warf er einen letzten Blick zum Nest hinauf und ein Stich ging ihm durchs Herz. Inuit-Jäger respektierten zwar die Seelen ihrer Beutetiere, aber damit erschöpfte sich ihre Anteilnahme auch schon – das Überleben des Stammes hing vom Erfolg der Jagd ab. Trotzdem musste Minik in diesem Moment an seine eigene Familie denken. Auch er hatte seine Mutter verloren. In gewisser Weise waren sich Schnee-Eulen und Inuit ja sehr ähnlich: Die »Männer« besorgten die Nahrung für ihre »Frauen« und diese wiederum fütterten die Jungen. Aber nun hatte die Brut da oben ihre Mutter verloren. Wenn sie keinen ganz außergewöhnlichen Vater hatte, dann musste sie unweigerlich sterben. Das Leben in der Wildnis war hart. Hoffentlich dachte der Schnee-Eulen-Geist genauso darüber und kam nicht auf die Idee, sich am Greiftöter von Saviksoah zu rächen.
»Vielleicht«, tröstete sich Minik, »ist euer Vater so wie meiner: ein Qisuk mit weißen Schwingen. Dann wird er euch beschützen.«
Mimik lief mit seiner Beute geradewegs zur Schutzhütte. Davor traf er einen Mann mit rotem Haar, der nur Englisch sprach. Mehr war aber auch nicht nötig, denn als der qallunaaq die Eule und den Falken sah, rief er laut einen Namen. Wenige Augenblicke später kam der Wissenschaftler aus dem Haus, der die verlockende Belohnung für den Fang der Eule ausgesetzt hatte. Minik hielt ihm die beiden Vögel hin.
Der Mann – er war stämmig gebaut, hatte aschblonde Haare und trug einen Vollbart – staunte nicht schlecht. Er fragte etwas. Minik zeigte auf seinen Hornbogen, tippte sich gegen die Brust und sagte: »Ich habe sie ganz allein erlegt. Und jetzt möchte ich bitte mein Messer haben.« Er streckte dem Wissenschaftler die geöffnete Hand entgegen.
Der schüttelte den Kopf und lachte. Offenbar hatte er verstanden. Es sagte: »Just a moment, please!«, und verschwand in der Hütte. Kurz darauf kam er zurück. Mit einem breiten Grinsen überreichte er dem Jungen die Belohnung: ein Klappmesser mit Hornschalen an den Griffflächen.
Am liebsten wäre Minik dem Mann um den Hals gefallen. Doch damit der Wissenschaftler es sich nicht am Ende doch noch anders überlegte, griff er sich flugs das Messer. Dem qallunaaq gefiel offenbar die zupackende Art des kleinen Jägers. Er rief etwas über die Schulter und aus der Hütte erscholl Gelächter. Dann aber – urplötzlich – wurde sein Gesicht ernst.
Minik fürchtete schon, etwas Falsches getan zu haben – er war mit den merkwürdigen Sitten des weißen Mannes nicht sehr vertraut. Doch der Grund für den unerwarteten Stimmungswechsel des Wissenschaftlers lag nicht bei ihm, sondern bei einem aufgeregten Jemand, der hinter dem Jungen aufgetaucht war. Als Minik sich zu dem Rufer umwandte, erkannte er ihn sofort.
Es war Matt Henson. Er kam den Strand entlang aus der Richtung des Schiffes. In einigem Abstand folgten ihm mehrere Inuit. Vier schleppten eine Trage aus Segeltuch, auf der ein Kranker oder Verletzter lag. Henson erreichte die Hütte als Erster und schrie etwas. Ein hagerer Mann mit braunem Haar kam hinausgelaufen. Minik wusste, dass es Pearys angakkoq war – die Weißen nannten ihren Schamanen »Expeditionsarzt«.
»Ist jemand verletzt, Onkel Matt?«
Jetzt erst wurde Henson auf den Jungen aufmerksam. Er lief zu ihm, ging neben ihm in die Hocke, sah ihm tief in die Augen und sagte: »Du musst jetzt ganz tapfer sein, kleiner Mann.«
Minik erstarrte. Es war ein Gefühl, als würde er von einem Eiszapfen durchbohrt. Hatte sich die Seele der Schnee-Eule etwa so schnell an ihm gerächt? Erschrocken blickte er zu den Männern mit der Trage. In dem Segeltuch war ein blutroter Fleck zu sehen. »Ist das ... mein Vater?«, hauchte er.
Matts Hand legte sich auf seine Schulter. »Ja. Der Meteorit war fast schon sicher aufs Deck herabgelassen, als plötzlich eine der Halteketten riss. Sie peitschte durch die Luft und das zerbrochene Glied traf deinen Vater am Unterarm. Wir haben sofort die Schlagader abgebunden und die Blutung gestillt, so gut wir konnten. Die Wunde geht zwar bis auf den Knochen, aber ...«
Mehr hörte Minik nicht. So schnell er konnte, lief er zum Ufer und rief immer wieder laut nach seinem Vater.
»Minik!«, hallte es von der Trage zurück, noch ehe er diese erreicht hatte. Der Junge war unendlich erleichtert, die vertraute, sanfte Stimme zu hören. Sie klang schwach. Aber lebendig!
Endlich hatte Minik seinen Vater und die Helfer erreicht. Der Expeditionsarzt legte ihm gerade einen Druckverband an. Die Wunde befand sich etwas oberhalb des linken Handgelenks.
Qisuk zwang sich zu einem Lächeln und sagte leise: »Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht.«
Minik rollten dicke Tränen über die Wangen. Sein Vater wollte ihn nicht beunruhigen, aber Qisuks blasses Gesicht und die matte Stimme straften seine Worte Lügen. Vermutlich hatte er viel Blut verloren. »Das habe ich nicht gewollt«, jammerte Minik.
»Du?«, wunderte sich Qisuk. »Es war meine Unvorsichtigkeit. Du warst ja nicht einmal in der Nähe ...« Er verzog das Gesicht, weil der Doktor ziemlich ruppig zu Werke ging.
»Tu ihm nicht weh!«, schimpfte Minik, aber der Arzt verstand ihn nicht und machte einfach weiter.
»Lass ihn. Piulis Heiler ist ein tüchtiger Mann. Er flickt mich schon wieder zusammen«, sagte Qisuk und dann stellte er die Frage, die Miniks schlechtes Gewissen nur noch heftiger pochen ließ. »Wo bist du überhaupt gewesen? Ich habe mir schon Sorgen gemacht, als ich dich heute früh nicht finden konnte.«
Minik war elend zu Mute. Obwohl sein Vater Schmerzen litt, zerbrach er sich den Kopf über ihn, den Ausreißer. Mit weinerlicher Stimme sagte er: »Ich habe meine Schneeschuhe verloren.«
Überraschenderweise sah Qisuk nicht böse aus, sondern nur noch besorgter. Miniks Seelenthermometer sank unter den Gefrierpunkt. Kleinlaut fügte er hinzu: »Sie sind in eine Spalte gefallen. Auf dem Berg.«
»Auf welchem Berg?«
»Wo ich neulich die Schnee-Eule gesehen hatte. Ich habe eine erlegt. Und einen Gerfalken!«
»Beug dich zu mir herab«, sagte Qisuk leise.
Minik gehorchte. Er wappnete sich für eine strenge Zurechtweisung.
Stattdessen streichelte sein Vater ihm die Wange, lächelte auf eine schrecklich bekümmerte Weise und sagte: »Ich bin stolz auf dich, kleiner Jäger, da du zwei Greife an einem Tag erlegt hast, aber auch sehr traurig, weil du heimlich losgezogen bist. Ich hätte dich so gerne begleitet. Und hast du dir überlegt, was aus mir geworden wäre, hätte dich der Spalt verschluckt?«
»Ich wollte dir nicht wehtun«, weinte Minik. Seine Rechte umklammerte immer noch das Messer, dessen Zauber nun für ihn verflogen war. Es schien in seiner Hand zu brennen wie ein glühender Stein. Wütend holte er aus und schleuderte den Lohn seiner Unvernunft ins Meer.
Aus Sicht von Robert E. Peary war das Bergungsunternehmen ein voller Erfolg. Ahnighito lag fest vertäut an Deck der Hope.





























