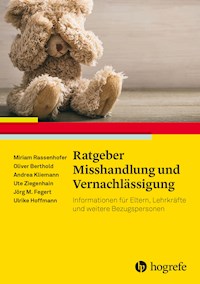23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie
- Sprache: Deutsch
Kindesmisshandlung und -vernachlässigung sind weit verbreitete, belastende und potenziell traumatische Kindheitsereignisse, die oftmals weitreichende Folgen auf psychischer, somatischer und psychosozialer Ebene haben. Kinderschutzfälle lösen bei Medizinern und Therapeuten häufig starke Verunsicherung aus. Wie soll weiter vorgegangen werden? Was darf ich tun? Was muss ich tun? Ziel des vorliegenden Leitfadens ist es, Klinikern Sicherheit im Umgang mit Fällen von Kindesmisshandlung und -vernachlässigung, bzw. Verdachtsfällen zu vermitteln Dazu werden aktuelle Erkenntnisse zur Epidemiologie von Misshandlung und Vernachlässigung, zu Folgeerscheinungen, zu rechtlichen Rahmenbedingungen, zur Diagnostik von Folgestörungen und zur Interventionsplanung dargestellt. Kernstück des Bandes sind Handlungsempfehlungen und Leitlinien für das Erkennen von Misshandlung und Vernachlässigung bzw. einer Kindeswohlgefährdung, den Umgang mit Hinweisen darauf, die Gesprächsführung mit betroffenen Patienten und ihren Bezugspersonen sowie die Vernetzung von Klinikern mit der Jugendhilfe und dem Rechtssystem. Weiterhin wird das Vorgehen bei der Diagnostik von Folgestörungen und bei der Planung sowie Durchführung von Interventionen mit Betroffenen und ihren Bezugspersonen, beschrieben. Materialien für die Praxis und Fallbeispiele ergänzen den Leitfaden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Miriam Rassenhofer
Ulrike Hoffmann
Lina Hermeling
Oliver Berthold
Jörg M. Fegert
Ute Ziegenhain
Misshandlung und Vernachlässigung
Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie
Band 28
Misshandlung und Vernachlässigung
Jun.-Prof. Dr. Miriam Rassenhofer, Dr. Ulrike Hoffmann, M.Sc. Lina Hermeling, Oliver Berthold, Prof. Dr. Jörg M. Fegert, Prof. Dr. Ute Ziegenhain
Herausgeber der Reihe:
Prof. Dr. Manfred Döpfner, Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann, Prof. Dr. Franz Petermann
Begründer der Reihe:
Manfred Döpfner, Gerd Lehmkuhl, Franz Petermann
Jun.-Prof. Dr. Miriam Rassenhofer, geb. 1983. Seit 2018 W1-Professur für Lehre, Dissemination und Vernetzung im Kinderschutz an der Universität Ulm.
Dr. Ulrike Hoffmann, geb. 1974. Seit 2017 Leitung der Arbeitsgruppe „Wissenstransfer, Dissemination, E-Learning“ an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm.
M.Sc. Lina Hermeling, geb. 1990. Seit Juni 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm.
Oliver Berthold, geb. 1980. Seit 2016 Ärztlicher Leiter der Kinderschutzambulanz der DRK Kliniken Berlin | Westend. Seit 2017 zusätzlich tätig als Facharzt in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm.
Prof. Dr. med. Jörg M. Fegert, geb. 1956. Seit 2001 Ärztlicher Direktor der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm.
Prof. Dr. Ute Ziegenhain, geb. 1956. Seit 2006 Leiterin der Sektion Pädagogik, Jugendhilfe, Bindungsforschung und Entwicklungspsychopathologie am Universitätsklinikums Ulm.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar
Format: EPUB
1. Auflage 2020
© 2020 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2668-6; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2668-7)
ISBN 978-3-8017-2668-3
http://doi.org/10.1026/02668-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
|V|Einleitung
Misshandlung und Vernachlässigung sind Formen von Gewalt gegen Kinder. Sie verursachen erhebliches Leid bei den betroffenen Kindern und sind häufig mit beträchtlichen und nachhaltigen negativen Entwicklungskonsequenzen für sie verbunden. Dabei lässt sich ableiten, dass das Risiko von Entwicklungsstörungen und psychischen Störungen ebenso wie von gesundheitlichen Belastungen in empirischem Zusammenhang mit der Häufigkeit und der Dauer von Misshandlungen steht, die Menschen in ihrer Kindheit und Jugend erleben. Tatsächlich sind Misshandlungs- und Vernachlässigungserfahrungen in der Kindheit mit den höchsten Risiken verbunden, später psychische Störungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen zu entwickeln (vgl. Goldbeck, 2018).
Weithin üblich werden vier Formen von Misshandlung unterschieden: Körperliche Misshandlung, psychologische bzw. emotionale Misshandlung, Vernachlässigung und sexueller Missbrauch (U. S. Department of Health & Human Services, 2008). Mit Ausnahme der Misshandlungsform des sexuellen Missbrauchs, für den ein eigener Band in der Reihe „Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie“ verfasst wurde (Goldbeck, Allroggen, Münzer, Rassenhofer & Fegert, 2017), werden alle Formen in diesem Band behandelt. Sie beziehen sich auf die Definitionen und Operationalisierungen, die eine Expertengruppe der amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in einem umfangreichen Konsultationsprozess und unter Berücksichtigung des aktuellen wissenschaftlichen Diskurses erarbeitet hat (Leeb, Paulozzi, Melanson, Simon & Arias, 2008). Die Ergebnisse dieses Konsultationsprozesses markieren eine qualitative Weiterentwicklung auf dem Weg zu einer einheitlichen Definition der Formen von Misshandlung und Vernachlässigung bzw. einer „gemeinsamen Sprache“ als Grundlage zumindest für systematisches Risikoscreening und Diagnostik, und zwar in einem bei Fällen von Misshandlung und Vernachlässigung nahezu immer zwingend notwendigen interdisziplinären Kontext.
Als Herausforderung für die Praxis bleibt, dass die Grenzen zwischen Normalität, Belastung und Entwicklungsgefährdung beziehungsweise Misshandlung und Vernachlässigung fließend sind. Misshandlung und Vernachlässigung sind auf einem Kontinuum angesiedelt, das sich von einzelnen und vorübergehenden, leichteren Episoden bis hin zu chronischen und schwerwiegenden Gewalterfahrungen oder gravierender Vernachlässigung erstreckt, die oft tief in den Beziehungsalltag der betroffenen Kinder hineinreichen. Die Mehrzahl der Fälle von Kindesmisshandlung spielt sich im Graubereich zwischen noch ausreichender Fürsorge und nicht mehr ausreichender Fürsorge ab (Thyen, Meysen & Dörries, 2010). Wenige Fälle sind eindeutig. Sie treten am ehesten bei körperlicher Misshandlung auf, wenn sie differenzial- bzw. röntgendiagnostisch festgestellt und z. B. von unfallbedingten Stürzen abgegrenzt werden können. Typisches Beispiel ist etwa die Vorstellung eines Kleinkindes in der Notfallambulanz der Kinderklinik, meist in den frühen Morgenstunden wegen eines vorgeblichen Sturzes (Bett, Wickeltisch). Das Unterlassen einer Handlung, wie bei Vernachlässigung, ist deutlich schwieriger einzuschätzen als eine aktive Handlung, psychische Folgeschäden bei emotionaler Misshandlung sind oft nicht unmittelbar ersichtlich. Diese Formen von Gewalt sind aber die häufigsten (Witt, Brown, Plener, Brähler & Fegert, 2017).
|VI|Misshandlung und Vernachlässigung finden weitgehend im häuslichen Umfeld und durch die Eltern1 bzw. durch nahe Familienmitglieder statt. Dies betrifft insbesondere Kinder zwischen 0 und 14 Jahren (Pinheiro, 2006). Insofern lassen sie sich auch als interpersonelle oder beziehungsbezogene Gewalt beschreiben. Dabei wird nicht selten übersehen, dass beziehungsbezogene Gewalt gegen Kinder neben direkter körperlicher oder psychischer Gewaltausübung auch indirekte Gewalt umfasst, nämlich dann, wenn sie Zeuge von Partnerschaftsgewalt werden (Ziegenhain, Künster & Besier, 2016; UNICEF, 2014). Miterleben von Partnerschaftsgewalt wird zunehmend als eine Form emotionaler Misshandlung erkannt, mit vermutlich ebenso langfristigen psychischen Entwicklungsrisiken wie bei direkt erlebter körperlicher Gewalt (Kindler, 2002). Insgesamt erleben Kinder und Jugendliche mehr Gewalt als andere Gruppen in der Gesellschaft (Finkelhor, 2007).
Bei beziehungsbezogener Gewalt geht es immer auch um die Verletzung eines tiefgreifenden Vertrauensverhältnisses zwischen Kindern und ihren engen Beziehungspersonen bzw. um die Verletzung von Verantwortungsprinzipien bei den Eltern (Ziegenhain & Fegert, 2018). Letztlich lassen sich Misshandlung und Vernachlässigung als „destruktive Entgleisung“ einer Eltern-Kind-Beziehung beschreiben. Eine solche beziehungsbezogene Sichtweise knüpft insbesondere an die ethologische Bindungstheorie an. Danach sind Kinder fundamental auf emotionale Zuwendung und Fürsorge sowie auf Schutz und (emotionale) Sicherheit angewiesen. Diese Angewiesenheit ist biologisch disponiert und tief in der Evolution verankert. Vermutlich lässt sich daraus die starke Disposition von Säuglingen ableiten, sich an nahestehende Bezugspersonen zu binden, und zwar auch an diejenigen Bezugspersonen, die sie vernachlässigen oder misshandeln. Bindung lässt sich als psychobiologischer Mechanismus beschreiben, über den Emotionen und Stress in engen Beziehungen reguliert werden. Im Falle von Misshandlung und Vernachlässigung versagen Eltern in ihrer biologisch angelegten Aufgabe, ihr Kind regulativ zu unterstützen, ihm emotionale Sicherheit zu geben und es zu schützen. Vielmehr sind sie es, die ihr Kind schlimmstenfalls bedrohen. Die betroffenen Kinder befinden sich damit in einer emotional ausweglosen Beziehungssituation mit ihren Eltern: Sie leiden unter deren dysfunktionalem, gewalttätigem oder vernachlässigendem Verhalten und sind dennoch emotional an sie gebunden (Ziegenhain, 2014; Witt, Brown, Plener, Brähler & Fegert, 2017).
Misshandlung und Vernachlässigung sind immer auch verbunden mit der Frage nach einer Kindeswohlgefährdung. Kindeswohlgefährdung ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der den Rahmen für das Eingreifen des Staates in die Rechte der Eltern umreißt. Hierbei gilt es zwischen der jeweils sozialpädagogischen bzw. psychotherapeutischen Einschätzung, welche Förderung und Unterstützung ein Kind ggf. benötigt, und der bei einer Kindeswohlgefährdung notwendigen Bestimmung der sogenannten „Erheblichkeitsschwelle“ zu unterscheiden. Letztere Einschätzung hat Auswirkungen darauf, inwieweit in Fällen, in |VII|denen Eltern nicht bereit sind, Unterstützung anzunehmen, dennoch gegen deren Willen Hilfen gewährt werden können. Unter diesen ist die Inobhutnahme die invasivste Option im Kontext von intensiveren sogenannten Hilfen zur Erziehung und im Kinderschutz. Inobhutnahmen sind zeitlich begrenzte Kriseninterventionen zum Schutz von Kindern meist in der Folge von vorhergehender Misshandlung und/oder Vernachlässigung. Sie dienen, neben ihrer Schutzfunktion, auch der Klärung der familiären Situation und der Gefährdungslage für das Kind. Diese kann ggf. auch zu einer längerfristigen oder dauernden Unterbringung des Kindes in einer Pflegefamilie oder im Heim führen. In der Regel aber ist der Königsweg, Eltern zu einer Kooperation zu bewegen. Meist gelingt es selbst in schwierigen Situationen, wie im Kontext von Misshandlung und Vernachlässigung, im persönlichen Gespräch mit Eltern ihre Zustimmung für weitergehende Hilfen zu erwirken und ggf. mit ihnen einen Kontakt zum Jugendamt herzustellen.
Bei einer psychotherapeutischen Begleitung von misshandelten oder vernachlässigten Kindern und Jugendlichen ist interdisziplinäre Kooperation mit anderen professionellen Akteuren im Hilfesystem, insbesondere aber dem Jugendamt, zwingend. Angesichts der chronischen und vielfältigen psychosozialen und meist auch biografisch bedingten Risikokonstellationen, denen Familien mit Misshandlungs- und Vernachlässigungsrisiko ausgesetzt sind, geht es gewöhnlich auch um längere Unterstützung und therapeutische Begleitung. Insofern müssen interdisziplinäre Kooperationen auch über längere Zeiträume hinweg verlässlich gestaltet werden. Mit dem Auf- und Ausbau der Frühen Hilfen in den vergangenen Jahren sind lokale Netzwerkstrukturen entstanden, die auch jenseits des Frühbereichs für die interdisziplinäre Zusammenarbeit professioneller Akteure im Kinderschutz genutzt werden können. Das Bundeskinderschutzgesetz und die Bundesstiftung Frühe Hilfen sichern die nachhaltige Finanzierung dieser Strukturen. Hinzu kommt, dass mit dem Bundeskinderschutzgesetz nun auch für sogenannte Berufsgeheimnisträger im Gesundheitssystem ein Rechtsanspruch auf Beratung durch sogenannte insoweit erfahrene Fachkräfte besteht. Die nicht selten belastende und nicht immer zufriedenstellende Abklärung in jedem Einzelfall wird damit nicht zwangsläufig leichter, kann aber günstigenfalls im Rahmen interdisziplinärer Zusammenarbeit im Netzwerk fachlich besser abgesichert werden.
Mit der im Februar 2019 veröffentlichten S3-Leitlinie zum Kinderschutz sollen zudem interdisziplinäre Diagnostik bei Verdacht auf Misshandlung standardisiert sowie Handlungsempfehlungen zur Verfügung gestellt werden. Sie wurde von mehreren Fachgesellschaften aus Medizin und Kinder- und Jugendhilfe erstellt und von der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin koordiniert sowie vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) gefördert (www.kinderschutzleitlinie.de). Dies ist ein Fortschritt gegenüber längst veralteten vorhergehenden Leitlinien.
Der vorliegende Leitfaden Misshandlung und Vernachlässigung ist folgendermaßen aufgebaut:
1Stand der Forschung mit ausführlichen Definitionen und Abgrenzungen, Auftretenshäufigkeiten und einer Diskussion von Risiko- und Schutzfaktoren sowie einer Zusammenfassung der lebenslangen Auswirkungen von Misshandlung und Vernachlässigung auch transgenerational.
2|VIII|Leitlinien mit rechtlichen Rahmenbedingungen, eingeschlossen Empfehlungen für interdisziplinäre Kooperation und Vernetzung vor Ort, und zwar im präventiven Bereich als auch bei (potenzieller) Kindeswohlgefährdung (z. B. Rechtsanspruch auf Beratung, Gefährdungseinschätzung, Hinweise zur Dokumentation, etc.). Die Leitlinien enthalten zudem Empfehlungen für Diagnostik, Beratung, Gesprächsführung und Psychoedukation, Partizipation von Kindern und Eltern sowie Empfehlungen zum Umgang mit emotional belastenden Fällen (Selbstfürsorge).
3Verfahren zur Diagnostik und Therapie im Zusammenhang mit Misshandlung und Vernachlässigung für Prävention, Diagnostik und Therapie.
4Zusammenstellung von Materialien, welche die klinische Arbeit mit von Misshandlung und Vernachlässigung betroffenen Kindern und Jugendlichen unterstützen können.
5Fallbeispiele, welche die Umsetzung der Leitlinien illustrieren und dabei gleichermaßen klinisches Vorgehen gemäß einer „guten Praxis“ als auch Prinzipien der interdisziplinären Kooperation verdeutlichen.
Dieser Band wird durch einen kompakten Ratgeber für Eltern, Lehrer und Erzieher (Rassenhofer, Hoffmann, Hermeling, Berthold, Fegert & Ziegenhain, in Vorb.) ergänzt. Der Ratgeber informiert über Erscheinungsformen von Misshandlung und Vernachlässigung sowie über Präventions- und Hilfemöglichkeiten.
Ulm, Sommer 2019
Miriam Rassenhofer, Ulrike Hoffmann, Lina Hermeling,
Oliver Berthold, Jörg M. Fegert und Ute Ziegenhain
Anerkennend, dass es viele Konstellationen gibt, in denen nicht beide leiblichen Eltern das Sorgerecht für ein Kind innehaben, ist im Folgenden aus Gründen der Verständlichkeit immer von „die Eltern“ die Rede, wenn der oder die Inhaber der elterlichen Sorge gemeint sind. Ebenfalls wird in diesem Band aus Gründen der Lesbarkeit die männliche Form verwendet. Nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Stand der Forschung
1.1 Grundbegriffe und Definitionen
1.2 Prävalenz von Misshandlung und Vernachlässigung
1.3 Risiko- und Schutzfaktoren
1.3.1 Risikofaktoren
1.3.2 Schutzfaktoren
1.3.3 Gefahr einer erneuten Misshandlung/Vernachlässigung
1.4 Folgen von Misshandlung und Vernachlässigung
2 Rechtliche Rahmenbedingungen, Leitlinien und Handlungsempfehlungen
2.1 Rechtlicher Rahmen der Versorgung betroffener Kinder und Jugendlicher
2.1.1 Einleitung
2.1.2 Der zivilrechtliche Kinderschutz
2.1.3 Vorgehen in den Heilberufen bei einem Fall von Kindeswohlgefährdung
2.1.4 Die S3-Leitlinie Kindesmisshandlung, -missbrauch, -vernachlässigung unter Einbindung der Jugendhilfe und Pädagogik (Kinderschutzleitlinie)
2.1.5 Strafrechtliche Regelungen
2.1.6 Rolle der Heilberufe bei Gericht
2.2 Prävention durch Frühe Hilfen
2.3 Traumaanamnese
2.4 Klärung von Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung und Gefährdungseinschätzung
2.5 Vorgehen bei Kindeswohlgefährdung
2.6 Dokumentation der Hinweise auf Misshandlung und Vernachlässigung
2.7 Gesprächsführung
2.8 Beratung und Psychoedukation
2.9 Kooperation und Vernetzung im Kinderschutz
2.10 Beteiligung betroffener Kinder und Jugendlicher
2.11 Beteiligung der Eltern bzw. Bezugspersonen
2.12 Psychodiagnostik von Folgestörungen sowie Diagnostik von komorbid vorliegenden psychischen Störungen bei betroffenen Kindern
2.13 Körperliche Untersuchungen bei Misshandlung und Vernachlässigung
2.14 Psychotherapeutische Interventionen
2.15 Evaluation von Interventionen
2.16 Selbstfürsorge
3 Verfahren zur Diagnostik und Therapie bzw. der Linderung von Misshandlungsfolgen
3.1 Verfahren zur Diagnostik
3.1.1 Screening-Fragebögen zur Erhebung posttraumatischer Stresssymptomatik
3.1.2 Klinische Interviews zur Diagnostik von Belastungsstörungen
3.2 Verfahren zur Intervention
3.2.1 Traumafokussierte Therapieverfahren
3.2.2 Videobasierte Bindungsförderung
3.2.3 Multisystemische Therapie für misshandelte und vernachlässigte Kinder
3.2.4 Traumapädagogik
3.3 Exkurs: Morphologische Befundmuster bei körperlicher Misshandlung (Stefan Pollak und Sieglinde Ahne)
4 Materialien
5 Fallbeispiele
5.1 Leon
5.2 Mia
5.3 Jasmin
5.4 Tim
5.5 Fred
6 Literatur
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Glossar
|1|1 Stand der Forschung
1.1 Grundbegriffe und Definitionen
In der epidemiologischen Forschung zu Kindheitstraumata gibt es das Konzept der sogenannten Adverse Childhood Experiences (ACE) (deutsch: belastende Kindheitserfahrungen). Diese umfassen zehn Aspekte:
körperliche Misshandlung,
emotionale Misshandlung,
physische Vernachlässigung,
emotionale Vernachlässigung,
sexueller Missbrauch,
häusliche Gewalt,
Drogenmissbrauch in der Familie,
psychische Erkrankung in der Familie,
Trennung oder Scheidung der Eltern,
Gefängnisaufenthalt eines Familienmitgliedes.
Definiert wurden sie im Rahmen einer Langzeitstudie zu gesundheitlichen und sozialen Folgen solcher Ereignisse (Felitti et al., 1998, 2007). Hierbei sind die ersten fünf angeführten diejenigen, die im Kontext der Beschäftigung mit Kindesmisshandlung meist thematisiert werden.
Sowohl national als auch international gibt es keine einheitliche Definition von Kindesmisshandlung und ihren Erscheinungsformen, die von den verschiedenen mit Kinderschutz befassten Disziplinen in Forschung und Praxis gleichermaßen anerkannt und akzeptiert ist (vgl. z. B. Herrenkohl, 2005).
Dieses Fehlen gemeinsamer Definitionen ist, wie eine Expertise für den Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (Jud et al., 2016) zeigte, eine zentrale Problematik bei der Erforschung und Verbesserung von Hilfeverläufen im vernetzten Kinderschutz.
Ein Problem bei der Formulierung einheitlicher Definitionen besteht darin, dass es Uneinigkeit in Bezug auf die Frage gibt, inwiefern Häufigkeit und Regelmäßigkeit von Handlungen bei der Bestimmung der Schwelle zur Misshandlung berücksichtigt werden müssen (vgl. English et al., 2005). Ist beispielweise eine einmalige Ohrfeige bereits als Kindesmisshandlung zu werten, oder muss eine gewisse Regelmäßigkeit oder Wiederholung solcher Handlungen gegeben sein, um von Kindesmisshandlung zu sprechen?
Einen großen Schritt hin zur Bewältigung der angesprochenen Schwierigkeiten einer Misshandlungsdefinition stellen die in einem umfangreichen Konsultationsprozess entstandenen Empfehlungen der amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention dar (vgl. Leeb et al., 2008). |2|Hier wurde erstmals ein Konsens bezüglich operationalisierbarer Definitionen erreicht, der von verschiedenen Fachdisziplinen für statistische Erhebungen verwendet wird.
Definitionen der unterschiedlichen Formen von Kindesmisshandlung nach Leeb et al. (2008, S. 11–16; Übersetzung durch Ziegenhain et al., 2016)
Kindesmisshandlung: Einzelne oder mehrere Handlungen oder Unterlassungen durch Eltern oder andere Bezugspersonen, die zu einer physischen oder psychischen Schädigung des Kindes führen, das Potenzial einer Schädigung besitzen oder die Androhung einer Schädigung enthalten.
Körperliche Misshandlung: Die gezielte Anwendung von körperlicher Gewalt gegen das Kind, welche zu körperlichen Verletzungen führt oder das Potenzial dazu hat.
Sexueller Missbrauch: Jede durchgeführte oder versuchte sexuelle Handlung mit oder ohne direktem sexuellen Kontakt an/mit einem Kind.
Emotionale Misshandlung: Jedes absichtsvolle Elternverhalten, welches dem Kind vermittelt, wertlos, fehlerbehaftet, ungeliebt, ungewollt oder unnütz zu sein und damit dem Kind potenziell psychologischen oder emotionalen Schaden zufügt.
Vernachlässigung: Die mangelnde Erfüllung der grundlegenden körperlichen, emotionalen, medizinischen oder bildungsbezogenen Bedürfnisse des Kindes durch die Bezugsperson und/oder die mangelnde Gewährleistung der kindlichen Sicherheit durch unzureichende Beaufsichtigung oder die fehlende Herausnahme aus einer gewalttätigen Umgebung.
Für die Definition der Misshandlung werden als Verursacher der Misshandlung Eltern und Bezugspersonen genannt. Diese Zuordnung wurde getroffen, da bei Gewalt durch Fremde oder Gleichaltrige andere Risikofaktoren und Folgen vorliegen und andere Konsequenzen gezogen werden müssen.
Die genannten Definitionen berücksichtigen sowohl Handlungen (Misshandlung, sexueller Missbrauch) als auch Unterlassungen (Vernachlässigung; für eine Übersicht vgl. Abbildung 1).
Neben gemeinsamen Definitionen der Misshandlungsformen im deutschsprachigen Raum fehlen auch Standards dazu, wo die Schwelle zur Misshandlung liegt und was noch als akzeptable elterliche Erziehungspraxis angesehen werden kann, zumal sich diese Schwelle in Abhängigkeit von historischen und kulturellen Rahmenbedingungen auch ändert (vgl. Jud, 2011). So wurde in Deutschland im Jahr 2000 mit § 1631 Abs. 2 BGB das Recht auf gewaltfreie Erziehung gesetzlich verankert. Dort heißt es: „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ Die Einstellung zur Anwendung von Körperstrafen hat sich seither deutlich gewandelt. Ergebnisse einer Untersuchung (Plener, Rodens & Fegert, 2016) zeigen, dass sowohl die Häufigkeit erfahrener körperlicher und nicht körperlicher Strafen als auch die Akzeptanz von Körperstrafen im |3|Zeitverlauf deutlich abgenommen hat. Es darf jedoch bei den insgesamt positiven Ergebnissen nicht übersehen werden, dass immer noch über 40 % der Befragten einen „Klaps auf den Po“ und 17 % eine „leichte Ohrfeige“ für ein akzeptables Mittel zur Erziehung hielten.
Abbildung 1: Formen der Kindesmisshandlung nach Leeb et al. (2008)
Vom Begriff der Kindesmisshandlung inhaltlich abzugrenzen, sind die Begriffe Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung.
Merke
Als Kindeswohl wird ein Rechtsgut aus dem deutschen Familienrecht bezeichnet. Kindeswohl umfasst das Wohlergehen eines Kindes und seine gesunde Entwicklung.
Eine Kindeswohlgefährdung wird von der Rechtsprechung definiert als: „Eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussagen lässt“ (BVerfG FamRZ 2015, 112; vgl. auch Kapitel 2.1).
Während die Kindeswohlgefährdung also eine auf die Zukunft gerichtete Prognosefrage meint, sind vom Begriff der Kindesmisshandlung konkrete Handlungen oder Unterlassungen (Vernachlässigung) umfasst (siehe dazu ausführlich das Kapitel 2.1.2 und das Kapitel 2.1.4).
Zu bedenken ist außerdem, dass die verschiedenen, mit dem Thema Kinderschutz befassten Systeme verschiedene Bezugsgrößen verwenden. Während die Kindeswohlgefährdung eine rechtliche Definition ist, ist die psychische Bezugsgröße die Belastung – es kann sein, dass die Erheblichkeitsschwelle, um eine Handlung als Kindeswohlgefährdung zu definieren nicht überschritten wurde, aber trotzdem eine Belastung des Kindes/Jugendlichen durch die Handlung vorliegt.
|4|1.2 Prävalenz von Misshandlung und Vernachlässigung
Kinder und Jugendliche sind in Deutschland relativ häufig von Gewalt betroffen. In der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) wurden im Jahr 2017 4.606 Fälle zum § 225 StGB (Misshandlung von Schutzbefohlenen) erfasst, die Fälle betrafen mit 52,7 % etwas mehr Jungen als Mädchen (47,3 %)2. Die angegebene Zahl hat jedoch mit der realen Häufigkeit von Fällen von Kindesmisshandlung in Deutschland wenig zu tun, denn sie bildet nur das Hellfeld ab – es gibt in Deutschland keine Anzeigepflicht für Misshandlung und sexuellen Missbrauch.
Real sind Fälle von Kindesmisshandlung also wesentlich häufiger. Einen Anhaltspunkt gibt die Anzahl der Verfahren zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung (vgl. Abbildung 2). Diese ist in den letzten Jahren jedes Jahr angestiegen (2012 ca. 106.000 Verfahren; 2013 ca. 115.000 Verfahren, 2014 124.000 Verfahren; 2015 ca. 129.000 Verfahren, 2016 136.000 Verfahren, 2017 ca. 143.000 Verfahren). Die Einschätzungsergebnisse sind jedoch im zeitlichen Verlauf relativ konstant geblieben.
Abbildung 2: Ergebnisse der Einschätzung in Verfahren von Kindeswohlgefährdung in den Jahren 2012 bis 2017 (Statistisches Bundesamt)
Dies traf ebenso auf die festgestellten Formen der Misshandlung zu. Vernachlässigung war mit weitem Abstand die am häufigsten festgestellte Misshandlungsform, sexueller Missbrauch die seltenste (vgl. Abbildung 3).
Abbildung 3: Anteile der Misshandlungsformen bei den Einschätzungsfällen von Kindeswohlgefährdung in den Jahren 2012 bis 2017 (Statistisches Bundesamt, Mehrfachangabe möglich)
Betrachtet man die festgestellten Misshandlungsformen in Bezug auf die Geschlechterverteilung, so zeigt sich, dass bei Jungen Vernachlässigung etwas häufiger vorkam als bei Mädchen (61,5 versus 57,7 %). Bei sexuellem Missbrauch war das Geschlechterverhältnis umgekehrt und deutlich ausgeprägt (Mädchen 7,9 %; Jungen 3,4 %). Bei körperlicher und emotionaler Misshandlung sowie in Bezug auf die Anzahl der Verfahren insgesamt war die Geschlechterverteilung etwa 50 : 50. (Alle Ergebnisse in Bezug auf Verfahren zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Jahr 2017, bei denen akute Kindeswohlgefährdung festgestellt wurde.)
Bei der Einordnung der Ergebnisse epidemiologischer Studien zu Kindesmisshandlung müssen zwei Aspekte bedacht werden. Zum Ersten berücksichtigen die Studien zur Epidemiologie die verschiedenen Misshandlungsformen in unterschiedlichem Maße. Zu körperlicher und sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen gibt es international viele Studien (vgl. z. B. Jud et al., 2016; Stoltenborgh et al., 2013a, 2013b; Stoltenborgh et al., 2011). Die Misshandlungsformen emotionale Misshandlung und Vernachlässigung sind deutlich weniger untersucht. Dies hat seine Ursache unter anderem in der besonderen Schwierigkeit der Definition (vgl. z. B. Stoltenborgh et al., 2012; Stoltenborgh et al., 2013a, 2013b). Auch Studien zur Versorgung von Kindern nach Misshandlung und Vernachlässigung gibt es noch nicht in |6|ausreichender Zahl. Die besondere Schwierigkeit liegt darin, dass in Fällen von Kindeswohlgefährdung viele Akteure involviert sind und sich deshalb die Erhebungssituation komplex darstellt. Außerdem bestehen in den unterschiedlichen Systemen keine einheitlichen Erhebungs- und Dokumentationsschemata, was den Vergleich von Daten erschwert.
Zum Zweiten ist zu bedenken, dass viele der bisherigen Studien retrospektive Befragungen von Erwachsenen zu Ereignissen in ihrer Kindheit und Jugend sind (vgl. z. B. Stoltenborgh et al., 2015; Stoltenborgh et al., 2011). Zwar können auch aus diesen Prävalenzen geschätzt werden, sofern die Studien bevölkerungsrepräsentativ sind, jedoch kann die Validität der Daten reduziert sein, da die Angaben in Befragungen zu zurückliegenden belastenden Ereignissen durch Erinnerungsfehler, Vermeidungsverhalten und Verdrängungsprozesse sowie Scham und Angst beeinflusst sind (vgl. z. B. Hardt & Rutter, 2004). Zudem bilden die Ergebnisse der Studien vergangene Situationen ab. Viele Experten fordern deshalb die direkte Befragung von Kindern und Jugendlichen (vgl. z. B. Jud et al., 2016).
Abbildung 4: Häufigkeit der Formen von Kindesmisshandlung nach Witt et al. (2017)