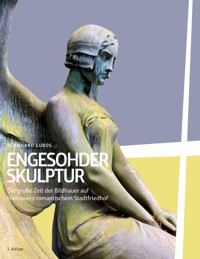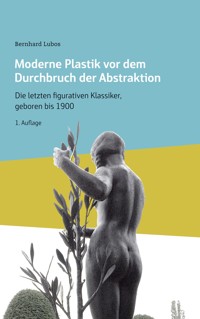
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Buch über Bildhauer. Leben, Werk, Freundschaften, politisches Umfeld, Institutionen und Stile der letzten figurativen Klassiker, geboren bis 1900. Sie widmeten ihr Leben speziell der menschlichen Figur. Mit dieser gemeinsamen Prämisse prägten sie die Plastik vom Klassizismus hin zur Moderne. Das Kompendium dokumentiert ihre Meisterwerke, benennt heutige Standorte im öffentlichen Raum, liefert Anekdoten und geschichtliche Hintergründe während einer Zeit der Umbrüche sowie Zeittafeln. Die erhellende, kurzweilige Lektüre ist als Reisebegleiter und heimisches Nachschlagewerk ein Gewinn für den Kunstfreund. Jules Dalou · Giulio Monteverde · Auguste Rodin · Jean Gautherin · Louis-Ernest Barrias · Ernst Herter · August Kraus · Stephan Sinding · Albert Bartholomé · Edmund Hellmer · Max Klinger · Paul Aichele · Ernst Moritz Geyger · Ernst Seger · Peter Christian Breuer · Walter Schott · Aristide Maillol · Arno Breker · Richard Daniel Fabricius · Selmar Werner · Franz Stuck · George Grey Barnard · Camille Claudel · Victor Rousseau · Otto Stichling · Arthur Lewin-Funcke · Constantin Starck · Roland Engelhard · Karl Gundelach · Hans Dammann · Käthe Kollwitz · Martin Schauß · Max Levi · Emil Fuchs · Jacques Loysel · Luigi Secchi · Emil Kiemlen · Gustav Vigeland · Henryk Glicenstein · Fritz Klimsch · Ernst Barlach · Franz Metzner · Felix Pfeifer · Georg Wrba · Georg Herting · Lilli Finzelberg · Jenny von Bary-Doussin · Josef Limburg · Bernhard Hoetger · Georg Kolbe · Richard Scheibe · Fritz Röll · Hermann Hahn · Bernhard Bleeker · Marnix d´Haveloose · Wilhelm Lehmbruck · Milly Steger · Rudolf Belling · Joseph Enseling · Edwin Scharff · Alexander Archipenko · Emil Jensen · Gerhard Marcks · René Iché
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mögen Sie abstrakte Kunst oder erfreuen Sie sich eher an einer naturalistischen Figur, zufällig in einem Park entdeckt? Vielleicht ja beides. Wenn wir unsere Städte nach Kunst im öffentlichen Raum durchkämmen, bemerken wir bald, dass abstrakte Figuren und non-figurative Skulpturen in den letzten Jahrzehnten hier und da neu aufgestellt wurden, während Figürliches, einem Naturalismus entspringend, meist schon etwa hundert Jahre alt ist. Warum ist das so?
War es eine Modeerscheinung, dass die naturalistische Plastik im Kunstbetrieb plötzlich nicht mehr gefragt war oder gibt es dafür andere Gründe? Wann endete die figurative Skulptur im Sinne einer allegorischen Darstellung des Menschen in bildhauerischer Perfektion? Welche Künstler gab es, die noch diesem Weg folgten, als die ersten Abstrakten schon auf den Plan traten?
Lassen Sie uns den Versuch starten, in chronologischer Reihenfolge ihrer Geburt bis zum Jahre 1900 die Bildhauer zu beleuchten, die ihr Werk in erster Linie der menschlichen Figur widmeten. Zusammenhänge stilistischer, freundschaftlicher und gesellschaftspolitischer Art werden sich uns erschließen. Und dabei können wir auch eher unbekanntere alte Meister für uns neu entdecken.
Bem.: Sollte Ihnen bei der Lektüre der Name eines Bildhauers fehlen, den Sie vielleicht sehr schätzen, der ebenfalls in diesen Epochen gelebt und hauptsächlich figürlich gearbeitet hat, so sehen Sie es mir nach, denn die vorliegende Auflistung soll und kann nicht komplett sein, vielmehr ist sie Ergebnis und persönliche Auswahl meiner Recherche bis zur Druckniederlegung der vorliegenden Auflage.
Autor
Bernhard Lubos ist selbst als Bildhauer tätig. Ursprünglich zur Inspiration für das eigene Schaffen erkundete und fotografierte er Skulpturen im öffentlichen Raum. Er sammelte weitere Bildquellen herausragender Werke figurativer Bildhauer und ergänzte sein kunstgeschichtliches Verständnis aus dem Studium von Architektur und Produktdesign um das Leben und Wirken speziell der Bildhauer der beschriebenen Epochen. Als Grafikdesigner und Zeitschriftenlayouter erfahren durch jahrzehntelange Verlagstätigkeit, formte er zwischen 2020 und 2022 aus dieser Sammlung von Werken und Texten ein kunstgeschichtliches Kompendium, welches nun in der 1. Auflage vorliegt.
Inhalt
I. VORGESCHICHTE
1.1 Nacktheit und Glaube
1.2 Studienreisen nach Rom: Auf zu den Vorbildern!
Antonio Canova, Johann Heinrich Dannecker,
Bertel Thorvaldsen, Ludwig Michael Schwanthaler,
Wilhelm Engelhard, James Pradier,
François Jouffroy (jeweils kurz beschrieben)
1.3 Die große Zeit der Denkmäler
Reinhold Begas, Frédéric-Auguste Bartholdi (kurz)
1.4 Werke von realistischer Wahrheit
Jules Dalou, Giulio Monteverde
II. EUROPA IM STILPLURALISMUS
2.1 Der Erneuerer
Auguste Rodin
2.2 Weitere Vorreiter aus Frankreich
Jean Gautherin, Louis-Ernest Barrias
2.3 Der Neobarock in der Berliner Bildhauerschule
Ernst Herter, August Kraus, Stephan Sinding
2.4 Initialwerk des Jugendstils
Albert Bartholomé, Edmund von Hellmer
2.5 Sezessionen versus Kunstbetrieb
Max
Klinger
2.6 Deutscher Impressionismus in der Plastik, mehr Epoche als Stil
2.7 Art déco ist nicht gleich Art nouveau
Paul
Aichele, Ernst Moritz Geyger, Ernst Seger,
Peter Christian Breuer, Walter Schott
2.8 Wegbereiter der Moderne
Aristide Maillol
2.9 Chronologischer Einschub: des Tyrannen Bildhauer
Arno Broker
III. GROSSE GEFÜHLE
3.1 Virtuosen der Emotionen
Richard Daniel Fabricius, Selmar Werner,
Franz Stuck, George Grey Barnard,
Camille Claudel, Victor Rousseau
3.2 Gesamtkunstwerke im Jugendstil
Otto
Stichling
3.3 Stilistischer Vergleich im Garten
Arthur Lewin-Funcke, Constantin Starck
3.4 Das Grabmal als Spezialisierung
Roland
Engelhard, Karl Gundelach,
Hans Dammann, Käthe Kollwitz
3.5 Académie Julian, Académie Colarossi, Villa Strohl-Fern, Villa Massimo und Villa Romana
Martin
Schauß, Max Levi, Emil Fuchs
3.6 Symbolismus und die inneren Gefühlswelten
Jacques Loysel, Luigi Secchi
3.7
Lokale Größen, Teil
Emil
Kiemlen
3.8 Ganz - schön - viel
Gustav Vigeland
IV. BEHERRSCHUNG VON SUJETS
4.1 Lebendige Porträts
Henryk Glicenstein
4.2 Ein Leben für die weibliche Skulptur
Fritz
Klimsch
4.3 Die Negierung des Körpers
Ernst Barlach
4.4 Das Muskelornament - Mythische Bauplastik
Franz Metzner, Felix Pfeifer
4.5 Skulpturenkombinationen: das Nebeneinander von Mensch und Tier
Georg Wrba
4.6 Lokale Größen, Teil 2
Georg Herting
4.7 Die dritte und vierte Bildhauerin
Lilli Finzelberg, Jenny von Bary-Doussin
4.8 Religiöse Connection
Josef Limburg
V. DEM ZEITGEIST FOLGEND
5.1 Avandgarde, Stilwechsel und Multi-Kulti
Bernhard Hoetger
5.2 Einmal Expressionismus und zurück
Georg Kolbe
5.3 Bildhauerfreunde
Richard Scheibe
5.4
„Eine Skulptur ist allseitig"
Fritz Röll
5.5
Das hübsche Gesicht von Käthe
Hermann Hahn, Bernhard Bleeker
5.6 Die
pure Freude an Körper und Bewegung
Marnix d’Haveloose
VI. SUCHE NACH NEUEN FORMEN
6.1 Expressiv, futuristisch und konstruktivistisch
Wilhelm
Lehmbruck, Milly Steger
6.2 Vorausschau ins Nonfigurative
Rudolf Belling
6.3 Und immer wieder Maillols Erbe
Joseph Enseling, Edwin Scharff
6.4 Abstrakt von Anfang an
Alexander Archipenko
6.5 Kleiner Mensch, großes Werk
Emil Rasmus Jensen
6.6 Erhalten der menschlichen Figur
Gerhard Marcks
6.7 „Ich bin der letzte unter den Klassikern“
René
Iché
VII. NACHBETRACHTUNG
7.1 Der naturalistische Weg in die Moderne
7.2 Der Sport und das neue Körperbewusstsein
7.3 Die Abkehr vom Naturalismus
7.4 Rehabilitierung und Dominanz der Abstraktion
7.5 Das Herausarbeiten von Natur und Geist
7.6 Die figurative Plastik hat viele Namen
RUBRIKEN UND SERVICE
Autor
Bildnachweise
Quellen
Zeittafeln
Bildhauerverzeichnis
I. Vorgeschichte
1.1 Nacktheit und Glaube
Von Praxiteles, geboren 395 v. Chr. in Athen, der als Spätklassiker von der erhabenen Strenge des Phidias abwich und sich erstmals in Griechenland auch dem weiblichen Aktbild intensiv widmete, über Michelangelo Buonarroti, geboren 1475 in Caprese, Toskana, dem Ausnahmebildhauer der italienischen Hochrenaissance, bis zu Auguste Rodin, geboren 1840 in Paris, der gleichzeitig für einen künstlerischen Höhepunkt des Naturalismus in der Neuzeit steht, wie für den Beginn von impressionistischer, symbolistischer und expressionistischer Arbeitsweise, waren zwei und ein Viertel Jahrtausende vergangen, in denen es den Bildhauern der figurativen Skulptur grundsätzlich darum gehen musste, vor jedweder beabsichtigten künstlerischen und sozialpolitischen Aussage erstmal den menschlichen Körper anatomisch zu begreifen und fehlerlos in der beabsichtigten Bewegung darzustellen.
Je nach ihrer Befähigung dies zu leisten, wurden die Künstler damals wie heute verehrt. Oder anders gesprochen, ein 5,17 Meter hoher David aus Marmor würde heute niemanden interessieren, wenn er im Offiziersmantel dastünde, wie ein Denkmal von Lenin oder Mao Zedong. Michelangelo stellt David in seiner Nacktheit selbstbewusst stehend dar, mit perfektem jugendlichen Körper, den entschlossenen Blick vor dem Kampf gegen Goliath leicht nach oben gerichtet.
Wie auch Rodin bei seiner ersten lebensgroßen Figur in Bronze „Das eherne Zeitalter“ (Abb. 6) den Betrachter fesselt mit dem Ausdruck des gesamten Körpers.
Das Wissen um den Aufbau des menschlichen Körpers und die hohe Meisterschaft der talentiertesten Bildhauer blieb jedoch im Verborgenen, sobald das Umfeld deren Entfaltung nicht zuließ.
Nach der Blütezeit der figürlichen Kunst der Antike im Mittelmeerraum, von Griechen und Römern vorangetrieben, folgten neue Mächte, wie christliche Würdenträger, die ein positives Verhältnis zur Nacktheit radikal bekämpften oder arabische Herrscher, die wenig mit dieser Kunst anzufangen wussten, schon aufgrund des islamischen Verbots lebende Wesen bildhaft darzustellen.
Dann gingen die Lichter ganz aus, im „finsteren“ Mittelalter, als Naturkatastrophen das Klima veränderten, Hunger und Seuchen herrschten. Man suchte nach einer Ursache für die schlechten Bedingungen. Die alles beherrschenden Kleriker in Europa fanden sie im sündhaften Leben der Menschen. Abbuße musste geleistet werden, in Form von Geld oder Diensten. Frömmigkeit wurde Maßgabe für das allgemeine Leben, für Krankheiten und Kriege wurden sogenannte Hexen und die Juden verantwortlich gemacht.
Menschliche Darstellungen ohne Kleidung galten als lüstern, verwerflich und vor allem gottlos, ketzerisch und wurden aus dem Leben der Menschen verbannt.
Wunderbar anschaulich wie Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski (1865-1941) in seiner Romanbiografie „Leonardo da Vinci“1 davon erzählt, wie in der Toskana zur Zeit der Frührenaissance beim Umpflügen von Feldern oder bei Baumaßnahmen antike Statuen entdeckt und ausgegraben wurden. Sofort wurden sie wieder versteckt, in Heuschuppen oder Kellern, da man Angst hatte vor der Inquisition und es äußerst gefährlich war so brisante, weil in den Augen der damaligen Zeit allzu erotische, Artefakte zu beherbergen. Doch bald änderten sich die Bedingungen, denn die Herrscherfamilien in Italien, die den Papststuhl unter sich ausmachten, fanden sich durch nackte Figuren nicht mehr belästigt, ganz im Gegenteil. Es kam nun in der einsetzenden Renaissance im 15. Jahrhundert zu zahlreichen und berühmten Bildhaueraufträgen und Malereien mit unverhüllten Figuren. Für die Künstler, die dem Humanismus und der anatomischen Forschung nahe standen, war das ein glücklicher Umstand.
Nördlich der Alpen musste man noch mehrere Jahrzehnte auf den Durchbruch der Renaissance warten, mit ihrem Bemühen um eine Wiederbelebung der kulturellen Leistungen der griechischen und römischen Antike, mit ihren Erfindungen und Entdeckungen in Kunst, Humanismus, Wissenschaft.
Letztenendes ging es um diese Inhalte, die die Künstler versuchten zu transportieren. Es ging um die ursprüngliche Schönheit des Menschen, vor allem in seiner Jugend, dargestellt als Allegorie für alle möglichen Lebenssituationen.
Waren es in der mittelalterlichen Bildhauerei noch ausschließlich Darstellungen von biblischen Geschichten oder von Kirchenstiftern, lieferte nun die griechische Mythologie die Themen, die auch bei den Literaten ein bevorzugtes Genre war, um menschliches Glück sowie Tragödie befreit von religiösen Zwängen zu beschreiben.
1.2 Studienreisen nach Rom: Auf zu den Vorbildern!
Aufgewühlt von den Werken ihrer Vorbilder der italienischen Renaissance wie Botticelli, Masaccio, Leonardo da Vinci, Michelangelo oder Donatello, reisten die europäischen Künstler fortan nach Italien und stießen gleichsam auf die Werke der Maler und Bildhauer des alten Roms.
Diese Studienreisen gab es zu allen folgenden Epochen, Manierismus, Barock, Rokoko, Klassizismus. Natürlich galt es während der langen Reise und des Studiums vor Ort fürKost und Logie eine Einnahmequelle aufzutun, entweder durch Arbeit, im besten Falle als künstlerischer Mitarbeiter eines Studios, oder aber: die jungen Künstler hatten einen wohlhabenden Gönner. Eine weitere Option ergab sich aus einem Stipendium der Kunstorganisationen des jeweiligen Heimatlandes. Diese „Rompreise" wollen wir uns mal näher anschauen.
1. ANTONIO CANOVA (1757-1822)
„Amor küsst Psyche“ Louvre 1793
Foto: Jörg Bittner Unna
Da uns hier die Bildhauer und die Zeit der „letzten Klassiker“ interessieren, machen wir einen Sprung ins beginnende 19. Jahrhundert, in den Klassizismus. Die Epoche löst 1770 Barock und Rokoko ab und endet um 1840 in der Romantik und im Historismus. Frankreich hat eine politische Vormachtstellung in Europa. Der Klassizismus in Frankreich beinhaltet auch die Stilrichtungen Louis-seize, benannt nach dem König, und Empire, benannt nach der Zeit von Napoleon Bonaparte, der sein Kaiserreich errichtet.
Rom ist gerade mehr oder weniger ein Satellitenstaat von Frankreich. In diese Zeit fallen auch die Ausrufung der Römischen Republik 1798, welche die Französische Revolution zum Vorbild hat, die aber nicht lange hält, die Besetzung Roms durch französische Truppen Napoleons 1808 und schließlich 1809 die Vereinigung des säkularisierten Kirchenstaates mit dem napoleonischen Königreich Italien.
Erst sechs Jahre später sollte der Kirchenstaat wieder entstehen, beschlossen auf dem Wiener Kongress, nachdem Napoleon besiegt war.
So waren es auch die Franzosen, die damit begannen, einen „Rompreis“ für talentierte Bildhauer auszuloben und eine Institution vor Ort zu installieren. Ab 1803 entschied die neugegründete Académie des beaux arts in Paris darüber, welches Talent sich durch ein Stipendium in der Villa Medici in Rom weiterbilden konnte.
Die jungen Hochbegabten trafen in Rom beispielsweise auf Antonio Canova, ein damals gefeierter Superstar der Plastik und Vorbild der italienischen Bildhauerei im Klassizismus. Er arbeitete auch für Napoleon und seine Werke in Marmor wurden so nachgefragt, dass seine Werkstatt als eine der ersten gilt, die sich systematisch mit der Herstellung von Kopien beschäftigte, auch mittels einer neu erfundenen, beziehungsweise verfeinerten Art des Punktiergeräts. Was bedeutete, dass der Geselle, indem er die dreidimensionalen Ausmaße Punkt für Punkt mit einer an einem Gestänge verschiebbaren Punktiernadel übertrug, einen Marmorblock nach einem Original schon grob vorarbeiten konnte, bevor sich der Meister schließlich um die finale Oberfläche kümmerte. Canovas kompositorische Eleganz und naturalistische Meisterschaft ist bei „Amor küsst Psyche“ von 1793 im Louvre (Abb. 1) oder beim Grabdenkmal für Erzherzogin Marie Christine von 1805 in der Augustinerkirche in Wien zu bestaunen.
An Canova kam man also nicht vorbei als Forschungsreisender in Sachen Skulptur. Für die heimischen Akademien und Meisterschüler waren die Bildhauer, die Ende des 18. Jahrhunderts von nördlich der Alpen in Italien ankamen, eine Bereicherung. Sie studierten die Antike und die Renaissance, um ihrerseits idealisierte Darstellungen der mythologischen Protagonisten und Wesen aus der Götterwelt des alten Griechenlands und Roms in eigenen Entwürfen zu schaffen. Manche der mittel- und nordeuropäischen Künstler kehrten mehrmals in die ewige Stadt zurück, manche blieben auch für immer dort.
Jahrgang 1758 und damit nur ein Jahr jünger als Antonio Canova war der in Stuttgart geborene Johann Heinrich Dannecker. Er bereiste erst Paris durch ein herzögliches Stipendium und vollzog im Anschluß vier Studienjahre in Rom, wo er sich mit Canova anfreundete. Nach seiner Rückkehr wurde er ein erfolgreicher Bildhauer Württembergs. Von seiner „Ariadne auf dem Panther“ steht eine restaurierte Marmorversion im Liebieghaus in Frankfurt am Main.
Der 1770 in Kopenhagen geborene Bertel Thorvaldsen wurde von Dänemark aus mit einem Stipendium prämiert und führte in Rom, wohlgemerkt als bekennender Protestant, das Grabmal in Marmor von Papst Pius VII. im Petersdom aus. Eine Vielzahl seiner äußerst naturalistischen, harmonischen und idealisierten Männer- und Frauenakte, versehen mit den Attributen der jeweiligen Akteure der griechischen Sagenwelt, birgt das Thorvaldsens Museum in Kopenhagen. Der Däne war eine Institution in seinem Metier und verkehrte in Zirkeln der Deutschrömer, wie der Kreis der in Rom lebenden deutschen bildenden Künstler und Literaten insbesondere des späten 18. und des 19. Jahrhunderts bezeichnet wird.
Auch der Münchener Ludwig Michael Schwanthaler, Hauptmeister der klassizistischen Plastik in Süddeutschland, verbrachte durch König Ludwig I. gefördert mehrere Jahre in Rom. Für die Ausgestaltung der Befreiungshalle Kelheim, ein Denkmal zum Gedenken der Siege über Napoleon, schuf er später nicht weniger als 34 Siegesgöttinnen in Gestalt von überlebensgroßen Marmorengeln, sie stehen im Kreis, halten sich die Hände, allesamt unterschiedlich in Gesten und Gewänder. Die Bavaria, die über dem Oktoberfestgelände in München thront, stammt von ihm oder auch das Mozartdenkmal in Salzburg.
Der durch Denkmäler in Hannover bekannte Maler und Bildhauer Wilhelm Engelhard war Schüler von beiden, von Thorvaldsen in Kopenhagen sowie Schwanthaler in München, und lebte anschließend drei Jahre in Rom. Am herausragendsten in seinem Werk ist vielleicht die Friesreihe „Nordisches Heldenleben“ nach der Edda, in der er mit atemraubender Präzision und Naturtreue die Körper der Protagonisten meist im Flachrelief, teils im Halbrelief, herausarbeitet. Seine Erfahrungen gab er in Hannover unter anderem an seinen Sohn Roland Engelhard und an Karl Gundelach weiter, die wiederum beeindruckende Werke, insbesondere in der Grabmalkunst, hinterließen und die wir später noch näher kennenlernen.
2. FRANÇOIS JOUFFROY (1806-1882)
„Junges Mädchen, welches Venus ihr erstes Geheimnis anvertraut“ Luxembourg 1839
Foto: Marie-Lan Nguyen
Für diese Zeit typisch ist auch die Karriere des Genfer Bildhauers James Pradier, der sich von 1812 bis 1819 in Rom aufhielt, hauptsächlich Antiken kopierte und 1827 zum Dozenten an der École des beaux arts berufen wurde. Zu den bekanntesten Figurengruppen im Louvre gehört Pradiers „Die drei Grazien" in Marmor von 1831. Er orientierte sich generell stark am griechischen Vorbild und gestaltete eine Vielzahl von antik angelegten Figuren. Sein Porträt des Schriftstellers und Philosophen Jean-Jacques Rousseau, auf einem Stuhl mit gedrechselten Beinen über einem Stapel Bücher sitzend, welches er 1830 entwarf und das 1835 in Genf auf einer kleinen Insel an der Rhône in der Nähe der heutigen Mont-Blanc-Brücke aufgestellt wurde, ist ein Beispiel für die äußerst realistische Ausführung damaliger Denkmäler.
Etwas später erhielt François Jouffroy, berühmt durch sein Junges Mädchen, welches Venus ihr erstes Geheimnis anvertraut“ von 1839 (Abb. 2), den französischen Rompreis. Er wurde 1864 Professeur an der École des beaux arts in Paris.
In diesem Werk setzt er mit einer gehörigen Portion Humor der klassischen Darstellung etwas Subtiles, sehr Menschliches entgegen. Daran gibt sich schon ein Anflug der Romantik zu erkennen, die nördlich der Alpen die menschlichen Empfindungen in den Mittelpunkt rückt.
3. REINHOLD BEGAS (1831-1911)
„Pan tröstet Psyche“ Alte Nationalgalerie Berlin 1858
Foto: Tilman Harte
1.3 Die große Zeit der Denkmäler
Knapp 20 Jahre später schuf der Berliner Reinhold Begas aus Marmor „Pan tröstet Psyche“ (Abb. 3), ein ähnlich gestenreiches Werk voller Situationsgenauigkeit. In diesem reichen Stil, dem sogenannten Neobarock, prägt er eine ganze Generation innerhalb der Berliner Bildhauerschule.
Seine monumentalen Auftragsarbeiten sollten für das preußische Berlin charakteristisch werden.
Richten wir also unseren Blick auf Deutschland, beziehungsweise die Länder, die diesen Staat später gründen sollten. Auch die Herzog- und Fürstentümer und die kleineren Königreiche innerhalb Deutschlands schicken mit Stipendien ihre talentiertesten Maler, Zeichner und Bildhauer nach Rom, um dann deren Erfahrungen für die aufkommenden Denkmäler, Profanbauten und Innenausstattungen zu nutzen. Nicht zuletzt durch die industrielle Revolution mit steigendem Kapitalaufkommen und der neuen wohlhabenden Klasse der Fabrikbesitzer, dem sogenannten Industrieadel, spült es zunehmend Gelder auch in die Kassen, die für Bauvorhaben repräsentativer und kultureller Art zuständig sind.
Stilistisch haben wir es ab 1850 mit keinem bestimmten oder mit allen damals bekannten Stilen parallel zu tun, denn der sogenannte Historismus ist besonders verbreitet.
Dabei entschied man sich je nach Funktion des geplanten Gebäudes für einen bestimmten Baustil - die passende Bauplastik selbstredend inbegriffen. Eine neu errichtete Kirche machte sich am besten im Stil der Gotik oder der Romanik mit ihren Spitz- oder Rundbögen, während etwa Banken und Bürgerhäuser im Stil der Renaissance mit ihren Säulen, Lisenen und Kuppeln entstanden, denn sie verkörperte die große Zeit der Stadtkultur, wie sie sich vor allem in Italien abspielte. Adelspalais und vor allem Theater baute man im reich verzierten Barockstil, während Fabrikhallen meist im englischen Tudorstil mit unverputzten Backsteinfassaden gehalten waren. Zuweilen wurden typische Elemente verschiedener Stile auch neu zusammengesetzt. Diese Vorgehensweise wird Eklektizismus genannt.
Politisch gesehen hat die deutsche Revolution von 1848 noch keinen Nationalstaat zur Folge, die Restauration nach Napoleon ist noch in vollem Gange. Wenn es auch nicht mehr gelang, die sozialen Errungenschaften, die Napoleon aus Frankreich mitgebracht hatte, ganz aus den Köpfen der Bürger in den deutschen Landen zu eliminieren, so wurde doch seitens der Adelshäuser der Versuch unternommen, verlorengegangene Macht und Einfluss im Alltag wieder aufleben zu lassen - und auch in für jeden sichtbarer Art und Weise in Form von Denkmälern und Prunkbauten. Paradebeispiel dafür: Ludwig II. und sein Schloss Neuschwanstein, das der von der Romantik geradezu besessene bayerische König ab 1869 errichten lässt. In der Romantik, deren Namensgebung über das Französische aus dem lateinischen Begriff „lingua romana" herstammt, also die heutige Sprache der romanischen Länder meint, wie Italienisch, Französisch oder Spanisch, im Gegensatz zur „lingua latina“, also das Latein des alten Roms, pflegte man, um die eigene Herkunft als Gegengewicht zur Antike zu stärken, idealisierte Vorstellungen des Mittelalters.
König Ludwigs Schloss wurde aufgebaut in konventioneller Backsteinbauweise, teils mit einem Stahlgerüst verstärkt.
Weißer Kalkstein und weitere Gesteinsarten außen und im Innern angebracht sorgten letzlich für das berühmte, phantastische Idealbild einer Ritterburg. Die Zeit der edlen Ritter, in der die deutschen Adelshäuser entstanden, sollte so nochmal inszeniert werden. Dem für seine Schlossprojekte auserwählten Bildhauer Philipp Perron stellte er eine Schar von italienischen Marmorspezialisten an die Seite. Ludwigs Schlösser wurden sehr reichhaltig mit Figuren und Bauschmuck versehen im Stil des Neobarock und Neorokoko.
Den Münchener Porträtspezialisten Michael Wagmüller engagierte er für zwei mondäne Brunnen seiner Königlichen Villa Schloss Linderhof in Ettal.
Als es, auch aufgrund des deutsch-französischen Krieges von 1870 und durch geschicktes Taktieren seitens Otto von Bismarck, 1871 zur Gründung des Deutschen Reiches kommt, geschieht dies unter preußischer Führung. Als größtes Land und stärkste Militärmacht des Reiches stellt Preußen nun die Hauptstadt, Berlin. Allmählich wird Berlin auch für die Künstler wichtiger, wenn auch München und Wien in der Kunst im deutschsprachigen Raum zunächst noch bedeutender sind. Bildhauer wie etwa Ernst Herter werden an der Berliner Akademie der Künste ausgebildet, vervollkommnen auf einer anschließenden Studienreise nach Italien ihre klassische Ausbildung, um dann ihrerseits als Professor weitere Bildhauer an den Berliner Fakultäten auszubilden. Und die Absolventen werden dringend gebraucht, denn es boomt gerade in Deutschland bei repräsentativen Bauten im Vorbild römischer Architektur und Denkmalkunst. Ausschmückende Elemente, Reliefs und Vollplastiken wollen gezeichnet und angefertigt werden.
Für die Bildhauer beginnt eine Zeit zahlreicher Aufträge für Brunnen auf großen Plätzen, figurative Inszinierungen an Bauten wie Opern und an institutionellen Einrichtungen deutscher Großstädte.
Auch in Frankreich fließt Geld in Großprojekte wie die New Yorker Freiheitsstatue, 1886 eingeweiht, geschenkt vom französischen Staat und entworfen vom 1834 im elsässischen Colmar geborenen Frédéric-Auguste Bartholdi. Nachseiner Ägyptenreise im Jahre 1856 war er von dem Gedanken besessen, einen gewaltigen Leuchtturm in der Gestalt einer 28 Meter hohen, fackeltragenden Ägypterin über der nördlichen Einfahrt des Sueskanals thronen zu lassen.
4. AIMÉ-JULES DALOU (1838-1902)
„Grabmal Victor Noir“ Cimetière du Père-Lachaise 1891
Foto: Postkarte um 1900
Dazu kam es zwar nicht, jedoch durfte er die 46 Meter hohe, in Roben gehüllte Libertas ausführen, die römische Göttin der Freiheit, mit der rechten die Fackel hochhaltend wie geplant, aber nun in der linken Hand eine Inschriftentafel, eine sogenannte Tabula ansata, mit dem Datum der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, zu ihren Füßen eine zerbrochene Kette. So steht Bartholdis Werk nun auf Liberty Island im New Yorker Hafen.
1.4 Werke von realistischer Wahrheit
Der verlorene Deutsch-Französische Krieg von 1870 bis 1871 hatte Frankreich arg gebeutelt. Paris war eingeschlossen, belagert und wahllos mit großer Artillerie beschossen worden. Der Beschuss galt auch der Zivilbevölkerung und sollte die Moral brechen. Zeitgleich kam es beim Aufstand der Pariser Kommune zu einem innerfranzösischen Bürgerkrieg. So kämpfte die französische Regierung quasi an zwei Fronten, auf dem Felde gegen die Deutschen und politisch gegen die Entmachtung durch den revolutionären Pariser Stadtrat. Um handlungsfähig zu bleiben, akzeptierte sie die Bedingungen Bismarcks und kapitulierte. Die Kommune konnte so blutig niedergeschlagen werden, 20.000 Kommunarden fielen. Der eigentliche Krieg brachte Frankreich hunderttausende Gefallene und Verwundete, es verlor große Teile von Elsass und Lothringen und musste Reparationszahlungen leisten. Deutsche Besatzungstruppen blieben bis zur endgültigen Rückzahlung 1873 in sechs Departements. Der Konfrontation folgte ein lang andauernder Tiefpunkt der Beziehungen beider Nationen. Im Vergleich zu den Weltkriegen erfährt dieser Krieg heute jedoch kaum Nachhall in dem historischen Bewusstsein von Deutschen und Franzosen, er war nach relativ kurzer Zeit wieder beendet, der Umgang mit Kriegsgefangenen war human und auf beiden Seiten war man zu sehr mit politischen Neuerungen konfrontiert. Auf deutscher Seite entstand ein geeintes Reich, auf französischer Seite ging mit der Kriegsgefangenschaft von Kaiser Napoléon III. das Zweite Französische Kaiserreich zu Ende und die sogenannte Dritte Republik wurde ausgerufen.
Der personifizierte französische Bildhauer der Dritten Republik, zwischen 1870 und 1940, war der 1838 geborene Jules Dalou, nicht nur als Schöpfer des Denkmals „Le Triomphe de la République“ von 1879 im Zentrum des Place de la Nation. In Paris schuf er neben figurenreichen Großreliefs an Fassaden öffentlicher Gebäude, weitere große Denkmäler wie „Monument à Eugène Delacroix“ von 1890 oder die Figurengruppe „Le Triomphe de Silène“ von 1897, beide stehen im Jardin du Luxembourg. Dabei stellte er das Heldentum in klassischen Gesten dar.
Aber Dalou zeigte auch einen realistischen Blick auf den sogenannten kleinen Mann auf der Straße, auf die Bauern und Arbeiter, wie bei „La Paysanne française allaitant" von 1873, London, Victoria and Albert Museum oder „Grand paysan" von 1897, Paris, Musée d'Orsay. Diesen sozialpolitisch motivierten Ansatz, der in der Malerei nicht ganz neu war, überträgt Dalou in die Plastik.
In seinem Gisant, französisch für „Liegender“, die Liegefigur auf dem Sarkophag des 1870 ermordeten Victor Noir, Pseudonym von Yvan Salmon, stellte er 21 Jahre später den wie eingefroren am Boden liegenden Journalisten dar, so wie man ihn wohl tot vorgefunden hatte (Abb. 4). Dieser wurde zu einer symbolträchtigen Figur der Commune-Bewegung, da er von einem Nachkommen Napoleon Bonapartes, einem Prinzen, im Streit erschossen wurde, der danach nicht verurteilt wurde.
Jules Dalou schuf auch zahlreiche Kleinplastiken, gerade in seinem Exil in London ab 1871 - er wurde der Teilnahme am beschriebenen Aufstand der Pariser Kommune beschuldigt und musste fliehen. In England entstanden Aktstudien mit für das Genre typischen Themen, wie „vor und nach dem Bade“. Dies waren intimere Skulpturen als seine Arbeiterstudien und er beschloss sie diskret zu behandeln.
Trotzdem waren seine Werke weiblicher Akte zu Lebzeiten bekannt, beliebt und gesammelt. Der Journalist und französische Kunstkritiker Gérald Schürr (1915-1989) urteilte über diese:
„Getreu dem Sinn des Monumentalen gelang es ihm, auch in seinen kleinen Figuren die Fallstricke des Realismus zu umgehen und den Naturalismus mit den Eroberungen des Impressionismus zu verbinden."2
Welche „Fallstricke des Realismus“ meint er da wohl? Kunstbegrifflich steht der Realismus wie der Naturalismus für eine naturgetreue Darstellung, seine Themen sind jedoch, wie von dem Maler Gustave Courbet (1819-1877) proklamiert, der als Gegenveranstaltung zur Weltausstellung 1855 seine eigene Ausstellung „Pavillon du Réalisme“ nennt, Blicke auf die Alltagswelt und ungeschönte Darstellungen der bäuerlichen Bevölkerung und der Arbeiter.
In der Folge wurde der Realismus zwar als demokratisch empfunden, dennoch kam Kritik auf, der realistische Künstler könne nur die Realität abbilden, die zudem oft häßlich sei oder banal als bloße Nachahmung, es fehle ihm an Phantasie und verstehe nicht den Geist, der in den Dingen wohnt.
Mit einem phantasievollen und äußerst geistreichen Naturalismus arbeitend, so lässt sich wohl ein italienischer Zeitgenosse Dalous beschreiben. Dennoch wurde er zunächst durch die realistische Darstellung eines medizinischen Fortschritts, nämlich die der Impfung, berühmt, der Bildhauer Giulio Monteverde aus Genua.
Wie bei einem Großteil der hier genannten Künstler brachte ein mehr oder weniger großer Zufall in Form einer Bekanntschaft mit einem Mäzen Schwung in die Karriere Monteverdes. Bis dahin hatten er und seine junge Familie Schwierigkeiten den Lebensunterhalt zu bestreiten, als ihm 1867 der spätere König Wilhelm II. von Württemberg während eines Urlaubaufenthalts in Rom eine detailreiche Figurengruppe mit dem Titel „Kinder, die mit einer Katze spielen“ abkaufte.
Europaweite Bekanntheit brachte ihm dann die lebensgroße Skulptur „Edward Jenner impft seinen Sohn gegen Kuhpocken“, die in Rom, in Wien und in Paris ausgestellt wurde. Das Werk zeigt wirklichkeitsnah mit großer Feinheit in den Details den englischen Landarzt, der die moderne Schutzimpfung gegen Pocken entwickelte, wie er seinen knapp einjährigen Sohn impft.
Monteverde schuf neben vielen Büsten auch Grabdenkmäler, darunter den Engel für das Grab Oneto auf dem Friedhof von Staglieno in Genua (Abb. 5). Einen Engel dieser Art hatte man vorher noch nicht gesehen und er wurde zu einer Ikone der Sepulkralkultur weltweit. Die Italiener nennen ihn auch respektvoll nach seinem Schöpfer „Angelo di Monteverde“. Das Mädchen oder die junge Frau mit Flügeln blickt je nach Standpunkt des Betrachters zum einen ruhig, wie teilnahmslos in die Weite, zum anderen jedoch durchdringend und ernst, wenn man ihr direkt in die Augen sieht. Mit einem Engel ist nicht zu spaßen, schon gar nicht, wenn er eine römische Tuba mit einer langen geraden Röhre in Händen hält und sich mit diesem Symbol als Wächter des Grabes kenntlich macht oder gar als Engel des jüngsten Gerichts, der Apokalypse.
5. GIULIO MONTEVERDE (1837-1917)
„Engel für das Grab Oneto“, Genua 1882
Foto: Vassil
Die Stellung strahlt einen gewissen Stolz, ein großes Selbstbewusstsein aus, während das Körperliche der in eine eng anliegende Toga gehüllten jungen Frau gewinnende Weiblichkeit versprüht. Meisterhaft naturalistisch gelingt es Monteverde im harten Stein Weichheit und Empfindsamkeit darzustellen. In den vielen Details der Bewegung drückt sich soviel Anmut aus, daß der Eindruck erwächst, die Figur solle und könne Trost spenden an einem Ort der Trauer und Endlichkeit. Der Engel führte zu zahlreichen Folgeaufträgen aus ganz Italien bis nach Südamerika und regte viele Bildhauer seiner Zeit im Sujet der Grabmalkunst zur Nachahmung an.
Als 74-Jähriger setzt sich Monteverde in der Plastik „Idealità e materialismo“ von 1911, Rom, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, mit Körper und Geist, im Sinne von Materie und Gedanken auseinander, ein philosophisches, weltanschauliches Grundthema. Eine Frau reitet im Seitsitz in wilder Fahrt auf einem „Wagen“, der aus einem Mann und einem symbolischen Rad mit Wolken besteht - eine allegorische Darstellung des Idealismus, der sich Ideen als Ausgangspunkt von Dingen und Handlungen vorstellt und den Menschen als wesentlich geistig bestimmt sieht, und seinem Gegenbegriff, dem Materialismus, der davon ausgeht, dass selbst Gedanken, Gefühle oder das Bewusstsein auf Materie zurückgeführt werden können. Der Materialismus erklärt die den Menschen umgebende Welt und die in ihr ablaufenden Prozesse ohne Gott. Diese symbolistische Plastik stellt zwei Lebenseinstellungen dar, noch mehr eine Glaubensfrage und Thema eines sich dem Ende nähernden Lebensalters, das er selbst, Giulio Monteverde, erreicht hatte.
II. Europa im Stilpluralismus
2.1 Der Erneuerer
In den 1870ern tritt ein Mann auf die Bühne der Bildhauerei, der ohne akademische Ausbildung die technische Perfektion eines Canova besitzt, sich tiefgreifend von Michelangelos bildhauerischem Erbe beeinflussen lässt und letztenendes den Beginn der modernen Plastik einläuten wird. Es ist Auguste Rodin, 1840 in Paris geboren.
An der École des Beaux-Arts wird er dreimal abgelehnt, von seinem Meister Carrier-Belleuse trennt er sich 1870 wegen Differenzen in der künstlerischen Auseinandersetzung.
Von Brüssel aus beginnt er 1876 eine Italienreise, er hält sich in Florenz und Rom auf und studiert Michelangelos Plastiken, den er ganz besonders verehrt. Nach seiner Rückkehr beschäftigt er sich weiterhin mit einem männlichen Akt, an dem er seit Oktober 1875 arbeitet. Als der Gips im Januar 1877 im Cercle artistique et littéraire de Bruxelles ausgestellt wird, behauptet ein Artikel in L’Etoile belge, Rodin habe einen Abguss eines lebenden Modells angefertigt, also im künstlerischen Sinne gemogelt. Die Anschuldigung verfolgt Rodin bis auf den Salon nach Paris, wo er die Figur unter dem Titel „Das eherne Zeitalter“ präsentiert (Abb. 6). Erst als sich seine Bildhauerkollegen für seine Ehre einsetzen, kommt es zu einem Bronzeguss.
Ein weiterer Disput entsteht, als er die traditionelle Denkmalkunst infrage stellt. Seine „Bürger von Calais" stehen auf dem Boden ohne das übliche hohe Podest, wild diskutierend und gestikulierend. 1885 von der Stadt Calais in Auftrag gegeben, gelangten seine Bürger erst 1895 zur Aufstellung, nach mehreren Entwürfen und zähen Auseinandersetzungen, jedoch zunächst mit einem vom Künstler nicht gewollten Marmorsockel und an anderer Stelle. Erst 1945 wurde die Gruppe vor dem Rathaus in Calais ebenerdig platziert.
Rodins Schaffen galt schon zu Lebzeiten als Höhepunkt der figürlichen Darstellung. Und seine Arbeitsweise ist einzigartig, denn er lässt seine Modelle nicht von Anfang an in einer inszenierten Stellung stehen, wie es bei naturalistisch arbeitenden Künstlern damals wie heute üblich ist.
Rodins Modelle sollen in seinem Atelier umherlaufen, sich unterhalten, interagieren. Er beobachtet bis ihn eine Situation interessiert, dann lässt er sie in der zufällig entstandenen Position verharren und modelliert in Kürze Tonfiguren, anatomisch korrekt, aber skizzenhaft mit seinen Fingerspuren im Ton. So entstehen Figuren quasi als Momentaufnahmen, eine Maßgabe der zeitgleichen impressionistischen Malerei. Rodin arbeitet insofern impressionistisch in der Plastik.
Ein besonders mystisches Lebenswerk spiegelt seine Obzessionen und Ängste wider. Es ist das „Höllentor“ nach Dantes Göttlicher Komödie und ist Schauplatz aller dunklen Seiten der menschlichen Seele. Die um 24 Jahre jüngere Bildhauerin Camille Claudel darf daran mitarbeiten, sie ist Schülerin, Modell und Muse zugleich. Eine Liebesbeziehung entsteht zwischen den beiden.
Die riesige Figurenlandschaft des Tores besteht aus einer Vielzahl von sukzessive dazu komponierten Kleinplastiken, von denen Rodin einige als Einzelfigur in Lebensgröße in Marmor fertigte, wie seinen berühmten „Denker", „Der Kuß“ oder „Die Kauernde“ (Abb. 7). Sie entstammen aus der Arbeit am Höllentor. Kurz bevor das komplette Gipsmodell im Jahre 1900, nachdem er 20 Jahre daran gearbeitet hatte, im Rahmen einer großen Rodinausstellung zur Weltausstellung in Paris endlich dem Publikum gezeigt werden soll, zerstört er die eigentlich fertige Version, indem er einige Figurenkonstellationen daraus entfernt, aus einer inneren Motivation heraus. Der Künstler erklärt das Handeln nicht, arbeitet jedoch noch bis zu seinem Tod 1917 weiter an dem Höllentor und seinen Figuren. Das Tor wurde posthum im Jahre 1928 nach einem nummerierten Plan, der sich in Rodins Archiv befand, mit den Figuren rekonstruiert und in Bronze gegossen.