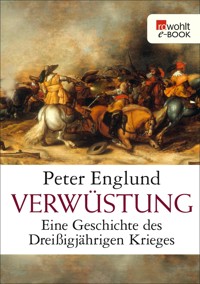28,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 28,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im November 1942 kommt es gleich auf mehreren Kriegsschauplätzen zur Entscheidung: in der Schlacht von El Alamein, Ägypten; auf der Pazifikinsel Guadalcanal; in Stalingrad. Geschehnisse, die die Wende des Zweiten Weltkriegs herbeiführen und die Peter Englund so weltumspannend wie dicht und nah am Menschen erzählt, ganz aus der Sicht derjenigen, die diesen Krieg erlebt haben: darunter ein deutscher U-Boot-Kommandant im Südatlantik, ein zwölfjähriges Mädchen in Shanghai, ein sowjetischer Infanterist in Stalingrad, ein Partisan in den belarussischen Wäldern, eine Journalistin in Berlin, eine Hausfrau auf Long Island. Dazu kommen bekannte Figuren wie Sophie Scholl, Ernst Jünger oder Albert Camus, leichthändig verwoben in die große Erzählung. So verfolgen wir, spannend wie in einem Roman, die Wende des Krieges – und erleben, was all diese Menschen antreibt, spüren ihre Ängste und Hoffnungen, Heldenmut und Verzweiflung. Ein episches Geschichtswerk, das von der Wüste Nordafrikas bis in die tödliche Kälte Russlands führt, von fernen Inseln im Westpazifik bis in die deutsche Hauptstadt. Und zugleich ein grandioses Stück «Anti-Geschichte», das in Einzelschicksalen die existenzielle Dimension des Krieges erfahrbar macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 885
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Peter Englund
Momentum
November 1942 – wie sich das Schicksal der Welt entschied
Über dieses Buch
Im November 1942 kommt es gleich auf mehreren Kriegsschauplätzen zur Entscheidung: in der Schlacht von El Alamein, Ägypten; auf der Pazifikinsel Guadalcanal; in Stalingrad. Geschehnisse, die die Wende des Zweiten Weltkriegs herbeiführen und die Peter Englund so weltumspannend wie dicht und nah am Menschen erzählt, ganz aus der Sicht derjenigen, die diesen Krieg erlebt haben: darunter ein deutscher U-Boot-Kommandant im Nordatlantik, ein zwölfjähriges Mädchen in Schanghai, ein sowjetischer Infanterist in Stalingrad, ein Partisan in den belarussischen Wäldern, eine Journalistin in Berlin, eine Hausfrau auf Long Island. Dazu kommen bekannte Figuren wie Sophie Scholl, Ernst Jünger oder Albert Camus, leichthändig verwoben in die große Erzählung. So verfolgen wir, spannend wie in einem Roman, die Wende des Krieges – und erleben, was all diese Menschen antreibt, spüren ihre Ängste und Hoffnungen, Heldenmut und Verzweiflung.
Ein episches Geschichtswerk, das von der Wüste Nordafrikas bis in die tödliche Kälte Russlands führt, von fernen Inseln im Westpazifik bis in die deutsche Hauptstadt. Und zugleich ein grandioses Stück «Anti-Geschichte», das in Einzelschicksalen die existenzielle Dimension des Krieges erfahrbar macht.
Vita
Peter Englund, geboren 1957, arbeitete als Kriegsreporter auf dem Balkan, in Afghanistan und im Irak, lehrte Geschichte in Uppsala und wurde Professor für Historische Narratologie in Stockholm. Von 2009 bis 2015 war er Ständiger Sekretär der Schwedischen Akademie, die den Nobelpreis vergibt. Mehrere seiner Bücher wurden Bestseller; seine Geschichte des Ersten Weltkriegs, «Schönheit und Schrecken» (2011), erschien in rund zwanzig Sprachen. Für sein Werk erhielt Peter Englund u.a. den Selma-Lagerlöf-Preis für Literatur.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Die schwedische Originalausgabe erscheint im September 2022 unter dem Titel «Onda nätters drömmar. November 1942 och andra världskrigets vändpunkt i 360 korta kapitel» im Verlag Natur & Kultur, Stockholm.
Copyright © 2022 by Peter Englund
Fachberatung Dr. Reinhard Stumpf
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung Christopher Richard Wynne Nevinson, Unter Londoner Scheinwerfern, Private CollectionPhoto © Christie's Images/Bridgeman Images
ISBN 978-3-644-10034-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
An den Leser
Dramatis Personae
1. bis 8. November Große und kleine Pläne
9. bis 15. November Erfreuliche Neuigkeiten
16. bis 22. November Nennen wir es Wendepunkt
23. bis 30. November Diesmal siegen wir
Die weiteren Schicksale
Literatur und Quellen
Internetquellen
Register
Bildnachweis
TAFELTEIL 1
TAFELTEIL 2
TAFELTEIL 3
In Erinnerung an
Józef Lewandowski
und alle anderen,
die mir im Laufe der Jahre begegnet sind,
die dort waren und dabei waren.
An den Leser
Dies ist ein Buch über den November 1942, die Zeit, in die der Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs fällt: Als dieser Monat begann, glaubten viele noch immer, dass die Achsenmächte siegen würden; als der Monat vorüber war, stand fest, dass es nur eine Frage der Zeit war, ehe sie verlieren würden. Gleichwohl ist dies kein Werk, das versucht zu beschreiben, was der Krieg während dieser vier kritischen Wochen war – seine Voraussetzungen, Planungen, Verläufe und Folgen –, sondern es möchte vielmehr etwas darüber sagen, wie der Krieg war.
Ein Phänomen wie der Zweite Weltkrieg wird uns immer in irgendeiner Weise entgleiten. Oft ist es vor allem eine Frage des Maßstabs. Es versteht sich von selbst, dass ein Konflikt, der so lange dauerte, der sich über so weite Teile der Welt erstreckte, so viel Verwüstung hinterließ und so viele Menschenleben forderte, unmöglich in seiner Gänze erfasst werden kann. Unfassbar ist er auch deshalb, weil dort so grässliche Dinge geschahen, dass unser Fassungsvermögen, unsere Wertvorstellungen und sogar unsere Worte nicht ausreichen und scheitern müssen. Dazu kommt eine weitere Schwierigkeit. Primo Levi schreibt, «wer das Haupt der Medusa erblickt hat, konnte nicht mehr zurückkehren, um zu berichten, oder er ist stumm geworden». Nachdem ich im Laufe der Jahre vielen begegnet bin, die dabei waren, ist mein Eindruck, dass sie alle Geheimnisse trugen, verdrängt oder zum Schweigen gebracht, und dass sie diese Geheimnisse mit in den Tod genommen haben.
Doch darf die Tatsache, dass das Geschehene schwer zu fassen ist, kein Argument dafür sein, es nicht zu versuchen. Im Gegenteil. Wir müssen diese Anstrengung unternehmen, sowohl um unserer selbst willen als auch für all jene, die im Krieg untergingen. Dieses Buch stellt einen solchen Versuch dar. Es versucht, sich den Tatsachen auf eine andere Weise zu nähern. Es hat kein übergreifendes Rahmenwerk und will vermeiden, was Paul Fussell das «Abenteuergeschichtenmodell» nannte, eine Art und Weise, zufällige oder gewöhnliche Ereignisse «klar und meist erhaben, kausal bedingt und zweckgerichtet» zu beschreiben. Die Form ist – wie schon in meinem vorangegangenen Werk über den Ersten Weltkrieg – ein Geflecht aus Biografien. Und im Zentrum soll auch hier der einzelne Mensch stehen, seine Erlebnisse und – nicht zuletzt – seine Gefühle, all das, was sonst vielleicht in Anmerkungen festgehalten ist oder manchmal als ein Farbklecks im trägen Fluss der großen Erzählung vorüberhuscht, aber meist einfach gar nicht sichtbar ist. Und wenn Sie sich fragen, was ich selbst zu diesen oft sehr berührenden Schilderungen hinzugefügt habe, so ist die Antwort schlicht: nichts. Die Quellen, die ich verwendet habe, sind reich genug.
In der Geschichtsschreibung ist diese Form ein Experiment, doch sie entspringt der Erkenntnis, dass die Komplexität der Ereignisse am deutlichsten auf dieser individuellen Ebene sichtbar wird. Hier stößt man auf ein düsteres Paradox. Viele von denen, die in den Ersten Weltkrieg zogen, waren von einem Idealismus getragen, der keine Verankerung in der Wirklichkeit hatte – sie schlugen sich für ihre Fantasien. Dieser Idealismus fehlte im Zweiten Weltkrieg zumeist, obwohl dieses Mal unendlich viel mehr auf dem Spiel stand. Das schuf eine seltsame Spannung zwischen den Zielen des Krieges und der Art und Weise, wie er erlebt wurde, einer Wirklichkeit, die nicht selten, wie der Nobelpreisträger John Steinbeck später schrieb, als er seine eigenen Erfahrungen zusammenfassen wollte, ein «verrücktes, schrilles Chaos» war.
Natürlich war nicht alles so. Wir wissen, dass es sich in Wirklichkeit um einen Kampf zwischen Barbarei und Zivilisation handelte und dass dieser Kampf im November 1942 auf seinen Höhepunkt zulief. Wahrscheinlich begriffen das auch viele der Beteiligten. Es war offensichtlich, welche Opfer er forderte. Den Ausgang dieses Kampfes als selbstverständlich zu betrachten, ist dagegen ein Fehler, nicht nur, weil das die Opfer zu einem historischen Abstraktum macht, sondern auch, weil es etwas, das damals eine ungewisse, unvorhersagbare und unüberschaubare menschliche Katastrophe war, in spannende, aber im Grunde ungefährliche Epik verwandelt. So kann die gefährliche Illusion entstehen, dass sich all das nicht wiederholen wird, und schon gar nicht mit entgegengesetztem Ergebnis.
Uppsala, an einem sonnigen Morgen im August 2021, P.E.
In den schrecklichen Nächten träumten wir
Dichte und heftige Träume,
Träumten mit Seele und Leib:
Heimkehren, Essen, Berichten.
Bis das Kommando vom Morgengrauen
Kurz und gepresst ertönte:
«Wstawać»;
Und es krampfte das Herz in der Brust sich.
Wir sind wieder nach Hause gekommen,
Unser Bauch ist gefüllt,
Unser Bericht ist zu Ende.
Es ist Zeit. Gleich hören wir wieder
Das fremde Kommando:
«Wstawać».
11. Januar 1946[1]
Primo Levi
Dramatis Personae
Mansur Abdulin
Gemeiner russischer Soldat vor Stalingrad, 19 Jahre
John Amery
Britischer Faschist und Überläufer in Berlin, 30 Jahre
Hélène Berr
Universitätsstudentin in Paris, 21 Jahre
Ursula Blomberg
Flüchtling aus Deutschland in Schanghai, 12 Jahre
Vera Brittain
Schriftstellerin und Pazifistin in London, 48 Jahre
John Bushby
Maschinengewehrschütze auf einem britischen Lancaster-Bomber, 22 Jahre
Paolo Caccia Dominioni
Fallschirmjägermajor in Nordafrika, 46 Jahre
Albert Camus
Schriftsteller aus Algerien, jetzt in Le Panelier, 29 Jahre
Keith Douglas
Britischer Panzerleutnant in Nordafrika, 22 Jahre
Edward «Weary» Dunlop
Australischer Militärarzt und Kriegsgefangener auf Java, 35 Jahre
Danuta Fijalkowska
Polin, Flüchtling und Mutter eines Kindes in Międzyrzec Podlaski, 20 Jahre
Lidia Ginsburg
Russische Hochschuldozentin in Leningrad, 40 Jahre
Wassili Grossman
Reporter für die Krasnaja Swesda in Stalingrad, 36 Jahre
Tameichi Hara
Japanischer Befehlshaber eines Zerstörers vor Guadalcanal, 42 Jahre
Adelbert Holl
Deutscher Infanterieleutnant in Stalingrad, 23 Jahre
Horst Höltring
Deutscher U-Boot-Kommandant, 29 Jahre
Wera Inber
Russische Lyrikerin und Journalistin in Leningrad, 52 Jahre
Ernst Jünger
Hauptmann des deutschen Heeres und Literat, auf der Reise an die Ostfront, 47 Jahre
Ursula von Kardorff
Journalistin in Berlin, 31 Jahre
Nella Last
Hausfrau in Barrow-in-Furness, England, 53 Jahre
John McEniry
Amerikanischer Sturzkampfbomberpilot über Guadalcanal, 24 Jahre
Okchu Mun
Zwangsprostituierte in einem japanischen Bordell in Mandalay, 18 Jahre
Nikolai Obrinba
Partisan in Weißrussland, 29 Jahre
John Parris
Amerikanischer Journalist, der über die Landung in Algerien berichtet, 28 Jahre
Lim Poon
Zweiter Steward auf einem britischen Handelsschiff, 24 Jahre
Jechiel «Chil» Rajchman
Gefangener im Vernichtungslager Treblinka, 28 Jahre
Willy Peter Reese
Gemeiner deutscher Soldat an der Ostfront, 21 Jahre
Dorothy Robinson
Hausfrau auf Long Island, 40 Jahre
Ned Russell
Journalist, der über die Kämpfe in Tunesien berichtet, 26 Jahre
Sophie Scholl
Universitätsstudentin in München, wohnhaft in Ulm, 21 Jahre
Elena Skrjabina
Russin, Geflüchtete und Mutter von zwei Kindern in Pjatigorsk, 36 Jahre
Anne Somerhausen
Sekretärin und Mutter von drei Kindern in Brüssel, 41 Jahre
Leonard Thomas
Britischer Maschinist auf einem Schiff in einem Eismeer-Konvoi, 20 Jahre
Bede Thongs
Australischer Infanteriesergeant auf Neuguinea, 22 Jahre
Vittorio Vallicella
Italienischer Lastwagenfahrer in Nordafrika, 24 Jahre
Tohichi Wakabayashi
Japanischer Infanterieleutnant auf Guadalcanal, 30 Jahre
Charles Walker
Amerikanischer Fähnrich der Infanterie auf Guadalcanal, 22 Jahre
Kurt West
Finnlandschwedischer gemeiner Soldat an der Swir-Front, 19 Jahre
Leona Woods
Doktorandin der Physik in Chicago, 23 Jahre
Zhonglou Zhang
Chinesischer Staatsbeamter auf Inspektionsreise in Henan, Alter unbekannt
1. bis 8. NovemberGroße und kleine Pläne
«Mitgefühl und Brutalität können in ein und demselben Menschen zu ein und derselben Zeit existieren, wider alle Logik.»
«Eine erfolgreiche Verdrängung ist nur möglich, weil der Tod empirisch nicht erfahrbar ist.»
«Vor einer Woche noch hat es einen halben Tag gebraucht, ein Bataillon zu zerstören, jetzt werden ganze Regimenter in fünfundvierzig Minuten ausgelöscht.»
Von der Ostchinesischen See und dem Huangpu-Fluss her kommen starke Winde auf, ziehen an den Dschunken, Dampfschiffen und Segelbooten im Hafen vorbei, fallen über das Gewimmel von Menschen, Tieren und Fahrzeugen auf der breiten Hafenpromenade her, fahren über Rikschas, Karren, Fahrradfahrer, massenhaft Fahrradfahrer, übervolle Straßenbahnen und gasbetriebene Busse und Militärlastwagen hinweg, pfeifen durch die Bund-Promenade mit ihren Reihen hoher, imposanter Gebäude im westlichen Stil – «The Million Dollar Mile» –, an Kolonnen, Kuppeln, Gauben, Balustraden und Türmchen vorbei und zausen die niemals kleiner werdenden Trauben von Bettlern, die davor lagern, ziehen über den Pudong Point hinein in die engen Gassen mit den niedrigen Häusern von Hongkou, von denen nicht wenige seit fünf Jahren in Trümmern liegen, weiter nach Zhabei, arbeiten sich durch die Mauern der alten chinesischen Stadt und das Gewimmel aus zinnenbewehrten Holzdächern, vereinnahmen von dort aus die leere Pferderennbahn mit ihrem zehnstöckigen Turm und den stillen, aufgegebenen, mehrstöckigen Zuschauertribünen, sausen weiter in den internationalen Teil der Stadt, die geraden Straßen und von Bäumen gesäumten Alleen entlang (Gordon Road, Bubbling Well Road, Avenue Foch, Avenue Joffe, Avenue Petain usf.) und über deren Menschenmengen, an Tempeln und Kathedralen, Krankenhäusern und Hochschulgebäuden, Warenhäusern und Theatern, Straßensperren und Stacheldrahtbarrieren, Cafés, Bars und Bordellen vorbei, hinauf durch Parks, in denen die Bäume immer schwärzer aussehen, je mehr die kühlen Winde das Laub mit seinen warmen Farben wegfegen, um schließlich nach Osten und zum Wusong-Fluss zu verschwinden, hinein ins Land mit seinen kleinen Städtchen, Dörfern und Reisfeldern, fort zu den weit entfernten Provinzen Jiangsu, Anhui und Henan. Es ist Spätherbst in Schanghai.
Unter den grauen Herbstwolken, im südlichen Teil der französischen Zone, lebt ein Mädchen namens Ursula Blomberg. Sie ist gerade zwölf geworden und wohnt mit ihren Eltern im Erdgeschoss eines von Mauern umgebenen Hauses am kleinen Place des Fleurs, direkt neben der Rue de Kaufman. Die Familie ist aus Deutschland geflohen, und sie mieten ein Zimmer mit Küche von einer russischen Frau. Im Obergeschoss wohnen noch andere Flüchtlinge aus Leipzig, und in einem Zimmer, das auf den Hof hinausgeht, leben zwei Männer aus Berlin, aber die sind nur selten da. Ursula findet wie ihre Eltern, sie haben es gut getroffen: Die Umgebung ist sicher, die Straße ruhig, das Zimmer hell und luftig, die Küche sauber und mit zwei Kochplatten und einem Eisschrank ausgestattet. Sie haben sogar Zugang zu einem blau gekachelten Badezimmer, wo man für ein paar Kupfermünzen ein heißes Bad nehmen kann. (Weit weg sind diese Flüchtlingslager in Hongkou, wo viele von denen, die mit demselben Schiff ankamen wie sie, immer noch dicht gedrängt hinter aufgehängten Tüchern auf grobem Betonboden in Gestank, Schmutz und Ungeziefer leben.)
Wie Millionen andere verfolgt die Familie den Verlauf des Krieges auf mehreren Karten. Die ihren sind aus Zeitungen ausgerissen und hängen, auf ein weißes Baumwolltuch aufgeklebt, im Flur. Ursula hat kleine verschiedenfarbige Papierflaggen auf Reißzwecken befestigt, mit denen sie das Vorrücken oder den Rückzug der unterschiedlichen Seiten markieren – rote für Großbritannien, blaue für die USA, grüne für die Niederlande, gelbe für Japan und so weiter. (In ihren Memoiren, die sie erst sehr viel später schreibt, sagt sie nicht, welche Farbe die deutsche Flagge hatte, also raten wir mal: schwarz?) Im vergangenen Jahr mussten die Flaggen wieder und wieder versetzt werden, weil die Nachrichten «devastating», vernichtend, waren, wie sie in ihrem Tagebuch festhält. (Dieses Adjektiv verwendet sie wiederholt, um zu beschreiben, welche Wirkung die Berichterstattung über den Krieg auf sie hat.) Sie musste nach Inseln suchen, von denen sie nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt, nach Ortsnamen, von denen sie nicht weiß, wie man sie richtig ausspricht. Corregidor. Rabaul. Kokoda. Alam Halfa. Maikop. Stalin-grad. Gua-dal-canal. Die grünen Flaggen sind verschwunden.
Die Linien von kleinen Löchern in den papierenen Karten zeugen davon, wie das unter der Kontrolle der Achsenmächte stehende Gebiet immer weiter gewachsen ist. Unter den Flüchtlingen wird diskutiert, ob es womöglich Australien sein wird, in das sie als Nächstes einwandern werden. Vor allem drei Stellungen der Flaggen sind es, die ihnen Angst machen: die in Nordafrika, die nach Osten Richtung Ägypten weist, die im Kaukasus hinunter nach Persien und die bei dem den Achsenmächten freundlich gegenüberstehenden Irak[1], samt der in Burma, die Richtung Westen nach Indien zeigt. Wenn sich die Erfolge der Achsenmächte so fortsetzen, dann werden diese Linien aus Flaggen bald irgendwo zusammentreffen, ja, wo wohl? Afghanistan? Westindien?[2]
«Wir hatten Angst. War es für ein so winziges Land wie Japan oder Deutschland mit einem so aufgeblasenen Ego […] möglich, einen Krieg gegen die gesamte westliche Welt zu gewinnen? Inklusive Amerika?», schreibt Ursula.
Es schien so zu sein. Das Leben im fremden Schanghai ist ein «traumähnliches Erlebnis» für Ursula. Sie leben in einer bedrückenden Isolierung, von der Welt abgeschirmt, hinterm Mond, wissen nicht mehr, als die sorgfältig zensierten Zeitungen und das japanische Radio ihnen berichten, und die Gerüchte blühen. Deshalb war es lange möglich, in dem Gedanken Trost zu suchen, dass die schrecklichen Nachrichten nur Propaganda seien, Übertreibungen und Desinformation. Aber der Freund eines Freundes hat ein Radio versteckt, und durch die Wand aus Knacken und Rauschen und verzerrten, heulenden Lauten kann er manchmal die Nachrichten des BBC auffangen. «Keine Gerüchte mehr, viele der niederschmetternden Kriegsberichte waren die Wahrheit, und die Zukunft suchte uns alle heim.»[3]
Die Feuchtigkeit ist überall. Seine Hose und die Jacke sind genauso nass wie sein Brot, und alles droht gleichermaßen zu schimmeln. Mit jedem Schritt, den er tut, sinken die Stiefel ein, sodass die anderen und er wie «Seiltänzer» durch den lehmig-klebrigen Schützengraben torkeln. Sein Name ist Willy Peter Reese, und er berichtet:
Die Gräben fanden wir versumpft und oft überschwemmt. In den behelfsmäßigen Bunkern und primitiven Schützenlöchern tropfte das Wasser, und die Pferde brachen auf den Wegen zusammen. Ein Pferd war wertvoller als ein Soldat, aber wir nahmen unser Schicksal, wie es kam, lebten in unseren Erinnerungen auf und dachten an unsere Heimkehr. Bald gewöhnten wir uns wieder ein, als hätte sich seit der Schlammzeit des Vorjahres nichts geändert.
Reese lebt mit den anderen seiner Gruppe in einem erweiterten Schützenloch, mit einer Zeltbahn als Tür, unter einem Dach aus von Wasser triefenden Holzbalken und Erde, Wärme bekommen sie von einem gusseisernen Ofen, Essen aus einer Feldküche, die weit entfernt in einem Graben versteckt steht, dorthin müssen die Essenholer im Schutz der Dämmerung laufen. Eine Möglichkeit, sich zu waschen, hat er nicht, er kann nicht einmal seine nassen Stiefel und Socken auswechseln. Stunden mit Sonne werden von einem weiteren Regenschauer abgelöst. Die waldige Landschaft wird immer leerer, nackt, nass, die Farben ausgelaufen, wie in einem Aquarell. Das Regenwasser rinnt die weichen Wege entlang. Das hohe Gras hat sich gelegt, wie um auf den Frost und den Schnee zu warten.
Tagsüber graben Reese und die anderen den wassersüchtigen Schützengraben aus oder säubern die Handfeuerwaffen oder die Munition oder eines der Maschinengewehre oder diese niedrige Panzerabwehrkanone, die die Gruppe zu bedienen hat. Nachts steht er auf Posten, eine Stunde ungefähr, dann darf er drei Stunden ausruhen. Das ist eigentlich alles, was er tut. Auf Posten stehen, «todmüde, frierend, sehnsüchtig, machtlos». So werden die Nächte in Stücke gehackt, und der Schlafmangel legt eine weitere Schippe auf die Erschöpfung, die seinen Körper und seine Seele betäubt. Etwas, das ihn vor einem Jahr noch zu Tode erschreckte, berührt ihn heute kaum noch. Stattdessen hat eine Art seliger Gleichgültigkeit in ihm Wurzeln geschlagen. Reese weiß nicht, ob dieses Gefühl aus «Fatalismus oder Gottesvertrauen» entspringt. Die Todesgefahr ist alltäglich geworden. Der Tod ebenso.
Willy Peter Reese ist einundzwanzig Jahre alt, gemeiner Soldat in der 95. Infanteriedivision, 279. Regiment, 14. Kompanie des deutschen Heeres. Er ist mager und trägt eine randlose Brille, was sein bereits etwas verträumtes Aussehen noch verstärkt. (Außerdem liest er viel oder schreibt, und da beide dieser Tätigkeiten Licht erfordern, ist das eine alltägliche Quelle des Streits mit den Kameraden, die wollen, dass er das Licht ausmacht, damit sie schlafen können. Es kommt vor, dass er beim Glimmen einer Zigarette liest oder schreibt.) Sowohl der Helm als auch die Uniform machen den Eindruck, ein wenig zu groß für seinen dünnen Leib zu sein. Er bekommt immer noch Aknepickel. Sein Blick ist hart und wachsam und bedeutend älter als sein Gesicht.
Etwa dreihundert Meter entfernt, auf der anderen Seite einer breiten Senke, hinter Wirbeln von Stacheldraht und zwischen Tannen und nacktem Erlengestrüpp können sie die sowjetischen Linien erkennen. Der Ort heißt Tabakowo, nach dem menschenleeren Dorf, das ein Stück weit hinter ihnen liegt und von dem nicht mehr viel übrig ist außer von Schornsteinen gekrönte Steinhaufen mit rußigem Holz und Gärten mit verwelktem, erfrorenem Gemüse.
Wenn Willy Reese es anderen erklären soll, dann sagt er, sie befänden sich «bei Rschew».[4] Im Moment ist es ruhig, was bedeutet, dass es keine sowjetischen Massenangriffe gibt, doch stehen sie immer wieder unter Beschuss von Heckenschützen und leichten Granatwerfern. Tagsüber können sie den Kamin nicht benutzen, weil der Rauch vom nassen Holz sofort die Aufmerksamkeit der feindlichen Geschütze auf sich ziehen würde. Und wenn sie sich im Schützengraben befinden, dann gibt es keinen Schutz gegen die plötzlich einschlagenden Projektile. Einer der Kameraden hat in der Nacht einen solchen Volltreffer abbekommen, dass der Schützengraben mit festgefrorenen Eingeweiden, Stücken von Stoff, Gehirn und Fleisch tapeziert und der Tote bis zur Unkenntlichkeit zerrissen war.
Es war wieder eine Nacht, in der das, was Reese den «Traumgott» nennt, ihn zufällig und in trügerischer Absicht nach Haus getragen hat, weg von alldem hier. (Man kann sich gut das Aufwachen vorstellen.) Die Dunkelheit verwandelt sich in den Morgen. Noch eine Dämmerung über dem Niemandsland, über Gehölz und Sumpfland und über verblichenem, braungelbem Sommergras. Es ist still. Er schreibt: «Die Schönheit dieser Stunden war manche Nacht voll Angst und Mühsal wert.»
Zurück zu Ursula Blomberg. Sie und ihre Eltern haben keine andere Wahl, als darauf zu warten, dass es Frieden gibt und sie weiter zu ihrem eigentlichen Ziel, den USA, reisen können. Dass sie in Schanghai gelandet sind, ist kein Wunder. Als die Familie im Frühjahr 1939 ihre Reise über das Meer antrat, war diese kosmopolitische Metropole im Grunde der einzige Hafen auf der Welt, der immer noch vorbehaltlos jüdische Flüchtlinge aus Deutschland willkommen hieß. Da spielte der Ruf der Stadt, verdorben, sündig, unüberschaubar und gefährlich zu sein, keine Rolle: In den letzten Jahren sind ungefähr achtzehntausend Flüchtlinge hier eingetroffen.
Manchmal überkommen Ursula dunkle Gedanken; zum Beispiel, wenn sie an all die britischen, amerikanischen, holländischen und französischen Zivilisten erinnert wird, die verschwunden sind und von den Japanern im entfernten Wusong in einem großen Lager interniert wurden; oder wenn sie an ihre Verwandten denkt, die in Deutschland geblieben sind – wie es ihnen wohl geht? Als sie viel später als Erwachsene auf diese Zeit zurückschaut, wird ihr klar, dass «unser Leben eine Zeit lang ohne äußere Störungen weiterging und wir in ein falsches Gefühl von rein egoistischer Zufriedenheit eingelullt waren». Dabei hilft, dass hier völliger Frieden herrscht und die japanischen Soldaten sie mit Respekt, ja Höflichkeit behandeln – sie sind schließlich trotz allem Deutsche, Alliierte. Doch unter der Oberfläche bleibt die Sorge.
Mitten in alldem genießt Ursula eine unerwartete und paradoxe Freiheit. Es macht ihr nichts aus, dass jetzt Spätherbst ist – es ist schön, die schwere, feuchte Hitze hinter sich zu haben. Die neue Malerfirma ihres Vaters läuft gut, und die Mutter erledigt zu Hause Näharbeiten. Sie selbst trägt ein bisschen Geld bei, indem sie versucht, drei jungen, schönen, kichernden asiatischen Frauen Englisch beizubringen. Es sind die Schwestern eines wohlhabenden Chinesen – oder das, was man so «Schwestern» nennt, denn sie hat im Laufe der Zeit schon begriffen, dass sie seine Konkubinen sind. Wenn das Wetter es zulässt, spielt sie mit den «Schwestern» Krocket und Tischtennis, und wenn es so wie jetzt seit Beginn des Monats kalt oder regnerisch ist, spielen sie Karten.
Musikalisches Intermezzo: Der Tag fängt an, sich abzukühlen, und sie stehen in der schräg einfallenden Wüstensonne und singen Psalmen, kurioserweise von einem Saxofon begleitet. Die Stimmen sind ungeübt, brüchig, der Gesang verklingt, und all die bekannten Geräusche tauchen wieder auf: das Grummeln der Motoren, der Klang von Metall auf Metall, die dumpfen Schläge entfernter Detonationen. Das Truppengebet geht zu Ende. Der magere Priester mit der wohlüberlegten Aussprache erhebt die Hand und erteilt den Segen des Herrn. Die Köpfe neigen sich. Die Männer sehen, dass der Regimentskommandeur sich angeschlichen hat und sie nun vielleicht insgeheim beobachtet. Wie immer ist er wie aus dem Ei gepellt, mit gut polierten Knöpfen, Grad- und Verbandsabzeichen, die Reitgerte unter dem Arm, den Schnurrbart gewachst. Es sieht aus, als neige auch er selbst den Kopf, doch bei ihm wirkt es mehr, als würde er seine Wüstenstiefel betrachten, aus Wildleder sind sie und so gebunden, dass exakt gleich lange Stücke der Schnürsenkel auf beiden Seiten des Schuhs herunterhängen.
Die Person, die hier ihren Kommandeur so eingehend beobachtet, ist ein etwas düster aussehender zweiundzwanzigjähriger Leutnant mit kantiger Nase, scheuem Lächeln und dicken Brillengläsern. Sein Name ist Keith Douglas. Er hat allen Grund, sich neugierig umzusehen, denn er ist neu im Regiment und erst vor wenigen Tagen angekommen. Eigentlich gehört er zum Divisionsstab, der über dreihundert Kilometer weiter verlegt worden ist, doch er hat die Tatenlosigkeit nicht länger ausgehalten, die starre militärische Bürokratie und die sinnlosen Schreibtischarbeiten und die Scham darüber, keine Kampfberührung zu haben, vor allem jetzt, da ein großer Vorstoß eingeleitet worden ist. «Kampferfahrung ist etwas, das ich haben muss.» Also hat er vor drei Tagen unerlaubt seinen Posten verlassen, eine frisch gewaschene Uniform angezogen, einen Lastwagen genommen, und jetzt ist er hier, nachdem er sich den Auftrag als Anführer eines Trupps mit zwei Panzern mehr oder weniger ergaunert hat.[5] Das war allerdings nicht sonderlich schwer, da das Regiment seit Beginn der Kämpfe vor neun Tagen schon sehr viele Offiziere in niederen Rängen verloren hat. Heute ist Sonntag, der 1. November.
Der Regimentskommandeur beginnt zu sprechen:
Morgen werden wir rausgehen, um die zweite Phase der Schlacht um El Alamein zu kämpfen. Die erste Phase, in der der Feind entlang der gesamten Front aus seinen Stellungen vertrieben wurde, ist beendet. In dieser Phase hat diese Division, diese Brigade hervorragende Arbeit geleistet. Der Divisionskommandeur und der Brigadekommandeur sind sehr zufrieden.
Man merkt, dass er ein geübter Redner ist. (Schließlich ist er auch Parlamentsabgeordneter. Für die Konservativen.) Er flicht persönliche Kommentare an ausgewählte Einzelpersonen in seine Rede.
Was also empfindet Douglas für seinen Vorgesetzten? Eine Mischung aus Bewunderung und Neid, Stolz und Ärger. Der Regimentskommandeur steht für alles, was er selbst nie gehabt hat: Geld, Traditionen und eine vornehme Familie, Privatschulen, Kricket und Fuchsjagd in roten Jacken und nicht zuletzt den Charme und die Selbstsicherheit, die man mitbekommt, wenn man in die Elite hineingeboren wird. Der Mut und die körperliche Einsatzkraft des Regimentskommandeurs sind überdies bekannt.
Gleichzeitig steht der Mann für all das, was in der britischen Armee anachronistisch, engstirnig und idiotisch ist. Eine wichtige Erklärung dafür, warum sie nichts anderes getan haben, als zu verlieren, wieder und wieder, und dies seit 1940 – sicherlich oft auf heroische und stilvolle Weise, aber dennoch eben verloren. Als sie vor knapp zwei Jahren im Nahen Osten ankamen, waren sie immer noch ein berittenes Kavallerieregiment, und im Offizierkorps des Regiments gibt es viele, die an dieser Tradition festhalten, was sich unter anderem in der sturen Verachtung von allzu großem technischen Sachwissen ausdrückt. Das hat es Douglas vom ersten Tag an, seit er vor einem Jahr in den Verband und in den Nahen Osten geschickt worden ist, schwer gemacht.
Damals war er bereits ausgebildeter Panzeroffizier, während der Rest des Verbands kaum je einen Panzer gesehen hatte, was dazu führte, dass er bald und nicht ganz zu Unrecht zu einem unerträglichen Besserwisser abgestempelt wurde. Douglas mit seinem einfachen Hintergrund fällt es nicht nur schwer, den Snobismus und die Oberschichtmanieren zu ertragen, er ist auch oft bockig und kann die Klappe nicht halten. Dabei ist er durchaus ein seltsamer Typ, er schreibt modernistische Lyrik, und es ist bei Sitzungen schon vorgekommen, dass er dabei ertappt wurde, wie er zeichnete, anstatt zuzuhören.
Mittlerweile ist der Regimentskommandeur am Ende seiner Rede angelangt:
Dieses Mal, in dieser zweiten Phase, haben wir nicht so viel Arbeit zu erledigen, denn andere … äh … dürfen noch dazukommen. General Montgomery wird die feindlichen Truppen in kleine Abschnitte zersprengen. Heute Nacht werden die Neuseeländer zum Angriff übergehen, und auf sie folgen die 9. Panzerbrigade und andere Panzerformationen. Wenn General Montgomery bereit ist, werden wir hinter ihnen antreten und dem deutschen Panzerverband den Todesstoß versetzen. Das ist eine große Ehre, und ihr dürft es als ein Verdienst ansehen, dass dies unserer Brigade bewilligt worden ist. Wenn wir die Panzer des Feindes zerstört und seine Truppen zur Flucht gezwungen haben, werden wir nach Kairo zurückkehren und … äh … ein Bad nehmen und die anderen armen Hunde das Jagen für uns übernehmen lassen.
Die Rede kommt bei Soldaten und Offizieren gut an. Selbst Douglas fühlt sich aller Skepsis zum Trotz etwas erhaben.
Die Traube von Männern verliert sich rasch in der schnell einbrechenden Dämmerung. Es gibt noch viel Arbeit zu tun, ehe sie bereit sind, morgen früh anzugreifen. Alle Panzer müssen mit Benzin, Öl, Wasser, Munition, Essen beladen werden. Ein Zeichen dafür, dass es jetzt wirklich ernst wird: Der Quartiermeister teilt Socken, Jacken und andere Uniformteile aus, ohne irgendeine Unterschrift dafür zu verlangen. Eine weitere sternklare Nacht bricht an.
Die Frage ist, ob Douglas nicht genauso anachronistisch ist wie sein Kommandeur, wenn auch auf eine andere Art. Viele der psychologischen Voraussetzungen für diesen Krieg sind bestimmt durch jenen, der zuvor stattgefunden hat, was sich nicht zuletzt in der Angst vor den schönen, aber berüchtigten Illusionen des vorangegangenen Großen Krieges zeigt. In vieler Hinsicht gleicht dieser zweiundzwanzigjährige Leutnant mehr den jungen Männern von 1914 als seinen eigenen Altersgenossen. Er will den Kampf, das ist eine Erfahrung, die er haben muss, eine Prüfung, die er durchstehen muss. Und der Krieg ist für ihn auch ein ästhetisches Phänomen, das seinen Sinn aus den literarischen und poetischen Bildern bezieht, die ihm vorausgehen. Die Absurditäten des Krieges erkennt Douglas deutlich, doch mit seiner komplizierten Natur ist er auf eine Weise für seine Doppeldeutigkeit empfänglich, die, sagen wir mal, zwanzig Jahre zuvor noch viel ersichtlicher war als jetzt, in dieser Zeit der Desillusion.[6]
Douglas schreibt:
Es ist spannend und erstaunlich: Tausende von Männern, die meisten ohne größere Ahnung, warum sie kämpfen, die alle die Unbilden ertragen, die in einer unnatürlichen, gefährlichen, aber nicht durch und durch schlimmen Welt hausen, gezwungen, zu töten und getötet zu werden, und die dennoch zwischendurch von einem Gefühl der Kameradschaft mit den Männern, von denen sie getötet werden und die sie töten, angerührt werden, weil sie dasselbe aushalten und erleben. Das entbehrt jeder Logik – darüber zu lesen kann nicht diesen Eindruck vermitteln, durch den Spiegel getreten zu sein, wie es den Mann berührt, der in den Kampf hinauszieht.
Derselbe Sonntag war in Berlin ein einigermaßen warmer, doch etwas regnerischer Herbsttag. Es ist Abend, und im vierten Stock der Rankestraße 21 wird wieder einmal gefeiert. Ein Gebäude im neuromantischen Stil, mit verspiegelten Wänden und Karyatiden im Eingang. Es liegt im Zentrum der Stadt, nur wenige Straßenzüge vom Zoologischen Garten und der schwindelerregend hohen Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche entfernt. Die Etage selbst ist ebenso schön, mit einem blank polierten Parkettboden, schweren Möbeln, Porträts in Goldrahmen und Massen von Büchern. Gerade ist sie voller Menschen, sicherlich über fünfzig, und in Schummerlicht und Zigarettenrauch hört man Gelächter, Geplauder und fröhliche Grammofonmusik. Im großen Salon ist der Esstisch beiseitegeschoben worden, damit die Leute tanzen können. Sie liebt das Tanzen, und sie liebt Feste.
Ihr Name ist Ursula von Kardorff, und sie ist einunddreißig Jahre alt. Ihre beiden Brüder sind ebenfalls da – der jüngere Jürgen und der ältere Klaus, beide in Offiziersuniform. Auch viele andere der jungen Männer auf dem Fest tragen Uniform, darunter sechs Rekonvaleszenten. Einem ist der Arm oben an der Schulter amputiert worden, ein anderer geht auf Krücken, ein Dritter kann nur mit Schwierigkeiten sitzen und dann nur auf einem aufblasbaren Kissen, ein Vierter ist noch nicht richtig wiederhergestellt, nachdem ihm große Teile der Füße wegen Frostbeulen amputiert werden mussten, versucht aber trotzdem zu tanzen. Doch es sind nicht nur die Uniformen und die Krücken, die an den Krieg erinnern, es ist auch die Form des Festes. Wie in jüngster Zeit üblich geworden, stellt die Gastgeberin – in diesem Fall Ursula – lediglich die Gläser und die Gäste die Getränke. Und da sind einige Flaschen aufgeboten. Ein anderes Detail: Sämtliche Fenster sind mit Pappe und Gardinen verhängt. Die Verdunkelung beginnt um 17.30 Uhr und geht bis 06.29 Uhr.[7] Würde einer der Gäste rausschauen, dann wäre in der verdunkelten Rankestraße nicht viel zu sehen, abgesehen von den schwankenden Lichtpunkten der Taschenlampen einzelner Fußgänger und dem gespenstisch bläulichen Schein der vorbeirumpelnden Straßenbahnen.
Die gründlich verdunkelten Fenster sind nicht nur eine Erinnerung an das, was in Europa und der Welt vor sich geht, sie sind auch ein Bild für eine innere Haltung. So wie viele Deutsche hält Ursula von Kardorff Krieg und Politik am liebsten auf eine Armeslänge Abstand. Sie schiebt diese Phänomene beiseite und zieht sich ins private Leben zurück. Das hier soll ein weiteres fröhliches Fest sein, weit entfernt von den Sorgen der Welt.
Doch es will keine rechte Stimmung aufkommen. Ursula bemerkt enttäuscht, dass viele nicht tanzen und sich stattdessen in einen der anderen Räume zurückziehen, um zu diskutieren. Vor allem die jungen Offiziere bestimmen den Ton, und der ist desillusioniert und auf eine neue und offenere Weise kritisch. Das gilt allgemein. Vor zwei Jahren noch, nach den Triumphen im Westen, waren viele dieser jungen Männer in Uniform ganz begeistert. Wie zahlreiche andere in ihrer Situation wurden sie von den raschen und brutalen Erfolgen in ihrem Glauben an den Führer, an das Reich und den Endsieg bestärkt. (Und, so können wir annehmen, sie waren Gegenstand des Neids vieler Männer derselben Generation, die nicht dabei gewesen waren und bald fürchteten, dass der Krieg zu Ende sein könnte, ehe sie ihre Chance erhielten.)
Man kann sich denken, dass der Glaube dieser jungen Offiziere an den Führer wie bei den meisten ihrer Landsleute darunter gelitten hat, dass man die Sowjetunion nicht, wie von ihm immer wieder öffentlich vorhergesagt, im Jahr 1941 schnell besiegt hatte. Dennoch war ihr Vertrauen zumindest zeitweilig durch die bekannte Rede wiederhergestellt worden, die er im März gehalten und in der er den Sieg stattdessen für diesen Sommer versprochen hatte. Denn bisher hatte der Führer immer recht behalten. Doch nun ist der Sommer längst vorbei, der Winter wird bald da sein, und die Unsicherheit wächst.[8] Allerdings nicht bei den Treuen – für sie ist die Einbildung immer stärker als die Wirklichkeit.
Zivilisten wie Ursula von Kardorff leben in einer Stadt, in der bombardierte Häuser noch immer eine Seltenheit sind, und können sich deshalb immer wieder in Privatleben und Vergnügungen zurückziehen. Für die jungen Männer in Uniform ist das anders, und es sind nicht nur ihre Erfahrungen oder der Alkohol, die sie kritisch sprechen lassen. Sie können es auch tun, weil sie in gewisser Weise durch ihre Verwundungen, ihre Auszeichnungen und ihren Status als Frontkämpfer geschützt sind.[9] Ursula ist von ihrer Bitterkeit offensichtlich erschüttert. Bisher war es immer umgekehrt gewesen: Die heimgekehrten Soldaten wurden von Zuversicht getragen, während die Zivilisten Zweifel nährten. Was geht hier vor?
Als Hans Schwarz van Berk an der Tür klingelt, schlägt das Fest von enttäuschend in missglückt um. Der Mann ist einer von Kardorffs alten Bekannten. Sie kennen sich aus der Zeit, als sie bei der Nazi-Zeitschrift Der Angriff gearbeitet hat, und Hans ist ein Mensch, den sie sowohl respektiert als auch schätzt. Der vierzigjährige Schwarz van Berk gehört seit Langem zu Goebbels’ Jungs, ein anerkanntermaßen tüchtiger Journalist, überzeugter Nazi und Angehöriger der Waffen-SS. In einem der Räume bricht bald ein immer hitziger werdender Streit zwischen dem SS-Mann und einigen der jungen Offiziere aus. Jemand sagt: «Wir sind alle wie die Ratten auf einem sinkenden Schiff, nur mit dem Unterschied, dass wir es nicht mehr verlassen können.» Schwarz van Berk ist empört, versucht aber dennoch, ruhig zu argumentieren und dagegenzuhalten. Als jemand sagt: «Es wird ja alles getan, um die Wahrheit zu unterdrücken», hat er genug, steht wütend auf und geht zur Tür. Ursula und ihr großer Bruder Klaus eilen ihm nach, sie versuchen, die Wogen zu glätten. Das gelingt ihnen auch, doch nicht ohne Schwierigkeiten.
Hinterher hat die ansonsten so selbstsichere Frau Angst. «Solche Aussprachen sind nicht ungefährlich für alle Beteiligten.» Enttäuscht ist sie auch. Sie erzählt weiter: «Am schönsten war der Abend gewesen, bevor die Gäste kamen und ich mit den beiden Brüdern abwechselnd im ausgeräumten Esszimmer tanzte.»
Am nächsten Tag ruft Schwarz van Berk Ursulas Mutter Ina – seit Langem eine treue und überzeugte Anhängerin des Regimes – an und klagt, «er sei entsetzt gewesen über so viel Defätismus».
Niemand mag den Geruch des Sieges am Morgen. Vor allem, wenn der Sieg vor vier Tagen bereits seinen Höhepunkt hatte und die Hitze tagsüber wie nachts tropisch ist.
Drei Nächte lang haben die japanischen Soldaten angegriffen, und jede Nacht wurden sie zurückgeschlagen. Niemand weiß genau, wie viele japanische Soldaten da vor ihnen verstreut und auf Haufen liegen. Jemand meint, es müssten über tausend sein. Charles Walker, den man nie anders nennt als Chuck, ist ein hochgewachsener, Brille tragender Fähnrich in der Kompanie H, 2. Bataillon des 164. Infanterieregiments des amerikanischen Heeres. Er hat die Zahl dreitausendfünfhundert gehört, doch niemand kann oder will sie alle zählen. Die Leichen sind in der Hitze aufgequollen, füllen prall ihre Uniformen, wechseln die Farbe, werden schwarz, die grauweißen Leichenwürmer quellen aus allen Körperöffnungen, und die Gesichtszüge verzerren sich zu grotesken Masken. Der Ort hat seinen Namen verdient: Bloody Ridge.
Walker und sein Bataillon befinden sich seit dem 13. Oktober auf Guadalcanal. Für ihn und die anderen ist das eine neue Welt, unbekannt, seltsam und furchterregend. Die meisten der Männer im Bataillon stammen aus North Dakota, nicht wenige aus Minnesota, darunter Grubenarbeiter, Waldarbeiter, Cowboys, Tischler, Mechaniker, Bauern, sie sind groß, stark, jung. Als sie eines kalten Abends im Februar des vorigen Jahres den Zug in Fargo bestiegen, der sie in ein Ausbildungslager in Louisiana brachte, wo sie als Soldaten der Nationalgarde in einen Kampfverband verwandelt werden sollten, hatte es geschneit. Und nun befinden sie sich auf einer tropischen Regenwaldinsel im Südpazifik. Wie auf einem anderen Planeten.
Ihre Sinne sind von all den neuen Eindrücken fast überwältigt worden. Vor allem sind da die Gerüche. Ein Regenwald strotzt vor sonnenheißem, feuchtem Grün, stillstehendem türkisfarbenen Wasser, Schimmel und Fäulnis. Um zu überleben, mussten sie schnell lernen, ihre Sinne auf eine neue Weise zu schärfen: Sehen und Hören, natürlich, aber auch das Riechen. Denn wenn es pechschwarze Nacht ist oder wenn das grellgrüne Baumwollgras ungewöhnlich dicht steht, dann kann man manchmal die Nähe der japanischen Soldaten erschnüffeln, weil ihre feine, neue Lederausrüstung einen seltsamen, leicht süßlichen Dunst von sich gibt.[10] Und lebendige japanische Soldaten haben einen anderen Körpergeruch als amerikanische. Ob es die Situation ist oder die Furcht, weiß man nicht, doch nach Wochen in engen Schützengräben zusammengedrängt haben viele auch gelernt, den individuellen Körpergeruch ihrer Kameraden zu unterscheiden. Was manchmal den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten kann.
Doch jetzt sind alle anderen Gerüche verschwunden, verdrängt vom dicken und widerlich süßen Gestank der Gefallenen. Die Aufräumarbeiten auf dem Schlachtfeld haben schon begonnen. Walker und die anderen halten es nicht aus. Die Leichen müssen unter die Erde. Vor der Stellung, die Walkers Kompanie gehalten hat, liegen besonders viele Tote, sodass sie wahrscheinlich genau in diesem Moment ihren Beinamen «Coffin Corner» bekommen hat.
Ja, drei Nächte lang[11] haben die Japaner Welle um Welle angegriffen, schreiend, rufend, heulend, brüllend, mit aufgepflanzten Bajonetten, Offiziere mit gezogenen Säbeln, mit einfachen Holzleitern, um über den Stacheldraht zu kommen, fest entschlossen, sich durchzuschlagen und den neu angelegten Flugplatz[12] einzunehmen, der ein Stück hinter ihnen liegt und der Grund dafür ist, warum sie überhaupt hier sind und warum das alles geschieht.
Dass es in einem solchen Massaker endete, liegt vor allem an zwei Faktoren. Was die japanische Infanterie so perfekt in der Verteidigung gemacht hat – Disziplin, Durchhaltekraft, Todesverachtung –, kann im Falle eines Angriffs zur Selbstvernichtung führen. So kamen sie immer wieder, ungeachtet der Verluste, von Mut, Übermut, Mut der Verzweiflung getragen, als wollten sie mit ihren Körpern den Triumph des Geistes über die Materie unter Beweis stellen.[13] Allerdings waren ihre Gegner auch ganz frische Soldaten, die niemals zuvor in einem Kampf gewesen waren, Nationalgardisten eben und somit per definitionem Amateure.[14]
Die allermeisten im neu zusammengestellten amerikanischen Truppenverband, die zu dieser Zeit auf dem Weg nach Großbritannien, Nordafrika oder in den Pazifik sind, haben denselben Hintergrund: Ihre Ausbildung war in der Regel zu kurz, und ihre Befehlshaber waren zu unerfahren, um den Eindruck von Hobbysoldaten abzuschleifen (was sie teuer zu stehen kommen wird). Das 164. Infanterieregiment hätte besser ausgebildet sein können als der Durchschnitt, doch Walkers vorheriger Bataillonskommandeur war ständig betrunken und kargte mit Schießübungen, weil er Munition hamstern wollte – um sie dann seinen Vorgesetzten zu präsentieren.[15]
Viele der alten Offiziere waren aufgrund von politischen Kontakten in ihre Positionen gekommen und deshalb unerfahren oder ungeeignet – oder beides. In den Monaten, bevor sie Guadalcanal erreichten, war die Fluktuation groß. Der frühere Regimentskommandeur war im zivilen Leben Bankier gewesen, dann aber durch einen Berufsoffizier ersetzt worden. Der versoffene Bataillonskommandeur war in aller Eile gegen einen der Kompaniechefs ausgetauscht worden. Der frühere Kompaniechef, ein inkompetenter und gewalttätiger Tyrann, war nach Schlägereien mit Untergebenen und einem Aufstand der Mannschaft degradiert und durch einen neu angekommenen Hauptmann ersetzt worden. Und der letzte große Schwund erfolgte, als der Bescheid kam, dass sie auf diese Insel versetzt werden würden, denn da entdeckten elf Offiziere plötzlich, dass sie von unterschiedlichen ernsthaften Krankheiten heimgesucht worden waren, und ließen sich mit sofortiger Wirkung krankschreiben – unter anderem der erwähnte Bataillonskommandeur und sein Stellvertreter. So viel Feigheit und Inkompetenz unter den Kommandeuren zu sehen, hatte demoralisierend gewirkt.
Immerhin ist Walkers Bataillon gut ausgerüstet. Vor der Abreise zur Insel bekamen sie zwölf zusätzliche Maschinengewehre, zwei zusätzliche Granatwerfer sowie eine Anzahl zusätzlicher, besonders für den Nahkampf im Dschungel geeigneter Handfeuerwaffen. Und die Soldaten haben alle – im Gegensatz zu den Marines an der Front neben ihnen – diese neuen halbautomatischen Gewehre vom Typ M 1.[16] (Viele Soldaten waren schon im zivilen Leben ausgezeichnete Schützen.) Außerdem ist die Stellung, die sie übernehmen sollen, gut ausgebaut und durchdacht, schlichtweg beispielhaft, mit weiten Kreisen von Stacheldraht bis sechzig Meter vor ihren Geschützstellungen.
Die hartgesottenen Japaner[17] waren wieder und wieder gegen etwas angestürmt, das schon im vorherigen Krieg Angriffe so gut wie unmöglich gemacht hatte: zusammenhängende, flankierende Geschützgürtel. Ein nie zuvor gesehener Geschosshagel aus automatischen und halbautomatischen Waffen, zusammen mit Unmengen von Handgranaten, Kartätschen aus leichter Artillerie und einem Regen von Projektilen aus Granatwerfern unterschiedlicher Kaliber, hatte bewiesen, dass die Materie durchaus immer über den Geist siegt, ganz gleich wie stark er ist – und manchmal sogar, weil der Geist so stark ist.
Doch natürlich war es ein harter Kampf gewesen, und in Dunkelheit und Verwirrung hatten sich einzelne Gruppen von japanischen Soldaten durch die Linien schlagen können. Sie kamen über den einfachen und schmalen Jeep-Weg, der direkt hinter der Stellung verläuft, bis zum Flughafen. Da wurden sie am Morgen gefunden, nachdem sie sich mangels weiterer Befehle und in völliger Erschöpfung schlafen gelegt hatten. Manche wurden im Schlaf getötet. Ab und zu tauchten neue verirrte japanische Soldaten auf. Sie wurden wie Kaninchen gejagt und ohne weitere Umstände erschossen.
Jetzt ist es vorbei. Nur der Gestank ist noch da.
Die Soldaten aus Charles Walkers Bataillon haben vor «Coffin Corner» im harten Lehmboden Massengräber ausgehoben, in die ungefähr hundertfünfzig Leichen passen. Sie zögern nicht lange. Es müssen weitere Massengräber her.
An diesem Tag sprengen sie ein Stück weiter östlich einen riesigen Krater in die Erde. Walker und die anderen ekeln sich immer mehr vor dem Zusammensammeln der zerfallenden Reste von etwas, das gerade noch Menschen waren. Sie überlassen es den koreanischen Sklavenarbeitern, die mit den Japanern auf die Insel gekommen waren, damit sie den neuen Flugplatz bauen – und die bei der Landung der Amerikaner zurückgelassen wurden.[18]
Ja, es ist vorbei. Das begreift Walker jetzt, denn nun tauchen die Souvenirjäger aus dem Tross und die hohen Offiziere zum Sightseeing auf, viele mit Kameras.[19]
Die Flugbasis Wyton liegt in Huntingdonshire in Westengland, knapp vierzig Kilometer nördlich von Cambridge, und sooft sich die Möglichkeit bietet, nehmen sie den Bus in die schöne Universitätsstadt, um dort zu feiern und Mädchen zu jagen. Wenn sie dann gut gelaunt, stark betrunken und vielleicht sogar sexuell befriedigt den Abend beenden, findet sich immer irgendein halbseidener Taxifahrer, der sie zurückbringen kann. Was teuer ist, denn sie fahren mit Schwarzmarktbenzin, doch das ist es wert. Niemand sagt es geradeheraus, aber alle wissen es: Sie könnten schon morgen tot sein. Allerdings verwendet auch niemand dieses Wort. Die offizielle Bezeichnung ist «missing» – «vermisst». Die Ausdrücke, die sie selbst verwenden, wenn jemand getötet wurde oder nicht zurückgekehrt ist, gleichen einer Palette an Euphemismen: jemand «got the chop», «bought the farm», «bought it», «hopped the twig», «is gone for six», «gone for a Burton» und so weiter.
Sein Name ist John Bushby, er ist zweiundzwanzig Jahre alt und Maschinengewehrschütze der 83. Staffel im Bomber Command der RAF. Seit Kindertagen am Fliegen interessiert, im zivilen Leben Schriftsetzer, hat er erst als Fallschirmpacker gedient. Schließlich schaffte er es durch beträchtliche Hartnäckigkeit, zu einem Kampfeinsatz versetzt zu werden: als MG-Schütze auf einem Bomber. Dass dies eine sehr gefährliche Sache ist, wusste er von Anfang an. (Das wissen sie alle, und sie sind sämtlich Freiwillige.) Er erzählt: «Wahrscheinlich war es von jenem Augenblick[20] an, dass ich in diesen Geisteszustand eintauchte, der alle kämpfenden Männer vor dem Gedanken an ihren eigenen Tod schützt: ‹Natürlich geschieht das, aber niemals mir.›»
Vor knapp zehn Monaten hat Bushby seinen ersten Einsatz geflogen, und schon ein paarmal war der Zufall auf seiner Seite. Nicht nur bei schwächelnden Motoren, schlechtem Wetter, einer Bruchlandung, Fliegerabwehrgranaten, die unangenehm nah explodierten, oder einem deutschen Nachtjäger, der nur wenige Meter an ihnen vorbeistrich, sondern auch buchstäblich: Einmal haben er und ein anderer Schütze Münzen geworfen, um zu entscheiden, wer von ihnen auf einen Einsatz gehen durfte. Bushby verlor, und der Bomber hob ohne ihn ab. Das Flugzeug wurde abgeschossen, und alle kamen ums Leben. (Er hat diese Münze aufgehoben.) Oder als er im Mai auf einen Kurs geschickt wurde und deshalb zu seiner großen Enttäuschung die beiden ersten «Tausend-Bomber-Angriffe» auf Köln und Essen verpasste, nur um drei Wochen später zur Basis zurückzukehren und zu erfahren, dass der Bomber, mit dem er gewöhnlich flog, abgeschossen und alle Insassen getötet wurden.
John Bushby hat das abgeschüttelt, wie es für junge Männer vielleicht typisch ist – aber auch, weil es von einem erwartet wird, das zu tun. Das gehört zur Kultur des Bomber Command, ebenso wie das Trinken, das Scherzen, die unanständigen Gesänge, der zufällige Sex – keine Abteilung der Streitkräfte ist so stark von Geschlechtskrankheiten heimgesucht wie die Besatzungen der Bomber.[21] So wie man niemals mit Auszeichnungen angibt, niemals einen Befehl infrage stellt und niemals zeigt, dass man Angst hat.
Also ist Bushby weitergeflogen, äußerlich ungerührt, in der Regel beunruhigt, oft ängstlich, doch ohne es jemals zu zeigen oder darüber nachzugrübeln. Eine Existenz, die sich in ihren absoluten Kontrasten durchaus unwirklich anfühlt: am Abend noch betrunken und grölend heiter, am nächsten Tag schon extremer Lebensgefahr ausgesetzt, dann wieder zu Hause, betrunken und sicher auf einem Fest oder in der Umarmung eines nackten Mädchens.
Seit einer Weile hat ihn die Wirklichkeit eingeholt. Es begann bei der Besprechung über einen weiteren nächtlichen Bombeneinsatz über Deutschland. Bushby sah sich im Saal um, betrachtete die Gesichter, fing an zu zählen und erkannte, dass von den Piloten und Besatzungen der 83. Bomberstaffel, mit denen er seinen Dienst im Januar begonnen hatte, noch … zwei geblieben waren. Der eine sein Pilot, Bill Williams, ein Mann in Bushbys eigenem Alter, leicht zu erkennen an seinem schicken, gewachsten Schnurrbart, der andere: er selbst. Bushby erzählt:
So wie in diesem Augenblick hatte mich das noch nie getroffen, und mich packte fast ein Gefühl der Panik, als wäre ich gefangen, erstickt von etwas, das dabei war, sich um mich zu schließen, wogegen ich machtlos war. Das konnte so nicht weitergehen. Ich war ich, mit von Blut durchströmten Adern, mit funktionierenden Sinnen, Fasern, Muskeln und Gehirn. Ich war am Leben, aber so viele waren es nicht mehr. Das konnte so nicht weitergehen. Die Wahrscheinlichkeit stand dagegen.[22] Warum ich? Warum ich, wenn sich so viele andere genauso wie ich aufgemacht hatten, aber nicht zurückgekehrt waren?
Hat Bushby darüber nachgedacht aufzuhören? Möglicherweise. Ist er weitergeflogen? Selbstverständlich. Er hat sich sogar freiwillig zu weiteren fünfzehn Einsätzen gemeldet.
Jetzt ist Anfang November. Das Wetter ist seit Tagen richtig schlecht. Viel Regen, scharfer Wind, manchmal sogar Gewitter. Deshalb stehen die großen viermotorigen Maschinen mit ihren schwarz gestrichenen Unterseiten da und warten, glänzend nass im Regen, wie schlafende Urzeittiere in den drei Hangars und draußen um die lange Startbahn herum. Vielleicht nutzen Bushby und die anderen die Gelegenheit, noch einmal zu feiern, in einem der verräucherten Pubs in den nahen Dörfern St. Ives oder Huntingdon oder sogar in einem Tanzlokal in Cambridge? Vielleicht spielen sie Karten oder schlafen in der kleinen Holzbaracke mit sieben Betten, die ihr Zuhause ist, denn wenn nichts anderes mehr geht, bleibt immer noch das Vergessen im Schlaf. John Bushby weiß: Sobald das Wetter aufklart, ist es wieder so weit.
Es gibt verschiedene Methoden, den Ernst der Lage für die italienische Armee hier an der Front von El Alamein zu bemessen. Ein deutlicher Indikator ist, dass die Schlachtfeldtouristen langsam verschwinden. Alle, selbst die Leute zu Hause, kennen das Phänomen, dass die großen und die kleinen Bonzen aus der Faschistenpartei dazu neigen, vage Order an die Front anzunehmen, wenn sie den Sieg riechen, und wie sie dann eine Zeit lang in ihren neuen, tadellos sauberen Uniformen herumstolzieren, nur um dann, sobald sie von den Journalisten in heroischen Posen fotografiert wurden mit all den Orden, die so wohltuend für Ego und Karriere sind und die sie aus unerfindlichen Gründen erhalten haben, schnell wieder ihre Sachen zu packen und abzureisen. Jetzt haben sie sich in Luft aufgelöst. So schlimm steht es also. Er verzieht das Gesicht.
Der Mann heißt Paolo Caccia Dominioni, ein schlanker, sechsundvierzig Jahre alter Major, der, obwohl er formell zur Fallschirmjägerdivision Folgore gehört, einem Eliteverband, immer so einen schmissigen Alpenjägerhut mit Feder trägt. Oft raucht er Pfeife. Seit am 23. Oktober die britische Offensive begann, war das 31. Pionierbataillon zusammen mit der übrigen Folgore-Division im südlichen Abschnitt einem harten Druck ausgesetzt, einem sehr harten Druck.
Caccia Dominioni ist, wie alle höheren Kommandeure auf beiden Seiten, ein Veteran der Jahre 1914 bis 1918, dazu dekoriert, mehrmals verwundet, und das auf einem der meistgefürchteten Schlachtfelder, der Front am Isonzo. Gewiss gibt es hier bei El Alamein vieles, das an die schlimmste Zeit des vorherigen Krieges erinnert: die verfahrene Lage, der Stacheldraht, die Schützengräben, alles noch festgefahrener und starrer durch die hunderttausend Minen, die beide Seiten in aufwendigen Versuchen, ihre Linien zu schützen, verlegt haben. Und dann, als der Kampf endlich beginnt: Feuerwalzen, Granatregen, Stahlgewitter, so konzentriert, wie man es schlimmer seit 1918 nicht gesehen hat, und schließlich die Wellen der Infanterie, unterstützt von in Staub gehüllten Kolossen aus Stahl.
Bisher haben sie sich, eingegraben auf einer lang gestreckten Hügelkette, erstaunlich gut zur Wehr gesetzt. Die angreifende Infanterie ist niedergemäht worden, auch das auf eine Weise, die mehr an den vorherigen Krieg erinnert als an den gegenwärtigen. Trotz eines akuten Mangels an schwerem Gerät ist es ihnen sogar gelungen, die Panzer von sich fernzuhalten – vor allem mithilfe von Benzinbomben, Flammenwerfern und deutschen Kanonieren. Aber die Verluste waren hoch, auch für das 31. Pionierbataillon. (Besonders an drei erinnert Caccia Dominioni sich: Rota Rossi, den Fähnrich mit dem großen Hund, einsam bei einem extrem gefährlichen Einsatz auf einem der Minenfelder im Niemandsland gestorben; Santino Tuvo, den bärtigen Korporal, der, obwohl schwer an Kehle und Bauch verletzt, über einen Kilometer weit einen Mann mitgeschleppt hat, dem die Beine weggesprengt wurden; Carlo Biagioli, Quartiermeister, der, als sie wieder einmal aus der Luft angegriffen wurden, aus unerfindlichem Grund aus der Deckung sprang und mit seiner kleinen Maschinenpistole auf ein herannahendes Jagdflugzeug schoss, worauf er natürlich augenblicklich in einer Wolke aus Kugeln getötet wurde, «aufrecht und stolz, die Zigarette trotzig zwischen die Lippen geklemmt».)
Ja, Caccia Dominioni hat das alles schon einmal gesehen. Das hier ist ein Erschöpfungsschlag, eine Materialschlacht, ein Angriff, um sie in die Knie zu zwingen. Keine Finessen, keine schlauen Schachzüge. Hier wird nur gehämmert und gehämmert und gehämmert. Wer wird am längsten durchhalten?
Momentan ist es hier im Süden ziemlich ruhig. Bisher sind alle Angriffe zurückgeworfen worden. Was wird als Nächstes passieren? Haben sie vielleicht gesiegt? Caccia Dominioni blickt von der Hügelkette aus über das Niemandsland, wo die Wracks der britischen Panzer in den gebrochenen Strahlen der untergehenden Sonne leuchten, als seien sie aus Gold.
Das hier ist eine andere Welt: dunkel, eng, verschlossen, klaustrophobisch. Es ist eine Welt, die von zwei Sinnen dominiert wird: Geruch und Gehör. Geruch, weil die Luft zäh ist vom Gestank ungewaschener Leiber, von Schweiß und Essensdämpfen, vermischt mit dem klebrigen, fetten Dunst von Dieselöl. Gehör, weil ein U-Boot unter Wasser in jeder Hinsicht blind ist. Und genau wie das Gehör bei einem Menschen das fehlende Sehen ersetzt, ist hier jedes Geräusch, das von außen kommt, von Bedeutung, ein Gegenstand der Interpretation, der Angst oder der Hoffnung. Alle sind still, hören, horchen, bewegen sich vorsichtig.
Der Sonarmaat, der in seiner kleinen Abseite das Hydrofon bedient, gibt an, dass er das dumpfe und langsam ersterbende Schwirren der Schrauben eines Dampfers hört, in das sich ein anschwellendes Schraubengeräusch in höherer Tonlage mischt. Das kann nur eins bedeuten: Die mögliche Beute verschwindet, und ein Jäger nähert sich. Der Sonarmaat meldet es dem U-Boot-Kommandanten, Kapitänleutnant Horst Höltring, doch sagt er nicht «Jäger», sondern «Fahrzeug» – das ist die Umschreibung, die beide in solchen Situationen verwenden, um die Besatzung nicht unnötig zu beunruhigen. Denn dass ein Jäger sich nähert, ist immer eine schlechte Nachricht.
Es ist Sonntag, der 1. November, auf dem Atlantik, irgendwo zwischen der portugiesischen Küste und den Azoren, und das deutsche U-Boot U604 befindet sich seit 8.23 Uhr in Tauchposition. Ein weiterer Feindalarm hat sie hinuntergezwungen, denn im gleichen Takt, wie sich der Geleitzug, den sie angegriffen haben, entlang der afrikanischen Küste weiter nach Norden bewegt hat, sind immer mehr alliierte Flugzeuge gekommen.
Fünf Tage lang ist U604 im Verband mit sieben weiteren U-Booten wieder und wieder um den Konvoi gekreist, wie Wölfe um eine Schafherde. (Diese Metapher verwenden die Männer im U-Boot selbst gern, weil sie so von den nationalsozialistischen scheindarwinistischen Denkfiguren bestimmt ist: In der Natur herrscht der Starke, und die Schwachen können nicht nur untergehen, sie werden untergehen. In Verbänden anzugreifen, wird «Rudeltaktik» genannt, und in deutschen Zeitungen bezeichnet man die U-Boot-Männer gern als «graue Wölfe» des Meeres.[23]) U604 hat selbst drei Schiffe aus dem Konvoi auf den Meeresgrund geschickt. Das erste, ein Tanker, wurde am 27. Oktober südwestlich der Kanaren torpediert, drei Tage später traf es in schwerem Wetter einen großen Truppentransporter sowie einen kleineren Dampfer. Wie viele auf diesen Schiffen ums Leben gekommen sind, kann die Besatzung der U604 unmöglich wissen.[24] Und die Frage ist auch, ob es ihnen nicht einfach egal ist. Die Schlacht um Geleitzug SL 125 war ein weiterer Erfolg der deutschen U-Boot-Flotte. Von siebenunddreißig Schiffen haben sie zwölf versenkt, und das ohne eigene Verluste. Doch jetzt ist vom BdU[25] der Befehl gekommen, die Angriffe abzubrechen.
Das Schraubengeräusch in höherer Tonlage verstummt. Höltring gibt den Befehl, das U-Boot auf Periskophöhe zu bringen. Tausend Meter entfernt liegt ein Jäger und wartet auf den passenden Augenblick. Kurz darauf hören sie alle das schwache, schwirrende «Ping» vom suchenden Sonar des feindlichen Schiffes. Jetzt ist – ganz wie das Klischee es verlangt – der Jäger zum Gejagten geworden. Die Sonarwelle trifft auf den Rumpf des U-Boots, wird zu einem tieferen und klangärmeren «Bing». Sie sind entdeckt. Höltring gibt Order abzutauchen.
Kommandos und Handgriffe sind gut eingeübt. Das vordere Tiefenruder auf «Tauchen», das hintere auf «Null»; die Entlüftungsventile werden geöffnet, Wasser schießt in die Ballasttanks, die Nase des Bootes wird immer weiter nach unten gezogen, alle halten sich fest, um bei dem scharfen Tauchwinkel nicht wegzurutschen. Sie sind auf dem Weg «in den Keller», wie es im U-Boot-Slang heißt, und das Sonar des Jägers macht in immer kürzeren Intervallen «Ping» und «Bing» – er bewegt sich direkt auf sie zu.
Kapitän Horst Höltring ist erst seit ungefähr zwei Jahren in der U-Boot-Waffe und gehört nicht zu den bekannten und verehrten «U-Boot-Assen», die, sooft es nur geht, in den Filmen der Wochenschau gezeigt werden. Doch er ist kompetent und bei der Mannschaft beliebt, weil er keine unnötigen Risiken eingeht – was unter jungen U-Boot-Kapitänen, die Berühmtheit und das begehrte Ritterkreuz erlangen wollen, eher unüblich ist. Allerdings ist Höltring nervös und trinkt ein wenig zu viel. Eine ungewöhnliche Eigenheit von ihm ist auch, dass er immer bewaffnet herumläuft. Unter der Besatzung geht die Geschichte um, er habe sich einmal im Suff selbst in den Fuß geschossen.
Während Höltring also trotz allem bei der Mannschaft recht beliebt ist, wird einer der anderen Offiziere regelrecht verabscheut. Sein Name ist Hermann von Bothmer, Doktor der Universität Berlin, ehemaliger SS-Mann, guter Amateurflötist. Dass von Bothmer überzeugter Nazi ist, dürfte nicht das Problem sein – die meisten U-Boot-Männer, ob in hoher oder niedriger Stellung, sind Freiwillige, regimetreu und trunken von den nationalsozialistischen Idealen vom Krieg als dem höchsten Gut und so weiter. Vielmehr ist es seine pedantische und penible Art, die stört. Im stinkenden Innern eines U-Boots, wo es so eng ist, dass nur wenige aufrecht gehen können, und wo alle zusammengepfercht leben, entsteht eine quasidemokratische Gemeinschaft, ebenso aufgezwungen wie intim, die Großzügigkeit und guten Willen braucht, um zu überleben. (Die Kleidung spiegelt das wider: Nur wenige tragen eine Uniform nach vorgeschriebenen Regeln, die Ausrüstung der Kriegsmarine wird mit zivilen Kleidungsstücken vermischt, und Dienstgradabzeichen sind nur selten zu sehen.) In einem solchen Umfeld nervt es, ständig wegen Kleinigkeiten Ärger zu kriegen.
In hundert Metern Tiefe wird Befehl gegeben, die Tauchtanks auszublasen. Das wohlbekannte Dröhnen der Druckluft ertränkt vorübergehend alle anderen Geräusche. Das Boot wird auf null balanciert. Es wird Schleichfahrt angeordnet. Wie man es tun sollte. Es gilt, Batterien zu sparen. Über ihnen zieht der Jäger ein erstes Mal vorbei. Wasserbomben sinken herab.
Auf Fotos von vergleichbaren Situationen sieht man, wie Besatzungsleute instinktiv nach oben schauen, als gäbe es dort etwas zu erkennen. Nun hören und spüren sie eine Explosion, dann zwei, drei, vier, sieben – das Dröhnen ist betäubend stark, denn im Wasser verbreiten sich Geräusche besser als in der Luft. Tiefe: hundertdreißig Meter. Höltring befiehlt eine weitere Kursänderung. Das U-Boot wendet, bewegt sich vorsichtig nach oben. Es knirscht im Rumpf.
Dann kehrt der Jäger zurück. Neue Wasserbomben. Die Sekunden dehnen sich, vergehen quälend langsam. Tiefe: hundertzehn Meter. Ein, zwei, drei weitere Explosionen. Das Dröhnen ist lauter, der Druck noch härter. Glühbirnen zerspringen. Blinkendes Licht. Stille. Dunkelheit. Alle horchen angestrengt.
Das U-Boot bohrt sich durch das Wasser. Ein weiterer Jäger kommt dazu. Noch mehr Wasserbomben.
Vier Stunden später steigt U604 an die Wasseroberfläche auf, abgesehen von einer ausgeschlagenen Lenzpumpe und einigen kleineren Schäden an den Luftabzügen unversehrt. Die Jäger sind weg. Die Erleichterung unter den Männern ist riesig, als die Luke aufgeschlagen wird und ein mächtiger Strom frischer Luft ins Boot zieht. Sie haben soeben ihren ersten Wasserbombenangriff überlebt.
Als man Anfang des Jahres bei Warner Brothers mit den Dreharbeiten begann, waren weder die Erwartungen noch das Budget oder die Gestaltung in irgendeiner Weise bemerkenswert. Es sollte ein weiterer B-Film werden, mit B-Stars in den Hauptrollen – noch eine Geschichte mit Romantik und Spannung als Hauptzutaten und mit dem Krieg als Hintergrund. Seit April hat die amerikanische Filmindustrie achtundzwanzig Filme über Spione, Saboteure und Verräter in die Kinos gebracht, neunzehn weitere sind schon fertig. Hollywood ist mit Macht in den Krieg gezogen, und das, obwohl die plötzliche – und unterwartet erfolgreiche – Umstellung der amerikanischen Wirtschaft auf Kriegsbedingungen massenhaft große und kleine, wichtige und weniger wichtige Einschränkungen mit sich gebracht hat.
So haben zum Beispiel die Rationierungen von Benzin und Gummi dazu geführt, dass weder die Schauspieler mit Hauptrollen noch der Regisseur weiter in der Limousine zu den Aufnahmen gefahren werden; sie dürfen brav mit den übrigen Studiomitarbeitern im Bus fahren. Und die Rationierung von Kleidung bedeutete, dass die Kostümschneiderei alle teuren Stoffe abliefern musste. So ist dieser Film der erste, in dem ausnahmslos alle Baumwollkleider tragen. Die Menge an Rohfilm pro Produktion wurde um 25 Prozent reduziert, die Kosten für einzelne Szenenaufbauten wurden bei fünftausend Dollar gedeckelt, und draußen zu filmen, ist beschwerlich – auf den staubigen Hügeln um die Stadt, auf denen im Laufe der Jahre unzählige Cowboys vor den Kameras hin- und hergeritten waren, stehen jetzt Flakbatterien. So ist der Film, abgesehen von einer Szene, ausschließlich im Studio gedreht.[26] Und kurz nach dem Beginn der Dreharbeiten Anfang Mai wurde ein Ausgangsverbot von acht Uhr abends bis sechs Uhr morgens für ausländische Bürger aus feindlichen Nationen wie Deutschland eingeführt, was ebenfalls Probleme machte, weil der größte Teil der Schauspieler in dem Film Immigranten aus Europa und nicht wenige davon vor Hitler und dem Krieg geflohen sind.[27]
Die größte Einschränkung war jedoch, dass dieser Film, genau wie alle anderen, von der neu eingerichteten Zensurbehörde namens «Bureau of Motion Pictures» genehmigt werden musste.[28] Ehe ein Film produziert wird, haben die Verantwortlichen sieben Fragen zu beantworten, deren erste lautet: «Wird der Film dazu beitragen, den Krieg zu gewinnen?» Die zweite: «Welches Problem mit Information über den Krieg versucht der Film zu klären, zu dramatisieren oder zu interpretieren?» Die Filme sind in sechs Kategorien aufgeteilt worden, die auf unterschiedliche Weise die Aufklärung des Publikums oder die Interessen des Krieges befördern sollen. Das Thema des erwähnten Films hat die Behörde als der Kategorie III B zugehörig klassifiziert (soll heißen, er handelt von alliierten Nationen; «B» bedeutet, dass diese okkupiert sind), mit dem untergeordneten Thema II C3 («Feind – Militärisch»).