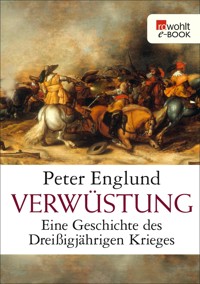
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges sind über Jahrhunderte im kollektiven Gedächtnis präsent geblieben. Millionen von Menschen kamen ums Leben, manche Gegenden im heutigen Deutschland und in seinen Nachbarstaaten wurden regelrecht entvölkert. Ausgehend vom Schicksal eines schwedischen Zeitgenossen schildert Peter Englund, wie der Krieg die Kultur, die Gesellschaft und die Geschichte in Europa geprägt hat und wie er die Menschen formte, die in seinen Mahlstrom hineingezogen wurden. «Englund vollbringt das Kunststück, die Ereignisse dieses ersten europäischen Krieges von den Staubwolken zu befreien, um sie dem Leser fast greifbar nahezubringen.» Deutschlandfunk
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1293
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Peter Englund
Verwüstung
Eine Geschichte des Dreißigjährigen Krieges
Über dieses Buch
Die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges sind über Jahrhunderte im kollektiven Gedächtnis präsent geblieben. Millionen von Menschen kamen ums Leben, manche Gegenden im heutigen Deutschland und in seinen Nachbarstaaten wurden regelrecht entvölkert. Ausgehend vom Schicksal eines schwedischen Zeitgenossen schildert Peter Englund, wie der Krieg die Kultur, die Gesellschaft und die Geschichte in Europa geprägt hat und wie er die Menschen formte, die in seinen Mahlstrom hineingezogen wurden.
«Englund vollbringt das Kunststück, die Ereignisse dieses ersten europäischen Krieges von den Staubwolken zu befreien, um sie dem Leser fast greifbar nahezubringen.»
Deutschlandfunk
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1993 unter dem Titel «Ofredsår. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt» bei Atlantis, Stockholm.
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, April 2013
Copyright © 1993, 1997 by Peter Englund und Atlantis
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München
(Abbildung: P. Palamedesz, Reitergefecht, 1635, akg-images)
ISBN Buchausgabe 978-3-499-62768-2 (1. Auflage 2013)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-48891-5
www.rowohlt-digitalbuch.de
Anmerkung: Die Seitenzahlen im Bild- und Kartenverzeichnis beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Karten: Deutschland und Europa
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Du musst herrschen ...
I. Der Mann im Schilf (1656)
1. Es ist unmöglich, ein einziges Bein zu retten!
2. Die letzten 80 Meter Mittelalter
3. Nach neunzehn Tagen kehrte der Verstand allmählich zurück
II. Die ersten Jahre (1625–1630)
1. Diese erbärmliche und elende Welt
2. Donnergrollen in der Ferne
3. Belehrung und Züchtigung
III. Der deutsche Krieg (1630–1638)
1. Ich bin der Löwe aus dem Mitternachtsland!
2. Fünf Schüsse im November
3. Wir haben Land von anderen gewonnen und unser eigenes ruiniert
4. Die Erde war mit Toten bedeckt
IV. Wendepunkte (1638–1641)
1. Alles läuft aufs Geld hinaus
2. Viele glaubten, es gebe keinen Gott mehr
3. Ein sonderbarer Schneefall in Beraun
4. Abschied von der Kindheit
V. Der Feuertaufe entgegen (1641–1643)
1. Ein Krieger stirbt
2. Rosetten appellieren ans Volk
3. Auf den Skorpion folgt eine Schlange
4. Geriet ich so unvermutet in den Krieg
VI. Der dänische Krieg (1643–1644)
1. Der brodelnde Kessel kocht über
2. Blitzkrieg im Norden
3. Wir lebten vom Tod umgeben
4. Endlich haben wir den alten Fuchs im Sack!
VII. Siege und Niederlagen (1644–1645)
1. So gut wie ein Junge
2. Die große Schlacht bei Fehmarn
3. Vier Meilen bis Wien
4. Ein letztes Treffen an dem runden Stein
VIII. Verpasste Gelegenheiten (1645–1647)
1. Die seltsame Belagerung von Brünn
2. Wir leben wie die Tiere, essen Rinde und Gras
3. Wurde aus einem Schreiber ein Soldat
4. Elf Tonnen Pulver in Demmin
IX. Der Westfälische Friede (1647–1650)
1. Zwei Meutereien und ein Kreis, der sich schließt
2. Die Schlacht bei Zusmarshausen
3. Königsmarcks großer Coup
4. Was sollen wir tun, wenn jetzt Frieden ist?
X. Der lange Nachhall des Krieges (1650–1654)
1. Landgewinne in Afrika und Amerika
2. Aufruhr und Zorn sind worden so groß
3. Einen Grafenhut gewinnen
4. Nach Jerusalem!
XI. Am Scheideweg (1654–1656)
1. In diesem Zeichen wirst du siegen
2. Die Katastrophe am Delaware
3. Eine Königin entsagt ihrem Thron
4. Am Scheideweg
Anhang
Nachweise zu den einzelnen Kapiteln
Quellen und Literatur
Bildverzeichnis
Tafelteil
Der Krieg
Exterieurs
Interieurs
Den Menschen, denen ich 1991 bei meinem Besuch an der Front in Kroatien begegnete und die nicht mehr leben
What passing-bells for these who die like cattle?
Karten: Deutschland und Europa
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Dieses Buch hat zwar eine Hauptperson, Erik Jönsson – später geadelter Dahlberg –, der historisch bewanderten Schweden als Militärperson und Zeichner gut bekannt ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Buch als Biographie anzusehen ist. Dafür beschäftige ich mich allzu wenig gerade mit dieser einzigen Person. Für mich ist er vielmehr zum Repräsentanten einer ganzen Epoche geworden. Diese Epoche ist das chaotische 17. Jahrhundert, und diese Zeit habe ich hier zu schildern versucht. Das vorliegende Buch ist der erste Teil einer geplanten Trilogie.
Das Phänomen, das im Mittelpunkt meines Interesses gestanden hat, ist, wie der Titel andeutet, der Krieg. Dieses Buch handelt unter anderem davon, wie der Krieg geführt wurde und wie er die Kultur, die Gesellschaft und die Geschichte in Schweden und in Europa geprägt und die Menschen geformt hat, die in seinen Mahlstrom hineingezogen wurden. Und mit «dem Krieg» meine ich hier den Dreißigjährigen. Er war zweifellos das allergrößte und nachhaltigste Ereignis des Jahrhunderts, eine Katastrophe von bis dahin unbekannten Ausmaßen, die sich wie ein Flächenbrand durch die europäische Geschichte ausbreitet. Der Schwerpunkt meiner Darstellung liegt auf seiner späteren Hälfte, einer Periode, die meist ziemlich beiläufig behandelt worden ist. Um die Mitte der dreißiger Jahre des 17. Jahrhunderts waren nämlich die großen heroischen Gestalten tot von der Bühne getragen worden – in seiner noch immer gut lesbaren Geschichte des Dreißigjährigen Krieges spricht Friedrich von Schiller davon, dass damit die Einheit der Handlung verlorenging, ein Standpunkt, den viele nachfolgende Historiker mehr oder weniger bewusst geteilt zu haben scheinen. Gleichzeitig löste sich auch vieles von der Rationalität des Konflikts und seine ganze Romantik in Luft auf. Übrig blieb somit ein Krieg, der aus dem Ruder gelaufen war, den wenige zu steuern versuchten, den niemand kontrollierte und unter dem alle litten. Es ist ein trauriger Anblick, der wenig Erbauliches, aber umso mehr Lehren bietet.
Glücklicherweise ist nicht alles nur Krieg. Es ist mein Vorsatz gewesen, neben der Schilderung der Großmachtpolitik im Großen und Kleinen, neben der Erzählung von dem jungen Erik Dahlberg und seiner Wanderung durch eine Welt, die – um ein Wort Thomas Manns zu benutzen – «ihre Kraft in Blutvergießen, Raub und Lust vergeudet, aber die doch unsterblich ist im Glanz ihrer Sünde und ihres Elends», noch einen Dritten, mehr kulturgeschichtlich orientierten Themenstrang einzuflechten, der eine gewisse Vorstellung davon zu geben versucht, wie es war, in diesem bemerkenswerten Jahrhundert zu leben. Es wäre freilich vermessen, das Resultat eine Synthese zu nennen, außer möglicherweise in einer Hinsicht. Alle Historiker stehen bekanntlich auf den Schultern ihrer Vorgänger, und schon ein flüchtiges Durchblättern der Quellenverweise und des Literaturverzeichnisses dürfte zeigen, in welch hohem Grad das vorliegende Werk auf der von anderen Kollegen geleisteten Arbeit aufbaut.
Es ist mir eine große Freude, dieses Buch auf Deutsch erscheinen zu sehen; es handelt schließlich von einer zentralen Periode unserer gemeinsamen Geschichte. Dass ich als Schwede diesen Teil der Vergangenheit aus einer schwedischen Perspektive betrachte, ist unausweichlich, doch habe ich mich bemüht, mich von einigen der absonderlichen Fesseln der nationalen Geschichtsschreibung zu befreien. Inwieweit mir dies gelungen ist, kann nur der deutsche Leser entscheiden.
Anmerkung der Redaktion:
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass der Verfasser das Datum historischer Ereignisse nach dem alten julianischen Kalender, wie bis zum 18. Jahrhundert in protestantischen Ländern üblich, und nicht nach dem reformierten gregorianischen Kalender angegeben hat.
Du musst herrschen und gewinnen,
Oder dienen und verlieren,
Leiden oder triumphieren,
Amboss oder Hammer sein.
J. W. von Goethe
Bet, Kindchen, bet, morgen kommt der Schwed
Wiegenlied aus dem Dreißigjährigen Krieg
I.Der Mann im Schilf (1656)
1.Es ist unmöglich, ein einziges Bein zu retten!
Von Rom nach Bug – Aufmarsch gegen Warschau – ‹Hilf uns, Jesus› – Die Dreitageschlacht – Der erste Tag – Das Heer im Sack – Schweden mit der Peitsche jagen – Der zweite Tag. Umgruppierung – Die Tataren reiten zum Angriff – Über Reitergefechte
Seit dem Tag, an dem er von Venedig losgeritten war, hatte es ununterbrochen geregnet. In acht Tagen musste er fünfmal den Hut wechseln, da der ständige, wolkenbruchartige Regen den Leim aus den Hüten wusch und sie unbrauchbar machte, doch der junge Mann wollte nicht anhalten, denn er hatte es eilig, zu dem neuen Krieg zu kommen.
Zwar hatte er vorher einige Tage in Florenz verweilt – wo der Großherzog ihm und seiner Reisegesellschaft sechs Flaschen weißen Verdecawein und einen Korb mit Früchten und Wildbret geschenkt hatte, nur weil er aus dem mächtigen Reich im Norden kam, gegen das des Herzogs Bruder zuvor während des großen Unfriedens gekämpft hatte –, aber danach war es vorwärtsgegangen. Er ritt Tag und Nacht: auf gewundenen Gebirgswegen über die Alpen, vorbei an Innsbruck nordwärts nach Nürnberg. Nachdem das Wetter auf der Höhe von Bamberg klar geworden war, ging die Reise noch schneller vonstatten, und in einem wahnwitzigen Tempo passierte er Jena, Leipzig, Wittenberg, Berlin. In der Nacht auf den 11. Juli erreichte er nach einem Tagesritt von 180 Kilometern Stettin an der Ostseeküste. Das war dreiundzwanzig Tage, nachdem er das sommerlich heiße Rom verlassen hatte.
Eigentlich hatte er vorgehabt, in Stettin, das ja eine seiner vielen Heimatstädte war, eine Ruhepause einzulegen. Aber im Hafen lag gerade eine bauchige Galeote zur Abreise nach Preußen bereit, wohin sie mit einer Ladung Munition gehen sollte. Wenn er dieses Schiff nicht nahm, würde er fast eineinhalb Monate auf die nächste Schiffsgelegenheit warten müssen, und so viel Zeit hatte er nicht, also ging er an Bord.
Der starke Wind führte sie hinaus auf die Ostsee. Das Schiff folgte der Küste, bis es drei Tage später in den Hafen der kleinen ostpreußischen Stadt Pillau einlief, von wo er sofort ins Landesinnere weiterreiste. Am nächsten Tag traf er einen Major, der auch auf dem Weg zu der schwedischen Armee war, die irgendwo ein Stück nördlich von Warschau stand. Die zwei ritten die Weichsel entlang nach Süden, und nachdem sie in Thorn die Pferde gewechselt hatten, erreichten sie am Abend des 17. Juli das Lager der vereinigten schwedischen und brandenburgischen Armeen. Der Ort war Nowy Dwór, nahe der Stelle, wo der Fluss Bug in die breite Weichsel einmündet. Das letzte Stück ritten sie über gepflügte Felder, auf die langen, flaggengeschmückten Erdwälle des Lagers zu, über den kleinen Graben, an den Wachtposten vorbei und hinein zwischen die Lagerfeuer, die Wagen und die langen, strengen Reihen von Zelten und angebundenen Pferden. Er war angekommen.
Doch auch hier bekam er keine Ruhe, denn es war etwas im Gange.
Die Truppen machten sich kampfbereit, und später am Abend begannen sie, ihre Familien und alle zivilen Helfer, aus dem Lager hinauszumarschieren, Richtung Südosten. Während die Abenddämmerung sich zum Nachtdunkel verdichtete, zog eine Kolonne nach der anderen, die Pferde Maul an Schwanz, in einer langen, schweigenden Reihe an einem mauerumstandenen Friedhof vorbei, hinunter in die buschbewachsene Flussebene und hinauf auf die neu erbaute Brücke über den Bug. Die ganze Armee war auseinandergezogen zu einer langen, sich windenden Schlange von etwas über dreißig Kilometern Länge. Zuerst kam die Reiterei: Östgöten, Uppländer, Småländer, Finnen und alle Söldnerregimente; 7500 Mann formiert in 37 Schwadronen. Die 58 Geschütze der Artillerie rollten ebenfalls hinüber. Danach folgte die Infanterie: Västgöten, Skaraborger, Södermanländer und die Übrigen; 2000 Mann in sechs Brigaden aufgeteilt. Der Mann folgte ihnen.
Die Schlange aus Männern und Pferden kroch langsam mit einer Geschwindigkeit von rund drei Kilometern in der Stunde voran. Die ganze Nacht vernahm man das Geräusch trampelnder Füße und klappernder Hufe, gemischt mit dem Ächzen der fünf Tage alten Brücke, die unter ihrem Gewicht schwankte. Die Trosswagen waren im Lager zurückgelassen worden, und stattdessen war an alle der Befehl ergangen, Proviant für drei Tage mitzuführen. Alles deutete darauf hin, dass ein Kampf nahe bevorstand.
Es waren wohl äußerst wenige, die wussten, wohin sie eigentlich unterwegs waren, während sie vermutlich im Halbschlaf in den langsam vorwärtskriechenden Kolonnen eingeklemmt standen. Sie bewegten sich, ohne Trommeln und klingendes Spiel, in die Richtung von Warschau und auf das große polnisch-litauische Heer zu, oder auf jeden Fall in die Richtung, in der man dieses vermutete.
Der Feind konnte nicht weit entfernt sein, denn die ganze Nacht schwärmten Haufen leichter litauischer Reiterei dort draußen im Dunkeln umher. Sie taten, was sie konnten, um die Überquerung zu stören: Sie waren eine Quelle der Irritation, doch keineswegs ein Hindernis. Der Marsch über den Bug ging langsam voran. Als gegen vier Uhr der Morgenhimmel aufzuflammen begann, stand das gewundene Band der brandenburgischen Truppen noch immer auf der Nordseite des Flusses und wartete. Da brach die Brücke.
Handwerker und Arbeiter kletterten sogleich auf ihr zerstörtes Skelett, und während die Sonne am Himmel heraufstieg, arbeiteten sie fieberhaft an der Reparatur der Brücke. Vier Stunden lang ruhte die Schlange aus Männern und Pferden auf ihrem Bauch, zur Hälfte jenseits des Flusses, vorübergehend zweigeteilt. Dann war die Brücke wieder einigermaßen heil. Die Schlange wand sich weiter.
Und es wurde Morgen, der erste Tag. Die Luft wurde langsam sommerwarm. Der Marsch der Soldaten nach Südosten ging weiter, auf ihrer Rechten das breite, glitzernde Band der Weichsel, auf ihrer Linken das Grün des Waldes und über ihnen der hoch gewölbte blaue Himmel. Gegen zwölf Uhr wurde haltgemacht, und die Soldaten bekamen Zeit, zu essen und sich neben dem sandigen Weg ein wenig auszuruhen. Da hatte der Kopf der Schlange ein kleines Dorf, Jablona, erreicht. Dort hatten bereits einige kleinere Zusammenstöße mit umherstreifenden litauischen Patrouillen stattgefunden. Die ersten polnischen Gefangenen wurden nach hinten geführt. Der Aufenthalt zog sich in die Länge.
Der König von Schweden, der korpulente Karl Gustav, und eine Reihe hoher Befehlshaber waren in einem rasch aufgeschlagenen Zelt verschwunden, wo sie aßen und Kriegsrat hielten. Offenbar war die Führung im Zweifel darüber, was zu tun sei. Nach einer Weile schien eine Art Beschluss gefasst worden zu sein, denn eine Truppe von 600 Reitern und Dragonern saß auf und verschwand in südlicher Richtung in der Hitze. Gleichzeitig erging der Befehl an die Verbände, sich in Schlachtordnung auf den Feldern um das kleine Dorf aufzustellen. Die zweieinhalb Kilometer breite Ebene zwischen den abfallenden Steilhängen zum Fluss hinunter und dem Wald wurde von Reiterei und Fußvolk in ihren rechteckigen Formationen überflutet. Damit die Kämpfenden besser zwischen Freund und Feind unterscheiden konnten, steckten sie sich nun Strohhalme an die Hüte oder umwickelten die Arme mit Strohbündeln. Das Losungswort des Tages wurde auch unter den Soldaten weitergegeben, es war «Hilf uns, Jesus!».
Gegen vier Uhr am Nachmittag konnten die Soldaten die scharfen Trompetenstöße hören, die zu Pferd riefen. Der Marsch ging weiter unter einer glühenden Sonne. Der Korridor zwischen dem Fluss und dem Wald wurde bald enger, und die dicht gestaffelten Rechtecke von Männern und Pferden wurden mehr und mehr zusammengedrängt. Vor sich vernahmen sie das entfernte Dröhnen von Schüssen. Die Vorhut hatte den Feind gefunden. Die Schlacht hatte begonnen.
Geschehen war Folgendes: Die Vorhut von 600 Mann war mit polnischer Reiterei zusammengestoßen. Nach einem kurzen Kampf flohen die Polen nach Süden. Die schwedischen Reiter stürzten sich Hals über Kopf in einen wilden Verfolgungsritt von gut fünf Kilometern. Die trockene Jahreszeit und der sandige Boden sorgten dafür, dass Jäger wie Gejagte in Staubwolken gehüllt wurden. Ein paar polnische Reiterverbände wurden plötzlich im staubigen Dunst sichtbar, mehr oder weniger überrumpelt, doch nach kurzem Gefecht verschwanden auch sie nach hinten über die Äcker. Die Schweden setzten ihnen nach, aber plötzlich entdeckten sie, dass sie, blind von all dem Staub, geradewegs in eine Reihe polnischer Befestigungen hineingeritten waren, die grau waren von Waffen. Die Polen eröffneten das Feuer mit allem, was sie hatten. Kartätschen, Musketenkugeln und Handgranaten prasselten auf die schwedischen Reiter herab. Die Gegner schienen jedoch ebenso überrascht worden zu sein wie die Schweden, und ein überstürzter Alarm rief die Männer hinter den Erdwällen zu Pferde. Der Kampf war nach wenigen Minuten vorüber. Die zischenden Projektile und der bedrohliche Anblick der Reitermassen, die sie hinter den Befestigungen erkennen konnten, ließen die schwedischen Reiter sich rasch zurückziehen.
Währenddessen trafen die schwedischen und brandenburgischen Hauptstreitkräfte nach und nach ein. Ein Verband nach dem anderen marschierte auf der Ebene auf, die vor den polnischen Befestigungen lag. Zu ihrer Linken hatten sie einen unregelmäßigen Sandrücken, der von der aus Buschwerk und vereinzelten, hochstämmigen Eichen bestehenden grünen Masse des Bialolekawalds bedeckt war, hier und dort unterbrochen von mehr oder weniger ausgetrockneten Sandflächen, die mit Erlen und Pappeln bestanden waren. Zur Rechten lag der Fluss, und vor ihnen war die Kette der polnischen Befestigungen und Wälle, die sich an den bewaldeten Sandrücken anschloss. Hinter den Befestigungen standen polnische Verbände kampfbereit Reihe hinter Reihe, gekrönt von einem Wald von Fahnen und Standarten, die im Sommerwind flatterten. Jenseits von ihnen, auf der anderen Seite der Weichsel, blitzte Warschaus buntes Gewimmel von hohen Ziegeldächern, Schornsteinen, Kirchtürmen und Palastspitzen auf. Und diesseits der Stadt lag eine lange Schiffsbrücke, die über die Weichsel führte, und darüber wand sich noch ein Strom, ein dem Anschein nach unendlicher Strom polnischer Truppen, um seinen Widersachern entgegenzutreten.
Es sah ganz und gar nicht gut aus.
Die schwedischen und brandenburgischen Truppen waren in einen engen Sack eingeklemmt; sie hatten Wasser auf der einen Seite, Wald auf zweien und polnische Befestigungen und Truppen auf der letzten. Die Ebene war viel zu schmal, als dass man auf breiter Front hätte vorrücken können. Die Verbände waren gezwungen, in doppelter Tiefe und in Reihen hintereinander Aufstellung zu nehmen. Der ganze Sack war rasch prall gefüllt durch die zusammengepresste schwedische Schlachtordnung; die Ebene wimmelte von Männern, Pferden, Piken, Feldzeichen, Kanonen und rastlos umherreitenden Offizieren.
Der gesamte Aufmarsch war von Chaos und Planlosigkeit geprägt. Wie die Vorhut vor ihnen ritten zwölf Reiterschwadronen blind von den dichten Staubschleiern ahnungslos direkt auf die polnischen Befestigungen zu. Es war ihnen unmöglich zurückzugehen, denn hinter ihnen drängte der Rest der Kavallerie nach. Sie waren daher gezwungen, vor den runden Schnauzen der polnischen Kanonen und Musketen stehen zu bleiben und, so gut es ging, vor deren schnellen Kugeln auszuweichen. Zu allem Überfluss reichte der Platz nur für die Aufstellung von fünf Schwadronen zum Kampf, der Rest war dem polnischen Feuer schutzlos ausgeliefert. Die alliierten Streitkräfte standen auf der staubvernebelten kleinen Ebene mehr oder weniger eingepfercht, und mehr drängten nach. Wenn das Unglück es wollte, konnten die Polen ihnen den Rückzug abschneiden und den Sack um sie herum vollständig zuschnüren.
Die Polen sahen die desorientierten Schwadronen, die vor der Befestigungslinie standen. Ein polnisches Reiterregiment wurde in einem Bogen über den Höhenzug geschickt, durch den Wald, um den falsch Gerittenen in den Rücken zu fallen und sie vom Rest der Armee abzuschneiden. Ihr Ritt wurde jedoch entdeckt. Als die polnischen Kavalleristen aus dem Waldrand brachen, ritten ihnen vier alliierte Schwadronen entgegen. Sie stießen unter krachenden Salven aufeinander; der Pulverdampf erhob sich in die Luft wie weiße Wogen und ließ umhergeschleuderte Menschenkörper mit verrenkten Gliedmaßen und verwundete, vor Schmerzen und Schrecken zappelnde Pferde zurück. Das polnische Regiment prallte ab und zog sich dezimiert zurück.
Eine Reihe verwirrter kleiner Angriffe und Gegenangriffe folgte. Vorsichtig, Fuß um Fuß, näherten sich Abteilungen mit alliierten Truppen den polnischen Befestigungen. Gruppen berittener Polen ergossen sich durch die Lücken zwischen den Wällen mit knatternden Standarten, breiteten sich aus, schwenkten auf die Alliierten ein, wurden von feuerspeienden Musketen und Pistolen empfangen und schwenkten in Rauch gehüllt wieder zurück. Inzwischen traf auch die Infanterie der Alliierten auf der Ebene ein. Niemand konnte sehen, was eigentlich auf der von Staubwolken verhüllten Ebene vor sich ging; man begnügte sich daher damit, das Fußvolk in zwei rund 700 Meter langen Linien aufzustellen, quer über den Korridor längs des Flusses und ein Stück entfernt von den polnischen Befestigungen. Hinter ihnen zogen sich die fahnenbekrönten Haufen der Reiterei in langen Reihen zusammen. Vor ihnen schleppten lange, zusammengekoppelte Pferdegespanne ein paar langhalsige Kanonen in Stellung. Am buschbewachsenen Rand einiger Äcker wurden Kugeln und Pulverfässer abgeladen, und die Kanoniere begannen, in das rauchige Irgendwo zu schießen, wo man die Polen vermutete. Beide Seiten warteten ab.
Während sich schon das Dunkel langsam über die Ebene senkte, hingen das Krachen und das Knallen der Kanonen und Handfeuerwaffen noch immer im lauen Wind. Der Teil der alliierten Reiterei, der in vorderster Linie stand, eingezwängt vor der eigenen Infanterie, litt am meisten. Brummende Geschosse rissen ein ums andere Mal Löcher in die dichten Reihen. Pferde und Männer stürzten in den Staub. Blutende Männer mit zerfetzten Gliedern, die von den Kanonenkugeln getroffen worden waren, wurden nach hinten getragen. Während das Dunkel sich verdichtete, sah die schwedische Führung ein, dass es sinnlos war, ihre Truppen entblößt und untätig vor den polnischen Feuerrohren stehen zu lassen. (Außerdem war die Reiterei für den Kampf im Dunkeln ganz ungeeignet, und die Führung kannte auch das Terrain nicht.) Es erging Order an sämtliche Streitkräfte, sich zurückzuziehen. Auf den Feldern verstreut lagen die Körper von Menschen und Pferden. An einzelnen Stellen sah man ganze Ketten von Toten säuberlich aufgereiht liegen: der Effekt einzelner Geschosse, die geradewegs die dicht gestaffelten Glieder von Männern durchschlagen hatten.
Noch um zehn Uhr am Abend fuhren die funkensprühenden Feuerbesen aus den polnischen Geschützen. Erst gegen Mitternacht ebbte der Waffenlärm im Nachtdunkel ab. Und so endete Freitag, der 18. Juli 1656.
Was eigentlich geschehen war, wussten nur wenige. Die alliierte Führung hatte am Tag zuvor erfahren, dass die gegnerische Streitmacht vorübergehend geteilt war – der erste Schritt eines polnischen Zangenmanövers gegen das schwedische Lager in Nowy Dwór –, die litauischen Streitkräfte standen auf dem östlichen Ufer der Weichsel, die Armee der Krone auf dem westlichen. (Außerdem waren die großen tatarischen Verstärkungen, die der Feind erwartete, noch nicht eingetroffen.) Karl Gustav hatte sich einen einfachen Plan ausgedacht, der darauf hinauslief, dass man eine Art Zentralposition einnahm, von der aus man seine Feinde einzeln angreifen und schlagen konnte. Zuerst würde man die Litauer auf dem östlichen Weichselufer überrumpeln, sie vernichten und die Brücke nach Warschau zerstören, bevor jemand ihnen zu Hilfe kommen könnte. Danach würden die Streitkräfte sich auf das westliche Ufer der Weichsel begeben und die Armee der Krone angreifen. Es kam jedoch ganz anders.
Der Einsturz der Brücke machte auch alle feinen Berechnungen zunichte. Der Aufmarsch der Alliierten verzögerte sich dadurch um gut acht Stunden. Und bei dem Dorf Jablona hatte die alliierte Führung eine unangenehme Nachricht bekommen: Ihr heimlicher Anmarsch war entdeckt, und die Polen waren dabei, ihre zerstreuten Streitkräfte zu sammeln. Einige in der Führung hatten da zu zweifeln begonnen. Die Voraussetzung der ganzen Operation war ja, dass man zum Angriff gegen das große feindliche Heer gehen sollte, während es zersplittert war. Einige sprachen sich für einen Rückzug aus, doch der schwedische König Karl Gustav, ein bekannter Spieler und Draufgänger, bestand auf dem Plan.
Die ersten Berichte, dass ihr Feind unterwegs sei, hatten die polnische Führung schon gegen zehn Uhr am Vormittag erreicht. Sie hatte deshalb reichlich Zeit, sich vorzubereiten. Auf der Nordseite des litauischen Lagers wurde ein hektisches Graben eingeleitet, und schon bald erhoben sich die Befestigungen, über die die Schweden später stolperten, aus dem sandigen Gelände, und sie wurden mit Kanonen und Musketieren gefüllt. Die heranziehenden Tataren erhielten Order, nicht gleich zur Hauptmacht zu stoßen, sondern in etwa zwanzig Kilometern Entfernung zu warten. Ihr Führer Kazi Aga befahl seinen Truppen, sich zu sammeln. Ihre Aufgabe war, den Alliierten in den Rücken zu fallen. Und die Armee der Krone hatte Order bekommen, sofort umzukehren. Alle verfügbaren Kräfte sollten auf dem westlichen Weichselufer gesammelt werden. Die Stimmung unter den polnischen Streitkräften war von heiterer Zuversicht geprägt, sie witterten einen großen Sieg; jemand hatte sich sogar bereits ausgedacht, wo die zwei Verbündeten, Karl Gustav und der Kurfürst von Brandenburg, nach der Schlacht gefangen gehalten werden sollten. Als die siegesgewissen Schwadronen der Hauptarmee über den Fluss ritten, konnten sie die polnische Königin Louise-Marie sehen, eine herbe Frau mit lockigem Haar und großen Augen, die in einer Karosse am westlichen Ende der Brücke saß und die Vorüberreitenden anspornte. Einer der Krieger rief zurück, dass sie die Schweden mit der Peitsche davonjagen würden. Gemeinsam würden sie am nächsten Tag «angreifen und dem ausgehungerten Feind den Garaus machen».
Dieser Tag hätte für die Alliierten richtig übel enden können. Es war ihr großes Glück gewesen, dass die polnische Führung ebenso wenig einen klaren Begriff davon gehabt hatte, was passiert war, wie sie selbst. Einen richtigen Versuch zur Einschließung der zusammengedrängten schwedisch-brandenburgischen Streitmacht in dem Korridor hatte es nicht gegeben. Die Verluste der dem Feuer der polnischen Artillerie ausgesetzten Truppen waren nicht unerheblich, aber sie hätten größer sein können, wenn die polnischen Kanoniere in ihren hohen Hüten, kurzen Jacken und knielangen Hosen nicht so schlecht gezielt hätten.
Zur Nachtzeit hielten die schwedischen und brandenburgischen Befehlshaber einen neuen Kriegsrat. Die Stimmung war, gelinde gesagt, düster. Gefangene wussten zu berichten, dass der König von Polen seine gesamte große Heeresmacht im Dunkel vor ihnen sammelte. Gerüchte besagten, dass die Polen 100000, ja vielleicht sogar 200000 Krieger zählten. (Der gerade aus Italien eingetroffene Mann hörte die Zahl 170000.) Die gesammelte Heeresmacht der Schweden und Brandenburger bestand aus 18000 Mann. Die hohen Offiziere, die während des Tages Zweifel geäußert hatten, waren jetzt nahezu mit Panik geschlagen. Mehrere von ihnen wollten den Kampf ganz einfach abbrechen. Die Stellung der Polen sei zu stark, meinten sie und fürchteten, man würde von ihrer Übermacht wie ein Tropfen im Meer verschlungen werden. Einer meinte entsetzt, es sei «unmöglich, daß ein einziges Bein der Unsrigen aus diesem Kampf mit einem starken und mächtigen Feind gerettet werden könne». Ein anderer forderte Karl Gustav auf, wenigstens sich selbst zu retten, solange dazu noch Zeit sei: die Armee zu verlassen und den Morgen nicht abzuwarten.
Karl Gustav wischte alle Befürchtungen vom Tisch. Er wollte einen letzten Versuch wagen und am nächsten Tag den Kampf aufnehmen. (Seine Einstellung war nicht ganz wahnsinnig. Wenn es schwer gewesen war, sich früher während des Tages umzubesinnen, so war es jetzt nahezu unmöglich geworden. Einem entschlossenen Feind, der nur ein paar Kilometer entfernt bereitstand, in nachträglicher Einsicht den Rücken zuzukehren, war mindestens ebenso gefährlich, wie ihm auf offenem Feld entgegenzutreten.) Er erklärte sich willens zu zeigen, «wie man mit Gottes Hilfe das Schlachtfeld erobert und der Hand des Feindes den Sieg entwindet».
Dazu brauchte man freilich zunächst ein Schlachtfeld, um das man kämpfen konnte. Das alliierte Heer kampierte zusammengedrängt in großer Unordnung auf dem schmalen Streifen zwischen dem Wald und dem Fluss. Die Stimmung unter den erschöpften Soldaten und Offizieren war von Missmut und der Furcht davor geprägt, am nächsten Tag auf einen Feind zu treffen, von dem sie mit allem Recht annahmen, dass er zahlenmäßig unendlich überlegen war. Die Ungewissheit war groß. Irgendwo im Nordosten brannte ein Dorf. Der Nachtwind führte das Dröhnen Tausender Pferdehufe heran, die drüben auf der polnischen Seite über die lange Schiffsbrücke trampelten. Es war offensichtlich, dass die Polen alles, was sie hatten, für den kommenden Tag zusammenzogen. Das dumpfe Geräusch setzte sich die ganze Nacht lang fort.
Als gegen zehn vor vier die Sonne aufging, ruhte der Morgen in Nebel gehüllt. Karl Gustav frühstückte: spanischen Wein und Semmeln. Ein Offizier, dem ein paar Stunden zuvor ein Arm abgeschossen worden war, war auch dabei, er trank auf den König und den Sieg und bat Karl Gustav, sich seiner Ehefrau und Kinder zu erinnern – eine Stunde später war er tot. Danach bestiegen der König, der Kurfürst von Brandenburg und einige höhere Offiziere ihre Pferde und ritten davon, um in dem milchigen Morgendunst Ausschau zu halten. Es war offensichtlich, dass die Alliierten nicht in dem Sack stehen bleiben konnten. Was sie jetzt vor allem brauchten, war Platz, Platz zum Aufstellen aller ihrer Schwadronen, Brigaden und Batterien. Und dieser Platz fand sich östlich des Höhenzugs und der polnischen Befestigungen. Dort, zwischen den beiden Dörfern Bialoleka und Bródno, breiteten sich weite Wiesen und Äcker aus. Dort würden die Alliierten ihre Leute aufstellen, und von dort würden sie den eingegrabenen polnischen Truppen auf dem Sandrücken in die Flanke fallen können.
Und es wurde Morgen, der zweite Tag. Wahrend die Sonne die weißen Nebelschwaden auflöste, die über dem Boden hingen, begannen die Schwadronen und Brigaden auf dem engen Feld am Fluss sich hin und her zu verschieben – es galt, Ordnung in die zusammengemischte Menschenmasse zu bringen. Vorn an der Front schossen ein paar Kanonen schwedische Losung – zwei Schüsse. In dieser Situation war dies eine Art Frage oder Herausforderung an den Gegner: «Ich will kämpfen, willst du?» Antwortete die andere Seite mit ihrer Losung, so bedeutete dies, dass sie die Herausforderung annahm und es zum Kampf kam. (Dieser sonderbare Brauch war teilweise ein Überbleibsel von den Schlachten des Mittelalters – die oft auf direkte Übereinkunft hin und unter der Oberaufsicht einer Art unparteiischer Schiedsrichter stattfanden, die hinterher die Entscheidung darüber fällten, wer gewonnen hatte.) Von der anderen Seite waren drei Schüsse zu hören: polnische Losung. Die Herausforderung war angenommen.
Zuerst eröffneten die Kanonen der Alliierten das Feuer, kurz darauf folgten die polnischen Geschütze. Die Schüsse fielen zunächst vereinzelt und tastend, aber sie verdichteten sich langsam zu einer Wand harter Knalle. Zum dumpfen Krachen der Kanonen verrichteten die Soldaten ihr Morgengebet. Unter dem kühlen, blauen Morgenhimmel nahm das Geschützfeuer an Stärke zu. Eine 700 Meter lange, still stehende Linie mit schwedischer Infanterie, Reiterei und rauchumwölkten Kanonen ging genau gegenüber den feindlichen Befestigungen in Stellung. Auf dem kilometerbreiten Feld zwischen den gegnerischen Linien ritten im Schritttempo kleine Gruppen irregulärer Kavallerie aus beiden Lagern nervös zwischen den Büschen umher und wechselten Schüsse.
In Deckung und im Schutz dieser rauchenden Mauer von Menschen und Pferden wurde der Plan der Alliierten gegen neun Uhr ins Werk gesetzt. In einem weiten Bogen zogen Kolonnen von Fußvolk und Reiterei nach links hinauf, durch das kühle Gewirr von Büschen und Eichen, über den Sandrücken, in nordöstlicher Richtung zu den weiten Feldern, die sich dahinter auftaten. Unter flackernden Laubschatten und in ausgetrampelten und sumpfigen Spuren folgten Kanonen langsam und knirschend.
Nach einer Weile waren von jenseits des Waldes Schüsse zu hören. Das war das Zeichen, dass der linke Flügel seinen Marsch durchgeführt hatte und dass es Zeit war für den rechten Flügel, der noch am Fluss stand, ihm nachzufolgen.
Da geschah es. Genau zu dem Zeitpunkt, als das Heer der Alliierten sich auseinandergezogen hatte und schwankend, mit je einem Bein auf den beiden Seiten des Bialolekawalds, balancierte, wurde es von einer Serie harter Schläge von verschiedenen Seiten getroffen. Die Polen gingen zum Angriff über. Eine größere Truppe von zwei- bis dreitausend Tataren offenbarte sich plötzlich wie eine dunkle Wolke genau im Rücken der Einheiten, die noch unten am Fluss standen.
Die Schlacht war in vielfacher Hinsicht ein Zusammenprall von Altem und Neuem, und das zeigte sich nicht zuletzt hier. Die Tataren waren ein halbnomadischer türkischer Volksstamm, der in den Steppenregionen des südlichen Polen und angrenzender Gebiete lebte. Sie waren eins der letzten Kriegervölker Europas und zu jener Zeit ein traditioneller Unruhefaktor im südöstlichen Europa. Sie verloren sich immer wieder in kriegerische Unternehmungen, liehen ihre Waffen mal diesem, mal jenem – Türken, Russen, Polen –, um sich zuweilen auf eigene Feldzüge kreuz und quer über die Grenzen zu begeben, die sie als neumodischen Firlefanz betrachtet zu haben scheinen, der wenig oder keinen Respekt verdiente. Sie waren wie blasse Schatten jener zentralasiatischen Kriegervölker, die während des Mittelalters eine Geißel der Christenheit gewesen waren. Ihre Armee war indessen keine Armee im modernen Sinn, sondern nur ein Bündel locker zusammengehaltener Banden irregulärer Reiterei, geeint durch ein gemeinsames Trachten nach Beute. Auch ihre Bewaffnung und ihre Art zu kämpfen waren von einfachster Art; als sie jetzt vorstürmten, fuchtelten sie mit Bogen und Spießen und rasselten mit Schilden und Krummsäbeln.
Die sechs schwedischen Reiterschwadronen, die ihnen entgegenritten, gehörten dagegen zu den allermodernsten und schlagkräftigsten Truppenverbänden, die man auf den Schlachtfeldern Europas sehen konnte. In ihren Händen hielten die Reiter ihre wichtigste Waffe, die Radschlosspistole. Diese Pistolen hatten ein grobes Kaliber (rund elf Millimeter) und waren lang (an die 75 Zentimeter) und schwer (fast zwei Kilo) – was sie zu einer brauchbaren Schlagwaffe machte, nachdem der Reiter den Schuss abgefeuert hatte. Die bis dahin vorherrschenden Handfeuerwaffen mit Luntenschloss – bei denen das Abfeuern mittels einer Art brennender Lunte geschah – waren allzu unhandlich, um von einem Mann benutzt zu werden, der zu Pferde saß. Das sinnreiche Radschloss – bei dem der zündende Funke entstand, wenn ein vermittels einer Feder gespanntes Stahlrädchen durch rasches Drehen gegen einen Feuerstein gerieben wurde – war für den Gebrauch im Sattel bedeutend einfacher. (Radschlosswaffen waren im 16. Jahrhundert in Österreich zeitweilig verboten, weil die leicht handhabbare Waffe unter den Straßenräubern dort in kurzer Zeit allzu beliebt geworden war.) Dies bedeutet allerdings nicht, dass es ein Kinderspiel war, sie zu benutzen. Im Kampf eine Radschlosspistole nachzuladen, während man auf einem Pferderücken schwankte, erforderte viel Übung und Fingerfertigkeit. Es handelte sich nämlich um komplizierte Maschinen – es gab Radschlösser, die aus bis zu siebzig Einzelteilen bestanden –, und dazu waren sie unsicher: Im Schnitt versagten sie bei jedem fünften Schuss.
Auf der einen Seite der große, wogende Haufen der Tataren mit seinem Durcheinander von wehenden Lanzen, Spießen und Wimpeln. Sie ritten schnell heran auf ihren feinen Pferden, wie aus einem Sack geschüttet. Auf der anderen Seite die dicht zusammengefügten Schwadronen in ihren kleinen, genau bemessenen Rechtecken, gut hundert Mann in jedem, in drei Gliedern aufgestellt. Der Zusammenstoß war kurz, wüst und verworren.
Warschau 1656
Als die schwedischen Reiter, die in den vordersten Gliedern ritten, ihren Gegnern so nahe gekommen waren, dass sie ihnen in die Augen sehen konnten, feuerten sie ihre Waffen ab. Der Abstand musste aus naheliegenden Gründen gering sein: Die Pistolen hatten eine wirksame Reichweite von rund zehn Metern. Als Antwort prasselte ein Schauer von Pfeilen über ihre Reihen nieder. Bevor das trockene Knattern der Salven verklungen war, steckten sie rasch ihre Pistolen fort und zogen die Degen. Sie warfen sich durch den weißen Rauch, den Tataren entgegen.
Es ist möglich, dass der Mann aus Italien bei ebendiesem Kampf zugegen war – allem Anschein nach war er während der gesamten Schlacht passiver Zuschauer. Er hat sie in einer Zeichnung festgehalten, «nach dem Leben gezeichnet» steht darauf. Die schwedischen Reiter stürmen geschlossen mit flatternden Hutkrempen und mit den Pistolen in den ausgestreckten Händen vorwärts. Die Mündungsfeuer zerreißen die Luft, und die dichten Rauchschwaden hüllen alle und alles ein und machen es schwer, Kameraden zu erkennen, die nur wenige Meter entfernt reiten. Ein Offizier feuert mit dem Degen seine Reiter an – oder weist er ihnen nur den Weg in dem blind machenden Rauch? Vor ihnen, hinter einem wogenden Rauchvorhang: ein wirres und schreiendes Durcheinander, wo Menschen kreuz und quer reiten. Manche drängen vorwärts gegen die Schweden, zusammengeduckt hinter ihren ovalen kleinen Schilden, als wehe ein starker Wind – in der Stellung, die Menschen, ohne zu denken und aus Instinkt einnehmen, wenn sie sich in starkem Feuer bewegen. Andere Tataren sind bereits auf dem Rückweg und schießen im Davongaloppieren unkontrolliert ihre Pfeile ab. Und zwischen den Hufen der Pferde, zerbrochenen Pfeilen, fallengelassenen Schilden und allerlei anderem Kram liegen die, die bereits verloren haben: über den Haufen Gerittene und Verwundete, die sich halb liegend zu schützen versuchen oder mit ausgestreckten Armen, gleich Ertrinkenden, um Hilfe flehen; andere liegen unter dem Gewicht gestürzter Pferde eingeklemmt und versuchen zappelnd, sich zu befreien; Verwundete winden sich in Schmerzen oder sind wie kleine Bündel zwischen dem trampelnden Gewimmel der Hufe zu erahnen, wo sie sich zusammengerollt haben und den Kopf mit den Armen zu schützen versuchen. (Auch wenn ein Pferd ungern auf einen lebenden Körper tritt, konnte eine Person von den Hufen doch schwer verletzt werden.) Und dann die Toten. Wie über den Boden ausgestreut liegen sie da, Arme und Beine von sich gestreckt, noch warm, vielleicht erst einen Atemzug vom Leben entfernt: die Gesichter verwandelt zu gähnenden Masken mit hängendem Kinn und zu dunklen Löchern ausgebrannten Augen. Dies war die hässliche Wirklichkeit hinter dem Begriff Kavallerieschock. Eine Szene, die sich in diesen Tagen stets aufs Neue wiederholen sollte.
Die Tataren prallten ab und wurden, mehr oder weniger in Auflösung begriffen, in das schützende Grün des Bialolekawaldes zurückgespült.
Die Polen griffen mehrfach von Süden und Osten an. Diese Angriffe endeten in etwa wie der der Tataren im Norden, und ihr Ablauf war betrüblich eintönig. Die Polen eröffneten mit lautem Schreien und einem geballten Ansturm, die Truppen der Alliierten empfingen sie mit Vollkugeln und heulenden Schauern von Traubenhagel aus ihren Kanonen. Die Polen wankten und wurden nach wenigen Minuten in wilder Unordnung zurückgetrieben, ohne an den Gegner herangekommen zu sein. Es hätte für die Alliierten übel ausgehen können. Zu ihrem Glück waren die Angriffe jedoch stets unkoordiniert und wurden immer nur von kleineren Teilen der gesammelten polnischen Streitkräfte ausgeführt.
Es war jetzt kurz nach zwölf. Offenbar verwirrt dadurch, dass die Serie wütender Angriffe nicht das geringste Ergebnis gezeitigt hatte, verharrten die Polen untätig in der Sommerwärme. Karl Gustav benutzte die Atempause, um den Truppen, die noch am Fluss standen, Order zu geben, unverzüglich zu den Truppen auf der anderen Seite des Bialolekawalds aufzuschließen. Die Armee musste vereint werden.
Ungestört konnten die Männer und Pferde die schon tief ausgetrampelten Pfade hinaufstapfen, die durch das feuchte und sonnenheiße Grün des Waldes führten. Bald war die ganze Armee am östlichen Rand des Waldes aufgestellt, in einer einzigen, rund 2500 Meter langen Linie vereint. Dann begann die gesamte Schlachtordnung sich zu bewegen, wie der Zeiger einer Uhr, der sich, ursprünglich auf zwölf zeigend, langsam auf fünf zudreht. Der äußerste Teil des rechten Flügels drehte sich am Waldrand auf der Stelle, während der linke Flügel in einem langen, weiten Bogen über die Felder zu dem Dorf Bródno schwenkte. Die lange Linie von Männern, Pferden und Kanonen drehte sich auf diese Weise um fast 180 Grad. Von der Ausgangslage ein Stück nördlich der polnischen Befestigungen mit dem Rücken zum Fluss und zum Wald sollte das Heer um diese herumgehen und auf einem breiten Feld seitwärts vom Lager mit dem Blick in Richtung Weichsel landen. Dies war ein schweres Manöver, das nur mit gut ausgebildeten Truppen durchgeführt werden konnte.
Langsam rückten Schweden und Brandenburger in der stickigen Hitze über das von kleinen Sandsenken und Bächen durchzogene Gelände vor. Tataren umschwirrten sie und stifteten Unruhe. Dicker Rauch begann von den niedrigen Häusern des Dorfes Bialoleka aufzusteigen. Bald brannte auch Bródno. Hier und da schwenkten Kanonen aus der alliierten Linie in Schussposition und sandten donnernde Salven über die Ebene. Dann rückte der große Zeiger der Schlachtordnung weiter vor über das grüne Feld und trieb verirrte Scharen von Polen und Tataren vor sich her.
Die dreitägige Schlacht bei Warschau 1656. Der Angriff der Tataren wird zurückgeschlagen. Stich nach einer Zeichnung von Erik Dahlberg
Auf einem der Sandhügel nördlich des Lagers befanden sich der polnische König Johan Kasimir, eine Gruppe Generale und Senatoren sowie die Königin und ihre Hofdamen. (Louise-Marie bewies weiterhin ihre Handlungskraft; früher am Tag hatte sie persönlich ein paar Kanonen auf dem anderen Ufer der Weichsel in Stellung bringen lassen, sodass sie gefährliches Flankenfeuer auf die alliierten Truppen abgeben konnten, die vor den Befestigungen standen.) Gegen drei Uhr wurden sie die lange, staubaufwirbelnde Schlachtlinie der Alliierten gewahr, die dort aufmarschierte. Sie waren alle vollständig überrumpelt von diesem schlauen Schachzug, der mit einem Schlag ihre Befestigungen mehr oder weniger wirkungslos machte. Es wurde Befehl gegeben, die eigenen Truppen um 90 Grad schwenken und sie auf den hohen Sandhügeln in Stellung gehen zu lassen, die Waffen und Gesichter gegen den draußen auf der Ebene heranmarschierenden Feind gerichtet. Dies war ein kompliziertes Unternehmen und dauerte gut eine Stunde. Währenddessen nahmen die schwedisch-brandenburgischen Truppen Aufstellung. Die lange Linie von Männern, Pferden, Kanonen und flatternden Feldzeichen erstreckte sich in einem Halbkreis vom Grün des Bialolekawaldes über die Ebene bis zu den Einfriedungen und Sümpfen des rauchverhangenen Dorfes Bródno. Sie waren bereit für den Gegenzug der Polen.
Die Kanonen und das polnische Fußvolk – das zum größten Teil aus deutschen und ungarischen Söldnern bestand – wurden aus ihren Befestigungen nördlich des Lagers abgezogen und auf den Sandhügeln aufgestellt. Sowohl hinter als auch vor ihnen sammelten sich lange, wogende Linien polnischer Reiterei. Die beiden Schlachtlinien standen ungefähr einen Kilometer voneinander entfernt, zwischen ihnen lag ein ebenes und flaches Feld mit Äckern, Büschen und ein paar verstreuten Wäldchen.
Kurz nach vier Uhr am Nachmittag kam der polnische Angriff.
2.Die letzten 80 Meter Mittelalter
Der Husarenschock – Über neue und alte Arten der Kriegführung – Nahkämpfe – Der dritte Tag – Von Sparr stürmt den Pragawald – Angriff auf den Höhenzug – Das polnische Heer bricht auseinander – Ausbruchsgefechte bei Bialoleka – Der große Kollaps
Dies war es, worauf alle gewartet hatten. Zwar hatten noch nicht alle Verbände vom westlichen Ufer der Weichsel die Brücke überqueren können, aber die polnische Führung wollte nicht länger warten. Das polnisch-litauische Heer bestand nicht, wie mancher bei den Alliierten glaubte, aus 200000 Mann, ja nicht einmal aus 100000, sondern zählte zu diesem Zeitpunkt nur etwas über 40000 Krieger. Es war eine überaus bunte Mischung; neben wilden und ungestümen Haufen berittener Tataren mit langen Mänteln, geschorenen Köpfen und kurzen, krummen Bogen sowie ausgehobenen Bauern mit Sensen und vereinzelten Schusswaffen konnte man Regimenter mit Dragonern und geworbener Infanterie sehen, die auf modernste Weise bewaffnet und ausgebildet waren. Die meisten Verbände bestanden aus Reiterei – das Fußvolk umfasste nur rund 4000 Mann. Die polnische Armee hier bei Warschau war dem Aussehen, der Denkart und der Kampfesweise nach altertümlich; sie war eine stolze und tapfere Armee zu Pferde, die Kühnheit, Panasch und individuellen Mut in Ehren hielt und nicht besonders viel für Drill, Schusswaffen und andere unnötige Innovationen übrighatte. Den Hauptteil des Heeres machte der Adel aus. Die vermögendsten und feinsten Adligen stellten die harte Elite der Armee: die Husaren. Jeder dieser Husaren war schwer bewaffnet mit einem Krummsäbel, langem Degen, Streithammer sowie einer über fünf Meter langen Lanze; außerdem trugen sowohl die Reiter als auch deren Pferde schöne Rüstungen und Kettenhemden, reich geschmückte Eisenpanzer und prunkvolle Kostüme. Sie hatten zu dieser Zeit begonnen, zu einem schönen Anachronismus auf den Schlachtfeldern zu verblassen, aber noch hielt sich ihr Ruhm. Sie hatten viele glänzende Siege hinter sich und hatten ein übers andere Mal überwältigende Ansammlungen russischer und türkischer Streitkräfte weichgeklopft. Noch 1605, also gut fünfzig Jahre zuvor, hatte die gefürchtete polnische Adelsreiterei eine ganze schwedische Armee auf dem hügeligen Schlachtfeld bei Kirkholm in der Nähe von Riga «wie eine Schar Hühner» niedergemetzelt. Die Husaren waren die Tapfersten der Tapferen, Polens Blüte und Stolz. Wenn irgendwer in der Lage war, den ausländischen Angreifern Paroli zu bieten, dann sie. Sie sollten die Speerspitze des Angriffs bilden, der darauf abzielte, die alliierte Schlachtordnung zu sprengen und den Feind in die Sümpfe bei Bródno zu jagen.
Husarenkompanien aus verschiedenen Regimentern wurden zusammengefasst, und den Befehl über die gesamte Streitmacht von rund 1000 Lanzen erhielt Hilary Polubinski, ein bekannter Edelmann, glatzköpfig, dickbäuchig und glotzäugig, mit fliehendem Kinn und arrogant gekrümmten Augenbrauen, der das litauische Regiment befehligte und offenbar ein unerschrockener Mann war. Langsam ritten sie die Sandhügel herab, ein farbenprächtiges Gewimmel unter einem hohen, blauen Sommerhimmel. Ein Stück hinter ihnen folgte eine weitere dichte Masse von Männern und Pferden: Es waren gut 4000 Kvartianer, berittene Grenztruppen, bei weitem nicht so ausgestattet und schwer bestückt wie die Husaren, aber doch in der Lage, mit Säbeln, langen Lanzen und Gewehren zu rasseln.
Die prächtige Erscheinung der Husaren bewegte sich über die Äcker in Richtung Osten. Sie hielten geraden Kurs auf den linken Flügel der Alliierten. Auf fünfhundert Meter herangekommen, gingen sie in Trab über. Sie wurden von der alliierten Artillerie begrüßt. Üppige weiße Wolken quollen aus den funkensprühenden runden Schnauzen, und Rauchbänke bauten sich vor den Batterien auf der anderen Seite des Feldes auf. Die scharfen Schnitte der Kugeln zischten durch die stauberfüllte Luft zwischen die Reitenden. Hier und dort stürzten Pferde im Feuer. Eine Haubitzenbatterie eröffnete das Feuer und brachte das Kunststück fertig, eine rauchende Granate zwischen die Reitenden zu lobben (man schoss gegen die Reiterei gern mit diesen explodierenden Projektilen, um die Pferde zu verwunden oder sie in Panik zu versetzen). Während die Husaren heranwogten, ließen sie eine schüttere Schneckenspur von Toten und Verwundeten, Pferdekadavern und abgeworfenen Reitern hinter sich zurück.
Als sie noch etwa 150 Meter entfernt waren, gingen die Husaren in Galopp über. Wie ein greller und farbenschimmernder Wolkenschatten flogen sie über die unebenen Äcker heran. Je näher sie kamen, umso mehr verdichtete sich der Lärm über den Feldern. Die Kanonenschüsse fielen dichter und dichter. Das Donnern Tausender von Pferdehufen mischte sich mit dem Rasseln der Rüstungen, Beinschienen und Lendenpanzer, die aneinanderschlugen. Dann stieg ein lauter, vibrierender Aufschrei von den schwankenden Ketten von Männern und Pferden auf, Ketten, die immer unregelmäßiger wurden, je mehr das Tempo zunahm.
Für die Männer, die auf der anderen Seite mit den Waffen in der Hand bereitstanden, wurden die Details immer deutlicher, als der Abstand zwischen ihnen und den Heranreitenden rasch schrumpfte. Die Husaren waren wahrlich ein prachtvoller Anblick, ein Stück erlesener, kolorierter Märchenpracht zu Pferde, dem Aussehen wie der Haltung nach. Reich verzierte Schabracken und Mäntel leuchteten, und an den Rüstungen der Pferde funkelten Gold- und Silberbeschläge in der Sonne; von den Schultern der Husaren flatterten Felle von Tiger, Löwe, Panther oder Luchs, und von sonderbaren Gestellen hinter den Sätteln wehten Adler- und Reiherfedern.
Als nur noch rund 80 Meter übrig waren, gaben die Husaren die Zügel frei, und die Pferde gingen in den vollen Lauf über.
In dieser Form war in Europa seit über einem halben Jahrtausend Krieg geführt worden; schwere Reiterei hatte uneingeschränkt auf den Schlachtfeldern von Hastings 1066, Cresson 1187, Bouvines 1214, Cressy 1347, Tannenberg 1410 und so weiter dominiert – bei der letztgenannten Gelegenheit hatten die polnischen Husaren die stolze Ritterschaft des Deutschen Ordens vernichtend geschlagen. Die schwere Adelsreiterei und ihre ungestümen Angriffe hatten das gesamte soziale und wirtschaftliche System beeinflusst und bildeten einen Teil der Basis der großen politischen Macht des Adels. Einer der Hauptzwecke des feudalen Systems in seiner klassischen Ausprägung lag ja gerade darin sicherzustellen, dass die Fürsten in reichlichem Maß über gepanzerte Ritter, diese Embleme und Herrscher des mittelalterlichen Kriegs, verfügen konnten.
Als dann der Herbst des Mittelalters angebrochen war und der Feudaladel langsam und zunächst unmerklich von den Männern einer neuen Zeit – den Kaufleuten, den bürgerlichen Karrieristen, den Manufakturbesitzern – zurückgedrängt zu werden begann, hatte diese Entwicklung ihren Schatten über die Schlachtfelder geworfen. Dort hatte der Ritter zu Pferd zusehen müssen, wie er langsam, aber sicher verdrängt wurde durch den einfachen, nichtadeligen Fußsoldaten, der weder Ahnen und Traditionen noch Sporen aus Gold hatte, aber stattdessen, wie die Schweizer, lange Piken und eine beinharte Disziplin oder, wie die Engländer, schnell schießende Langbogen, die den gepanzerten Käfer aus mehreren hundert Schritten Abstand aus dem Sattel werfen konnten. Während daraufhin der Ritter im Westen im Verlauf der voraufgegangenen Epoche mit Sack und Pack die Schlachtfelder verlassen hatte, um sich zu einer schönen Dichtung vom guten Leben und edlen Mut verwandeln zu lassen, hielt er sich auf den Schlachtfeldern im Osten noch immer. Für Polubinski und die anderen hochadeligen polnischen Husaren, die jetzt auf ihren schmucken Pferden über die Äcker des Dorfes Bródno heransprengten, war der Kampf in vielfacher Hinsicht die einzige Beschäftigung, die eines wahren Aristokraten würdig war. Sein Schlachtruf war eine selbstbewusste Demonstration seines hohen Mutes, und der kriegerische Kampf hatte für ihn individuellen Charakter, er war noch Spiel und Sport. Die Schweden dagegen waren Europas führende Betreiber des neuen und modernen Krieges. Während viele Krieger auf der polnischen Seite noch Pfeil und Bogen benutzten, waren die Schweden schon lange dazu übergegangen, auf Musketen und andere Schusswaffen zu vertrauen; während die Polen noch stolze und mutige Individualisten waren, die sich in Scharen bewegten, doch am liebsten einzeln kämpften, glichen die disziplinierten, exakt gedrillten und straff geführten Schweden in ihren dicht geschlossenen und geometrisch vollendeten Formationen am ehesten einem Apparat, der mit nahezu maschinenmäßiger Präzision sowohl bewegt wurde als auch kämpfte.
80 Meter. So lang war die Strecke, als die polnischen Husaren aus dem Mittelalter in eine neue Epoche hineinritten.
Zunächst ging es genau wie erwartet. Sie stürmten heran, mit lauten Schreien, gesenkten, wimpelgeschmückten Lanzen und Pferden, die Schaum und Geifer schnaubten, und brachen wie ein wahrer Erdrutsch über den äußeren Teil des linken Flügels der Alliierten herein. Das Donnern der Pferdehufe, das Klappern der Ausrüstung und die Schlachtrufe der Husaren verschmolzen nun mit dem Krachen und Knattern des Gewehrfeuers der Schweden und Brandenburger zu einem undurchdringlichen, kompakten Dröhnen, als die zerrissene und wirre Masse von Pferden und Männern mit ihren dicht geschlossenen Widersachern zusammenprallte.
Auf kurze Distanz feuerte die brandenburgische Fußgarde eine mächtige Salve ab, die zwischen die Reiter prasselte; die Feuersalve war eine jener Erfindungen, die den Kampfstil der westeuropäischen Armeen revolutioniert hatten. Vier leichte Geschütze waren mit Kartätschen geladen, und sie wurden auch alle im selben Moment abgefeuert. (Jede Kartätsche enthielt rund 36 gewöhnliche Musketenkugeln; die vier Geschütze dürften also auf einen Schlag 140 Kugeln ausgespuckt haben.) Offenbar genügte es hier, zu diesem genau abgepassten Zeitpunkt zu schießen – die altertümliche polnische Reiterei hatte eine panische Angst vor diesen maschinenmäßigen Feuersalven. Die Husaren prallten in diesem Augenblick zurück. Aber einigen uppländischen und småländischen Schwadronen erging es weniger gut.
Die småländische Reiterei war nahezu halbiert worden, seit sie Anfang Juni 1655 auf dem Seeweg von Kalmar nach Polen gekommen war. Kämpfe und Entbehrungen hatten das Regiment auf eine Stärke von 473 Mann reduziert. Neben ihnen stand das uppländische Reiterregiment. Trotz seines Namens war es eine bunte Mischung, die außer aus Uppländern auch aus Sörmländern, Närkingern, aus Värmländern und Västmanländern und in Pommern angeworbenen Männern bestand. Der Verband war seit dem Beginn des Krieges in mehrere Kämpfe verwickelt gewesen, unter anderem bei Opoczno, Warka, Gnesen und Thorn. Ein Teil des Regiments war außerdem in polnischer Gefangenschaft verschwunden, als das schwedisch besetzte Warschau gut einen Monat zuvor kapituliert hatte.
War man einem schweren Kavallerieschock ausgesetzt, galt es, bis zum letzten Augenblick sein Feuer zurückzuhalten, damit die Salve den größtmöglichen Effekt erzielen konnte. Das hatten die brandenburgischen Fußgardisten gerade getan. Doch da die wichtigste Waffe der Reiter die Pistole war und diese Waffe eine so kurze effektive Reichweite hatte, mussten sie wirklich bis zum letzten Augenblick warten. Der heulende Ansturm der Husaren versetzte die Nerven in diesen zwei Verbänden in Schwingung. Sie feuerten eine knatternde Salve ab. Der Abstand war zu groß. Danach, statt wie gewöhnlich sofort mit dem gezogenen Degen den Polen entgegenzureiten, kam es offenbar zu einem kurzen Augenblick des Zögerns unter den Reitern. Das reichte. Die funkelnde Lanzenwand der polnischen Husaren war über den schwedischen Reitern, brach in sie ein. Menschen fielen im Rauch. Die Schwadronen gerieten in Unordnung, wichen zurück. Ihre Fahnen schwankten, wackelten, fielen. Eine Schwadron der Östgöta-Reiterei wurde mit in das Wirrwarr gezogen. Ungefähr die Hälfte der angreifenden Husaren sprengte sich wie ein riesiges Projektil durch die erste Linie der Gegner hindurch.
Die schwedischen und brandenburgischen Verbände waren wie üblich in mehreren Linien hintereinander aufgestellt: erstes, zweites und drittes Glied. Die schwedischen Verbände, die von dem Angriff überrannt worden waren, flohen nun durch die Lücken zwischen den Schwadronen des zweiten Glieds nach hinten. Die Husaren drängten weiter. Die Unordnung pflanzte sich in das zweite Glied fort. Die Regimenter aus deutschen Söldnern, die hier standen, setzten sich jedoch mit Pistolen und Degen zur Wehr. Die Husaren brandeten wie das Meer gegen den Felsen und kamen zum Stillstand. Die Wucht des Schocks ließ wie gewöhnlich nach dem ersten gewaltigen Stoß nach, und als die Husaren dazu noch einem peitschenden Musketenfeuer von der Seite ausgesetzt wurden, machten sie im Pulvernebel kehrt. Ohne Unterstützung der Kvartianer – deren Ansturm von einem schwedischen Gegenstoß, der sie in die Flanke traf, gestört worden war – zogen sie sich ungeordnet zurück. Als ein buntes Gewimmel verschwanden sie, zurück zu den Sandhügeln, wo die brausende Flut von Menschen und Pferden sich in kleinere Ströme teilte und außer Sichtweite verrann.
Der Angriff, der nur ein paar kurze Minuten gedauert hatte, war vorüber.
Zurück blieben rund 150 Husaren, die getötet oder verwundet worden waren, und eine große Menge ihrer schönen und wertvollen Pferde. Die schwedischen Verbände schlossen zueinander auf und formierten sich wieder in Schlachtordnung. Die durchbrochene Linie verdichtete sich aufs Neue zu einer lückenlosen Mauer. Die Krise war vorüber. Zumindest für den Augenblick. Die Husaren, das Beste, was Polen ins Feld führen konnte, waren gescheitert. In der folgenden Stunde wurden weitere Angriffe gegen verschiedene Teile der alliierten Linie vorgetragen. Polnische Reiterei rollte heran wie schnelle Gezeitenwellen: Ein paar schnelle Salven und ein paar hastige Stöße mit Lanze oder Degen, und dann flutete die Gezeitenwelle wieder zurück. Alle Angriffe prallten ab, und keiner von ihnen stieß so weit vor, wie es den Husaren bei ihrem ersten Schock gegen den linken Flügel gelungen war. An einigen Punkten kam es zu kurzen, doch ergebnislosen Nahkämpfen. Die schwedischen und brandenburgischen Soldaten machten meistens keine Gefangenen – die Feinde, die sich zu ergeben versuchten, wurden mit dem Ruf «Warschauer Akkord» getötet, was darauf anspielte, dass eine Reihe schwedischer Gefangener bei der Kapitulation Warschaus getötet worden waren. Es waren grausige Begegnungen, diese chaotischen Treffen, bei denen die Leute mit Pistolen schossen und mit scharf geschliffenen Säbeln und Degen aufeinander einhackten, -hieben und -schlugen. (Man kann sich leicht das Ergebnis eines solchen Kampfes mit blanken Waffen vorstellen; erschöpfte Männer mit vor Schreck geweiteten Augen reiten davon, Gesichter und Kleider verwüstet, einige mit blutenden Händen, nachdem sie versucht haben, sich gegen sausende Hiebe zur Wehr zu setzen: die Handflächen zerschnitten von tiefen Wunden, so tief, dass die Knochen hervortreten, die Finger abgehackt und baumelnd.)
Bei einem dieser Nahkämpfe war der König nahe daran, sein Leben zu verlieren. Während eines Kampfes erblickte nämlich einer der polnischen Husaren, ein Jakub Kowalski, Karl Gustav, der im vordersten Glied ritt. Der Husar folgte ihm mit dem Blick. Der König hatte die Gewohnheit, die rechte Hand mit dem Degen und dem Zügel hoch in die Luft zu halten, und als er einem Reiter im Glied zu nahe kam, blieb der Zügel an dessen Pistole hängen. Das Pferd des Königs, «ein apfelgrauer Engländer», wurde irritiert und bäumte sich auf. In diesem Augenblick gab Kowalski seinem Pferd die Sporen und warf sich mit gesenkter Lanze in dem staubigen Wirrwarr nach vorn. Der Stoß traf Karl Gustav gegen die Brust, in Höhe des Halses. Der Harnisch des Königs verhinderte jedoch, dass er eindringen konnte. Im Gedränge setzte Karl Gustavs Leibknecht Bengt Travare schnell seine Pistole gegen die Seite des Polen und drückte ab. Kowalski wurde vom Pferd geschleudert.
Überall auf dem Schlachtfeld wiederholte sich das schon bekannte Muster: Die Polen ritten tapfer an, wurden aber von heulenden Garben von Kugeln und Schrot begrüßt und mussten hübsch umkehren. Die Rufe der Polen, ihre schmucken Pferde und flatternden Tigerfelle halfen wenig gegen den maschinenmäßigen Drill und die mörderische Feuerkraft der Schweden und Brandenburger. Als sich der Staub legte und der übel riechende Pulverdampf in dem warmen Wind verweht war, konnten die alliierten Soldaten immer mehr tote und verwundete Polen auf den Feldern verstreut liegen sehen, umgeben von Blutlachen, Waffen, zuckenden Pferdekörpern und gestürzten Kadavern.
Die polnischen Truppen zogen sich entmutigt und zusammengestaucht in der Nachmittagssonne zurück, hinter die Sandhügel, wo sie in Verteidigungsstellung gingen und Verstärkungen heranholten. Nun war es an den Alliierten, zurückzuschlagen.
Um sich eine eigene Auffassung vom Zustand des Heeres zu bilden, ritt Karl Gustav an den aufgestellten Verbänden entlang. Um für den folgenden Tag die bestmögliche Ausgangslage zu bekommen, wollte er sich der Sandhügel bemächtigen, doch die Vorbereitungen dafür zogen sich in die Länge, und es begann zu dämmern. Als die Sonne gegen halb acht unterging, beschloss die Führung, dass es für heute genug sein sollte. Die schwedischen und brandenburgischen Truppen zogen sich unter dem Beschuss der polnischen Kanonen zurück, hinüber nach Bródno, wo das Feuer nun seine Arbeit getan und die Häuser in schwarze Skelette verwandelt hatte. Dort wurden sie in einem engen, etwa drei Kilometer langen Halbkreis aufgestellt, in dessen Mitte der Tross zusammengezogen wurde. Wachen und Vorposten wurden nach allen Seiten über die Felder ausgeschickt. Es galt, gegen einen polnischen Überrumpelungsversuch gewappnet zu sein.
An diesem Abend erhielt Bengt Travare, der Leibknecht des Königs, der seit dem Dreißigjährigen Krieg in seinem Dienst war, ein Lehen von vier Bauernhöfen als Dank dafür, dass er Karl Gustav das Leben gerettet hatte. Der König ließ auch Jakub Kowalski suchen. Er war tot. Mit einer Geste, die zeigte, dass der Traum vom Ritter keineswegs ausgestorben war, nicht einmal bei den Schweden, ließ er dessen Körper bergen. (Man barg auch den Leichnam eines polnischen Herzogs, den jemand erkannte, wie er nackt und zerschossen dalag, und legte ihn auf den Rüstwagen des Königs.) Die Befehlshaber der alliierten Armee trafen sich und hielten einen weiteren Kriegsrat ab. Die Stimmung war eine andere als am Abend zuvor, als Furcht und Mutlosigkeit geherrscht hatten; jetzt war sie von Ruhe und Zuversicht vor dem kommenden Tag geprägt. Karl Gustav war fast heiter. Eine drohende Niederlage war abgewehrt worden, und die Versammelten waren sich einig, am nächsten Tag direkt zum Angriff gegen die Polen anzutreten.
Der König befahl später bei Einbruch der Nacht, dass man seinen Wagen sowie seine «Küchenkalesche» vorfahren solle, damit er und sein Bruder Adolf Johan essen konnten. Danach legte er sich in den Wagen zum Schlafen. Für seine Soldaten gab es wenig von dem Ersten und nichts von dem Zweiten. Die meisten hatten keine richtige Mahlzeit gehabt, seit sie am Donnerstagabend aus dem Lager bei Nowy Dwór marschiert waren. Nun war es Samstagabend, und wieder blieben sie ohne Essen, sodass sie sowohl hungrig als auch durstig einschlafen mussten, soweit sie in dieser Nacht, ihrer dritten unter freiem Himmel, überhaupt schliefen. Die Nacht wurde unruhig. Die Tataren zogen draußen in dem dichten Dunkel umher und umkreisten unter Rufen und dem Abfeuern von Schüssen die gesammelte Armee, deren Verbände in Schlachtformation standen – vermutlich schliefen die Soldaten in Schichten, direkt an ihrem Platz im Glied, wo sie auch ihre Bedürfnisse verrichteten. Mehrmals wurde Alarm gegeben, aber die Offiziere hatten Schwierigkeiten, ihre erschöpften Soldaten wach zu halten.
Von der polnischen Seite hörte man die gedämpften Geräusche von Männern, die gruben und Bäume fällten, gemischt mit den dumpfen Lauten von Truppen und Wagen auf dem Marsch. Was würde als Nächstes geschehen?
Und so wurde es Morgen, der dritte Tag.
Kurz vor vier Uhr ging die Sonne auf. Nebel lag über den Feldern. Die Wachen und Patrouillen wurden eingezogen, und die Verbände begannen, sich in Schlachtordnung zu formieren. Anschließend wurde ein Gebet gesprochen. Tross und Verwundete wurden in Bródno zurückgelassen. Der milchige Nebel erschwerte die Sicht, sodass beide Seiten eine Anzahl von Patrouillen aussandten, um den Feind auszukundschaften. Aufgrund der schlechten Sicht stolperten diese Patrouillen immer wieder übereinander, und kleine, wirre Scharmützel flammten hier und da im Dunst auf.
Gegen acht Uhr hatte die Sonne die letzten Nebelschwaden über den Feldern aufgelöst, und die feindlichen Heere sahen sich wieder einander gegenüber. Beide Seiten warteten zunächst ab. Das alliierte Heer stand in einer drei Kilometer langen Linie genau den Sandhügeln gegenüber. Die Polen warteten auf der anderen Seite des Feldes, in einer über fünf Kilometer langen Kette, die sich von einer der Schanzen im Norden hinunterzog zu einem Wald, der ein Stück vor der Warschauer Vorstadt Praga diesseits des Flusses lag. Am Rand dieses Waldes hatten sie während der Nacht ein paar einfache Erdbefestigungen gebaut.
Als die Polen keine Miene machten anzugreifen, entschloss sich Karl Gustav zu handeln. Der erste Stoß sollte sich gegen die neuen polnischen Stellungen im Pragawald richten. Hatten sie den Wald in ihrer Hand, würden die Alliierten direkten Einblick in das polnische Lager haben und die Truppen auf den Sandhügeln umgehen und ihnen in den Rücken fallen können. Eine größere Abteilung mit Musketieren, Reitern und Kanonen wurde mit Richtung auf den Pragawald in Marsch gesetzt. Das Kommando über diese Truppen hatte Otto Christoph von Sparr – ein 50-jähriger Deutscher mit Hakennase und zusammengekniffenem Mund, der im Dreißigjährigen Krieg gegen die Schweden gekämpft hatte, aber nun als brandenburgischer General in ihrem Dienst stand. Es eilte, denn die Polen setzten ihre Arbeit dort fort, und es war wichtig, sie aus dem Gehölz hinauszuwerfen, bevor ihre Befestigungen und Sperren in Form gefällter Bäume allzu massiv wurden. Um Sparrs Flanke zu schützen, setzte sich der Rest der alliierten Linie in gemächlichem Tempo auf die Hügel zu in Bewegung.





























