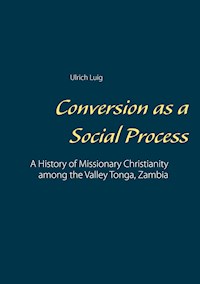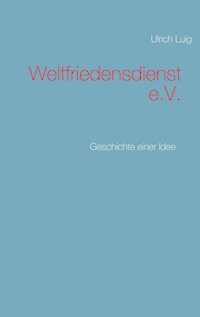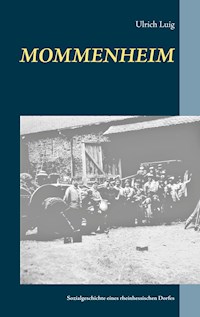
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Sozialgeschichte des Dorfes Mommenheim beschreibt die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im deutsch-französischen Grenzgebiet südlich von Mainz im Kontext der letzten 150 Jahre deutscher Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
VORBEMERKUNG
EINLEITUNG
KAPITEL: DAS DORF ALS LEBENSFORM MOMMENHEIM UM 1900
Haus und Hof - das Dorf als Lebensraum
Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe - die dörfliche Ökonomie
Wer hat, der hat - Landbesitz, Vermögen und sozialer Status
Formen des Zusammenlebens
Dorfkultur
Kirche im Dorf
Dorfpolitik
KAPITEL: DIE HISTORISCHEN VORAUSSETZUNGEN
Die Anfänge
Die Ganerben
Konfession und Politik
Die französische Herrschaft unter Napoleon
Rheinhessen wird "darmstädtisch"
Revolution, Nationalismus und die Entstehung der Vereine
Auswanderung
Konfession, Nationalismus und die Anfänge des Kaiserreichs
Krisenjahre - Feuer und Selbstmord
Schlechte Preise, schlechte Ernten – das Kreditwesen
Technischer Fortschritt
KAPITEL: DER ERSTE WELTKRIEG
Krieg
Staatliche Wirtschaftslenkung im Krieg
Die Kriegstoten aus Mommenheim
KAPITEL: FRANZÖSISCHE BESATZUNG UND WEIMARER REPUBLIK
Ende des Krieges, der Versailler Vertrag und die neue Republik
Die Situation auf dem Land
Französische Besatzung
Reparationen und Währungsverfall
Der "passive Widerstand"
Inflationszeit und Währungsreform
Schlechte Zeiten
Das Ende der Besatzungszeit
Der Verfall der Republik und der Aufstieg der NSDAP
KAPITEL: MOMMENHEIM IM "DRITTEN REICH"
1933 - Die "Machtergreifung"
"Ein Volk, ein Reich, ein Führer"?
Die Landwirtschaft im "3. Reich"
Die Beseitigung der Arbeitslosigkeit
SA und SS
Alltag im "Dritten Reich"
Politische Entwicklungen
Judenverfolgung
Das Euthanasieprogramm
Die neue Kirchenpolitik
Vorkriegszeit
KAPITEL: DER ZWEITE WELTKRIEG
"Für Führer, Volk und Vaterland"?
Der Anfang vom Ende
Die Opfer
KAPITEL: DIE NACHKRIEGSJAHRE
Kriegsende
Die Deutschlandpolitik der Siegermächte
Alltag in der Nachkriegszeit
Die Landwirtschaft in der Nachkriegszeit
Eine neue Wirtschaftspolitik
Zwei deutsche Staaten
KAPITEL: DEMOKRATIE UND SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT
Ein neuer Staat
Der Wiederaufbau der Landwirtschaft
Vereine und Dorfpolitik
KAPITEL: MOMMENHEIM VERÄNDERT SICH
Die Veränderung der dörflichen Ökonomie
Die Gemeindereform
Die "Neubürger" kommen
Mommenheim wird modernisiert
KAPITEL: VON DER "LEBENSFORM DORF" ZUR "LÄNDLICHEN LEBENSWEISE"
Vom Bauernhof zum Wohnort - das Dorf als Heimat
Land-Wirtschaft
Neue Sozialbeziehungen
Dorfpolitik unter neuen Verhältnissen
Ausblick
ZEITTAFEL ZUR GESCHICHTE VON MOMMENHEIM
LITERATURVERZEICHNIS
VORBEMERKUNG
Mommenheim ist ein typisches rheinhessisches Dorf, ca. zehn Kilometer südlich der Landeshauptstadt Mainz und damit am südwestlichen Rand des heutigen Ballungszentrums Rhein-Main gelegen. In der Erzählung seiner Geschichte spiegeln sich sowohl die sozialen und wirtschaftlichen Dynamiken eines kleinräumigen Gemeinwesens als auch die lokalen Besonderheiten eines unter speziellen Bedingungen gewachsenen dörflichen Milieus. Insofern hat auch diese nur leicht überarbeitete Neuauflage einer Geschichte Mommenheims nach fünfunddreißig Jahren ihre sachliche Berechtigung.
Als diese Geschichte Mitte der 1980er Jahr geschrieben wurde, befand sich der Ort mitten in einem bis dahin beispiellosen Veränderungsprozess. Dieser Prozess hat sich fortgesetzt. Durch die Erschließung weiterer Neubaugebiete ist die Einwohnerzahl auf über 3.000 angestiegen. Der Ausbau eines Gewerbegebietes an der Straße zum benachbarten Zornheim und der Bau einer Umgehungsstraße haben das Äußere des Dorfes deutlich verändert. Der Betrieb eines Golfplatzes in der unmittelbaren Umgebung Mommenheims zieht Golfspieler von weit her an, und auf der Bahntrasse fahren schon lange keine Züge mehr, sondern Fahrradfahrer. Dennoch hat sich Mommenheim seine Besonderheit und Eigenständigkeit weitgehend bewahrt unter den Bedingungen, die im 10. Kapitel skizziert sind.
Berlin, im April 2021
Ulrich Luig
EINLEITUNG
Das Dorf hat gleichsam zyklisch immer neu Konjunktur. In dem Maße, in dem den Städtern zum Bewusstsein kommt, dass ihnen die Natur unter den Händen zerrinnt, die von A. Mitscherlich diagnostizierte "Unwirtlichkeit der Städte" zunehmend konkreter Ausdruck für den Verlust von Lebensqualität im urbanen Bereich ist und Wirtschaftskrisen die Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen einschränkt, wird das Dorf als alternative Lebensform immer neu attraktiv. Es scheint, als habe sich im Hinterland der Städte eine Existenzweise erhalten, auf die in Zeiten der Krise des städtischen Lebens zurückgegriffen werden kann, um neue Zukunft zu gewinnen.
Diese Hochschätzung des Lebens auf dem Lande in Zeiten krisenhafter Prozesse in den Städten ist keineswegs neu, sowenig auch die Verachtung neu ist, die in Hochzeiten der städtischen Entwicklung den Dörfern entgegenschlug. Dabei waren die Klischees, die im Laufe der Geschichte vom Leben auf dem Lande entwickelt wurden, fast durchweg Produkte städtisch-bürgerlicher Phantasie, Gegenbilder zum Stadtleben, das mal als "Hort der Freiheit und des Fortschritts" bejubelt, mal als "verrucht und dekadent" beklagt wurde. Dementsprechend reicht das Vorstellungsarsenal der Städter über das Landleben von "natürlich und unverdorben" bis zu "unerträglich eng und hoffnungslos rückständig". Wen wundert es da noch, dass die Dorfbewohner angesichts solcher Wechselbäder zunächst einmal mit Misstrauen und Abwehr reagieren, wenn Kulturmissionare unterschiedlichster Profession in den Dörfern auftreten, um den neuesten Erkenntnisstand über das Leben auf dem Land unters Volk zu bringen. Verständlich wird von daher aber auch jener tiefsitzende Minderwertigkeitskomplex, der auch heute noch häufig in den Dörfern anzutreffen ist, jene schwankende Identität, die zwischen starrem Konservativismus und bedenkenlosem Modernisierungseifer pendeln kann.
Was also ein Dorf ist und was das Leben auf dem Dorf wirklich ausmacht, ist daher nicht nur höchst umstritten, sondern viele Aussagen über das Leben auf dem Lande sind zudem außerordentlich ideologieverdächtig. Es stellt sich also die Frage, wie die Lebenswirklichkeit der Menschen im Dorf so begriffen werden kann, dass Vorstellungen und Realitäten annähernd übereinstimmen. Bei der Beantwortung dieser Frage wird man zunächst davon ausgehen müssen, dass die Dörfer aufgrund ihrer geografischen und historischen Voraussetzungen nicht nur äußerlich sehr verschiedenartige Erscheinungsbilder bieten, sondern die spezifischen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse jedes Dorfes auch ihre je eigene Rationalität haben. Den lokalen Erfordernissen und Möglichkeilen der landwirtschaftlichen Produktion entsprechen soziale Hierarchien und Konkurrenzen, die die jeweiligen Lebensbedingungen im Dorf prägen, aber auch auf ihre Veränderung zielen. Aus dem Zusammenspiel dieser verschiedenen Faktoren ergibt sich eine jedem Dorf eigene Dynamik, deren Kenntnis den Verlauf der Lokalgeschichte erst begreifbar macht.
Es sind jedoch nicht allein diese inneren Verhältnisse, die den Verlauf der Geschichte eines Dorfes ausmachen. Die Lebens- und Arbeitsweisen der Menschen im Dorf waren immer auch verbunden mit den politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der Gesamtgesellschaft - ein Zusammenhang, der häufig unterschätzt oder gar übersehen wird. Kriege und Konfessionsstreitigkeiten, Wirtschaftskrisen und staatliche Eingriffe, technische Entwicklungen und der jeweilige Zeitgeist waren wesentliche, oft sogar entscheidende Faktoren für die Dorfgeschichte. Augenfällig ist dieser Zusammenhang vor allem in den letzten Jahrzehnten geworden, in denen sich viele Dörfer vor allem in der Nähe der industriellen Ballungszentren in einem Ausmaß verändert haben, wie das kaum zuvor in ihrer Geschichte der Fall war. Die Umstrukturierung der landwirtschaftlichen Produktion, die Abwanderung von Arbeitskräften in die Industrie und das Entstehen von Neubausiedlungen um die alten Ortskerne herum haben dazu geführt, dass sich herkömmliche dörfliche Lebensweisen und typische Lebensformen einer Industriegesellschaft heute im Dorf auf eine eigentümliche Weise mischen und überlagern.
Dieses Buch verfolgt das Ziel, den Prozess der Auseinandersetzung des rheinhessischen Dorfes Mommenheim mit den Problemen des 20. Jahrhunderts sichtbar zu machen. Die Darstellung der historischen Entwicklungen konzentriert sich daher auf das Zusammenspiel von Lokal- und Regionalgeschichte und den jeweiligen Folgen für das Leben in diesem Dorf. Viele dieser Entwicklungen sind anderenorts sicher ähnlich verlaufen, anschaulich und damit verständlich werden sie jedoch erst in der Konkretion der Geschichte eines bestimmten Dorfes.
Eine Dorfgeschichte, die den Ursachen und Wirkungen der jeweiligen historischen Prozesse nachspüren will. muss zunächst von den spezifischen Bedingungen des Lebens im Dorf ausgehen. Im ersten, einleitenden Kapitel wird daher ein Modell der Lebensformen in Mommenheim zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt. Das Dorf wird dabei als ein gegliedertes Ganzes erkennbar, das von landwirtschaftlicher Produktion, Besitzverhältnissen. Arbeitszusammenhängen, Sozialbeziehungen und Formen dörflicher Kultur bestimmt sind. Damit wird zugleich der historische Ausgangspunkt markiert, von dem aus die Menschen in Mommenheim die Entwicklungen der folgenden Jahrzehnte zu bewältigen hatten.
Wertvorstellungen, soziale Identitäten, politische Optionen und konfessionelle Ressentiments haben die Entwicklungen in Mommenheim meist ebenso stark beeinflusst wie Besitzverhältnisse oder Familienbindungen. Auch solche Bewusstseinsinhalte sind historisch vermittelt, selbst wenn sie in der aktuellen Situation oft nur in der Form des unbegriffenen Vorurteils zur Wirkung kamen. Um jene historischen Erfahrungen aufzuzeigen, die die Denk- und Verhaltensweisen der Bewohner Mommenheims geprägt haben, gibt das zweite Kapitel einen Oberblick über die wichtigsten Entwicklungen in der Geschichte dieses Dorfes bis zum Beginn des 1. Weltkrieges.
Die weiteren Kapitel folgen dann der Chronologie der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, an deren vorläufigem Ende das heutige Mommenheim steht. Dabei ist die Darstellung von dem Interesse geleitet, das Allgemeine im Besonderen konkret werden zu lassen, in dem Mikrokosmos Mommenheims die jeweiligen Auswirkungen der gesamtgesellschaftlichen Prozesse aufzuzeigen und anschaulich zu machen.
Danken möchte ich an dieser Stelle all jenen Mommenheimern und Mommenheimerinnen, die mir durch Informationen und Gespräche geholfen haben, das Dorf und seine Geschichte zu verstehen. Besonders dankbar bin ich für das Vertrauen, das sie mir dabei entgegenbrachten, denn Dorfgeschichte ist immer auch ein Mosaik von Lebensgeschichten bestimmter Menschen im Ort. Vielleicht hilft dieses Buch auch dazu, das Leben jener Generation besser zu verstehen, die diese verschiedenen Zeiten wirklich erlebt hat.
Mommenheim, im Juni 1987
Ulrich Luig. Pfarrer
1. KAPITEL: DAS DORF ALS LEBENSFORM MOMMENHEIM UM 1900
Mommenheim liegt im Gebiet des heutigen Rheinhessens ca. 15 km südlich von Mainz und 5 km westlich des Rheins. Die Nähe zum Rhein als wichtiger Verkehrsverbindung, das sonnenreiche und warme Klima sowie der fruchtbare Boden boten für die Menschen in den Dörfern dieser Gegend verhältnismäßig günstige Lebensbedingungen. Als Grenz- und Durchgangsland war Rheinhessen aber auch immer Außeneinflüssen ausgesetzt, die häufig Bedrohung und Bereicherung zugleich waren. Soldaten, Kaufleute, Missionare, wandernde Handwerker oder auch Flüchtlinge sind durch die rheinhessischen Dörfer gezogen und haben sich mitunter auch hier niedergelassen. Diese geschichtlichen Erfahrungen, die sich bis in unsere Gegenwart immer wieder neu bestätigt haben, sind der Hintergrund für die Lebensweise, die das Leben der Menschen in Mommenheim bestimmte. Dazu gehörte der notwendige Schutz vor Bedrohungen von außen, der sich auch in der eher abweisenden Bauweise des Ortes ausdrückt, und zugleich jene Offenheit und Lebensfreude, die für das Völkergemisch am Rhein typisch geworden ist.
Haus und Hof - das Dorf als Lebensraum
Bei feierlichen Anlässen stellen sich die Dorfbewohner auch heute noch gern als geschlossene Dorfgemeinschaft dar. Im Alltagsleben dagegen zeigt sich sehr schnell, dass der entscheidende Bezugspunkt für das Leben des Einzelnen der eigene bäuerliche Betrieb und die Familie ist. Von jeher war die selbständige Arbeit auf dem eigenen Hof die Lebensgrundlage für die meisten Familien in Mommenheim. Der Hof, die Arbeitsgeräte und weitgehend auch das Land waren Eigentum der Bauern; die Arbeitskräfte stellte in der Regel die Familie. D.h. die selbständige Verfügung über die Produktionsmittel bestimmte die Arbeit und das Leben der Bauernfamilien. Dieser Besitz, der die Existenz sicherte und die soziale Bindung an die Familie waren daher von elementarer Bedeutung in allen Lebensphasen, die der Einzelne durchlebte.
Von der materiellen Seite her bedeutete die Selbständigkeit im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb auch eine relative Arbeitsplatzsicherheit. Diese Selbständigkeit war aber verbunden mit unregelmäßigen und schwer kalkulierbaren Einkommensverhältnissen, die von den Wetterbedingungen und den jeweiligen Marktpreisen abhingen. Hausbesitz, Gemüsegarten und die Bereitschaft der ganzen Familie, eventuelle Einkommensverluste mitzutragen, bildeten jedoch eine Struktur, die bis zu einem gewissen Grad flexibel genug war, derartige Einbußen aufzufangen. Dies gelang freilich nur, wenn Arbeitsamkeit und Sparsamkeit als Werte beachtet und die ohnehin vorhandenen Risiken nicht noch durch unkluge Entscheidungen im Betrieb zusätzlich vermehrt wurden. Von hier aus wird einsichtig, worin Arbeitsamkeit. Sparsamkeit und Risikoscheu (Konservativismus) als "typische" Charaktereigenschaften der Landbevölkerung begründet sind.
Die landwirtschaftliche Produktion war vor allem bestimmt durch die Zuständigkeit für den gesamten Produktionsablauf. Von der Vorbereitung der Felder über die Aussaat bis zur Ernte und - z.B. beim Wein - der Weiterverarbeitung zum verkaufsfertigen Produkt lag nicht nur die Verantwortung, sondern auch die Arbeit in einer Hand. Dies erforderte eine höchst vielfältige Qualifikation in den verschiedensten Bereichen. Das nötige Wissen für all diese Tätigkeiten war in der Familie oder im Dorf verfügbar und wurde weitgehend informell vermittelt. Insofern war eine Familienfeier oder ein Besuch in der Gastwirtschaft durchaus eine Gelegenheit. Informationen auszutauschen, neue Entwicklungen zu bereden oder Geschäfte anzubahnen.
Das Dorf war neben dem Hof und der engeren Familie das unmittelbare Lebensumfeld, mit dem der Einzelne durch vielfältige Beziehungen verbunden war. Im eigenen Dorf lebten die Verwandten, hier ging man zur Schule, schloss man Freundschaften und häufig auch die Ehe. Hier wurde der Lebensunterhalt erarbeitet, Hof und Familie vorangebracht und schließlich wurde man hier auch alt. Diese lebenslange Bindung an den Ort ließ alle anderen Beziehungen zur Außenwelt zweitrangig werden. Hierin ist sicherlich eine der stärksten Wurzeln für jenen ausgeprägten dörflichen Lokalpatriotismus zu sehen, der nicht nur für Mommenheim charakteristisch ist.
Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe - die dörfliche Ökonomie
Die wirtschaftliche Grundlage des Dorfes bildete die Landwirtschaft. Fast alle Nahrungsmittel, die zum täglichen Leben gebraucht wurden, produzierten die Mommenheimer Bauern selbst. Die hohe Bodenfruchtbarkeit mit dementsprechend guten Ernteerträgen und die günstige Verkehrsverbindung zum nahen Mainz machten es jedoch auch möglich, eventuelle Überschüsse auf dem Markt zu verkaufen. Dadurch war das Dorf schon seit langem in die regionalen Marktbeziehungen eingebunden und somit auch von den Entwicklungen auf dem Agrarmarkt abhängig. Dies zeigt sich z.B. daran, dass bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts die ev. Pfarrer in der Pfarrchronik nicht nur die Ernteergebnisse für die einzelnen Jahre festhielten, sondern häufig auch die Erzeugerpreise für die einzelnen Produkte. Auch die Gründung der Mommenheimer Spar- und Darlehenskasse im Jahre 1892 ist ein Hinweis auf die starke Einbindung des Ortes in den Markt und den Geldverkehr.
Insgesamt betrieben die Mommenheimer Bauern eine ausgewogene Mischwirtschaft, um auf diese Weise das Risiko bei schlechten Ernteerträgen in einzelnen Anbaubereichen zu mindern. Um 1900 produzierten sie hauptsächlich Roggen, Weizen, Kartoffeln, Obst und Wein. Roggen und Kartoffeln bildeten die Grundlage der Selbstversorgung, während Weizen, Obst und Wein überwiegend für den Markt angebaut wurden. Wein war die ertragreichste Marktfrucht, die einen entsprechend hohen Stellenwert in der landwirtschaftlichen Produktion hatte. Die Redewendung "Mit einem Stück Wein (1.200 Liter) fährt man durch die ganze Scheuer" (d.h.: 1 Stück Wein ist wertvoller als der übrige Scheuneninhalt) belegt dies eindrücklich. Absatzschwierigkeiten oder ein Absinken der Weinpreise trafen daher die Mommenheimer Bauern stets besonders empfindlich. Bei ihren Entscheidungen über die Art der angebauten Produkte orientierten sich die Bauern daher durchaus an der aktuellen Marktlage. So berichtet Grimm (1912:119f.), dass die Mommenheimer Bauern um 1870 vom Weizen- zum Gerstenanbau überwechselten und ab 1910 mit dem Anbau von Zuckerrüben und Gurken begannen.
Zusätzlich zur Felderbewirtschaftung war die Viehhaltung ein wichtiger Produktionszweig. Da es in der Gemarkung kaum Weideland gab, wurde Vieh nur in Ställen gehalten, das Futter wurde angebaut. Neben ihrer Funktion als Zugtiere (Ziehkühe) dienten die Rinder vor allem zur Milchproduktion. Im Jahre 1912 wurden in Mommenheim täglich 2.500 Liter Milch nach Mainz und in die Rheinhessische Milchzentrale in Bechtolsheim geliefert (vgl. Grimm 1912:121). Die Ziegen waren vor allem für die ärmeren Familien zur Selbstversorgung mit Milch wichtig (die Ziege als die "Kuh der kleinen Leute"). Auch Schweinefleisch wurde außer für den Eigenbedarf ebenfalls für den Markt produziert.
In Ergänzung zur landwirtschaftlichen Produktion hatte sich aber auch ein dörfliches Handwerk und Gewerbe in Mommenheim entwickelt. Meist waren es ärmere Bauern oder Tagelöhner, die sich auf diese Weise eine zusätzliche Einkommensquelle schufen. Im Jahre 1912 gab es neben der Landwirtschaft folgende Berufe in Mommenheim:
3 Schneider
4 Maurer
2 Schmiede
3 Bäcker
3 Barbiere
2 Tüncher
1 Spengler
3 Metzger
5 Händler
1 Zimmermann
2 Küfer
6 Makler
2 Schreiner
4 Schuhmacher
2 Aufkäufer
2 Wagner
1 Sattler u.
Tapezierer
Ferner existierten 10 Gastwirtschaften und 5 Läden.
(Quelle: Grimm 1912:83).
Die Vielzahl der hier aufgeführten Berufe ist zum einen ein deutliches Anzeichen für die im Dorf entwickelte Arbeitsteilung und Spezialisierung, zum anderen aber auch ein Hinweis auf die enge Verzahnung der einzelnen Wirtschafts- und Arbeitsbereiche. Für die Bereiche Bau. Bekleidung, Nahrungsmittel und Handel gab es im Ort eigene Betriebe, die auf die Befriedigung der grundlegenden Bedürfnisse der Dorfbewohner ausgerichtet waren. Landwirtschaft. Handel und Gewerbe bildeten damit einen Wirtschafts- und Lebenszusammenhang, dessen einzelne Bereiche eng aufeinander bezogen waren und die in ihrer Gesamtheit die Voraussetzungen für das Leben in Mommenheim darstellten.
Wer hat, der hat - Landbesitz, Vermögen und sozialer Status
Das Leben und Arbeiten im eigenen bäuerlichen Betrieb war zwar das bestimmende Element für das gemeinsame Leben im Dorf, doch gab es innerhalb des Dorfes auch deutliche Unterschiede hinsichtlich des Landbesitzes der einzelnen Familien und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Möglichkeiten. Danach bemaßen sich Einfluss und sozialer Status. Von der Persönlichkeit und den Fähigkeiten der Einzelnen hing es jedoch ab, ob diese Möglichkeiten genutzt oder vertan wurden.
Die wichtigste Voraussetzung für die Bearbeitung der Äcker und Weinberge war neben der verfügbaren Arbeitskraft, die in der Regel von der Familie gestellt wurde, der Besitz von Pferden oder Kühen als Zugtiere für die landwirtschaftlichen Geräte. Daher war der Besitz eines oder zweier Pferde nicht nur Ausdruck der technischen Möglichkeiten zur Bearbeitung der Felder, sondern zugleich ein bedeutendes Symbol für den sozialen Status eines Bauern. Der Besitz eines Pferdes war in doppelter Hinsicht mit dem Landbesitz verknüpft: zum einen musste genügend Land vorhanden sein, um die verhältnismäßig hohen Anschaffungskosten (1.220 - 1400 Mark) zu rechtfertigen, zum anderen brauchte ein Bauer ca. 1.5 Morgen Haferfeld und 4 Morgen Kleefeld, um die Ernährung eines Pferdes für 1 Jahr sicherzustellen. Auf diese Weise waren Landbesitz, Verfügung über Arbeitsmittel und sozialer Status im Dorf eng miteinander verknüpft. Zugleich erklärt sich aus diesem Zusammenhang der ständige "Landhunger" der Bauern; denn nur durch vergrößerte Anbauflächen konnten die Einkünfte gesteigert werden. Da die verfügbare Nutzfläche innerhalb der Gemarkung naturgemäß begrenzt war, konnte Landbesitz nur durch Heirat, Erbschaft, Kauf oder Pacht vermehrt werden.
Jene Bauern, die zwei Pferde besaßen und somit doppelspännig arbeiten konnten, waren die wirtschaftlich potenteste und angesehenste Gruppe in Mommenheim. Mit einer gewissen Abstufung zählten zu den "Pferdebauern" auch jene, die lediglich ein Pferd besaßen. Diese arbeiteten bei bestimmten Arbeitsvorgängen, die zweispännig bewältigt werden mussten, mit einem anderen "Pferdebauern" in "Hufgemeinschaft" zusammen. Eine weitere Gruppe bestand aus jenen Bauern, die Kühe als Zugtiere verwendeten (Kuhbauern). Kühe waren als Zugtiere zwar nicht so leistungsfähig wie Pferde, kosteten aber weniger in der Anschaffung und gaben zusätzlich noch etwas Milch. Die wirtschaftlich und sozial am schlechtesten gestellte Gruppe waren die im Dorf wohnenden Tagelöhner, die über keinen oder nur äußerst geringen Landbesitz verfügten. Sie waren darauf angewiesen, als landwirtschaftliche Arbeiter bei den besser gestellten Bauern zu arbeiten, und wurden mit einem geringen Geldbetrag sowie mit Naturalien bezahlt. Daneben bewirtschafteten sie Hausgärten und kleinere Äcker, die häufig auf Pachtland angelegt waren und auf denen Kartoffeln und Gemüse zur Selbstversorgung angebaut wurden. Schließlich gab es noch eine Anzahl von Knechten und Mägden (Dienstboten), die in den größeren landwirtschaftlichen Betrieben angestellt waren und meist dort auch wohnten. Als Ortsfremde und in der Regel Unverheiratete, die auch nur auf Zeit im Dorf wohnten, waren diese Dienstboten jedoch nicht wirklich integriert in das dörfliche Leben und hatten dementsprechend nur ein geringes Ansehen, obwohl sie in materieller Hinsicht häufig besser gestellt waren als die Mommenheimer Tagelöhner.
Einen gewissen Einblick in die soziale und wirtschaftliche Gliederung des Dorfes gibt eine Übersicht über die Sparbücher bei der Mommenheimer Spar- und Darlehenskasse, die nach Berufsgruppen aufgeteilt ist (vgl. Grimm 1912, Anhang, S. IV ff.). Im Jahre 1911 waren aus Mommenheim 197 Personen Mitglieder der "Kasse", aus dem Nachbarort Harxheim 125 und 2 aus weiteren Orten. Unter den Mitgliedern waren 194 Landwirte, 55 Handwerker. 33 Arbeiter. 20 Beamte, 16 Kaufleute und Händler sowie 1 Arzt und 1 Genossenschaft (die eine motorgetriebene Dreschmaschine unterhielt). Die einzelnen Mitglieder der Kasse führten für ihre Familienangehörigen häufig mehrere Sparkonten. Nach Berufsgruppen unterteilt gliederten sich die Sparbücher in Mark wie folgt:
Gesamtguthaben pro Sparbuch
214 selbständige Landwirte
434.542,-
2.030,-
117 Handwerker u. Beamte
336282,-
2.874,-
40 landwirtschaftliche Arbeiter
9.373,-
234,-
27 Dienstboten
10.484,-
388,-
258 Kinder
41.046,-
159,-
Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, dass die selbständigen Landwirte sowie die Handwerker und Beamten über die größten Spareinlagen verfügten. Bei den Landwirten und Handwerkern wird man allerdings davon ausgehen müssen, dass die Spareinlagen zum größten Teil als Betriebskapital (für Pachten, Arbeitsgeräte und sonstige Arbeitsmittel) dienten. Ebenso wird das Spargeld der Kinder als Verfügungsmasse dem jeweiligen Familieneinkommen zuzurechnen sein. In vielen Haushalten gab es auch zweckgebundene Sparbücher, die zur Finanzierung der Aussteuer für die Mädchen oder zur absehbaren Auszahlung der Geschwister als Miterben angelegt worden waren. In den einzelnen Familien war also durchaus Geldvermögen vorhanden, das jedoch nicht als frei verfügbares Geld angesehen werden kann.
Während die Aufgliederung der Spareinlagen nach Berufsgruppen lediglich einen groben Überblick über die Vermögensverhältnisse im Dorf vermittelt, lässt eine weitere Aufstellung der in der Mommenheimer Sparkasse geführten Sparbücher allerdings eine kleinere Gruppe verhältnismäßig wohlhabender Bankkunden erkennen. Im Jahre 1911 bestanden bei der Spar- und Darlehenskasse Sparbücher mit folgenden Einlagenhöhen:
121 Bücher zu
bis 20 Mk Einlage
63 Bücher zu
bis 50 - 100 Mk "
163 Bücher zu
100 - 500 Mk
54 Bücher zu
500 - 1000 Mk
111 Bücher zu
1000 - 5000 Mk
36 Bücher zu
über 5000 Mk
(Quelle: Grimm 1912)
Vergleicht man diese Aufstellung der Spareinlagen mit den Anbauflächen der landwirtschaftlichen Betriebe in Mommenheim, so ergibt sich ein ähnliches Bild. Von den insgesamt 229 Betrieben in Mommenheim hatten bei der Landwirtschaftzählung im Jahre 1907 insgesamt 78 Betriebe eine Anbaufläche unter 1 Hektar. 37 zwischen 1 und 2 Hektar, 54 zwischen 2 und 5 Hektar, 49 zwischen 5 und 10 Hektar und lediglich 11 Betriebe zwischen 10 und 20 Hektar Land zur Verfügung. Landbesitz, Vermögen und sozialer Status hingen also in der Regel unmittelbar zusammen und bildeten die wichtigsten Merkmale für die soziale Gliederung des Dorfes. Dennoch waren die Unterschiede in den Besitzverhältnissen in Mommenheim nicht so ausgeprägt, dass sie sich zu einer strengen hierarchischen Ordnung verfestigen konnten. Wohl gab es ein "Oben und Unten" im Dorf, die "besseren und die geringeren Leut'", doch waren die Grenzen dazwischen nicht scharf, sondern eher fließend und konnten unter bestimmten Umständen durchaus auch durchbrochen werden.
Formen des Zusammenlebens
Die Art des Zusammenlebens im Dorf war vor allem geprägt durch den engen Zusammenhang von Arbeiten und Wohnen im bäuerlichen Familienbetrieb. Der Hof war nicht nur Arbeitsplatz, sondern zugleich auch Wohnstätte für alle, deren Existenz von diesem Betrieb abhing. Arbeit und Privatleben. Arbeitszeit und Freizeit, öffentlicher und privater Bereich durchdrangen und ergänzten sich daher auf eine Weise, die den Einzelnen eng in vorhandene soziale Beziehungen einband und ihm wenige Spielräume zur persönlichen Lebensgestaltung ließ. Dies galt vor allem für die Familie; denn meist konnte der Lebensunterhalt nur dann gesichert werden, wenn die Familienmitglieder im eigenen Betrieb mitarbeiteten. Die Familie im Dorf war damit nicht nur eine Verbrauchereinheit (wie die städtische Familie), sondern eben auch Produktionseinheit. Diese Tatsache bestimmte weitgehend die Geschlechterrollen und das Verhältnis der Generationen zueinander. So entschieden sich z.B. an der Partnerwahl nicht nur das persönliche Glück der zukünftigen Eheleute, sondern vor allem auch die Zukunft des Familienbesitzes und die Frage der Versorgung der nicht mehr arbeitsfähigen, älteren Familienmitglieder. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Familie nicht nur in der Kindheit, sondern auch im Erwachsenenalter mitreden wollte, wenn Lebensentscheidungen eines Angehörigen anstanden; denn jeder in der Familie war in seinem Bereich von solchen Entscheidungen mitbetroffen.
Diese engen sozialen Bindungen bildeten auch die Voraussetzung für die strenge Sozialkontrolle, die den Einzelnen daran hindern sollte, soweit über die Stränge zu schlagen, dass es anderen Gruppenmitgliedern in irgendeiner Weise schaden könnte. Auf diese Weise wurden aber auch einsame Entscheidungen verhindert oder erschwert, so dass in der Regel alle in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden mussten, die davon in irgendeiner Form betroffen waren. Dieser vom Prinzip her kollektiven Lebensform im Dorf entsprachen somit ein kollektiv kontrolliertes Normensystem und kollektiv gefällte und getragene Entscheidungen. Diese gegenseitige Abhängigkeit und Kontrolle existierte sowohl im engeren Bereich der Familie als auch - wenngleich mit einer geringeren Verbindlichkeit - in der Großfamilie, bei Freunden und Nachbarn und bei Vereinen und anderen Gruppen. In all diesen Beziehungen galt das Prinzip der Gegenseitigkeit: Hilfst du mir beim Ausbau meiner Scheune, helfe ich dir beim Transport von Düngemitteln; kommst du zu meinem Vereinsfest, gehe ich auch zu deinem. Gleichzeitig existierte innerhalb der Familie wie zwischen den einzelnen Betrieben. Vereinen und Gruppen auch ein deutliches Gefälle von Macht und Einfluss, so dass das geltende Konsensusprinzip zugleich durch das Konkurrenzprinzip begrenzt und bedroht war. Ebenso wirkte sich die unterschiedliche Konfessionszugehörigkeit in vielen Bereichen trennend aus. So bestimmten der Zwang zu Kooperation auf der einen Seite und der Wunsch nach größerer Entscheidungsautonomie und Besitzstandserweiterung auf der anderen Seite in ihrem Zusammenspiel jeweils die wirklichen Verhältnisse in den Familien wie im Dorf.
Diese durch vielfältige innerdörfliche Beziehungen und Verpflichtungen bestimmte Lebensweise verhinderte bzw. erschwerte aber zugleich auch die Entfaltung von Individualismus und Privatheit, die für das Stadtleben charakteristisch sind. Die selbstverständliche Gruppenzugehörigkeit zur Familie, Großfamilie, Verein etc. erzeugte eine halböffentliche Lebensweise, die anderen Gruppenmitgliedern die Wahrnehmung und Teilhabe an den eigenen Lebensvollzügen ermöglichte. Nur auf diese Weise konnte auch das Prinzip der Reziprozität, der gegenseitigen Anteilnahme und Hilfeleistung, in der Alltagspraxis zur Geltung kommen. Insofern hatte der im Dorf übliche Klatsch und Tratsch, die mitunter penetrante Neugierde in Bezug auf die persönlichen Lebensverhältnisse durchaus ihre reale und nicht nur negativ zu wertende Grundlage.
Die grundsätzliche Geltung des Konsensusprinzips und des Prinzips der Reziprozität machte aber auch den offenen Austrag von vorhandenen Konflikten nur in seltenen Fällen möglich. Je ausgeprägter die Abhängigkeitsverhältnisse waren - und dies traf insbesondere für die Familien zu -, desto häufiger wurden Konflikte verdrängt oder als individuelles Versagen des jeweils schwächsten Gruppenmitgliedes interpretiert. Davon waren Kinder, Frauen, die von außerhalb eingeheiratet hatten, und alte Leute am stärksten betroffen. Verzweiflungsakte wie Selbstmorde oder Brandstiftungen stellten daher in offenbar ausweglosen Konfliktsituationen die einzige Möglichkeit dar, dem Druck der Verhältnisse zu entkommen. Da ein solches Verhalten jedoch die Vorstellungen von "geordneten Verhältnissen" und "harmonischem Familienleben" tief bedrohte, vermied man es nach Möglichkeit, solche Verzweiflungstaten mit familieninternen Konflikten in Verbindung zu bringen. Daher wurden Selbstmorde und Brandstiftungen häufig als Ausdruck von Geistesgestörtheit angesehen und so in den Bereich des unbegreiflichen "Anormalen" abgedrängt.
Der Zwang zur Verdrängung von Konflikten konnte aber auch zum Ausbruch ungehemmter Aggressivität da führen, wo aggressives Verhalten erlaubt oder möglich war. Fastnachtsitzungen hatten wesentlich die Funktion eines ritualisierten Konfliktaustrages. Handfeste Streiche (z.B. während der "Hexennacht") oder der gezielte Einsatz des Dorfklatsches waren nicht nur Formen der Sozialkontrolle, sondern auch Möglichkeiten zum (verdeckten) Austrag von Konflikten. Direkt und mitunter mit erheblichen körperlichen Schädigungen wurden dagegen die bestehenden Konflikte häufig in den zahlreichen Gastwirtschaften ausgetragen, wenn die Hemmschwellen durch den Konsum von Alkohol herabgesetzt waren. Trotz aller Konflikte war jedoch das Harmoniemodell dasjenige, das durch die kollektive Lebensform im Dorf am stärksten begünstigt wurde und deshalb entsprechend hoch in der dörflichen Werteskala angesiedelt war. "Die große Familie" war und ist daher ein immer gern gebrauchtes Bild für das positiv erlebte oder auch nur vorgestellte Miteinander im Dorf. Die oben zitierten Hinweise auf die dörflichen Tugenden der Einigkeit und des Gemeinsinns bestätigen dies.
Dorfkultur
Die dörfliche Kultur war vor allem gekennzeichnet durch ihre enge Verbindung zum unmittelbaren Lebensvollzug der Menschen im Dorf und durch ihren weitgehenden Gebrauchscharakter. Die Schöpfer und Träger dieser Kultur waren zugleich auch ihre Konsumenten und umgekehrt. Ein typisches Beispiel für diese dörfliche Alltagskultur war die Bedeutung des Weines als der kulturell am höchsten bewerteten Marktfrucht, weil daran der enge Bezug zwischen Arbeit, sozialen Beziehungen und kulturellen Ausdrucksformen besonders deutlich wurde. Dieser Zusammenhang zeigt sich insbesondere daran, dass während der gemeinsamen Arbeit bei der Weinlese nicht nur gesungen, sondern bei den Pausen in den Weinbergen auch gegessen und anschließend getanzt und gefeiert wurde. Sicher war das Singen während der Lese auch ein Mittel, den Verzehr von Trauben bei der Arbeit möglichst gering zu halten, doch überwog dabei zweifellos die als positiv erlebte Verbindung zwischen Arbeiten und Feiern. Die relativ große Zahl von erhalten gebliebenen alten Fotos mit Motiven aus der Weinlese bestätigt daher nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die soziale und kulturelle Bedeutung des Weinanbaues im Dorf.
Zeiten geringer Arbeitsintensität - vor allem im Winter - waren auch Gelegenheiten zum Erzählen. Beim Reparieren von Gerätschaften, bei der aufwendigen Herstellung von Latwerge (Pflaumenmus), beim Spinnen oder bei sonstigen Handarbeiten wurde u.a. auch die Orts- und Familiengeschichte tradiert. Sagen oder Anekdoten zur allgemeinen Belustigung oder Belehrung weitergegeben. Nicht umsonst ist die handwerkliche Tätigkeit des Spinnens zum Synonym für eine ausschweifend fantasievolle Erzählweise geworden und hat sich so im allgemeinen Sprachgebrauch erhalten.
Die früher praktizierten Bräuche und Feste waren am Agrarzyklus sowie an den Jahreszeiten orientiert und hatten neben den sozialen oft auch religiöse Bedeutungen. Hinzu kamen bestimmte Riten, Praktiken und Normen für die als krisenhaft erlebten Lebensabschnitte Geburt, Pubertät, Hochzeit und Tod. Vereinsfahnen, Wappen, Hausinschriften, Möbel etc. waren Ausdruck einer bäuerlichen Kultur, die sich als kreative Bearbeitung der konkreten Lebenswirklichkeit der Menschen im Dorf herausgebildet hatte.
Einen besonderen Bereich dörflicher Kultur in Mommenheim stellten die Aktivitäten der verschiedenen Vereine dar. Obwohl die Vereinsidee erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts in den Dörfern Rheinhessens Verbreitung gefunden hatte, bildeten die Vereine sehr schnell einen wichtigen Faktor im sozialen und kulturellen Leben des Dorfes. Ihre Bedeutung zeigt sich bereits an der Zahl der im Jahre 1912 bestehenden Vereine. Dazu gehörten der
Kriegerverein (Vors.: Joh. Peter Kessel III)
Soldatenverein (Vors.: Gustav Adolf Wolff)
Kirchengesangverein (Vors.: Adam Ludwig Leib)
MGV 1862 (Vors.: Jean Niebergall)
Turnverein (Vors.: Georg Grimm)
Kasino (Vors.: Kaspar Herberg)
Rinderzuchtverein (Vors.: Andreas Heidt, Bäcker)
Verschönerungsverein (Vors.: Jakob Heinrich Grub I).
Ihre soziale Bedeutung erhielten die Vereine vor allem durch die Tatsache, dass sie neben den Familienverbänden als wichtigste soziale Klammern für das Dorf als Ganzes wirkten. Die Teilnahme einzelner Vereine an Wettbewerben und besonders die Veranstaltung von Festen hatten daher auch die Funktion, die Mitglieder beisammen zu halten und den Verein nach außen darzustellen. Das Amt des Vereinsvorsitzenden (häufig "Präsident") war mit hohem Prestige besetzt und dementsprechend begehrt. Dazu wurden natürlich nur solche Personen gewählt, die über ein ausreichendes Ansehen im Dorf verfügten. Erfolge oder Misserfolge des Vereins wirkten daher unmittelbar auf das soziale Prestige der Vereinsvorsitzenden zurück, betrafen aber ebenfalls die Ehre der einzelnen Vereinsmitglieder. Insofern hatte jeder Verein auch ein bestimmtes Ansehen im Dorf, das von seiner Mitgliederzusammensetzung und seinen Leistungen her bestimmt war.
Charakteristisch für diesen Zusammenhang ist ein Vorstandsbeschluss des damals sehr einflussreichen "Männergesangverein 1862 Mommenheim" aus dem Jahre 1900, nach dem
"von heute an keine auswärtigen Dienstboten, weder aktiv noch inaktiv in den Verein aufgenommen" werden sollten (Vereinsprotokoll vom 5.2.1900).
Auf diese Weise verhinderte man einerseits eine gleichberechtigte Stellung der sonst untergeordneten Knechte im Verein, andererseits wurde damit auch Ortsfremden der Zugang zu vereinsinternen Informationen verwehrt. Damit erklärt sich auch der verhältnismäßig hohe Identifikationsgrad der einzelnen Mitglieder mit "ihrem" Verein. Gleichzeitig barg das mit der Vereinsarbeit verbundene hohe Sozialprestige aber auch die ständige Gefahr in sich, dass innerörtliche Konflikte die Vereinsarbeit beeinträchtigen oder den Verein sogar spalten konnten. Insofern hatten die Vereinsvorstände in der Regel ein starkes Interesse daran, solche Konflikte aus dem Vereinsleben herauszuhalten, was jedoch nicht immer gelang.
Die besondere Bedeutung der Vereine für die Dorfkultur ergab sich aus ihrer doppelten Funktion als Träger der traditionellen Dorfkultur (z 13. bei der Gestaltung von feierlichen Anlässen oder Festen) einerseits und als Vermittlungsinstanz zwischen dörflicher und städtischer Kultur andererseits. Die Krieger-, Sport-, Gesang- und Verschönerungsvereine, die um die Jahrhundertwende in den rheinhessischen Dörfern existierten, waren von ihren Inhalten her überwiegend städtisch orientiert. Die Krieger- und Soldatenvereine gedachten ihrer Heldentaten in der Fremde, die Sportarten und -geräte der Sportvereine wurden in den Städten erfunden, die von den Gesangvereinen gesungenen Lieder von Städtern komponiert und getextet, und die Verschönerungsvereine bezogen ihre ästhetischen Ideale ebenfalls aus der Stadt. Diese Orientierung zur Stadt zeigt sich insbesondere an dem Gedankengut, das durch die Gesangvereine in den Liedertexten vermittelt wurde. So überwiegen z.B. in den Liedern, die anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Mommenheimer Männergesangvereins im Jahre 1912 gesungen wurden, solche Motive, die in verklärender Form Heimatgefühl, Naturerlebnisse, Soldatenschicksale, Liebe und Abschiedssituationen beschreiben (vgl. Festschrift MGV Mommenheim von 1912). Diese Inhalte bezogen sich also auf Lebenssituationen, die kaum einen Bezug zu den konkreten Alltagserfahrungen der Menschen in Mommenheim hatten.
Interessanterweise wurden aber offenbar in den Mommenheimer Gesangvereinen um die Jahrhundertwende keine Lieder mit nationalen oder militaristischen Inhalten gesungen (zumindest nicht bei offiziellen Anlässen wie Sängerfesten), obwohl das Wahlverhalten der Mommenheimer klare politische Optionen erkennen lässt. Dies erklärt sich dadurch, dass unter den Mitgliedern und auch im Vorstand beide Konfessionen vertreten waren, die in ihrem Verhältnis zu Preußen und zum Reich unterschiedliche Positionen vertraten. Da die gute Zusammenarbeit im Verein offenbar höher bewertet wurde als die jeweiligen politischen Überzeugungen, wurde die Politik nach Möglichkeit aus dem Vereinsleben ausgeklammert. Die dörflichen Werte (Einigkeit. Gemeinsinn) waren damit in ihrer Bedeutung für das Zusammenleben der Menschen in Mommenheim anderen Einstellungen und Haltungen gegenüber deutlich überlegen.
Eine weitere wichtige Funktion der Vereine war die Verhaltenskontrolle der Vereinsmitglieder. Vor allem Pünktlichkeit und gesittetes Verhalten wurden genau kontrolliert. Wie aus den erhaltenen Vereinsprotokollen ersichtlich ist, beschäftigte sich der Vorstand des Männergesangvereins seit seiner Gründung im Jahre 1862 mehrfach mit solchen Disziplinfragen und ahndete eventuelles Fehlverhalten mit kleinen, aber fühlbaren "Geldstrafen". Welche Bedeutung diesem Bereich des Vereinslebens beigemessen wurde, ergibt sich z.B. aus der Tatsache, dass dafür eigens das Amt eines "Strafmeisters" geschaffen wurde. In einer bäuerlichen Gesellschaft, die von einem hohen Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortung der einzelnen Haushalte geprägt war, war eine solche Disziplinierung sicher auch in gewisser Weise notwendig, um die gemeinsamen Vorhaben bewältigen zu können. Der hohe Stellenwert aber, der diesem Problem beigemessen wurde, deutet darauf hin, dass man sich hierbei in erster Linie an städtischen Maßstäben orientierte. Pünktlichkeit z.B. spielte in den Büros und Fabriken der Stadt eine weit größere Rolle als in den sehr viel weniger straff organisierten Arbeitszusammenhängen eines Dorfes. Insofern hatte der Verein auch in dieser Hinsicht eine Vermittlungsfunktion zwischen städtischen und ländlichen sozialen Normen.
Kirche im Dorf
Eine außerordentlich wichtige Bedeutung für die Dorfkultur hatte die Kirche im Ort. Wenn der Volksmund behauptet, man solle "die Kirche im Dorf lassen", dann ist damit ausgesagt, dass die Kirche einerseits selbstverständlich zum Dorf dazugehört, ihr aber anderseits nur eine geringe Bewegungsfreiheit zugemessen wird. Unabhängig von den religiösen Einstellungen der einzelnen Dorfbewohner waren Kirche und Pfarrer in Mommenheim wichtige, ja unverzichtbare Institutionen.
Die Bedeutung der Institution Kirche für das Leben im Dorf ergab sich nicht allein aus der öffentlichen Darstellung des religiösen Lebens (z.B. bei Festgottesdiensten, Auftreten des Pfarrers usw.), sondern ebenso aus den kirchlich vermittelten Wertvorstellungen und den daraus folgenden gewünschten oder abgelehnten Verhaltensweisen. Religiöse Inhalte bestimmten bereits die Kindererziehung in den Familien. Der durch den Pfarrer erteilte kirchliche Unterricht war ein weiterer wichtiger Faktor in der religiösen Sozialisation der Kinder und Jugendlichen. Die früher praktizierte Kirchenzucht, die häufig sogar Bestandteil der Gemeindeordnungen war, bildete ein wirksames Instrument zur Kontrolle des kirchlichen und moralischen Verhaltens der Dorfbewohner. So wurde z.B. mit Geldstrafe belegt, wer zu spät zum Gottesdienst erschien oder sein Kind nicht innerhalb von 3 Tagen taufen ließ. Jahrhunderte lange Erfahrungen mit der Institution Kirche prägten somit zentrale Bereiche des dörflichen Lebens und Denkens. Die Traditionen und kulturellen Ausdrucksformen, die daraus erwuchsen, hatten sich im Laufe der Zeit weitgehend verselbständigt und wurden auch unabhängig von der Person des jeweiligen Pfarrers bewahrt und gelegentlich auch gegen neue Pfarrer verteidigt. Religion und Kirche bildeten daher einen wichtigen Teilbereich der Dorfkultur, wobei jedoch der tatsächliche Einfluss der Kirche bzw. des Pfarrers auf die anderen Bereiche des dörflichen Lebens durchaus nicht feststand, sondern sich je nach Situation verändern konnte.
Aus diesen Gründen kam der Person des Pfarrers und seiner Fähigkeit, auf die besonderen innerörtlichen Verhältnisse angemessen zu reagieren, besondere Bedeutung zu. Zwar war der Pfarrer von seinem Amt und seiner Ausbildung her in einer herausgehobenen Position, sein tatsächlicher Einfluss hing aber wesentlich von seiner Persönlichkeit und seiner Bereitschaft ab, sich für die Belange des Dorfes einzusetzen. Eine solche Bereitschaft wurde durchaus akzeptiert und war auch erwünscht, selbst wenn sie über den engeren Bereich der kirchlichen Arbeit hinausging. Die Beteiligung des evangelischen Pfarrers Beck an den Verhandlungen über den Bau der Eisenbahnstrecke in den 80er Jahren und die Aktivitäten des Pfarrers Weimar in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, die zur Gründung der Spar- und Darlehenskasse und zum Bau eines gemeindeeigenen Kindergartens führten, sind dafür Beispiele. Bei solchen Beteiligungen an Vorhaben der Ortsgemeinde waren die Pfarrer vor allem als Vertreter des gebildeten Bürgertums gefragt, die sich im Schriftverkehr und im Umgang mit den Behörden auskannten und dies nicht gegen, sondern für die Menschen im Dorf einsetzte.
Auch der umgekehrte Fall, nämlich die Begegnung mit dem Pfarrer als privilegiertem Vertreter des staatlichen Herrschaftsapparates, war Teil des dörflichen Erfahrungsschatzes mit der Institution Kirche. Insbesondere die protestantischen Pfarrer waren von ihrer Herkunft her meist städtisch-bürgerlich geprägt und unterstanden bis zum Jahre 1918 mittelbar der staatlichen Verwaltung. Im Bewusstsein der Menschen im Dorf waren sie daher zunächst einmal "von draußen" kommende Vertreter der Staatskirche. Dagegen verstanden sich die katholischen Pfarrer eher als "Funktionäre" ihrer Kirche, deren Rechte und Interessen sie zu wahren und durchzusetzen hatten. Hinzu kam, dass die Pfarrer nicht nur für die Kirchenzucht und die Fragen der öffentlichen Moral zuständig waren, sondern zugleich als Verwalter der Kirchengüter, Vorsteher der Konfessionsschule und damit als Vorgesetzter der Dorflehrer (bis 1895) und als Arbeitgeber für die, die auf dem Pfarreiland und im Pfarrhaushalt arbeiteten, fungierten. Sie hatten damit durchaus Machtmittel in der Hand, die sie zur Stärkung ihrer Position nutzen konnten.
Von diesen Voraussetzungen her hatte auch die unterschiedliche konfessionelle Zusammensetzung Mommenheims eine erhebliche Bedeutung für das soziale und politische Leben des Dorfes. Mommenheim war seit Jahrhunderten ein gemischt-konfessionelles Dorf, wobei etwa zwei Drittel der Bevölkerung evangelischen und ein Drittel katholischen Bekenntnisses war (s. u. Statistischer Anhang 12). Die katholische Gemeinde befand sich dabei in einer doppelt benachteiligten Situation: zum einen war sie zahlenmäßig in der Minderheit, zum anderen wohnte der katholische Pfarrer im Nachbarort Lörzweiler und war deshalb mit den Mommenheimer Verhältnissen nicht so gut vertraut wie der evangelische.