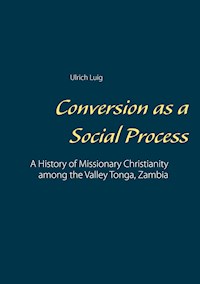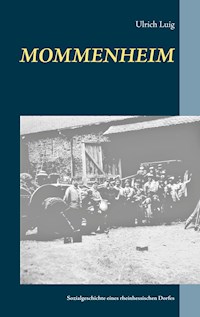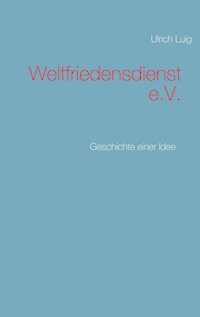
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Förderung von Frieden, Entwicklung und Menschenrechten ist nach unserem Verständnis von der Einen Welt eine globale Aufgabe. Das begründet die Zusammenarbeit mit und Interessenvertretung für unsere Partner im Süden ebenso wie die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in unserer eigenen Gesellschaft. Auslands- und Inlandsarbeit sind daher eng aufeinander bezogen. Unser langjähriges Motto "Wer sich im Süden engagiert, darf im Norden nicht schweigen", drückt diesen Zusammenhang aus. Mitgliederversammlung 2012 des Weltfriedensdiensts e.V. Dieses Buch erzählt die Geschichte der hartnäckig verfolgten Idee, Frieden im Weltmaßstab zu denken, aber dafür von unten her zu arbeiten - gemeinsam mit benachteiligten Menschen in den Krisengebieten der Welt, aber auch bei uns in Deutschland. Am Anfang des Weltfriedensdiensts stand die Idee, dass zu dem in beiden Deutschlands gerade (1956) erst wieder eingeführten Wehrdienst die Alternative eines Friedensdienstes geschaffen werden müsste: "Friedensdienst statt Kriegsdienst!" lautete dafür die Parole. Was unter Frieden zu verstehen ist, auf welche Weise und in welcher Form der Frieden in der Welt mit den eigenen beschränkten Mitteln am besten befördert werden kann, war immer neu Gegenstand von Diskussionen aus unterschiedlichem Anlass. Für die Arbeitsweise des Weltfriedensdiensts bedeutete dies eine charakteristische Dialektik von praxisbezogener Konzeptionsentwicklung einerseits und konzeptionsorientierter Praxis andererseits. Erzählt wird die Geschichte des Weltfriedensdiensts daher als Geschichte der leitenden Ideen einer bestimmten Projektpolitik in ihrem zeitgeschichtlichen Kontext sowie der entsprechenden Projektaktivitäten und der Reflexion der gemachten Erfahrungen als Grundlage einer veränderten Projektpolitik im Sinne von "lessons learnt": Vision - Erfahrungen - Reflexion - veränderte Vision. Eine angefügte ausführliche Zeittafel erlaubt einen detaillierten Blick auf die tatsächliche Chronik der Ereignisse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung
Das Entstehen dieses Buches war ein Prozess, in dem ich von mehreren Seiten Unterstützung erfahren habe. Wichtige Informationen und Hinweise zur Geschichte des Weltfriedensdienstes verdanke ich insbesondere den früheren Geschäftsführern des Weltfriedensdiensts Wilfried Warneck(†), Peter Sohr, Eberhard Bauer und Walter Hättig sowie Folker Thamm, Ursula Reich, Hans-Martin Schwarz, Eckehard Fricke, Gerd Hönscheid-Gross, Bernd Leber, Erich Schlauch, Thomas Schwedersky, Karin Fiege, Volker Rhein, Theo Mutter, Klaus Ebeling, Anton Karch, Andreas Rosen, Carola Gast und Hans-Jörg Friedrich. Für die Hilfe bei der Archivarbeit danke ich Caro Ziegert, Katrin Steinitz und Jürgen Steuber.
Ulrich Luig
Ulrich Luig, geb. 1945 in Berlin. Studium der evangelischen Theologie und Promotion in Berlin. Seit 1968 ist er in verschiedenen Funktionen mit dem Weltfriedensdienst verbunden. Seit 2008 im Ruhestand, lebt in Berlin.
INHALT
Danksagung
Vorwort
Welt – Frieden – Dienst
Projektpolitik 1: Freiwillige für den Frieden
Projektpolitik 2: Soziale Aktivierung
Gemeinschaftsdienste und "soziale Aktivierung"
Zweiter Anlauf - erste Projekte
Elfenbeinküste
Palästina
Brasilien
Gambia
Grundsatzdiskussionen
Projektpolitik 3: Staatliche Partner
Fachdienst für Gemeinwesenarbeit
Senegal
Burkina Faso
Befreiungsbewegungen an der Macht
Kapverden – Insel der Hoffnung?
Guinea-Bissau – Regionalentwicklung Boé
Fachkräfte für Mosambik
Projektpolitik 4: Zurück zur Basis
Arbeitsschwerpunkt südliches Afrika
Genossenschaften in Simbabwe
Das Weya Community Training Centre –WCTC
Cold Comfort Farm Trust (CCFT)
Grow More Trees Furniture Cooperative (GMT)
Chikukwa Ecological Land Use Trust
Nayahode Union Learning Centre (NULC)
Zivilgesellschaft in Südafrika
Projektpolitik 5: Globale Partnerschaft
Öffentlichkeitsarbeit als Süd-Nord-Arbeit
Rundreisen mit Projektpartner*innen
Das Antirassismusprojekt
Das Projekt Bäuerliche Landwirtschaft
Langfristige Kooperationen
Netzwerk- und Lobbyarbeit
Krisenjahre
Auslands- und Partnerschaftsprojekte
Ziviler Friedensdienst und Entwicklung
Partnerschaftsprojekte
Friedensarbeit lokal und global
Das Versöhnungsprojekt
Peace Communication
Peace Exchange
Global Generation
Öffentlichkeitsarbeit
Bildung und Fundraising: Work for Peace
Kampagnenarbeit: Stoppt den Wasserraub
Rückblick und Ausblick
Anhang
Friedenspolitisches Profil des Weltfriedensdiensts
Leitbild des Weltfriedensdienst e.V.
Zeittafel
Vorwort
Dieses Buch erzählt die Geschichte der hartnäckig verfolgten Idee, Frieden im Weltmaßstab zu denken, aber dafür von unten her zu arbeiten - gemeinsam mit benachteiligten Menschen vor allem in Krisengebieten der Welt, aber auch bei uns in Deutschland. Geschrieben wurde das Buch insbesondere für Menschen, die in der einen oder anderen Weise Teil dieser Geschichte waren oder die dem Weltfriedensdienst e.V. neu begegnet sind und sich darüber informieren wollen.
Am Anfang des Weltfriedensdiensts stand die Idee, dass zu dem in beiden Deutschlands gerade (1956) erst wieder eingeführten Wehrdienst die Alternative eines Friedensdienstes geschaffen werden müsste: "Friedensdienst statt Kriegsdienst!" lautete dafür die Parole. Konkret wurde diese Idee durch die Mit- und Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Prägung und Form ihrer Beteiligung, die sich unter dem Dach des Vereins Weltfriedensdienst e.V. zusammenfanden und ihn zu dem machten, was er zu den je verschiedenen Zeiten war. Namen werden in diesem Buch nur selten genannt; dafür waren es zu viele, die auf ihre eigene Weise wichtig waren. "Der Weltfriedensdienst" ist daher immer ein Kollektivbegriff, der sich aus vielen unterschiedlichen Namen zusammensetzt.
Typisch für den Weltfriedensdienst war von Anfang an eine ausgeprägte Diskussionskultur. Was unter Frieden zu verstehen ist, auf welche Weise und in welcher Form der Frieden in der Welt mit den eigenen beschränkten Mitteln am besten befördert werden kann, war immer neu Gegenstand von Diskussionen auf Mitgliederversammlungen, Strategieseminaren und Treffen aus unterschiedlichem Anlass. Den Rahmen dafür boten vor allem in den Anfangsjahren kommunikative und fast familiäre Formen des Miteinanders wie Feste und persönliche Einladungen. Daraus hat sich eine Gesprächskultur entwickelt, die stets offen war für unterschiedliche persönliche Überzeugungen und aktuelle Bezüge zu internationaler Politik und speziell der Entwicklungspolitik, die aber gleichzeitig auf Konsens in den Zielen und gemeinsames Handeln ausgerichtet war. Für die Arbeitsweise des Weltfriedensdiensts bedeutete dies eine charakteristische Dialektik von praxisbezogener Konzeptionsentwicklung einerseits und konzeptionsorientierter Praxis andererseits.
Der Aufbau dieses Buches folgt dieser Charakteristik. Der Darstellung der leitenden Ideen einer bestimmten Projektpolitik folgt eine kurze Beschreibung der Aktivitäten des Vereins, die sich daraus entwickelten. Deren Reflexion im Verein wurde wiederum zur Grundlage einer veränderten Projektpolitik wurde im Sinne von "lessons learnt": Vision – Erfahrungen – Reflexion – veränderte Vision. Dabei ergibt sich zwangsläufig, dass die Chronologie der tatsächlichen Ereignisse häufig nicht mit diesem Schema in Einklang zu bringen ist. Die Projekte einer "projektpolitischen Generation" werden jeweils im Zusammenhang dargestellt und erst dann wird auf der Basis der gemachten Projekterfahrungen die Herausbildung von neuen projektpolitischen Leitvorstellungen beschrieben.
Erzählt wird die Geschichte des Weltfriedensdiensts auf der Grundlage des – leider nur unvollständig vorhandenen und häufig nur zufällig zugänglichen – Archivmaterials des Vereins. Auf genaue Quellenangaben wird im Interesse der besseren Lesbarkeit verzichtet. Überprüft und ergänzt wurde diese Datengrundlage durch zeitgeschichtliches Sekundärmaterial und die Erinnerungen der Akteure in den unterschiedlichen Phasen der Arbeit des Vereins. Eine angefügte ausführliche Zeittafel erlaubt einen detaillierten Blick auf die tatsächliche Chronik der Ereignisse. Auf dieser Basis ergibt sich die Geschichte einer faszinierenden und nach wie vor relevanten Idee vom Dienst am Frieden in der Welt.
Es ist ein alter Streit, ob aus der Geschichte gelernt werden kann. Welche Einsichten aus der Geschichte für die Zukunft gewonnen werden können, hängt von der Fragestellung ab, unter der das Vergangene betrachtet wird. Manches aus der Geschichte des Weltfriedensdiensts liest sich erstaunlich aktuell, anderes lässt strukturelle Konstanten erkennen, wieder anderes kann für Irrwege sensibel machen. Stoff genug also für die Vorbereitung auf die Herausforderungen, die sich heute für den Welt-Friedens-Dienst von morgen abzeichnen.
Berlin, im November 2017
Ulrich Luig
Welt – Frieden – Dienst
Projektpolitik 1: Freiwillige für den Frieden
"Welt – Friedens - Dienst" – unter diesem Thema lud die Evangelische Akademie Berlin vom 30. Juni bis 2. Juli 1959 zu einer Tagung ein. Insbesondere junge Menschen sollten für die Idee eines einjährigen Aufbaudienstes in einem der Länder Asiens oder Afrikas gewonnen werden als "Beitrag zur friedlichen Entfaltung der menschlichen Zukunft".
Das Thema war hoch aktuell. Der zweite Weltkrieg mit seiner immensen Zahl an Toten und der Zerstörung ganzer Städte war erst vierzehn Jahre zuvor zu Ende gegangen. Unmittelbar nach Kriegende hatte der Kalte Krieg zwischen "Ost" und "West" begonnen, der umzuschlagen drohte in einen dritten, mit Atomwaffen ausgetragenen Weltkrieg. Gleichzeitig ging das Zeitalter des Kolonialismus zu Ende. Mit der Bandung-Konferenz vom April 1955 hatten die Völker Afrikas und Asiens – weit mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung – als "Dritte Welt" die Bühne der Weltpolitik betreten. Sie forderten das Ende von Rassismus und kolonialer Herrschaft, Abrüstung einschließlich eines Kernwaffenverbots sowie verstärkte Entwicklungshilfe für die Länder des Südens. Der "wind of change" fegte vor allem durch den europäischen Nachbarkontinent Afrika.
In dieser Situation warb der deutsch-amerikanische Rechtshistoriker und Soziologe Eugen Rosenstock-Huessy für die Idee eines "Weltfriedensdiensts". Er hatte bereits als junger Professor im schlesischen Breslau in den Jahren 1928 bis 32 freiwillige soziale Arbeitslager konzipiert und geleitet, bei denen Bauern, Arbeiter und Studenten gemeinsam körperliche Arbeiten verrichteten sowie aktuelle gesellschaftspolitische Fragen diskutierten. Dabei sollten sie sich über soziale Schranken hinweg kennen und respektieren lernen. Rosenstock-Huessy war 1933 wegen seiner jüdischen Abstammung in die USA emigriert, hielt aber Kontakt zu seinem Schüler und Freund Helmuth von Moltke und dem "Kreisauer Kreis", einer Widerstandsgruppe um Moltke während der Zeit des Nationalsozialismus. Der unmittelbar nach dem Kriegsende 1945 einsetzende "Kalte" Krieg mit der drohenden Möglichkeit des Einsatzes von Atomwaffen war für ihn ein Anlass, die Idee eines freiwilligen sozialen Dienstes über ideologische Grenzen hinweg neu ins Gespräch zu bringen – als Weltfriedensdienst. Für die Deutschen sah er in einer solchen Initiative die Chance, sich nach dem deutschen Eroberungskrieg und den dabei begangenen Verbrechen mit den europäischen Nachbarvölkern zu versöhnen. Angesichts der zunehmend konfliktreichen Dekolonisierungsprozesse in den europäischen Kolonien antizipierte er zugleich eine "Eine Menschenwelt", in der die Beziehungen zwischen Nationen und Völkern nicht mehr durch Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung, sondern durch ein friedliches Miteinander bestimmt sein sollten. Mit griffigen Formulierungen warb er ab 1956 auf mehreren Vortragsreisen in Deutschland und den Niederlanden für diese Idee. Angesichts einer immer stärker zusammenwachsenden Gemeinschaft der Völker der Welt einerseits und der gewaltigen Zerstörungskraft der neu entwickelten Atombomben andererseits sah er im Weltfrieden die einzige Möglichkeit zum Überleben der Menschheit:
Die Menschenwelt ist eine geworden. Unser Planet ist erschlossen. Alle sind mit Allen verbunden. Kein Erdteil, kein Volk steht mehr außerhalb, lebt mehr für sich. … Der Krieg, in der bisherigen Geschichte wirksames Mittel der Politik, wesentlich gestaltendes Moment der Weltgeschichte, kann heute keine politischen Entscheidungen mehr erzwingen, sondern höchstens zum wechselseitigen Selbstmord der Völker führen. Wenn künftig menschliche Geschichte also nicht überhaupt enden soll, wird sie künftig nicht mehr Kriegsgeschichte sein. Es gilt nicht mehr, Feinde zu besiegen — denn es gibt keinen Sieg mehr mit Atomwaffen —, sondern es gilt, Freunde zu gewinnen.
(Fritz Vilmar, Ein Weltfriedensdienst, S. →)
Für Rosenstock-Huessy war das friedliche Miteinander der Völker und Gruppen eine Aufgabe, die ständig neuer Anstrengungen bedarf. Dabei verstand er weder Krieg noch Frieden als statische Größen, sondern als höchst dynamische Prozesse. Einprägsam formulierte er daher:
Das Gegenteil von Krieg ist nicht Frieden, sondern Friedensdienst.
Der junge Soziologe Fritz Vilmar griff diese Idee auf und entwickelte in einem 1958 veröffentlichten Aufsatz "Ein Weltfriedensdienst – Politische Initiative am Ende der Kriegsgeschichte" ein Konzept für den Aufbau eines internationalen Freiwilligendienstes für den Frieden. Junge Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen sollten sich bei gemeinsamen Arbeitseinsätzen kennen lernen und mit Unterstützung von friedensorientierten Politikern den Weg zum Ende der Kriegsgeschichte in der Welt ebnen helfen. Vilmar kontaktierte dazu auch die Evangelischen Akademien als wichtige gesellschaftspolitische Gesprächsforen. Erich Müller-Gangloff, der Leiter der Evangelischen Akademie Berlin, war bereit, die Idee eines Weltfriedensdiensts zum Thema einer Tagung zu machen. Bei der Berliner Akademietagung zum "Weltfriedensdienst" im Sommer 1959 erhielt Fritz Vilmar die Gelegenheit, als Hauptreferent seine Vorstellungen zu entfalten.
Die Tagung über den "Welt-Friedens-Dienst" fügte sich gut ein in das Konzept der Berliner Evangelischen Akademie, die Lehren aus Nationalsozialismus und 2. Weltkrieg mit den Herausforderungen der neu in den Blick gekommenen "Einen Welt" zu verbinden und durch den praktischen Einsatz für den Frieden zu verarbeiten. In enger Zusammenarbeit von Akademieleiter Erich Müller-Gangloff, dem Präses der Kirchenprovinz Sachsen, Lothar Kreyßig, sowie dem späteren evangelischen Berliner Bischof Kurt Scharf waren im Juni 1957 die Aktionsgemeinschaft "Für die Hungernden"(heute" Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt", ASW) und im April 1958 die "Aktion Sühnezeichen" (heute "Aktion Sühnezeichen Friedensdienste", ASF) gegründet und durch Akademie-Tagungen begleitet worden.
Evangelische Akademie Berlin
Tagung
für die
junge Generation
über den
WELT-
FRIEDENS-
DIENST
vom 30. Juni bis 2. Juli 1959
Quelle: WFD-Archiv
Beide Initiativen hatten sowohl einen praktischen, auf Aktion gerichteten Charakter als auch einen auf die Welt als ganze ausgerichteten Bezug. Die Aktionsgemeinschaft "Für die Hungernden" warb um Spendengelder für die Unterstützung von Armen im Süden der Welt und organisierte über lokale Partnerorganisationen deren Verteilung. Die "Aktion Sühnezeichen" bemühte sich durch Arbeitseinsätze von jungen Menschen um Versöhnung mit Menschen in den Ländern, die unter deutschen Kriegshandlungen besonders gelitten hatten. Mit dem Konzept einer Verbindung von Frieden und Entwicklung wurde der "Weltfriedensdienst" zu einem weiterem Glied in der Reihe von Initiativen der Evangelischen Akademie Berlin, die Versöhnung möglich machen und gleichzeitig Armut und Unterdrückung in der Welt bekämpfen sollten.
An der Tagung "über den Weltfriedensdienst" im Sommer 1959 nahmen sowohl einige Studenten und evangelische Pfarrer als auch Vertreter verschiedener Friedens- und Zivildienste teil. Nach ausführlicher Diskussion wurde die Gründung einer zunächst zeitlich begrenzten "Arbeitsgemeinschaft Weltfriedensdienst 1960" vereinbart. Auf einer weiteren Tagung im folgenden Winter sollte das genauere Vorgehen geklärt werden. Die Zeit bis zur verabredeten 2. Tagung wurde intensiv genutzt. Die im Jahr zuvor gegründete Aktion Sühnezeichen, der Internationale Zivildienst und der Christliche Friedensdienst erklärten ihre Bereitschaft zur Mitarbeit. Die Finanzierung der veranschlagten Kosten von ca. DM 110.000,00 sollte über Spendengelder gesichert werden.
Über die Schweizer Zweige des Internationalen Zivildienstes und des Christlichen Friedensdienstes, die schon seit Jahren mit Aufbauprojekten in Griechenland tätig waren, kam ein Kontakt zum Gemeinderat der Kleinstadt Servia in Nordgriechenland zustande. Die Stadt Servia war 1943 von italienischen und deutschen Truppen nach einem Partisanenangriff niedergebrannt und zur "toten Zone" erklärt worden. Viele Einwohner wurden bei dieser Aktion ermordet, die Mehrzahl der Überlebenden obdachlos. Als erstes Projekt des neuen Weltfriedensdiensts wurde ein langfristig angelegtes Aufbauprogramm in Servia geplant. Damit sollte der Versöhnungsgedanke der Aktion Sühnezeichen mit der Leitidee der gelebten Völkerverständigung durch praktische Friedensarbeit unter dem Dach des neuen Weltfriedensdiensts verbunden werden.
Als die Evangelische Akademie Berlin zu ihrer zweiten Tagung vom 19. bis 21. Dezember 1959 "über den Weltfriedensdienst 1960" einlud, hatte das Projekt bereits deutliche Konturen gewonnen. Die griechischen Behörden waren informiert und ein detaillierter Aktionsplan lag vor. Der Akademieleiter Erich Müller-Gangloff hatte nicht nur die Koordination der Vorbereitung und die Leitung der Tagung übernommen, sondern trieb auch die Realisierung der Pläne voran. Finanzierung und Organisation mussten gesichert werden. Der Agrarwissenschaftler Siegfried Krause war zur Übernahme der Geschäftsführung mit einem minimalen Gehalt bereit. Um auch die rechtlichen Voraussetzungen für diese Arbeit zu schaffen, wurden die drei neu gegründeten Initiativen Arbeitsgemeinschaft Weltfriedensdienst, Aktion Sühnezeichen und die Aktionsgemeinschaft Für die Hungernden zum 1. Januar 1960 unter dem Vereinsdach Versöhnungsdienste e.V. mit einem gemeinsamen Vorstand zusammengefasst.
Welt – FRIEDEN - DIENST
….
Eugen Rosenstock-Huessy hat der Sache, um die es hier geht, schon vor Jahren diesen Namen gegeben - der allerdings auch aufs prägnanteste ausdrückt, was hier gemeint ist -, so daß wir keinen Augenblick zögerten, mit der Realisierung der Aufgabe, die uns fast ohne unser Zutun zugewachsen ist, auch den bereits voraus geprägten Namen zu akzeptieren.
Weltfriedensdienst, wie wir ihn verstehen, meint zunächst ganz wörtlich Dienst. Wenn Rosenstocks Feststellung gilt, es gehe heute nicht mehr darum, Feinde zu vernichten, sondern Freunde zu gewinnen, so dürfte es an der Zeit sein, dem Wehr- und Kriegsdienst für die Vaterländer und Mächtegruppen heute im Zeichen der Einen Welt einen Friedensdienst entgegen oder zum mindesten an die Seite zu stellen, der zugleich ein Arbeitsdienst und Hilfsdienst für die sogenannten Entwicklungsländer ist.
Wenn schon ein Dienst, so könnte man sagen: Muß es gleich ein Weltdienst sein? Ist hier nicht doch der Mund ein wenig voll genommen? Sollte man nicht zuwarten, zumal ja in Europa mit dem Dienst begonnen wird, ob der Impuls auch noch für andere Kontinente zureicht? Wir wissen nicht, wie weit uns unser Anlauf tragen wird. Dies aber meinen wir auf jeden Fall zu wissen, daß das, was wir begonnen haben, sofort jedweden Sinn verlöre, wenn darauf verzichtet würde, es im Bezug auf einen Welthorizont und als eine Weltaufgabe zu verstehen.
Aber muß denn unbedingt vom Frieden, vom Weltfrieden gar, die Rede sein? Ist das nicht ein zweideutiges, ja ein höchst verdächtiges Namensschild? Wer das meint, dem können wir nicht helfen. Wir konnten das, was wir beginnen, unschwer auch als Welthilfsdienst offerieren, und wenn es nicht so böse Parallelen gäbe, wäre auch Weltarbeitsdienst als Name denkbar. Aber da wir in einer Welt leben, in der es nach einem Worte Eisenhowers keine Alternative mehr zum Frieden gibt, will uns der von Rosenstock-Huessy gewählte Name im Bezug auf den Frieden einer unteilbaren Welt nur um so sinnvoller erscheinen.
Dienst am Weltfrieden, Weltdienst für den Frieden oder Friedensdienst für die Welt — wie immer wir es wenden oder deuten: Es scheint uns ein rechter Name für eine rechte Sache zu sein.
Erich Müller-Gangloff Quelle: Kommunität 14, 1960. S. 116
Nachdem die Finanzierung gesichert und eine Gruppe von 29 jungen Männern und Frauen zusammengestellt worden war, begann im April 1960 das erste Projekt der Arbeitsgemeinschaft Weltfriedensdienst im griechischen Servia. Die organisatorische Leitung lag zunächst bei der Aktion Sühnezeichen, ab 1961 beim Internationalen Zivildienst. Werbung und Auswahl der Freiwilligen für die Aktion Sühnezeichen hatte Pfarrer Dr. Franz von Hammerstein übernommen. Als Mitarbeiter des Berliner Sozial- und Industriepfarramtes hatte er gute Kontakte zu Berufsschulen und Gewerkschaftern, über die die Werbung von Freiwilligen organisiert wurde. Die praktische Umsetzung der Idee eines Weltfriedensdiensts hatte Akademieleiter Erich Müller-Gangloff zu seiner Aufgabe gemacht.
Die Ankunft der ersten Freiwilligengruppe in Servia war symbolträchtig für den 6. April 1960 geplant, dem Tag des deutschen Überfalls auf Griechenland im Jahre 1941. Die erste Aktivität der Gruppe bestand in dem Bau einer Zisterne, durch die die Wasserversorgung und damit auch die hygienischen Verhältnisse im Ort verbessert werden sollten. Langfristig waren auch der Bau neuer Wohnungen und Transportwege sowie die Ausbildung von Handwerkern geplant. Gegenüber den aufwendigen Vorbereitungen für das Projekt Weltfriedensdienst nahm sich die Realität des neuen Dienstes ernüchternd aus. Die Freiwilligengruppe konnte zwar zum Ende des Jahres den Bau einer zentralen Zisterne in Servia fertig stellen, doch häuften sich die Konflikte in der bunt zusammengewürfelten Gruppe, die u.a. zur vorzeitigen Abreise von zwei Teilnehmern führten. Auch das Verhältnis zu den griechischen Partnern trübte sich deutlich ein. Nach der anfänglichen Begeisterung über das Hilfsangebot aus Deutschland empfanden die Griechen es nach neunmonatiger Erfahrung als Zumutung, "sich vom ehemaligen Besatzer Vorschläge machen zu lassen, wie man zweckmäßig wirtschaftet und lebt" (Projektleiter Ernst Buczys). Erst als der Internationale Zivildienst mit der Entsendung von Fachkräften für den Gesundheitsbereich und die Heimarbeit von Frauen die Arbeit in Servia fortsetzte, entspannte sich die Lage. In der Folgezeit wurden daher statt Gruppen von Freiwilligen überwiegend einzelne Fachkräfte vom Weltfriedensdienst nach Ägypten, Indien und Afghanistan entsandt.
Als kritisch erwies sich ebenfalls das Verhältnis zwischen dem Versöhnungsgedanken der Aktion Sühnezeichen und dem Entwicklungshilfekonzept des Weltfriedensdiensts in dem Projekt in Servia. So urteilte Studentenpfarrer Peter Kreyßig, der Sohn von Lothar Kreyßig, nach einem Kurzbesuch:
Hauptproblem ist ganz offensichtlich die Firma selbst: "Weltfriedensdienst 1960". … Mir persönlich ist in der Diskussion in Servia völlig klar geworden, daß vom Kern der Sache her die Kombination Sühnezeichen und Entwicklungshilfe unvereinbar sind.
Für Sühne kann man tatsächlich zeichenhaft arbeiten, d.h. an ganz begrenzten Projekten, nach den Wünschen der Gastgeber sich richtend und in der Haltung mehr des Empfangenden als des Gebenden. …
Entwicklungshilfe steht auf einem ganz anderen Blatt. Hier werden Gelder investiert, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und auch von der Seite des Gebers, der hier nicht mehr als Empfangender auftreten kann, unter bestimmten Bedingungen der sinnvollen langfristigen Wirkungen unter Kontrolle zu behalten. Mit Zeichen oder auch Beispielen ist da nichts getan. … Sofort tauchen Machtfragen auf. Dazu kommt die Frage des Umfanges der Hilfe.
Typisches Beispiel für die Problematik auf die man dann stößt ist der geplante Hausbau in Servia. Für 500 bedürftige Familien 12 oder auch 20 Häuser zu bauen schafft immense Probleme. Die Griechen wollen natürlich nicht heran, weil die Aufgaben der Auswahl die Möglichkeiten menschlicher Verantwortung in der Gemeindeleitung in Servia übersteigt. 480 Familien werden durch die Auswahl in Enttäuschung, Neid und sozialen Unfrieden gestürzt, mit dem nach unserem Abzug die Griechen nachher leben sollen. Dass sie es schwer haben, dies als einen Friedensdienst zu begreifen, wenn das Problem des sozialen Unfriedens durch diese Aktion unerträglich aufgeschaukelt wird, hat mir persönlich eingeleuchtet. So wird man es jedenfalls nicht machen können.
Peter Kreyßig, Herbst 1960 (WFD-Archiv)
Einen neuen Versuch mit einem internationalen Arbeitslager für Freiwillige unternahm der Weltfriedensdienst 1961 in Kamerun. In Zusammenarbeit mit der Bauernorganisation Action Paysanne sollte in Nkpwang/Südkamerun ein Zentrum für Jugendliche errichtet werden, um deren Abwanderung in die Städte zu stoppen. Als Reaktion auf die Erfahrungen in Servia war bei diesem Einsatz die Projektleitung dem einheimischen Partner übertragen worden. Aber auch hier gelang es der deutschen Gruppe nicht, sich den lokalen Verhältnissen angemessen anzupassen. Die Konflikte innerhalb der Gruppe und mit den lokalen Partnern ließen das Projekt im Fiasko enden, so dass selbst das Diakonische Werk als kirchlicher Geldgeber eine weitere Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Weltfriedensdienst formell unter Vorbehalt stellte. Bemängelt wurden insbesondere "eine gewisse dilettantische Arbeitsweise" sowie die "weltanschauliche Ungebundenheit der Teilnehmer". Hinzu kamen moralische Bedenken, da sich einige der männlichen deutschen Projektteilnehmer für eine engere Kooperation mit der weiblichen Dorfjugend durchaus offen gezeigt hatten.
Das Scheitern des Einsatzes in Kamerun war für den Koordinator des Weltfriedensdiensts Erich Müller-Gangloff insofern prekär, als das Zentrum im kamerunischen Nkpwang für eine internationale Konferenz der Workcamporganisation bei den Vereinten Nationen (CCIVS /UNESCO) vorgesehen war. Durch einen Kontakt zu dem jungen evangelischen Theologen Wilfried Warneck gelang es, kurzfristig eine Arbeitsgruppe zu rekrutieren, die die noch ausstehenden Bauarbeiten in Nkpwang rechtzeitig zum Beginn der Konferenz ausführen half. In der Folgezeit führte der Weltfriedensdienst bis 1962 in Zusammenarbeit mit der "Aktionsgemeinschaft Für die Hungernden" Kurzzeiteinsätze in Form von Einzel- und Kleingruppenentsendungen nach Ägypten (landwirtschaftliche Beratung), Afghanistan (gewerbliche Berufsausbildung) und Indien (Gandhigram, Aufbau von Genossenschaftsdörfern von Kastenlosen) durch. Im August 1962 beendete der bisherige Geschäftsführer Siegfried Krause seine Tätigkeit. Die noch laufenden Projekte wurden als "Referat Weltfriedensdienst" beim Internationalen Zivildienstes in Hamburg weitergeführt. Die Arbeitsgemeinschaft Weltfriedensdienst in der von Erich Müller-Gangloff in der Evangelischen Akademie konzipierten Form hatte praktisch aufgehört zu existieren.