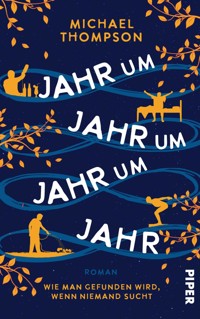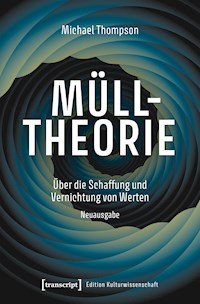
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Edition Kulturwissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie kommt es, dass Müll unversehens als Antiquität gehandelt werden kann? Müll ist keine materielle Eigenschaft von Dingen, sondern eine kulturelle Zuschreibung und das Ergebnis eines gesellschaftlichen Codierungsprozesses. Das Verständnis für die Entstehung der Kategorie »Müll« ist eine Grundvoraussetzung, um die Mechanik der fließenden Übergänge zwischen Privatem und Öffentlichem, Informalität und Formalität, Vergänglichem und Dauerhaftem richtig zu beschreiben. Michael Thompsons 1979 erstmals erschienene »Mülltheorie« ist nicht nur ein Klassiker der Cultural Theory , sondern im Zeichen von Klimawandel und Nachhaltigkeitsdiskursen von ungebrochener Aktualität. Dies stellt Thompson zusammen mit Co-Autor M. Bruce Beck in einem unbequemen Nachwort unter Beweis, in dem die Autoren unser Verhältnis zum Wasser analysieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michael Thompson ist Forschungsbeauftragter am International Institute for Applied Systems Analysis in Laxenburg, Österreich, und Fellow am Institute for Science, Innovation and Society and Civilization an der University of Oxford. Nach seiner Tätigkeit als Berufssoldat und Bergsteiger im Himalaya studierte er Anthropologie in London. In seiner Forschung beschäftigt er sich u.a. mit der Abholzung und nachhaltigen Entwicklung im Himalaya, der Entwicklung von Haushaltsprodukten, dem globalen Klimawandel, der technologischen Entwicklung sowie mit Kulturtheorien.
Michael Thompson
Mülltheorie
Über die Schaffung und Vernichtung von Werten
Neuausgabe Herausgegeben von Michael Fehr
Die erste englische Ausgabe der Mülltheorie erschien 1979 unter dem Titel Rubbish Theory. The Creation and Destruction of Value bei Oxford University Press. © Michael Thompson 1979.
Die zweite, erweiterte englische Ausgabe des Buchs erschien 2017 bei Pluto Press, London, unter dem gleichen Titel als New Edition. © Michael Thompson 1979/2017.
Diese Übersetzung folgt der englischen Ausgabe von 2017.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2021 transcript Verlag, Bielefeld
Neuausgabe
Alle Rechte vorbehalten. Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: Maria Arndt und Kordula Röckenhaus, Bielefeld Korrektorat: Anne Speckmann, Bielefeld Übersetzung aus dem Englischen: Michael Fehr Print-ISBN 978-3-8376-5224-6 PDF-ISBN 978-3-8394-5224-0 EPUB-ISBN 978-3-7328-5224-6https://doi.org/10.14361/9783839452240
Besuchen Sie uns im Internet: https://www.transcript-verlag.de
Unsere aktuelle Vorschau finden Sie unter www.transcript-verlag.de/vorschau-download
Inhalt
Editorische Notiz
Vorwort
Rubbish revisited ‒ Einführung (2017)
Rubbish Theory (1979)
1. Der Schmutz auf dem Weg
2. Stevenbilder – der Kitsch von gestern
3. Rattenverseuchter Slum oder ruhmreiches Erbe?
4. Von Dingen zu Ideen
5. Eine dynamische Mülltheorie
6. Kunst und die Ziele ökonomischer Aktivitäten
7. Erhaltung der Monster
8. Die Geometrie der Glaubwürdigkeit
9. Die Geometrie des Vertrauens
10. Das Nadelöhr
Engineering Anthropology – Nachwort (2017)
Co-Autor M. Bruce Beck
Rubbish Theory applied – Ein Bericht (2020)
Michael Fehr
Literaturverzeichnis
Editorische Notiz
Michael Thompsons Mülltheorie erschien 1979 unter dem Titel »Rubbish Theory – The creation and destruction of value« in der Oxford University Press. 1981 wurde das Buch von Klaus Schomburg übersetzt und bei Klett-Cotta, Stuttgart, unter dem Titel »Die Theorie des Abfalls. Über die Erschaffung und Vernichtung von Werten« herausgebracht. 2003 erschien das Buch erneut in einer von mir revidierten Übersetzung und um eine »Einführung« von Michael Thompson ergänzten Version unter dem Titel »Mülltheorie. Über die Schaffung und Vernichtung von Werten« im Klartext Verlag, Essen. 2017 brachte die Pluto Press, London, den Reprint der Ausgabe von 1979, um eine neue »Einführung« von Michael Thompson und ein von ihm und M. Bruce Beck verfasstes »Nachwort« ergänzt, als »neue Ausgabe« unter dem ursprünglichen Titel heraus. Für die hier vorliegende Publikation habe ich diese beiden neuen Kapitel übersetzt, den deutschen Text von 2003 vollständig durchgesehen und ein eigenes Nachwort angefügt.
Michael Fehr, 2020
Vorwort
Für den Autor eines Buches über Müll ist es schwierig, denjenigen, die ihm bei seinem Unternehmen geholfen haben, angemessen zu danken. Müll bleibt auch dann, wenn alles gesagt und getan ist, ein ziemlich abstoßendes Zeug und neigt dazu, an den Menschen hängen zu bleiben, die mit ihm in Berührung kommen. Aus diesem Grund dürften nicht alle, denen ich danken möchte, mir dafür danken, dass ich dies in dieser öffentlichen Weise tue.
Aber den vielen Kunsthochschulen (insbesondere in Hull, Winchester, Falmouth und The Slade), die mich im Laufe der Jahre ermutigt und finanziell unterstützt haben, schulde ich großen Dank. Dies gilt auch für die Architekturfakultät am Polytechnic Portsmouth. Und auch folgenden Institutionen möchte ich für ihre finanzielle Unterstützung danken: der Nuffield Foundation (neunmonatige Forschungsassistenzzeit am University CollegeLondon), dem Massachusetts Institute of Technology (vierzehnmonatiges postgraduales Stipendium) und dem International Institute for Environment and Society, Berlin, (viermonatiges Besuchsstipendium). Das intellektuelle Klima an Kunst- und Architekturschulen ist zwar ideal für das Keimen und Wachsen zarter Pflanzen geeignet, doch früher oder später müssen sie aus dem Treibhaus der Künste in die kalten Rahmen der akademischen – und der weiteren – Welt transferiert werden. Dass sowohl ich als auch meine Ideen diese traumatische Reise überlebt und meine Gedanken über Müll mich zu weitergehenden Überlegungen und zur Auseinandersetzung mit der Katastrophentheorie geführt haben, ist weitgehend der strengen, aber hilfreichen Kritik meiner Kollegen im Fachbereich Anthropologie am UCL und am mathematischen Institut der University of Warwick zu verdanken.
Ich möchte darauf hinweisen, dass einige Argumente in den frühen Kapiteln des Buches bereits in einer etwas anderen Form in New Society erschienen sind und ein Teil des Kapitels 8 zuerst in Studies in Higher Education, Band 1, Nr. 1 (1976), veröffentlicht wurde.
Michael Thompson, 1979
Rubbish revisited – Einführung zur Neuausgabe
Im Sommer des Jahres 2000 sorgte die Veröffentlichung von Auszügen eines geheimen Entwurfes zu zukünftigen Regierungsstrategien in der Daily Mail für große Aufregung bei der britischen New Labour-Regierung. Zuerst wurde befürchtet, es gäbe einen »Maulwurf« in Nr. 10 Downing Street: Ein Insider müsse das geheime Dokument dem der Regierung nicht unbedingt wohlgesonnenen Blatt per Fax oder E-Mail gesandt haben. Dann vermutete man einen »Hacker« in der Zentrale der Konservativen Partei, und anklagende Finger richteten sich ziemlich öffentlich in diese Richtung. In jedem Fall aber war man sich einig, dass es sich um eine schädliche Verschwörung mit der Murdoch-Presse handeln müsse. Zur Erleichterung der Beschuldigten und zur Schadenfreue all derer, die weder zu den Anklägern noch zu den Beschuldigten gehörten, stellte sich schließlich jedoch heraus, dass es sich um keinen dieser Verdächtigen handelte. Es war vielmehr Benjamin Pell, heute besser bekannt als »Benji the Binman«.
Benjamin ist insoweit ein Müllsammler, als er eine Mütze und einen leuchtend gelben Anorak trägt und umhergeht, um Mülltonnen zu leeren; doch im Gegensatz zu den meisten Müllsammlern arbeitet er nicht für eine lokale Behörde, sondern ist selbstständig. Außerdem ist er sehr wählerisch und nimmt nur bestimmten Müll – handschriftliches und getipptes Material, das ihm von Wert erscheint – mit und diesen nur aus bestimmten Gebäuden, wie zum Beispiel aus Anwaltskanzleien in der City, aus Häusern von Prominenten oder Politikberatern im Londoner Norden. Auf einer dieser nächtlichen Touren mit seinem weißen Lieferwagen hatte Benji akquiriert, was sich als ein verworfener, erster Entwurf eines geheimen Strategiedokuments herausstellte. Als er es besaß und erkannt hatte, was es war, wusste er, wohin er es bringen musste: zu den Büros von News International. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.
Wurde eine Straftat begangen? Es überrascht kaum, dass aus der Gesetzgebung nicht eindeutig hervorgeht, ob und bis zu welchem Punkt Menschen, die etwas wegwerfen, das Recht haben, dessen nicht beraubt zu werden. Kurz gesagt, es handelt sich hier um eine »Grauzone«; doch wegen der Schwere der Folgen dieser besonderen freiberuflichen Müllabfuhr beschloss die Polizei, Benjis Haus zu durchsuchen (richtiger, das Haus seiner Mutter, da Benji, der damals Ende Dreißig und unverheiratet war, noch zu Hause lebte). In einem großen Holzschuppen im hinteren Teil des Gartens fand die Polizei mehr als 200.000 Dokumente, allesamt aus Mülleimern geborgen, sorgfältig geordnet, indiziert und archiviert.
Das Bemerkenswerteste an dem großartigen Pell-Archiv ist aber, dass es ausschließlich aus Dokumenten besteht, die weggeworfen wurden, um Archive anlegen zu können. Der glücklose Berater in Nr. 10 konnte nur dadurch zu einem zufriedenstellenden Strategiedokument kommen, indem er seine früheren, nicht ganz zufriedenstellenden Entwürfe verwarf; denn es hätte Probleme geben können, wenn das Büro des Premierministers nicht nur die endgültige Fassung des Dokuments auf seinen Computern gehabt hätte (die es dann an alle, die befugt sind, sie einzusehen, weiterleiten würde), sondern auch alle Versionen, die zu diesem Dokument führten. Wenn man also kein Archiv aufbauen kann, ohne etwas wegzuwerfen: Um was alles in der Welt handelt es sich dann bei diesem Schuppen voller Dokumente, der zwar alle Merkmale eines Archivs aufweist, aber aus nichts anderem als aus Weggeworfenem besteht? Es ist natürlich ein »Anti-Archiv«: Ein Affront gegenüber allen Archiven, aus denen es sich in dieser negativen Weise konstituiert, da es eindeutig sowohl eine Ordnung als auch einen Wert hat, wiewohl das Weggeworfene, aus dem es sich zusammensetzt, als form- und wertlos galt. Mithin: Nur über ihre Entsorgung konnten diese Dokumente Form und Wert erlangen und zu einem Archiv werden!
Shredder könnten helfen – wie Einzelrechner mit Programmen, die überflüssig gewordene Dokumente routinemäßig selbständig löschen. Und ein Gesetz, das die »Grauzone« beseitigt, indem es die Aneignung von Dingen untersagt, die von jemand anderem weggeworfen wurden, wäre eine weitere Möglichkeit. Aber weder wollen die meisten Briten so leben, als wären sie MI 5-Agenten, noch sind Eigentumsrechte am Müll ein kapitalistischer Anreiz. Doch selbst wenn wir all dies täten, hätte Weggeworfenes immer noch die Struktur und den Wert, die »Benji the Binman« für uns alle sichtbar gemacht hat; nur würden wir ohne ihn und seinesgleichen und ihr etwas befremdliches Hobby nichts davon wissen. Darüber hinaus wären wir und unsere Nachwelt wahrscheinlich alle etwas ärmer. Jetzt aber hinzugehen und Benjis »Anti-Archiv« zu zerstören – eine geordnete Ansammlung, die im Gegensatz zu den meisten anderen Archiven nicht nur kostendeckend arbeitet, sondern auch einen ansehnlichen Gewinn erwirtschaftet –, wäre sicherlich eine philisterhafter und Kultur zerstörerische Tat; ganz ähnlich wie die von Lady Churchill, die Graham Sutherlands Portrait ihres berühmten Gatten verbrannt haben soll.1
Und so läuft es! Einmal aus dem Sack, können wir Benjis »Anti-Archiv« nicht wieder hineinstecken. Tatsächlich stand Benjamin Pell, obwohl ihm selbsternannte Psychologen nachsagten, dass er an einer »Zwangsneurose« (Schatten der alten Sowjetunion) leide, weniger als ein Jahr später auf der Liste für die begehrte Auszeichnung Scoop of the Year bei den so genannten Oscars des britischen Journalismus.2
****
Nun, diese Geschichte – »Benji the Binman« und sein »Anti-Archiv« – bestätigt so ziemlich jede Vorhersage der Mülltheorie, die ich in den 1960er Jahren3 erstmals aufgestellt habe (das Buch erschien erst 1979).
•Man kann keine Werte schaffen, ohne nicht zugleich Nicht-Werte zu erzeugen.
•Wir geben unserer Welt einen Sinn, indem wir sie auf überschaubare Proportionen zurechtstutzen.
•Dieses Zurechtstutzen kann weder unvoreingenommen geschehen,
•noch werden wir jemals eine allgemeine Verständigung darüber erzielen, wie dieses Zurechtstutzen erfolgen sollte.
•Und selbst dann, wenn das Zurechtstutzen vollzogen wurde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nicht von Dauer sein wird.
•Und so weiter …
Was also ist das für eine Theorie, die uns solche Vorhersagen liefert: Vorhersagen, die, obwohl ich das damals nie realisiert habe, eindeutig eine gewisse Relevanz haben, wenn es darum geht zu bestimmen, was man heutzutage als »Archivprozesse« bezeichnet.4
Um diese Frage schnell und einfach zu beantworten, beziehe ich mich auf eine Kritik der Mülltheorie aus dem Jahre 1979. Was mir an dieser Rezension besonders gefällt (ich komme aus einer Ingenieursfamilie), ist, dass sie nicht von einem Sozialwissenschaftler, sondern von einem Mathematiker, von Ian Stewart, stammt: 1979 ein aufstrebender junger Bursche, heute jedoch der wahrscheinlich bedeutendste Mathematiker Großbritanniens. Er beginnt mit dem rätselhaften Geschäft der Schaffung von Antiquitäten (antique-creation), in der er eine der Kernfragen der Mülltheorie erkennt:
•Wie wird aus etwas Gebrauchtem eine Antiquität?
•Wie, in einem größeren und weniger beweglichen Maßstab gedacht, kann aus einem von Ratten verseuchten Slum ein Teil unseres glorreichen Erbes werden?
•Und wie kann, wenn ich nun zu der Art von Prozessen komme, die Benjamin Pell auf den Kopf gestellt hat, eine Notiz zu einem entscheidenden Bestandteil eines nationalen Archivs werden?
Das waren die Fragen, die ich mir in den 1960er Jahren stellte, als ich an meiner Dissertation zu arbeiten begann, und natürlich habe ich mir die gesamte Literatur – insbesondere die der Wirtschaftswissenschaften – angeschaut, um herauszufinden, welche Antworten darauf es bereits damals gab. Zu meinem Erstaunen fand ich keine theoretisch begründeten Antworten auf diese Fragen und darüber hinaus, und das fand ich noch erstaunlicher, dass den meisten Theorien zufolge dramatische Wertverschiebungen dieser Art eigentlich unmöglich seien.
Ich war also in ein wunderbares Promotionsthema gestolpert; ich musste nur eine Theorie aufstellen, die (a) die Existenz von zwei Wertkategorien bewies: »vergänglich« (heute hier, morgen weg) und »dauerhaft« (für immer eine Freude), und die (b) zu erklären vermochte, wie Übergänge von der einen in die andere Kategorie möglich werden (und warum Übergänge in umgekehrte Richtung nicht möglich sind).
Abbildung 0: Die grundlegende Mülltheorie-Hypothese. Die festen Kästchen bezeichnen offene kulturelle Kategorien; das Kästchen mit der gestrichelten Linie bezeichnet eine verdeckte Kategorie wie die weggeworfenen Dokumente bei der Bildung eines Archivs. Die durchgezogenen Pfeile bezeichnen Transfers, die stattfinden, die gestrichelten solche, die nicht stattfinden, weil sie den Wert- und/oder Zeitrichtungen widersprechen, die die verschiedenen Kategorien definieren.
In seiner Besprechung erklärt Ian Stewart dies so:
»Sozialökonomen unterteilen seit Langem besitzbare Objekte in zwei Kategorien: in vergängliche und dauerhafte [...]. Der Wert in der einen sinkt auf null, der in der anderen steigt bis ins Unendliche. Michael Thompson argumentiert, dass es eine dritte, verdeckte Kategorie gibt: Müll. Müll hat keinen Wert, ist also für die sozioökonomische Theorie unsichtbar. Aber das ist eine engstirnige Selbsttäuschung. Denn Müll ist der Kanal zwischen dem Vergänglichen und dem Dauerhaften.«5
Wenn es die Müll-Kategorie nicht gäbe, wenn also alles auf der Welt irgendeinen Wert hätte, wären keine Transfers möglich. Doch auch dann, wenn diese Kategorie existiert, gibt es nur einen geraden Weg: vom Vergänglichen über den Müll zum Dauerhaften.
Diese herrlich einfache Hypothese leistet zwei wesentliche Dinge: Sie beantwortet meine Fragen (die drei Punkte oben) und sie rettet uns vor der »engstirnigen Selbsttäuschung« der orthodoxen Wirtschaftslogik. Dass sie nur gemischten Zuspruch fand, konnte nicht wirklich überraschen. In der Kunstwelt (wo dank meines Engagements in der Art and Language Group6 alles begann) wurde sie jedoch von Anfang an akzeptiert. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels (August 2016) ist eine frühe Version von Abbildung 0 als Kunstwerk in der Tate Britain Gallery in der Ausstellung »Conceptual Art in Britain: 1964-1979« zu sehen. Und ein Museum für moderne Kunst – das Karl-Ernst-Osthaus-Museum in Hagen, Deutschland – wurde ab den späten 1980er Jahren explizit nach den Prinzipien der Mülltheorie neu orientiert. Neben der konzeptuellen Kunst habe ich mit einer Reihe von Beispielen aus der realen Welt gearbeitet, von denen die gewebten Seidenbilder des 19. Jahrhunderts, die so genannten Stevenbilder (Stevengraphs), die in Coventry auf Jacquard-Webstühlen der Fabrik von Thomas Stevens Ltd. hergestellt wurden, vielleicht die schönsten waren. Im Jahr 1902 kostete ein kompletter Satz von sechzig Stevengraphs 2,55 £. Gleich nach dem Kauf waren sie so gut wie nichts mehr wert, und das blieb auch die nächsten fünfzig Jahre so. Doch 1973 waren sie 3.000 Pfund Wert, was, die Inflation berücksichtigt, etwa dem zweihundertfachen des ursprünglichen Preises entsprach.
Ian Stewart ist als Differenzialtopologe (eine Sorte von Mathematikern, deren Nase fein auf qualitative Unterschiede abgestimmt ist: auf Zustandsänderungen, wenn z.B. Eis schmilzt oder eine ruhige Strömung Turbulenzen entwickelt) besonders an einfachen Hypothesen interessiert, die zu komplexem und kontraintuitivem Verhalten führen. Und nachdem er sich beruflich mit der Katastrophentheorie7 auseinandergesetzt hatte, fühlte er sich besonders von einfachen Hypothesen angezogen, die zu genau dieser der Art von diskontinuierlichem Verhalten führen – den einen Moment verachten, den nächsten schätzen –, das dem Wertewandel der Stevenbilder zugrunde liegt (und nicht weniger den Häusern in der Londoner Innenstadt, die dank meiner zeitweisen Nebentätigkeit im Baugewerbe zu meinem zweiten wichtigen Beispiel wurden, da mir nicht nur das britische Social Science Research Council die finanzielle Unterstützung meiner Promotion verweigerte, sondern der Leiter meiner Fakultät sie zu verhindern versucht hatte). Die Mülltheorie, so erklärt Ian Stewart weiter, »untersucht diesen Mechanismus und seinen alles beherrschenden Einfluss.«8
•Welche Sorte Menschen bewirkt den Transfer?
•Welche Sorte Menschen versucht, den Transfer zu verhindern?
•Welche Sorte Menschen kann davon profitieren?
•Welche Sorte Menschen verliert dabei?
Indem er auf diese notwendige vierfache Varietät9 verwies, auf die vier verschiedene Arten von »sozialen Wesen«, die alle vorhanden sein müssen, wenn dieser Mechanismus mit seinem allgegenwärtigen Einfluss zum Tragen kommen soll, war Ian Stewart dem »anthropologischen Spiel« voraus, da er damit eine explizite Verbindung zu der vierfachen Typologie herstellte, die Mary Douglas (die meine Doktormutter war) in ihrem Aufsatz »Cultural Bias«10 dargelegt hatte: Eine Verbindung, die ich selbst erst viele Jahre später wirklich herstellen konnte.11 Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Mary Douglas« ursprüngliches analytisches Schema (sie nannte es »Rastergruppenanalyse«) zu einer vollwertigen und oftmals angewandten Theorie (als Cultural Theory, als »Theorie pluraler Rationalität«, als »neo-Durkheimische Institutionentheorie« und anderswie genannt) entwickelt, die, so wurde behauptet, »der Theorie der rationalen Entscheidung sowie den Weberschen und postmodernen Perspektiven im Hinblick auf die Sozialwissenschaften Konkurrenz macht.«12 Daher muss ich, wenn diese Behauptung zutrifft (und selbstverständlich will ich das zeigen) und Ian Stewart tatsächlich dem »Spiel« voraus war, hier innehalten, um diese implizite Verbindung explizit zu machen. Doch werde ich das hier auf eine eher lockere Art und Weise tun und die stärkeren Argumente erst im Nachwort zum Zuge kommen lassen.
Zum Zusammenhang zwischen Mülltheorie und Cultural Theory
Eines ist offensichtlich: Sozialer Status und Besitz von Dauerhaftem sind eng miteinander verbunden (wie, auf der anderen Seite, Marginalität und Müll). Und wir alle wissen, dass Geld allein keinen sozialen Status verleiht. Wenn es das täte, würden wir nicht diesen sozial aufreibenden Prozess bei denjenigen beobachten können, die »neues Geld« erworben haben, und es dadurch in »altes Geld« umzuwandeln versuchen, dass sie unter anderem Gegenstände erwerben, die dauerhaft sind, und mit ihnen angenehm zu leben versuchen (wie so schön mit der Bemerkung des Herzogs von Devonshire charakterisiert, die er nach der Abreise eines ziemlich bürgerlichen Gastes machte: »Was für eine Unverschämtheit von diesem Mann, über meine Stühle zu sprechen!«).
Aber es gibt noch einen anderen Weg, der zum gleichen Ziel führt: Denn manchmal gelingt es kreativen und aufstrebenden Individuen Frank Sinatra nachzueifern und to do it in their way, indem sie die Hohepriester davon überzeugen, dass all der Plunder, mit dem sie sich liebevoll umgeben, fälschlicherweise für Müll gehalten wird, während es sich in Wirklichkeit um schändlich missachtete Teile unseres glorreichen Erbes, also um Dauerhaftes handele. Dies ist (wie wir in Kapitel 3 sehen werden) zum Beispiel das, was in den 1960er und 1970er Jahren mit den Reihenhäusern in der Innenstadt von London geschah. Über die Kombination dieser beiden Wege – neues Geld alt zu machen und Müll in Dauerhaftes zu transformieren – kann aber Zweierlei ermöglicht werden: (a) das Kategoriensystem mit dem gesamten, sich ständig weiterentwickelnden technologischen Prozess, in dem Objekte produziert, konsumiert und konserviert werden, auf der Höhe zu halten, und (b) sicherzustellen, dass Status (z.B. das Gefühl, sich mit Dauerhaftem wohl zu fühlen) und Macht (z.B. jede Menge Geld) ständig neu aufeinander abgestimmt werden.
In der Klassengesellschaft, in der wir leben und auch weiterhin leben werden, muss dies in jedem Fall gegeben sein. Damit das geschieht, müssen aber die Kontrollen der Transfers zum Dauerhaften »genau richtig« sein: Durchlässig genug, um die »Klassenschau« aufrechtzuerhalten, und restriktiv genug, um die Kategorie des Dauerhaften nicht so aufzublasen, dass das Dauerhafte allgegenwärtig und es deshalb nicht länger möglich ist, die entscheidende Verbindung von Status und Macht wahrnehmen zu können: Anders gesagt, es muss ein Repeater-System geben.13 Dies wirft die Frage auf: Wie können wir all den anderen möglichen Verschiebungen auf die Spur kommen: Den Verschiebungen, die auf die eine oder andere Weise das Ganze aus dem Repeater-System herauslösen können, das solange herrscht, wie die Kontrollen »gerade richtig« funktionieren?
Das ist ganz offensichtlich die große Frage – eine Frage in einer Größenordnung, die uns ansonsten eher im Gebiet der Sozialwissenschaften begegnet. Leider müssen wir uns, um sie vollständig beantworten zu können, in das Gebiet der Kybernetik wagen – der Wissenschaft von Kommunikation und Kontrolle – und das ist etwas, was viele Sozialwissenschaftler vermutlich als einen Schritt zu weit ansehen könnten. Daher ist es wohl besser, wenn ich diesen Schritt bis zum Nachwort aufschiebe, wo ich auf das Fachwissen meines Koautors Bruce Beck zurückgreifen kann, einem (wie er es bescheiden formuliert) Gesellen der Steuerungstechnik.14 Stattdessen möchte ich nur auf zwei Dinge hinweisen: Erstens, dass das übergeordnete System (vorstellbar als drei miteinander verbundene Zisternen und zwei Wasserhähne) das Potential hat, Verschiebungen über zwei Dimensionen – Status und Macht – hinweg zu bewirken; und zweitens, dass es, um dieses Potential zu realisieren, eine ausreichende Heterogenität unter den individuellen Akteuren geben muss, damit all die möglichen dynamischen Veränderungen (diesen Hahn öffnen, jenen Hahn schließen etc.) ermöglicht werden. Eine Analogie hierzu wäre das mysteriöse Spiel, bei dem (ausreichend viele) Menschen um einen Tisch herumsitzen, von denen ein jeder einen seiner Finger auf ein umgedrehtes Glas legt, das Glas sich daraufhin zu verselbständigen scheint und auf der glatten Tischoberfläche hin und her rutscht.
Eine solche notwendige Varietät steht, wiewohl ein wichtiges Konzept der Kybernetik, in ernsthaftem Widerspruch zum Großteil der Sozialwissenschaften, da diese verlangen, dass Rationalität plural sei (wohingegen die Theorie der rationalen Entscheidung zum Beispiel darauf besteht, dass sie singulär sei und wir alle rationale Nutzen-Maximierer seien). Jedes »soziale Wesen«, so die Cultural Theory, strebt nach einem anderen Ziel (von denen die Nutzen-Maximierung nur eines ist); sie drehen den Hahn also auf oder zu, doch in jedem Fall in der Erwartung, damit das Ganze ihrem Ziel ein Stück näher bringen zu können, wenn es ihnen denn gelingt, diejenigen zu überwinden, die sie in andere Bereiche abzudrängen versuchen. Allerdings muss diese Pluralität der Rationalität ausreichend sein; und sie muss vierfach sein: Lediglich zwei Paar Hände (etwas, das die Sozialwissenschaften in der Regel am ehesten befürworten, wie z.B. Märkte und Hierarchien) könnten zwar Vor- und Rückwärtsbewegungen bewirken, ließen jedoch die volle Bandbreite der anderen Varianten ungenutzt. Zum Beispiel:
•Beim Repeater-System, das heißt, wenn also die Kontrollen »gerade richtig« sind, gibt es viel Hierarchisierung und viel Konkurrenz, schlagen sich die mit den Transfers vom Vergänglichen in den Müll und vom Müll ins Dauerhafte einhergehenden, unvermeidlichen Machtveränderungen schnell in entsprechenden Statusänderungen nieder. Doch trotz aller unvermeidlichen Veränderungen bleiben die Dinge die Gleichen: So verstanden sich zum Beispiel die im 19. Jahrhundert zu Wohlstand gekommenen Britischen Brauer schließlich »zum Brauen geadelt«.
•Wenn die Kontrollen restriktiver werden, können sich Status und Macht nicht mehr aufeinander beziehen, und geraten wir in dem Maße, wie sie divergieren, in eine Kasten-Gesellschaft (wie im klassischen indischen System, in dem der fleischverzehrende Radscha zwar unangefochten an der Spitze der Machtstruktur sitzt, sich aber innerhalb der Hierarchie der Kasten dem vegetarischen Brahmanen unterordnet).15 Vielleicht lässt sich der in Großbritannien gegenwärtige, oft beklagte und trotz aller Bemühungen, sie zu fördern, bestehende Mangel an sozialer Mobilität mit einer – relativ geringen und leicht zu übersehenden – Verschiebung von der Klasse hin zur Kaste erklären.
•Wenn die Kontrollen zu lasch gehandhabt werden, dann bricht die Kategorie des Dauerhaften unweigerlich unter ihrem eigenen Gewicht zusammen. Der Status »Geld« (currency) beginnt aufzuweichen, und das Ganze wird sich im rechten Winkel weg von der Klassen-Kasten-Achse verlagern. Mit dem Verschwinden der Statusunterschiede werden die Transaktionen symmetrischer, und bewegen wir uns auf einem immer stärker abgeflachten »Spielfeld«, das zwar bei denen, die restriktive Praktiken verabscheuen, beliebt sein, doch von denjenigen abgelehnt werden dürfte, die in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft keine Möglichkeiten haben, auf einen grünen Zweig zu gelangen. Margaret Thatchers so genannte »Unternehmenskultur« (enterprise culture) kann hier verortet werden. Und einige hochgradig individualistische Gesellschaften, wie zum Beispiel die im Hochland von Neuguinea, die im Zeremonialtausch von Schweinen miteinander konkurrieren, gelangen tatsächlich an die Spitze (obwohl sie nicht in der Lage sind, sich in dieser Position zu halten, wie wir in Kapitel 9 sehen werden).
•Weitere Einstellungen der Hähne werden die anderen möglichen Verschiebungen in dieser zweidimensionalen »Tabelle« umreißen.16
Die erforderliche Varietät wird durch die Antworten auf die vier Fragen, die Ian Stewart aufgelistet hat, gut erfasst:
•Diejenigen, die in der Lage sind, to do it in their way – wir können sie als »Crashers-through« bezeichnen –, sind die Verfechter dessen, was in der Cultural Theory als »individualistische Solidarität« bezeichnet wird. Sie haben genug Kraft, um den Hahn offen zu halten, der den Fluss der Objekte (selbstverständlich ihrer eigenen) vom Müll ins Dauerhafte ermöglicht.
•Diejenigen, deren Ziel es ist, die Kontrolle der Hähne durch die »Crashers-Through« zu überwinden – wir können sie »Hohepriester« (»high priests«) nennen (wie zum Beispiel jene Literaturkritiker, die zu bestimmen versuchen, was in den Kanon aufgenommen werden soll und was nicht) –, sind die Verfechter dessen, was man als »hierarchische Solidarität« bezeichnen kann.
•Diejenigen – wir nennen sie »Nivellierer« (»levellers«) –, die durch die Überflutung der Kategorie des Dauerhaften sowohl den Status als auch die Macht herabzusetzen vermögen, sind die Apostel dessen, was man als »egalitäre Solidarität« bezeichnen kann.
•Und diejenigen – wir können sie »Verlierer« (»losers-out«) nennen –, die sich trotz aller Bemühungen immer wieder an den Rand gedrängt sehen (die sozusagen unfähig sind, irgendeinen Hahn kontrollieren zu können, und wenn, nicht wüssten, ob sie ihn auf- oder zudrehen sollen) sind die Verfechter dessen, was man als »fatalistische Solidarität« bezeichnen kann.
So hilft uns die vierfache Pluralität, die in den Sozialwissenschaften weit verbreiteten, unzulänglichen ein- und zweifachen Schemata zu überwinden und liefert uns damit das, was wir für eine anständige Theorie brauchen: die erforderliche Varietät.17 Darüber hinaus hat sie eine gewisse Plausibilität, da wir uns selbst und andere in ihr erkennen können.18 Oder anders ausgedrückt (und ich hoffe, dass das im Nachwort deutlicher wird): Die Cultural Theory ist der Mülltheorie inhärent; sie sind aus einem Guss: eine einzige, ziemlich alles umfassende Theorie. Aber was, mag man fragen, rechtfertigt, einmal abgesehen von dieser Verschmelzung innerhalb dessen, was oft abschätzig als Grand Theory19 bezeichnet wird, diese Neuauflage der Mülltheorie?
Das Buch selbst und warum es immer noch gültig ist
Der Grundgedanke ist, um es noch einmal kurz zu rekapitulieren, dass die beiden kulturellen Kategorien – die des Vergänglichen und die des Dauerhaften – der Welt der Objekte »sozial aufgezwungen« werden. Deckten diese beiden Kategorien die materielle Welt vollkommen ab, dann wäre der Transfer eines Objekts von der einen in die andere Kategorie nicht möglich, da die sie definierenden Kriterien sich wechselseitig widersprechen: Objekte in der Kategorie des Vergänglichen haben einen ständig abnehmenden Wert und eine erwartet endliche Lebensdauer; die in der Kategorie des Dauerhaften haben dagegen einen ständig zunehmenden Wert und eine erwartet unendliche Lebensdauer. Doch decken diese beiden Kategorien natürlich nicht alles ab; sie umfassen nur die Objekte, die überhaupt einen Wert haben, und klammern einen riesigen Bereich aus: Den Müll, also den Bereich, der, wie es sich zeigt, die Einbahnstraße vom Vergänglichen zum Dauerhaften darstellt. Ein vergängliches Objekt, einmal hergestellt, verliert an Wert und erwarteter Lebensdauer und erreicht schließlich in beiderlei Hinsicht den Nullpunkt. In einer idealen Welt, dem unheimlichen Weltbild, mit dem die neoklassische Wirtschaft arbeitet, würde das Objekt, hat es seinen Dienst getan, in einer Staubwolke verschwinden. Doch sehr häufig geschieht dies eben nicht, sondern hält es sich in einem wert- und zeitlosen Schwebezustand (im Müll), bis es gelegentlich von einem kreativen und aufstrebenden Individuum entdeckt und in die Kategorie des Dauerhaften überführt wird.
Wer genau die Menschen sind, die diese wertschöpfenden Transfers bewirken können, und welche Sorte Menschen sich mit vergänglichen Objekten, mit dauerhaften Objekten oder mit Müllobjekten wohl fühlen, sagt viel über unser dynamisches und sich ständig veränderndes Gesellschaftssystem aus. Erkennbar wird daran auch, dass sowohl die Statusleiter selbst, als auch die auf ihr in beiderlei Richtungen stattfindenden, subtilen Verschiebungen davon abhängen, dass es »da Draußen« Sachen gibt, die wir herumschieben können (und von denen wir herumgeschoben werden): von der Materialität, wie manchmal gesagt wird. Mit anderen Worten, und das ist wohl die entscheidende und nachhaltige Botschaft dieses Buches, auf das Zeug kommt es an. Wir brauchen eine Theorie der Menschen und ihres Zeugs, insbesondere jetzt, wo wir mit scheinbar unlösbaren Problemen wie dem Klimawandel konfrontiert sind – und genau das ist es, was die Mülltheorie leisten kann (und was Bruce Beck und ich im Nachwort zu erklären versuchen).
In den ersten Kapiteln wird die Rahmung dieser drei-Komponenten-und-zwei-mögliche-Transfers abgesteckt, und darauf aufbauend werden die sozialen und kulturellen Dynamiken untersucht, die durch sie entstehen. Dies geschieht zunächst anhand von Fallstudien: anhand von Objekten, wie den Stevenbildern (Stevengraphs), und anhand von zeitgenössischen Auseinandersetzungen darüber, welche Objekte welche Transfers machen können (Grange Park, damals ein verfallenes Herrenhaus in Hampshire, ist ein spektakulärer ästhetischer Zankapfel). Ein zweiter Anlauf wird dann in Form einer anthropologischen Feldforschung unternommen: als teilnehmende Beobachtung im Baugewerbe bei der Arbeit in Islington im Norden Londons, das sich damals in den Anfängen der so genannten Gentrifizierung befand.
Doch das ist alles nicht so einfach und werden die Dinge bald ziemlich kompliziert. Denn wie ein wohlwollender Rezensent bemerkte, eröffnet die Mülltheorie die Möglichkeit, sich mit einer Frage auseinanderzusetzen, die im Zentrum der Sozialwissenschaften steht (oder besser gesagt stehen sollte).
»Im Grunde gibt es nur zwei mögliche Themen für die Sozialwissenschaften – Stabilität und Wandel. Da Stabilität nur mit sehr viel Veränderung zu erreichen ist, es aber ohne Stabilität keinen Wandel geben kann, besteht immer die Gefahr, dass die Sozialwissenschaften ihren Untersuchungsgegenstand verschlucken. Michael Thompsons Mülltheorie ist ein heroischer Versuch, gerade lange genug außerhalb der Gesellschaft zu stehen, damit das Subjekt aufhören kann, nach seinem eigenen Schwanz zu jagen.«20
Anders gesagt: Die Auseinandersetzung mit der Materialität einerseits und mit Stabilität und Wandel andererseits führt uns in einen regelrechten Mahlstrom sozialer und kultureller Dynamik: einen Mahlstrom, in dem allmähliche und sanfte Veränderungen einiger Variablen zu plötzlichen und diskontinuierlichen Veränderungen bei anderen führen können: wie bei einer Reihe bis dahin vernachlässigter Phänomene, mit denen sich Mathematiker gerade zu diesem Zeitpunkt auseinandersetzen: die Katastrophentheorie, wie sie von dem großen französischen Topologen Réné Thom genannt wurde (Katastrophe bedeutet auf Französisch einfach »diskontinuierliche Veränderung« und ist nicht wie der englische Begriff negativ konnotiert). Die Katastrophentheorie war der entscheidende Vorläufer all jener Theorien – »Chaos«, »Komplexität«, »dynamische Systeme« und so weiter –, auf die man sich nun verlässt (in den physikalischen und biologischen Wissenschaften allerdings häufiger als in den sozialen). Die Katastrophentheorie stützt sich typischerweise auf »gefaltete Landschaften«, auf »morphogenetische Felder«, auf denen sich die »Schwerkraft« in beide Richtungen auswirken kann: Je nachdem, wo sich die Dinge in Bezug auf eine Falte befinden, können die diskontinuierlichen Veränderungen nach oben oder nach unten verlaufen, und diese geometrischen Erkenntnisse haben einige tiefgreifende Konsequenzen auch für unser Verständnis von dem, was im sozialen Leben vor sich geht.
»Durch all das hindurch zieht sich, wenn man genau zuhört, die Sprache der Verstoßenen, die wieder aufstehen wollen. Wäre es nicht wunderbar, wenn sich das verschmähte Objekt, die abgelehnte Idee, Person oder Gruppe, wenn sich die Müllhaufen der Gesellschaft als ihre Transformatoren, die in ihrem kollektiven Körper die Samen einer zukünftigen Regeneration enthalten, erweisen würden? Wenn das, was untergeht, plötzlich in der Welt wiederauftauchen könnte, so wie der Aufstieg aus einer gesellschaftlichen Kluft?«21
Auch wenn ich nahezu vierzig Jahre später immer noch der Meinung bin, dass nichts davon falsch ist, räume ich allerdings gerne ein, dass das Buch ganz und gar vom Charme der damaligen Zeit durchdrungen ist.22 Tatsächlich bietet es aufgrund seiner Ursprünge in der frühen Konzeptkunst einen großen Schluck vom intellektuellen Gebräu, das in den 1960er und 1970er Jahren brodelte; das würde ich heute nicht nochmals in dieser Weise machen. So führen die weiteren Kapitel des Buches entlang seiner grundsätzlich optimistischen Argumentationslinie zu Orten, die auf den ersten Blick ziemlich weit entfernt von den Fallstudien und der Feldarbeit in den ersten Kapiteln erscheinen mögen: Zu den Wirtschafts-zyklen, die durch die zeremonielle Schweinezucht unter den Völkern im Hochland von Neuguinea hervorgerufen werden (und die den jüngsten und andauernden Transformationen der Weltwirtschaft verblüffend ähnlich sind), oder zu sozio-linguistischen Prozessen, die dazu führen, dass die Bemühungen um Stabilität innerhalb unserer Bildungssysteme die Curricula einer ganzen Reihe von Veränderungen unterworfen haben, die uns (zumindest für eine gewisse Zeit) zu genau dem zurückgebracht haben, wovon wir durch eben diese Bemühungen wegkommen wollten. Ist es also nur der Charme der Zeit oder ist das Buch immer noch relevant? Letzteres würde ich behaupten wollen, doch möchte ich dazu erklären, was mit der Mülltheorie in den etwa vierzig Jahren seit ihrer ersten Veröffentlichung geschehen ist (oder fünfzig Jahren, wenn wir mit dem Artikel An Anatomy of Rubbish zu zählen beginnen, der 1969 in New Society erschien).
Vielleicht ist die bleibende Botschaft des Charmes dieser Zeit die Omnipräsenz dessen, was Aaron Wildavsky, Richard Ellis und ich (damals, als wir uns zusammensetzen, um das Buch »Cultural Theory« zu schreiben23) als Krummlinigkeit (curvilinearity) definiert haben: Nichts, wie es auch die Mülltheorie klar zeigt, verläuft je entlang einer Geraden. (Kant hat es etwas eleganter ausgedrückt: »Aus so krummen Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden.«) Vielmehr stellt sich wie bei den ganzen gefalteten Landschaften, den Schweinezyklen und curricularen Verzerrungen immer wieder heraus, dass ein sich in bestimmter Weise Verhalten immer mehr hervorbringt als das, was wir erwarten; um dann, ohne erkennbaren Hinweis darauf, dass sich etwas geändert hat, wie einen Rückwärtsgang einzulegen; und uns damit zwingt, entweder weitaus weniger zu akzeptieren oder gewohnte Verhaltensweisen drastisch zu verändern. Oder wie es der vernachlässigte Ökonom Hyman Minsky formulierte, der die globale Finanzkrise 2007/08 vorhersagte, aber nicht mehr erlebte: »Stabilität destabilisiert.«24
Die periodischen Abfolgen von wirtschaftlichen Aufschwüngen und Krisen werden üblicherweise als Folge der fortgeschrittenen Industrialisierung verstanden. Wirtschaftstheorien, die diese zyklischen Dynamiken zu analysieren versuchen (keynesianisch, schumpeterianisch usw.), gelten daher als nicht geeignet, primitive Gesellschaften zu verstehen. Doch führt (wie wir in Kapitel 9 sehen werden) die zeremonielle (und konkurrierende) Schweinezucht im Hochland von Neuguinea zu Zyklen, die, wie sich zeigen lässt, selbst mit so ausgeklügelten Modellen nicht zu erklären sind, wie es das Hansen-Samuelson-Modell des Handelszyklus ist. Die »Großen Männer«, wie sie im Pidgin genannt werden, vergeben in der optimistischen Aufschwungsphase Kredite (wobei man sehr darauf achtet, die »Müllmänner« zu übergehen), dennoch beginnt, in einer Weise, die der Kreditklemme bzw. der globalen Finanzkrise von 2007/08 frappierend ähnlich ist, das Vertrauen mehr und mehr zu schwinden und löst schließlich einen katastrophalen Zusammenbruch aus: Eine trostlose Phase von Pleiten, die zu Kriegen zwischen nun misstrauisch gewordenen Clans führt. Bis es schließlich wieder aufwärts geht. Mit anderen Worten, und wie ich kürzlich im Zusammenhang mit der Krise von 2007/08 argumentiert habe,25 wird diese Art von erratischen Zyklen wahrscheinlich in jedem menschlichen Sozialsystem und nicht nur in fortgeschrittenen Industriegesellschaften zu finden sein. Nicht nur die Entwicklungsländer haben Entwicklungsprobleme; es hätte nur noch wenige Jahre mit seiner jüngsten negativen Wachstumsrate (ca. 5 Prozent) gebraucht, bis Griechenland in die Reihe der LDC (Least Developed Countries) aufgenommen worden wäre.
Stabilität und Wandel, Gradualismus und Saltation, Ordnung und Aktion, Evolution und Revolution, Beständigkeit und Veränderung: Rückblickend sind das einige der beängstigenden intellektuellen Herausforderungen, die sich ergeben, sobald wir unsere Nasen in den Müll zu stecken beginnen. Ein Fall von »Dummköpfen, die hereinstürmen« mögen einige sagen, doch hat die Mülltheorie, so lässt sich behaupten, einen ziemlich brauchbaren Schuh daraus gemacht. Doch was hat, anders gesagt, die Mülltheorie (die frühen Kapitel) mit der Katastrophentheorie (die späteren Kapitel) zu tun? Sir Christopher Zeeman (der so viel für die Entwicklung und noch mehr für die Anwendung dieses neuen Gebietes der Mathematik getan hat) gab in seinem Vorwort zur Erstveröffentlichung die Antwort.26 »Das langfristige Ziel«, so erklärt er, »ist es, einige der zentralen Paradoxien der Sozialwissenschaften anzugehen, wie z. B. die Beziehung zwischen Werten und Verhalten, zwischen Weltsicht und Handeln, zwischen Kultur und Gesellschaft.« Weiterhin schreibt er, dass eine der wichtigsten Erkenntnisse der Mülltheorie
»die Beobachtung ist, dass ein Paradox unter Umständen nichts anderes ist als die Existenz zweier verschiedener Konfigurationen desselben Systems unter denselben sozialen Zwängen. Die Analogie zur Physik wird durch die Verwendung desselben universellen mathematischen Modells für beide, nämlich die Cusp-Katastrophe, präzisiert. Dies wiederum verweist auf eine Vielzahl verwandter Phänomene, eine Synthese von Ideen, die ohne die Geometrie nicht möglich gewesen wäre; noch dass diese Synthese ohne die Sprache der Geometrie hätte zum Ausdruck gebracht werden können.«27
Ursprünge und Folgen der Mülltheorie
Die Theorie nahm ihren Anfang als ein eindeutig anthropologisches Projekt: Sie basiert auf den Arbeiten meiner Doktormutter, Dame Mary Douglas, insbesondere auf ihren Büchern »Purity and Danger« und »Natural Symbols«28 und entsprach der althergebrachten Forderung der Disziplin nach zwei oder mehreren Jahren teilnehmender Beobachtung (obwohl der Ort, im Herzen der Hauptstadt eines entwickelten Landes und nicht in einer abgelegenen und schriftlosen Gesellschaft, etwas unkonventionell war). Auswirkungen hatte sie jedoch hauptsächlich in anderen Bereichen und Disziplinen, vor allem in Kunst und Architektur. Wie bereits erwähnt hatte ich mich stark bei der frühen Konzeptkunstbewegung Art and Language engagiert. Peter Rayner Banham ließ mich immer eine Vorlesung vor seinen Erstsemestern am University College London, der Bartlett School of Architecture, halten; und neuerdings habe ich erfahren, dass es seit 2016 im Libanon ein serielles Kunstwerk, das Rubbish Theory fanzine, gibt.29 Auch in der Archäologie gab es (nicht zuletzt durch Colin Renfrews Interesse an der Katastrophentheorie) Auswirkungen, und diese Einflüsse breiteten sich alsbald auf Museologie und Ästhetik aus.
Ich erinnere mich an einen aufregenden »Schmutzkongress«, der um 1980 im Darmstädter Werkbund stattfand und von Lucius Burckhardt einberufen wurde; er leitete dann auch die weitere Konferenz »Design der Zukunft«, die im legendären Ballhaus in Berlin-Kreuzberg stattfand.30 Dann (wie bereits erwähnt) das Karl Ernst Osthaus-Museum in Hagen, dessen Direktor Michael Fehr es ab 1988 explizit auf der Mülltheorie aufbauend neu orientierte: Eine erfolgreiche Initiative, die 2002 zur großen Jubiläumsausstellung »Museutopia – Schritte in andere Welten« führte, zu der ich einen Beitrag über Kunstwerke in Form einer einaktigen Farce über Ökonomen leistete,31 den ich später zu einem Buchkapitel über die abfallwirtschaftlichen Probleme mit dem Begriff der Knappheit erweitern konnte.32 Der Museutopia-Ausstellung ging eine (vom Karl Ernst Osthaus-Museum und dem Kulturwissenschaftlichen Institut Essen veranstaltete) interdisziplinäre Konferenz »Utopisches Denken« voraus, zu der ich den Beitrag »Visions of the Future« beisteuerte, in dem ich die Mülltheorie mit der vierfachen Typologie der Cultural Theory verknüpfte.33
Neben diesen eher ästhetischen Zusammenkünften kam die Mülltheorie auch in den Museum Studies an; so fand ich mich selbst als Hauptredner bei einem Treffen der Association of Nordic Museums in Lillehammer, Norwegen, wieder, und ein großer Teil der Mülltheorie wurde in einen der Leicester-Reader in Museum Studies aufgenommen (Thompson 1994b).34 Etwa ein Jahrzehnt später fand die Mülltheorie über eine Konferenz im Landesmuseum für Natur und Mensch Oldenburg ihren Weg in das neu entstandene Gebiet der Müllgeschichte (Thompson 2003b),35 und kurz darauf, im Jahr 2002, über eine Konferenz unter der Schirmherrschaft des Kulturwissenschaftlichen Forschungskollegs Köln in die Archivkunde.36 Wie im Vorwort erläutert wird, hat sie sogar die Grundlagen für ein ganz neues Feld – die Discard Studies – gelegt und wurde mit der Entstehung der Cultural Studies und des Poststrukturalismus in Verbindung gebracht (oder vielleicht sollte ich sagen: dafür verantwortlich gemacht).
Ein großer Teil dieser Auswirkungen, das ist klar, war in Deutschland und nicht in Großbritannien zu verzeichnen, und auf die Anthropologie hatte die Mülltheorie im Übrigen nur sehr wenig Einfluss. Dass der Prophet in eigenen Land nichts gilt, könnte eine Erklärung für diese seltsame Tatsache sein; eine andere ist, dass, Mary Douglas Verpflichtung zur Universalität folgend (auf der Suche nach Theorien und analytischen Schemata, die für alle Gesellschaften zu allen Zeiten gelten), die Mülltheorie gegen den anthropologischen Strom schwamm, der sich, und das ist stellenweise immer noch so, sehr stark in Richtung Partikularismus bewegte (alle Gesellschaften und alle historischen Perioden sind unvergleichlich verschieden; das Beste, was man machen kann, ist eine dichte Beschreibung zu entwickeln). Doch, wie auch immer die Erklärung aussehen mag, im Jahr 1979 lief es in Oxford für die Mülltheorie gar nicht gut.
Der Brief
»Ich möchte, dass Sie das auf Ihrem Schreibtisch haben, wenn Sie aus dem Urlaub zurückkehren«, lautete die erste Zeile des wütenden Briefs eines Wirtschaftsprofessors, der auch Mitglied des Vorstands der Oxford University Press (OUP) war, an deren Geschäftsführer. Seine Empörung galt der Rubbish Theory, die an diesem eilfertigen Torwächter vorbei in der allgemeinen Reihe der OUP erschienen war. Allerdings befand sich die Rubbish Theory dabei in bester Gesellschaft, denn sie erschien in derselben Reihe und im gleichen Jahr wie James Lovelocks Gaia-Hypothesis, einem Buch, das es auf die berüchtigte Liste Books fit for burning der Zeitschrift Nature geschafft hatte. Den ganzen Brief durfte ich nie lesen, doch hatte er eine unmittelbare und verheerende Wirkung. Die OUP verbannte die Rubbish Theory in den Müll; über Nacht wurde sie zu einem Unbuch. Es gab keine zweite Auflage, meine Bitte, mir die Rechte am Manuskript zurückzugeben, wurde bereitwillig erfüllt, und der Herausgeber der allgemeinen Reihe verlor seinen Job (»Das Beste, was mir je passiert ist«, sagte er mir einige Zeit später).
Der Verlagsleiter hätte sich natürlich behaupten und darauf hinweisen müssen, dass es sich nicht um eine wirtschaftswissenschaftliche Publikation handelte, dass sich auch andere Disziplinen mit dem Thema Wert beschäftigten und dass sie im Übrigen von einigen Wirtschaftswissenschaftlern bereits positiv aufgenommen wurde (z. B. gab es eine Rezension im Journal of Economic Literature, die mit der Frage begann, warum »dieses Buch von einer großen Wirtschaftszeitschrift ernst genommen wird«, und zum Schluss kam: »[...] ich empfehle dieses Buch jedem Wirtschaftswissenschaftler, der sich für die philosophischen und soziologischen Grundlagen der Wirtschaftstheorie interessiert.«37 Doch konnte er sich nicht durchsetzen, und so wurde das Buch Gegenstand des ersten Transfers, der in ihm beschrieben wird: von der Kategorie der Vergänglichkeit in die des Mülls. Aber die Katze war aus dem Sack, die 1.500 Exemplare waren durch das Tor gekommen, bevor es ihr eifriger Hüter zuschlagen konnte, und etwa dreißig Jahre später hat das Buch nun den zweiten Transfer durchlaufen: aus dem Müll in die Kategorie des Dauerhaften. Der Preis für antiquarische Exemplare (wie Carl Zimring, ein Professor am Pratt Institute in New York, der jedes Jahr einen Kurs in Mülltheorie gibt,38 auf unterhaltsame Weise beschrieben hat) ist immer weiter gestiegen, was ihn spekulieren ließ, dass eine Neuveröffentlichung den Preis für die Erstausgaben in schwindelerregende Höhen treiben könne. All dies wirft die Frage auf, ob und wie sich die Mülltheorie seit jenen leidenschaftlichen Tagen auf die Wirtschaft ausgewirkt hat. Und diese Frage zu stellen, bedeutet auch zu fragen, wo die Mülltheorie selbst jetzt steht. Darauf komme ich im Nachwort genauer zu sprechen.
Von kitschigen Stevengraphs und rattenverseuchten Slums zu Systemdenken und Engineering Anthropology
Wie es der Zufall wollte, arbeitete ich zum Zeitpunkt, als die Mülltheorie veröffentlicht wurde, im Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA), einem Think-Tank in Österreich, der in einem ehemaligen Palast der Habsburger vor den Toren Wiens untergebracht ist; einem Ort, an dem Wissenschaftler (wie wir genannt wurden) aus Ost und West an der Lösung von problems of common interest arbeiteten: also wie man die Welt ernähren, bewässern, mit Energie versorgen kann und so weiter. So kam ich in Kontakt mit Leuten wie Brian Arthur (einem irischen Wirtschaftswissenschaftler, der zum Entsetzen der meisten seiner Kollegen zusammen mit zwei ukrainischen Mathematikern über competing technologies under increasing returns to scale39 forschte, einer Arbeit, die ihm später den Schumpeter-Preis einbringen sollte, doch damals fast seinen Job kostete), und Bruce Beck (einem englischen Chemieingenieur, dessen von Ideen aus der Luft- und Raumfahrttechnik und der Ökologie inspirierte Arbeit an der Control Theory die herkömmliche Überzeugung im Bauwesen, dass die Verschmutzung durch die Städte kontrolliert werden könne, durch die Annahme in Frage stellte, dass die Welt sich in einem unveränderlichen, stabilen Zustand befinde). Auch der kanadische Ökologe Crawford »Buzz« Helling war da und legte gerade zu dieser Zeit seinen vierfachen ecocycle vor: eine inzwischen hoch geschätzte Abfolge von Transformationen, die (in ihrer zugrunde liegenden Dynamik) nicht nur den Mustern unheimlich ähnlich war, die in der Cultural Theory von Mary Douglas frühem Werk und in der Mülltheorie implizit enthalten sind, sondern auch in ihrer späteren Arbeit und in meinem (mit Richard Ellis und Aaron Wildavsky) verfassten Buch Cultural Theory explizit formuliert wurden.40
In unserem Nachwort werden Bruce Beck und ich also zunächst ausführlicher darlegen, wie die Mülltheorie zur Idee der pluralen Rationalität geführt hat (den vier »Lebensweisen«, die jeweils mit den anderen konkurrieren und doch voneinander abhängig sind, und von denen nur eine mit dem »rationalen Nutzen-Maximierer« übereinstimmt, der von der neoklassischen Ökonomie angenommen wird), und dann zeigen, wie die Zusammenführung von Materialität einerseits und Stabilität und Wandel andererseits in der Mülltheorie zu dem geführt hat, was wir engineeringanthropology nennen. Auch wenn viele Anthropologen und Ingenieure über diese Synthese verwirrt sein mögen (und sich sogar gegen sie sträuben), glauben wir, dass dies das Ziel ist, zu dem uns die Mülltheorie vierzig Jahre später und dank ihrer zufälligen Abzweigung in die Systemtheorie geführt hat.41
Wir begründen dies damit, dass das Bauwesen, das sich schon lange als »die Nutzung der großen Naturkräfte zum Wohle der Menschheit« definiert hat, einen die Materialität respektierenden Ansatz braucht, sollen die endlosen Auseinandersetzungen darüber, was einen Nutzen darstellen kann und was nicht, verstanden und das Beste aus ihnen gemacht werden können. Radioaktiver Abfall zum Beispiel bedeutet für die einen das Ende der Zivilisation, so wie wir sie kennen; andere würden ihn gerne auf ihre Cornflakes streuen.42 In der Tat ist die vielleicht größte aller Veränderungen, seitdem die Mülltheorie zum ersten Mal veröffentlicht wurde, die massive Zunahme der Sorge über den Zustand unserer Umwelt und die Kontroverse um diese Sorge, insbesondere über die Frage des Klimawandels. Fragile Erden, Blaue Planeten, Grenzen des Wachstums, Planetarische Grenzen, Stumme Frühlinge, Nukleare Winter, Überladene Archen und so weiter bis hin zu der (natürlich stark umstrittenen) Behauptung, dass wir jetzt im Anthropozän leben: All dies ist in den letzten vier oder mehr Jahrzehnten ins Blickfeld geraten. Und da es die Stoffströme sind, insbesondere die Kohlendioxidströme, die im Mittelpunkt dieser Besorgnis stehen, sollte die Mülltheorie dazu etwas zu sagen haben. In der Tat hat sie das, und das ist es, was das Nachwort leisten muss, wenn die Theorie und ihre Relevanz vollständig auf den letzten Stand gebracht werden sollen.
1Ob sie das Bild tatsächlich verbrannte, weiß man nicht genau. Was man weiß, ist die Tatsache, dass sowohl sie als auch ihr Mann das Gemälde verabscheuten, und dass dieses historische Portrait – zum Zeitpunkt seines Entstehens war der Porträtierte der bedeutendste lebende Engländer und der Porträtierende der bedeutendste lebende englische Maler – nach Lady Churchills Tod nirgends gefunden wurde.
2The British Press Awards, um ihren korrekten Namen zu verwenden. Die Veranstaltung fand am 21. März 2001 im Londoner Hilton-Hotel statt; der Bericht über Herrn Pells Nominierung für den begehrten Preis erschien an diesem Tag in The Independent – eine der wenigen britischen Zeitungen, die nicht im Besitz von News International sind. Damals bestritt Benji (erneut), dass er die Quelle der undichten Stelle war, die die ganze Aufregung in der Nummer 10 verursacht hatte, bekannte sich jedoch zu beeindruckenden Zahlen anderer Scoops. Vielleicht war es also doch ein Maulwurf oder ein Hacker der Konservativen Partei.
3Vgl. Thompson, M.: An anatomy of rubbish: from junk to antique, in: New Society, 28. Mai 1969; Thompson, M.: The death of rubbish, in: New Society, 28. Mai 1970. Der Erste bot dem Herausgeber die Gelegenheit, eine Roy Lichtenstein »Reproduktion« auf der Titelseite des Magazins abzubilden – die eines in einem eleganten Stöckelschuh steckenden Fuß, der auf das Pedal eines blumengeschmückten Treteimers tritt. Die billige Drucktechnik, mit der die New Society hergestellt wurde, passte zwar recht gut zu Lichtensteins charakteristischen »Punkten«, überbot ihn jedoch insoweit durch die Verwendung von nur zwei Farben, während seine, nicht ganz so billige Technik, drei verwendete.
4Pompe, H. und Scholz, L. (Hg.): Archivprozesse, Köln 2002.
5Stewart, I.: Review of Rubbish Theory, in: New Scientist, 23. August 1979, S. 605.
6Dazu gehörten etwa ein Dutzend Künstler, meist Briten, die sich dafür einsetzten, den Kunstbegriff über das Kunstobjekt zu stellen. Beispielsweise fanden ihre konventionelleren Kommilitonen an der Slade School of Fine Art, wenn sie zu ihren unvollendeten Zeichnungen im Life Room zurückkehrten, kleine Kärtchen an ihnen befestigt vor: »Sei kein Malerschwein.« Viel Einfallsreichtum steckte in der Entwicklung von Kunstwerken, die wir für nicht-besitzbar hielten; in der Tat zogen wir Worte den Markierungen auf der Leinwand vor, und dies führte zu Sammlungen von »Kunst als Worte« in Form einer Zeitschrift: Art-Language.
7Vgl. Zeeman, E. C.: Catastrophe Theory. Selected Papers 1972-1977, London 1977.
8Stewart, wie Anmerkung 5.
9Ashbys Gesetz der erforderlichen Varietät – dass ein Steuerungssystem mindestens so viel Varietät enthalten muss, wie in dem, was es kontrollieren soll, vorhanden ist – ist in der Kybernetik von entscheidender Bedeutung: die Wissenschaft von der Kontrolle, siehe Ashby, W. R.: Variety, constraint and the law of requisite variety, in: Buckley, W. (Hg.): Modern Systems Research for the Behavioural Scientist, Chicago 1968.
10Douglas, M.: Cultural Bias, Occasional Paper, Nr. 35, Royal Anthropological Institute London, 1978. Wiederabdruck in: Douglas, M.: In the Active Voice, London 1982.
11Thompson, M.: Times Square: deriving cultural theory from rubbish theory, in: Innovation, 16 (4), 2003, S. 319-29.
126, P. und Mars, G. (Hg.): Introduction to The Institutional Dynamics of Culture, Bd. 1, Farnham 2008, S. XV-XLI.
13Es war Basil Bernstein, einer der Begründer der Cultural Theory, der zum Leidwesen vieler seiner Soziologenkollegen immer wieder die Frage stellte: »Wie produziert ein Repeater System das Nichtwiederholbare?« Wir werden ihm und den dynamischen und sich ständig selbst transformierenden Systemen, die er verstehen wollte, in Kapitel 8 begegnen.
14Siehe jedoch Thompson, M.: Anmerkung 8, für das, was ich unter einem vernünftigen ersten Versuch verstehe.
15Anstreben anstelle von Ankommen ist der Name dieses Spiels, und das gilt für alle vier divergierenden Ziele. Selbst wenn die Kaste scheinbar alles erobert, wie Marriott, M. in: Hindu transactions: diversity without dualism, in: Kapferer, B. (Hg.): Transactions and Meaning, Institute for the Study of Human Issues, Philadelphia 1967, gezeigt hat, gibt es immer noch mehr als einen Hauch von Klasse (vgl. Thompson, M.: Times Square).
16Siehe Thompson, M.: wie Anmerkung 11.
17Zum vollständigen Set der Programme – es gibt insgesamt fünfzig, von denen einige noch nicht von der Sozialwissenschaft »kolonisiert« wurden – siehe Thompson, M.: Organising and Disorganising, Axminster 2008, insbesondere Kapitel 8.
18Dass sich Menschen oft in allen vier Gemeinschaften wiedererkennen, untergräbt die Theorie in keiner Weise, denn das Argument ist, dass es die Gemeinschaften und nicht die Individuen sind, die die Grundlage für die Analyse darstellen. Tatsächlich ist Individualität, die wir zu einem großen Teil aus unserer Auseinandersetzung mit anderen entwickeln, von Natur aus relational. Wir bewegen uns in und aus unterschiedlichen Gemeinschaften in verschiedenen Bereichen unseres Lebens – zum Beispiel am Arbeitsplatz und zu Hause – und wir ändern unser Verhalten (und unsere Rechtfertigungen für unser Verhalten) entsprechend. Für Kulturtheoretiker ist es sinnvoller – wie es McKim Marriott schon lange getan hat – vom »Trennenden« (»dividual«) zu sprechen.
19In diesem Fall (und wie in 6, P. und Mars, G. (Hg.), a.a.O., schön erklärt) ist es die Durkheimsche Grand Theory.
20Wildavsky, A.: Delving into dustbins (review of Rubbish Theory), Times Literary Supplement, 27. Juni 1980, S. 736.
21Wildavsky, a.a.O.
22Nicht wirklich charmant, mögen einige einwenden, da sie zuweilen und stellenweise in das umschlägt, was heute als politicalincorrectness angesehen werden könnte: Bauarbeiter lassen in der Schwulendisco die Sau raus, Macho-Zitate von Mick Jagger, die Erwähnung von Darkies and Bubbles und so weiter. Eine Möglichkeit, die ich in Betracht zog, war, diese beleidigenden Passagen zu entfernen oder zu ändern; doch das hätte nicht der Meinung der Berater des Verlags entsprochen, die unisono darauf bestanden, dass der Originaltext ohne jegliche Änderungen reproduziert werde. Zu meiner Entlastung möchte ich darauf hinweisen, dass die Feldarbeit nicht nur die Beobachtung, sondern auch die Teilnahme des Anthropologen erfordert; und so habe ich viele glückliche und recht gut bezahlte Jahre im Baugewerbe verbracht. Tatsächlich war diese Tätigkeit die ökonomische Grundlage meines akademischen Lebens; wenn ich nicht über begrenzte Talente als Zimmermann und Reparateur alter Häuser verfügen würde, hätte ich die Anthropologie schon sehr früh (also vor meiner Promotion) aufgeben müssen. Und: Ja, ich nehme an, wir waren politisch inkorrekt, obwohl man das damals nicht so sah. Tatsächlich waren es zwei schwule Freunde von mir, die fröhlich erzählten, dass sie ihren Bauherrn in einer Disco getroffen hatten. Es gibt auch einen sachlichen Fehler (auf S. 68 der ersten Ausgabe), der korrigiert werden muss, nämlich dass es mir gelungen ist, die Größen des englischen Landschaftsgartens in die falsche Reihenfolge zu bringen: Lancelot »Capability« Brown, Humphry Repton, William Kent. Es muss Kent (1684-1748), Brown (1716-1783), Repton (1752-1815) heißen.
23Thompson, M., Ellis, R. und Wildavsky, A.: Cultural Theory, Boulder 1990.
24Minsky, H.: The financial instability hypothesis, The Jerome Levy Economics Working Paper Series, 1992, Neudruck in: Argyrous, G. und Stilwell, F. (Hg.): Economics as a Social Science: Readings in Political Economy, North Melbourne 2003, S. 201-203.
25Thompson, M.: How BOFIs (Banks and Other Financial Institutions) Think, Mary Douglas Memorial Lecture, University College London, 25. Mai 2016.
26Wir haben dieses Vorwort vor allem deshalb nicht in diese Neuveröffentlichung aufgenommen, weil die Anwendung mathematischer Techniken in der Anthropologie nicht mehr so neu ist, wie sie es 1979 war. Dies gilt auch für die Katastrophentheorie.
27Zeeman, E. C.: Foreword to Thompson, M.: Rubbish Theory, Oxford 1979, S. IX.
28Douglas, M.: Reinheit und Gefährdung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreinigung und Tabu, Berlin 1985; dieselbe: Ritual, Tabu und Körpersymbolik. Sozialanthropologische Studien in Industriegesellschaft und Stammeskultur, Frankfurt a. M. 1974.
29Siehe: www.behance.net/gallery/14430349/A-Rubbish-Fanzine.
30Thompson, M.: Welche Gesellschaftsklassen sind potent genug, anderen ihre Zukunft aufzuoktroyieren?’, in: Burckhardt, L. (Hg.): Design der Zukunft, Köln 1987, S. 58-87.
31Thompson, M.: A bit of the other: a farce in one act, in: Fehr, M. und Rieger, T. W. (Hg.): Museutopia – Schritte in andere Welten, Hagen 2003, S. 208-217.
32Thompson, M.: A bit of the other: why scarcity isn’t all it’s cracked up to be, in: Mehta, L. (Hg.): The Limits to Scarcity, London 2010, S. 127-144.
33Thompson, M.: Visions of the future, in: Rüsen, J., Fehr, M. und Rieger, T. W. (Hg.): Thinking Utopia: Steps into other Worlds, Oxford 2005, S. 32-52.
34Thompson, M.: The filth in the way, in: Pearce, S. M. (Hg.): Interpreting Objects and Collections, London 1994.
35Thompson, M.: Stoffströme und moralische Standpunkte, in: Fansa, M. und Wolfram, S. (Hg.): Müll-Facetten von der Steinzeit bis zum Gelben Sack, Mainz 2003, S. 217-228.
36Thompson, M.: Benji the binman and his anti-archive, in: Pompe, H. und Scholz, L. (Hg.): Archivprozesse. Die Kommunikation der Aufbewahrung, Köln 2002, S. 100-110.
37Smith, C. A.: Review of Rubbish Theory, in: Journal of Economic Literature, 28, 1980, S. 1094f.
38Siehe: https://carlzimring.com/2013/01/31/an-exercise-in-rubbish-theory/, aufgerufen am 18.09.2020.
39Wie im biblischen »Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden.« Im Nachwort geben wir ein Beispiel dafür: Thomas Crappers inzwischen allgegenwärtiges Wasserklosett, das seinen Rivalen verdrängt: das Erdklosett von Pfarrer Henry Moule.
40Siehe Anmerkung 23.
41Im Rückblick stelle ich fest (nicht unähnlich Molières bürgerlichem Gentilhomme, der entdeckte, dass er sein ganzes Leben lang Prosa gesprochen hat), dass ich schon seit einiger Zeit Anthropologie und Ingenieurwesen zusammengebracht habe. In der Tat habe ich bereits in den 1980er Jahren, als ich Mitglied der Risiko-Arbeitsgruppe des britischen Umweltministeriums und des Rates für Wirtschafts- und Sozialforschung war, ein Kapitel mit dem Titel »Engineering and Anthropology: Is there a Difference?« geschrieben, in: Brown, J. (Hg.): Environmental Threats: Perception, Analysis and Management, London 1989, S. 138-150. Und einige Jahre später wurde ich zusammen mit unserem damaligen Umweltminister eingeladen, einen Vortrag in der Plenarsitzung des Weltkongresses für Abfallwirtschaft in der Hofburg in Wien zu halten: einer sehr fröhlichen Veranstaltung, die von der ISWA, der International Solid Waste Association, gesponsert wurde (Thompson, M.: Waste and fairness, Social Research 65 (1), 1998, S. 55-73). Es gab auch einen Gastbeitrag in der Zeitschrift Waste Management and Research, der auf einem Vortrag basierte, den ich bei De Balie in Amsterdam gehalten habe (Thompson, M.: Blood, sweat and tears (guest editorial), in: Waste Management and Research, 12, 1994, S. 199-205), sowie einen kleinen Aufsatz, den für das Blue Ribbon Panel der US National Academy of Engineering von 2006 bis 2007 zu schreiben Bruce Beck und ich von Paul Crutzen (ein mit dem Nobelpreis ausgezeichneter Atmosphären-Chemiker und Autor des geologischen Begriffs »Anthropozän«), eingeladen wurden (Crutzen, P., Beck, M. B. und Thompson, M.: Cities – Blue Ribbon Panel on Grand Engineering, US National Academy of Engineering essay, in: Options, Winter issue, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria 2007, S. 8). Dies hat zu einer umfangreichen Arbeit unter der Rubrik »Cities as Forces for Good in the Environment« (CFG) geführt, von der ein Großteil unter www.cfgnet.org archiviert ist. Darüber hinaus waren Bruce Beck und ich, und das ist es, was am Ende den Weg für unser Nachwort frei gemacht hat, vor Kurzem am Foresight Future of Cities-Project der britischen Regierung beteiligt (Thompson, M. und Beck, M. B.: Coping with Change. Urban Resilience, Sustainability, Adaptability and Path Dependence, UK Government Foresight Future of Cities Project, 2014; siehe auch: www.gov.uk/government/publications/ future-of-cities-coping-with-change, aufgerufen am 18.09.2020).
42In den 1980er Jahren nahm ich an einem Treffen (der Hoover Institution der Stanford University) der stark die Atomkraft befürwortenden Organisation Scientists and Engineers for Secure Energy teil, bei dem viel über Forschungsarbeiten (hauptsächlich über Nagetiere) diskutiert wurde, die darauf hinzudeuten schienen, dass die Exposition gegenüber schwach radioaktiver Strahlung ihnen tatsächlich gut tut. Andere sind natürlich nicht überzeugt und sehen jede Strahlung als schädlich an, und wieder andere sehen eine niedrige Strahlenbelastung als proportional schädlicher an als eine höhere. Alles hängt daher vom Verlauf der so genannten »Dosis-Wirkungs-Kurve« ab, und bei niedrigen Werten besteht große Unsicherheit darüber, wie sie verläuft. Mit anderen Worten, die wissenschaftliche Unsicherheit ist so groß, dass man jeden Verlauf, den man gerne hätte, bekommen kann (siehe dazu Kapitel 5 von Schwarz, M. und Thompson, M.: Divided We Stand – Redefining Politics, Technology and Social Choice, Philadelphia 1990).
Rubbish Theory (1979)
1. Der Schmutz auf dem Weg
Rätsel: Der Reiche steckt es in seine Tasche, und der Arme wirft es weg. Was ist das? Antwort: Rotze.
Während Kinder dieses Rätsel gewöhnlich äußerst lustig finden, besteht die normale Reaktion von Erwachsenen darin, es als kindisch, anrüchig, ziemlich abstoßend und keiner ernsthaften Beachtung wert zu betrachten. Die Mülltheorie stellt diese Reaktion nicht nur auf den Kopf, sondern betrachtet diesen Witz als besonderer Aufmerksamkeit wert, und zwar gerade, weil die normale Reaktion von Erwachsenen in der westlichen Kultur darin besteht, ihm keine Beachtung zu schenken. So ist es schon von Anfang an nahezu unmöglich, sich distanziert, objektiv und wissenschaftlich dem Gegenstand der Mülltheorie zu nähern. Der ernsthafte Erwachsene ist ein ernsthafter Erwachsener, weil er kindischem Dreck aus dem Weg zu gehen versucht, und deshalb erscheint es als ein Widerspruch, sich mit dem Anspruch eines ernsthaften Erwachsenen mit kindischem Dreck zu beschäftigen – nicht weniger widersprüchlich als die Haltung eines kommunistischen Börsenmaklers (oder vielleicht eines jungen Konservativen oder eines Kunst-Ausbilders).
Dieses kindische Rätsel lässt jedoch in geeigneter, wenn auch vulgärer Weise die Umrisse des Schwerpunktes meines Erkenntnisinteresses erkennen. Zuallererst definiert es eine Beziehung zwischen einem Status, dem Besitz von Gegenständen und der Fähigkeit, Gegenstände wegwerfen zu können. Das einwandfreie und ziemlich wenig amüsante Beispiel, das mit dem Rätsel aufgestellt wird, mag folgendermaßen ausgedrückt werden: Es existiert ein Statusunterschied zwischen dem Reichsein und dem Armsein, wobei ersteres einem höheren und letzteres einem niedrigeren Status entspricht. Reichsein oder Armsein bestimmt sich nach der Menge der Gegenstände, die man besitzt: Eine arme Person besitzt wenige Gegenstände, eine reiche Person viele. Aber wie kann man feststellen, ob jemand reich oder arm ist? Abgesehen von Vagabunden ziehen es die meisten Menschen vor, sich ohne ihre ganzen Besitztümer zu bewegen, und wirklich reiche Leute wären physisch gar nicht in der Lage, ihren Besitz mit sich zu führen, selbst wenn sie es wollten und selbst wenn man einmal annähme, dass sie die Sicherheits- und Versicherungsprobleme, die ein solch ostentatives Verhalten mit sich brächte, lösen könnten. Nun, die Antwort lautet, dass es sehr schwierig sein kann, einen Reichen von einem Armen zu unterscheiden. Doch kann als sicherer Hinweis auf den Status gelten, wie viele Gegenstände Leute in der Lage sind wegzuwerfen. Ein Armer, da er nur wenig Besitztümer hat, wird kaum etwas, ein Reicher dagegen mehr wegwerfen können.