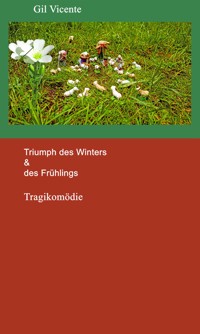Beste Kulissen für die Kunst
Münster entwickelt sich zur Stadt der Galerien
Die bedeutendste Galerie nördlich der Ruhr liegt in Münster, ausgerechnet dort, wo es den Bürgern genügt, sich an Stelle eines Kunstwerkes ein Zebrafell oder ein Plakat übers Sofa zu hängen. Seitdem es das Picasso-Museum gibt, hat sich Münster zu einer Stadt der Galerien entwickelt. Beim regelmäßig im September stattfindenden „Schauraum“ kann sich jeder Besucher selbst einen Eindruck davon machen. Wie wird sich Münsters Kunstszene erst entwickeln, sobald die Stadt über ein eigenes Matisse-Museum verfügen sollte?
Wollmütze, graumelierter Bart, weißes T-Shirt mit doppelköpfiger Dohle – so tritt Kolja Steinrötter auf. Wie ein Schicki-Micki-Galerist will einer der jüngsten Galeristen Münsters nicht wirken. Darauf deutet der Name der Galerie an der Germania Brauerei
5: FB 69. Ist er Mitte 40? Heute findet eine Vernissage im Beisein
katalanischer Künstlerinnen statt. Nachdem er Wasser gereicht hat, bringt er ein Laptop in sein „Wohnzimmer“. Dort heizt er den viel jüngeren Gästen mit Pop-Musik ein. Jetzt scherzt jemand über ein mit Neonlicht beleuchtetes Bild. Darauf ist eine Frau mit BH abgebildet:
„Ist sie Pornodarstellerin?“ Im Wohnzimmer stellt Steinrötter unkonventionell aus, denn die Bilder hängen kreuz und quer. Ein weiteres zeigt eine asiatische Frau zwischen roten Bällen. Auf einem Podest steht ein weißes Pferd mit pinselartigem Schwanz.
Im September feiern die Münsteraner wie in jedem Jahr den „Schauraum“. Zahlreiche Galerien und Ateliers öffnen an einem langen Wochenende ihre Tore. Ein Rundgang durch die ganze Stadt
bereitet Freude, weil sich Erkenntnis bringende Gespräche mit Ausstellern ergeben und sich ein schneller Überblick über deren Werke ermöglicht. Leider fürchten sich viele Menschen, überhaupt eine Galerie zu betreten, weil sie meinen, sie verstünden nichts von moderner Kunst.
Lebendig erzählt Steinrötter, wie sehr es ihn reize, Talente zu finden und zu fördern. Manche kritisierten ihn: Seine Galerie sei „eher etwas für junge Leute“. Dagegen stellt er, Kunst für junge Leute gebe es nicht. Sie sei zeitlos. „Das, was mein Vater in den 1960-er Jahre angeboten hat, kann ich heute noch aufhängen.“ Er hat nach dem Soziologie-Studium vier Jahre in der Galerie seines Vaters
Claus Steinrötter gelernt. In dem neuen Feld der Kunst spreche ihn die von Frauen an: „Ich habe gemerkt, dass Frauen ganz früh mit größerer Sensibilität als viele Männer arbeiten und mit einer größeren Sicherheit Eigenständigkeit anstreben.“ Dage
gen seien sie unsicherer im Schritt in die Außenwelt. Genau hier könne er einspringen. „Mit einer Künstlerin muss ich oft diskutieren. Sie ist genial, hat eine Begabung, für die sich Leute umbringen würden. Sie braucht bloß ein bisschen zu zeichnen, das dann einfach rührend ist.“ Sie frage sich aber: Ist meine Kunst gut genug? Soll ich nicht besser Lehrerin
werden? Von solchen Künstlerinnen blieben viele auf der Strecke.
Seine Vernissagen bestreiten häufig ausländische Künstlerinnen. Im Ausland gebe es oft eine lebendige junge Kunstszene. In
Deutschland beschränke sich die Szene eher auf den Hobbybereich. „Viele haben vergessen, welche Aufgabe Kunst hat. Die Emotionen bei den Kritikern
reichen von Empörung bis Begeisterung. Gegenwartskunst löst häufig Irritation aus. Sie stellt Fragen, provoziert, öffnet einen kleinen Abgrund. Die Leute verwechseln oft Kunst mit Dekoration, die
sie dann für 25.000 Euro kaufen. Aber dem wahren Künstler fehlt dann das Geld.“ Steinrötter lernte die Künstlerinnen Carla Rendon und Jessica Ruiz aus Badalona – „einem Stadtteil von Barcelona mit schlechtem Ruf“ - vor einigen Jahren kennen. Auf einem ihrer Bilder im ans Wohnzimmer
angrenzenden Ausstellungssaal rollt einer Frau mit grünen Augen eine Träne über die Wange. Sie schließt ihre Hände. Zwischen den Fingern läuft eine mit Edelsteinen besetzte Kette hindurch, an deren Ende ein goldenes
Kreuz hängt. Sie scheint zu beten. Auf einem anderen Bild befinden sich zwei aneinander
gebundene Katzen. Ein Kater springt hoch und zieht eine Katze mit hinauf. Unter
ihnen liegen Rosen. Neugierig gehen zwei Frauen hin, schauen auf den Preis.
Monate später wieder in Steinrötters Galerie: Bei einer Vernissage der Däninnen Vibeke Mejlvang und Sofie Hesselholdt erkundigt sich ein Besucher, ob
jemand ein Bild der Katalaninnen gekauft habe. „Nein!“ Steinrötter machte in einer Pressemitteilung auf die neue Ausstellung neugierig: Sie zählten zu Skandinaviens bedeutendsten Künstlerinnen. Er lernte sie auf einer Messe kennen, zeigte ihre Werke schon im
Jahr 2009. Jetzt stellt er sie wieder aus. Denn das ist eines seiner neuen
Geschäftsmodelle. „Als Galerist bin ich die erste Instanz zur Bewertung der künstlerischen Qualität.“ Er treffe die erste Auswahl. „Das haben Galeristen schon immer so gemacht.“ Statt wie ein Kunsthändler nur das einzukaufen, was sich am besten verkaufe, stelle er Kunst auch
noch ein zweites oder drittes Mal aus. Im besten Fall sei ein Künstler noch in 40 Jahren in seiner Galerie vertreten. „Ich möchte ihn irgendwann einmal im Museum oder in einem Kunstverein vertreten sehen.“
Die Werke der Däninnen sind nicht leicht zu entschlüsseln. Denn sie befassen sich mit dänischen Besonderheiten. Die Damen wählten dafür einen Malgrund aus gebranntem Ton, den man in Dänemark mit blauen Farben bemalt, um mit ihnen Wände zu schmücken. Jeder ihrer Teller ist ein Unikat. Am unteren Rand eines solchen Tellers
ist „1219 ·15 Juni ·1969“ eingraviert. Auf ihm zwei Mönche und ein Bischof. Über ihnen fällt eine Flagge herunter. Das Datum 1219 erinnert an den Sieg König Waldemars II. gegen die damals noch heidnischen Esten. Als die Schlacht
verloren schien, fiel der Legende nach die dänische Flagge, der Danebro, vom Himmel. Die Schlacht wendete sich, die Esten
wurden geschlagen. Der Danebrog ist ein Geschenk des Himmels.
Kolja Steinrötter hat das Redetalent seines Vaters Claus, einem der ältesten Galeristen Münsters. Dieser erzählt gerne lustige Geschichten über die Stadt Münster und deren prominente Bewohner. Der Geschichten wegen lohnt es sich schon,
seine Galerie zu besuchen, nicht nur wegen der unerwarteten Kunst. Claus Steinrötters Galerie liegt in der Rothenburg 14-16. Er öffnet die bürgerlich-dezente Glastür: graue Haare, leichte Falten, große Brille. Er lächelt gewinnend. Sein Hemd unterm blauen Pullover ist gestreift. Den Hemdkragen
hat er darüber gelegt. Er verschwindet nach hinten, überlässt seinem Gast die Besichtigung. Es geht am „Wachhund“ im Foyer vorbei, der in Wirklichkeit ein lebensgroßes, modern gestaltetes Bronzekänguru ist.
Zu sehen ist auch ein Bild eines halbnackten Paares mit von einem Gewand
bedeckten Unterkörper. Fische liegen in beider Schoß. Der Mann trägt ein Baseballcap. Die Frau hat ihre pinkfarbenen Haare über die Brust gelegt. Beide schauen selig. Sie winkt. Zu ihren Füßen liegt auf einer Wiese mit Blüten eine nackte Frau. Alle Figuren befinden sich in einer Industrieruine, auf
deren Giebel ein gefesselter Christus gemalt ist. Vor dem Haus wuchert Gras,
auf dem rostige Gerüste stehen. Dieses Tryptichon lässt die Deutung zu, dass hier Kunst für den öffentlichen Raum geschaffen wird, in dem eine nahezu religiöse Botschaft verkündet wird. Jesus ist gefesselt. In der Galerie wird genau an diesem Platz dem
Besucher eine Bank zur Kontemplation angeboten.
Nach einigen Minuten kehrt Steinrötter zurück und erzählt, dass sein Wissen als Kunstkenner nicht nur der Förderung seiner Künstler diene. Er habe bereits den Verleger Hubert Burda beraten, ebenso den früheren Oberbürgermeister Dr. Jörg Twenhöven und Jost Springensguth, Ex-Chefredakteur der Westfälischen Nachrichten. Dieser habe ihn gefragt, warum das Feuilleton der Münsterschen Zeitung als das bessere beider Zeitungen gelte.
Im Büro ist jeder Platz belegt: Auf den Armlehnen des Sofas liegen Bücher; kleinformatige Bilder hängen an den Wänden. Kunstbände stehen teils in Regalen, teils stapeln sie sich auf einem weiteren Sofa. Außerdem stehen dort Wanduhren und Plastiken. In diesem geordneten Chaos erzählt er, er sei seit über 50 Jahren Galerist. Vom Kunsthandel grenzt er sich ab. „Ein Galerist ist symbiotisch mit dem Künstler. Er sitzt mehr in dessen Atelier als im Büro des Käufers. Er ist der intimste Partner des Künstlers.“ Dagegen kaufe ein Kunsthändler auf Märkten, um die Nachfrage zu bedienen. „Der Künstler orientiert sich an der Galerie, der er seine Werke anvertraut. Er muss
Leute haben, die seine Werke an die Oberfläche bringen. Ich muss ihm das Geld besorgen.“ Eine Ausstellung sei nur erfolgreich, wenn gekauft werde. „Bilder haben nur ihr richtiges Leben in den Händen der Sammler, nicht in den Galerien.“ Er stelle das aus, was er gut finde. Nur Geld zu verdienen, sei eine andere
Aufgabe. Wenn es nur darum ginge, würde er keine Galerie führen.
Galerie Hachmeister: graue Hausfassade, zugezogene Gardinen, unscheinbar
zwischen Raphaelsklinik und Promenade in der Klosterstraße. Wer zur Galerie kommt, sucht sie gezielt auf. Münsters bedeutendster Galerist, Entschuldigung, „einer der bedeutendsten Galeristen zwischen Düsseldorf und Hamburg“, sicher 1.80 Meter groß, dunkles Polohemd, hängt seine Bilder selbst auf. Er ärgere sich, wenn Dr. Klaus Bußmann, ehemaliger Direktor des Landesmuseums Münster, ihn bei Empfängen als besten Galeristen Münsters vorstelle. „Was ist denn schon zwischen Münster und Hamburg?“ Er nennt ebenbürtige Adressen in Düsseldorf und Hamburg. In Bremen habe er gelebt und das Glück gehabt, in die führenden Gesellschaftsschichten eingeführt zu werden. Doch ein Kunstmarkt existiere dort nicht, also auch keine Käuferschicht. Er selbst sei Ostfriese, seit 1979 Galerist in Münster.
Zuvor hat er ein Bild des Künstlers Georg Frietzsche (1955-1985) in einem seiner Räume aufgehängt. „Sie kennen ihn wahrscheinlich nicht.“ Er stamme aus Berlin. Hachmeister beschreibt ihn als schüchtern. Er verwalte dessen Nachlass. Er führt durch die Galerie, aber da er nicht richtig etwas erzählt, muss man sich selbst die Bilder erklären. Sie sehen filigran aus durch ihre Gewebestruktur, als hätte der Künstler die Textilien gefärbt und auf Papier gedruckt. Aber es sind Wachsplatten, die er markiert, gefärbt und aufgelegt hat. Auch gemalt hat er: Mit einfachen Pinselstrichen erzeugte
Frietzsche eine faszinierende Dreidimensionalität. Er malte „mit einem sehr sicheren Pinselstrich Linien, bei denen man nicht fehlgehen darf“. Denn sonst hätte er das Bild von vorne malen müssen.
Eine Mitarbeiterin bringt Kaffee, siezt „Herrn Hachmeister“, der erzählt, dass er sich von Soziologie schon lange verabschiedet habe. In dem Fach hat
er promoviert. „Ich schreibe sehr oft Texte für meine eigenen Katalogbücher, sogar für ausländische Verlage. Trotzdem nehme ich, wenn möglich, immer auch fremde beziehungsweise Spezial- Autoren mit ins Boot, damit es
nicht so nach Hausmacherart wird.”Auch das Design mache er selbst. Wenn er eine Übersetzung ins Englische brauche, beauftrage er eine Honorarkraft aus den USA,
die 16 Seiten günstig für etwa 600 Euro übersetze. So möchte Hachmeister wohl zeigen, wie gut er alles organisiert. Schließlich holt er ein Glas Weißwein, aber nicht ohne dem Gast Mineralwasser hinzustellen. Aber da der Markt für Kunst derzeit gesättigt ist, erläutert er von selbst die härteren Belastungen, unter denen er heute arbeiten muss. So lägen die Preise für Messestände im Verhältnis zum einkalkulierten Umsatz zu hoch. Er sei nicht mehr auf der Art Cologne
vertreten, weil er für die Gebühr ein sehr gutes Bild verkaufen müsse. „Das ist dann auch weg.“
Eine Woche später: In der Galerie findet eine Vernissage statt. Heiner Hachmeister trägt Anzug. Ehefrau und Tochter schenken den älteren Gästen Wein ein, füllen Gebäck in Schalen. Als die Zahl der Gäste abnimmt, ergibt sich die Gelegenheit, mit Hachmeister zu sprechen. „Ich habe ein Bild verkauft“, raunt er. „Das Bild mit dem roten Punkt.“ Jemand hat weit über 1.000 Euro investiert.
Das überrascht. Oft lassen sich Kunden Zeit.
Wie es zugehen kann, erlebte Paul Anczykowski, Inhaber der Galerie Clasing, der ältesten Galerie Münsters am Prinzipalmarkt. Er stellte einst ein Bild Emil Noldes aus, das er
einem Sammler für 8.000 Mark angeboten habe. Aber dieser habe geklagt, dass er dafür einige Werke für seine japanische Kunstsammlung kaufen könnte. Heute sei dessen Sammlung Millionen wert. Ein Jahr später sei er wiedergekommen. Der Wert sei auf 16.000 Mark gestiegen. Nach einem
weiteren Jahr sei er mit seiner Frau gekommen. Der Preis lag bei 20.000 Mark.
Wenn er das Werk jetzt nicht kaufe, würde sie es tun, sagte seine Frau. Heute sei es 300.000 Euro wert. Schon bei
Kolja Steinrötter stellte sich die Frage, wovon Galeristen hier eigentlich leben. Bei nicht
einem der mehrstündigen Besuche erschienen Käufer. Nicht immer findet sich ein Nolde im Safe. Claus Steinrötter sagt, es gebe kein schlechtes Pflaster, sondern nur ein schlechtes Angebot.
Kunst habe in Münster keine Tradition. Südlich des Limes, aber auch in Holland, kriegten die Leute „Schüttelfrost“, wenn die Wände leer seien. „Den kriegen hier viele nicht. Da tut es auch ein Zebrafell oder ein Plakat. Das
Auto und der Schmuck der Frau sind verlässliche Größen. Das ist Kunst nicht.“
Store Torv
geöffnet: 1. Mai - 30. September
Mo-Sa: 9.30 - 16.00 Uhr
Di: 10.30 - 16.00 Uhr
geöffnet: 1. Oktober - 30. April
Christo, Kirkeby und Picasso
Seite an Seite mit Schlaun
Münsters Innenstadt entwickelt sich auf 4,8 Kilometern zu einer Metropole der
Ateliers, Kunsthandlungen und Museen. Dies geschieht eher unauffällig im Schatten großer Städte wie Köln, Düsseldorf und Berlin. Wer hätte gedacht, dass in Westfalen und nicht nur bei Sothebys in London mit Werken
Christos, Picassos und Schmidt-Rotluffs gehandelt wird, in ihrer Heimat hoch
gehandelte Stars hier ihre ersten Schritte zur vielleicht internationalen
Karriere unternehmen.
Eine knochige Hand stützt das bärtige Kinn eines auf einer Stufe auf der Nordseite des Domes sitzenden Mannes.
Er trägt einen langen Umhang und sitzt mit dem Rücken zum Gekreuzigten. Traurig schaut er nach unten, aber ein abgeschlagenes
gespaltenens Haupt zu seinen Füßen beachtet er nicht. In der rechten Hand hält der Mann zwei Blätter, auf denen zum einen die Umrisse des mittelalterlichen Münsters zu erkennen sind, zum anderen die Häuserfront einer Stadt mit dem Titel „Das himmlische Jerusalem“. „Apokalypse“ steht auf einem Buchrücken unter dem rechten Mann des Mannes. Die Augen des haarlosen Toten sind
geschlossen. Neben ihm liegt der Griff eines Morgensterns, einer Waffe aus den
Bauernkriegen, verbunden mit zwei Schwertern, die einen Helm durchstoßen. Hinter liegen zerbrochene Herrschaftszeichen vergangener Mächte wie ein Hakenkreuz sowie Hammer und Sichel. Durch seine gebeugte Haltung
und den nachdenklich-traurigen Gesichtsausdruck ist zu erkennen, dass die
namenlose Hauptfigur die Taten all dieser dahinter stehenden Mächte als sinnlos erkennt. Er sitzt auf einem Scherbenhaufen aller falscher
Lehren. Das Wort Apokalypse bedeutet die Offenbarung Gottes, dass jede falsche
Herrschaft zerschlagen wird.
Der Düsseldorfer Künstler Bert Gerresheim hat diese Kreuzigungsgruppe 2004 geschaffen. Allein in Düsseldorf sollen an die 30 Skulpturen das Stadtbild beherrschen. Eigentlich steht
der Jünger Johannes unter dem Kreuz. Stattdessen steht dort der romantische Dichter
Clemens Brentano. Neben ihm stehen zwei Frauen, beide in Nonnentracht – Anna Catharina Emmerick und Edith Stein. Brentano hatte sich von Emmerick zwischen 1819 und 1824 ihre Visionen schildern
lassen, in denen die stigmatisierte Nonne des Augustinerordens die Leiden
Christi geschaut hatte, und daraus mehrere Bücher verfasste, die so genannten Emmerick-Schriften. An jedem Freitag erlitt die
in Coesfeld geborene Bauerntochter die Passion Christi. 2004 wurde sie selig
gesprochen. Die Jüdin Edith Stein ließ sich 1922 taufen und trat 1933 in den Karmeliterorden ein. 1942 wurde sie
trotzdem verhaftet und im KZ Auschwitz ermordet. 1998 wurde sie heilig
gesprochen. Es handelt sich um Menschen, die am Leiden Christi teilgenommen
hatten, ohne Zeitgenossen zu sein. Steht Gerresheim etwa in der Tradition von
Galens, dessen lebensgroßes Standbild vor noch gar nicht so langer Zeit am Ostchor des Doms aufgestellt
wurde, gestiftet von der Kaufmannschaft? Will er zeigen, dass Ideologien, die
sich dem Christentum entgegensetzen, den Zerfall schon in sich tragen?
Oft wird in Münster nach dem Kardinal von Galen gefragt, weil er es gewagt habe, den
Nationalsozialismus in seinen Predigten zu entlarven. Daher gilt er noch heute
als „Löwe von Münster“. Die Haltung von Galens führte zur starken Identifikation der Bürger mit der Stadt als Bischofs- und Kaufmannsstadt, so wie sie ihnen überliefert wurde. Diese Haltung setzt sich auch nach dem Kriege fort. Die Stadt
war hart getroffen von der Bombardierung. 90 Prozent der Innenstadt waren zerstört. Es entwickelte sich beim Wiederaufbau ein schwieriger Entscheidungsprozess
gegen eine moderne Stadt. In Hamburg und Kiel hingegen entschied man sich für ein modernes Stadtbild, was mancher heute bereut.
Münster ist eine alte Bischofsstadt. Es gibt nur wenige Städte, in denen erst eine Missionsstation an einer Furt entstand, der dann eine
Siedlung folgte. Hieraus entwickelte sich der Dom und um ihn herum die Domburg.
An die lehnte sich die Bürgerstadt an. Den Wohlstand bezogen die Bürger aus den frühen Marktrechten und der Hanse. Der Grundplan der mittelalterlichen
Stadtentwicklung wurde beim Wiederaufbau beibehalten. Das kann jeder leicht auf
Luftaufnahmen an den rund um den Dom angeordneten Straßenzügen erkennen. Münster ist eine katholische Stadt, was jahrzehntelang nicht nur der CDU
hervorragende Wahlergebnisse bescherte, sondern auch den Ruf einbrachte,
langweilig zu sein. Wer interessierte sich zwischen 1960 und der
Jahrtausendwende schon für Münster? Berlin, Düsseldorf und Köln waren als Szenestädte angesagt!
Um so mehr überrascht, dass sich in der von der Promenade umschlossenen Innenstadt ein reges
Kunstleben abspielt. Dies betrifft nicht nur das alle zehn Jahre stattfindende
Skulptur-Projekt. Denn auch die Anzahl der Ateliers und Kunsthandlungen wächst. Ebenso sind immer mehr Skulpturen und Installationen zu sehen, an denen
allerdings viele Einheimische achtlos vorübergehen. Das ist traurig, denn unter ihnen befinden sich nicht wenige von hoher
künstlerischer Aussagekraft. Auch bei der Architektur hat sich einiges getan. Zum
alten Baubestand sind neue Gebäude hinzugetreten, von denen einige so gelungen sind, dass sie das alte
historische Stadtbild sinnvoll ergänzen. Unter den Architektenbüros zählen vor allem Bolles+Wilson und Deilmann zu den Aushängeschildern. Unter den Künstlern befinden sich immerhin der Däne Per Kirkeby, Eduardo Chillida und Richard Serra.
In Deutschland ist der Dom zu Münster der einzige, der dem Apostel Paulus geweiht ist. Das hat folgende
historische Bewandtnis: Im 8. Jahrhundert tobte ein Streit darüber, auf welchem Wege die Missionierung stattfinden sollte: erst taufen, dann
christliche Unterweisung oder umgekehrt. Der Frankenkönig Karl der Große wollte erst taufen, was ihm 773 der northumbrische Abt Eanwulf empfohlen
hatte: So wurde Karl vorgeworfen, er predige mit „eiserner´Zunge“. Für ihn galt die Alternative: „Taufe oder Tod“. Kritik daran äußerte vorzugsweise der aus Friesland stammende Missionar Liudger. Seine Kritik
richtete sich gegen Massentaufen ohne Unterweisung. Maßgebend war für ihn der Apostel Paulus, dessen Maxime Liudger bei der Missionsarbeit übernahm; erst belehren, dann taufen. Nachdem er zum Bischof berufen worden war,
unterstellte Liudger seinen Dom und sein Bistum dem Apostel Paulus, seinem
Vorbild in der belehrenden Mission. Nicht eine von den 26 Bischofskirchen in
Deutschland ist Liudgers Beispiel gefolgt. Als erstes errichtete Liudger an der
Aa auf dem Horsteberg eine Missionskapelle. Liudger umgab die
Missionsniederlassung mit Wall und Graben. Ebenfalls geht die Domschule auf ihn
zurück. Sie rühmt sich heute, als Paulinum das älteste Gymnasium Deutschlands zu sein.
Die Christen im Bistum mussten ab dem Jahre 805 erst einmal ihren Kirchenpatron
kennen lernen. „Lesung aus dem Briefe des Heiligen Apostels Paulus“: So hörten und hören sie es bei fast jeder Messe: Ist Paulus denn ein Apostel? Jesus hat zwölf Apostel eingesetzt. Nachdem Judas sich erhängt hatte, war den elf Übriggebliebenen die Zahl zwölf so wichtig, dass sie diese wieder auffüllen mussten; sie wählten Matthias. Gott ist Mathematiker, das war allen klar, denn er hat den
gesamten Kosmos nach Maß, Zahl und Gewicht wohlgeordnet. Er hat der Sonne befohlen, sich in zwölf Monden im Jahreslauf zu drehen. Deshalb ist die Zahl zwölf Gottes Zahl. Alle Großmütter haben ihre Aussteuer zwölfteilig gesammelt. Das Überschreiten der heiligen Zwölf bedeutet ein Überschreiten der heiligen Ordnung Gottes. Nach dem zwölften Monat folgt die Silvesternacht. Keine US-Fluggesellschaft fliegt eine
Maschine mit der Nummer 13. Kann da der Apostel Paulus der dreizehnte Apostel
sein? Natürlich nicht, er ist mit Petrus zusammen ein Apostelfürst.
Doch steht er mehrfach als einzelner Apostel im Dom: An der Ostseite des Südwestpfeilers des Langhauses befindet sich ein Epitaph aus dem Jahre 1609. Hier
steht der Heilige Paulus als Doktor Gentium, Lehrer der Völker, rechts der Heilige Petrus als Pastor Ovium, Hirt der Herde. Im Hochchor
stehen rechts und links an der Wand die Steinfiguren Petrus und Paulus von
1350. Wenn Petrus und Paulus gemeinsam dargestellt werden, steht immer Petrus
rechts und Paulus links. Einen Hirten und einen Lehrer brauchen alle Menschen.
Paulus aber erklärt im Besonderen die Absicht des dreieinigen Gottes, die durch den Sündenfall verdunkelt wurde. So zeigen ihn die Zierscheiben im Johannischor, ein
Bild der Dreifaltigkeit, ein Bild Adams und Evas und des Apostels Paulus.
Der Dom zeigt Paulus nicht nur als Lehrer der Völker, sondern schon als Saulus bei der Steinigung des Märtyrers Stephanus und bei seinem Damaskus-Erlebnis. Im Stephanuschor ist an der
Vorder- und Seitenwand eines um 1625 entstandenen Sarkophags abgebildet, wie
Stephanus, Mitglied der christlichen Urgemeinde in Jerusalem, gesteinigt wird.
Saulus, der hier noch Pharisäer ist, betrachtet das Geschehen distanziert. Denn er ist blind für die wahre Lehre und verfolgt die Christen, da er diese für eine jüdische Sekte hält, die vom Gesetz abweicht. Eine wunderbare Begegnung mit dem auferstandenen
Christus aber verändert sein Leben. Von der Erscheinung Christi getroffen, fällt Saulus zu Boden, erblindet und wird nach Damaskus geführt. Der Christ Ananias heilt und tauft ihn. Saulus wird trotz seiner
Vergangenheit Christ, Apostel und Missionar (Apostelgeschichte IX, 17-19) und
nennt sich Paulus. Über der Tür zum Eingang des Domes im Paradies befindet sich noch ein Relief Johann Wilhelm
Gröningers von 1726, das auch die Szene der Bekehrung zeigt. Um 1570 fertigte der
Bildhauer Albert Reining einen Altar an, auf dem die Blendung und das
Sehendwerden den Mittelteil bilden. Die Darstellung dieses Reliefs befindet
sich in der Domkammer. Die gleiche Szene ist im Mittelteil des ehemaligen
Hochaltars, heute im Westchor, dargestellt – 1619 geschnitzt von Gerhard Gröninger. Damit aber ist noch nicht geklärt, welcher Apostel er ist. Er selbst nennt sich aber Apostel. Erster Brief an
die Römer, 1-6: „Paulus, Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel. Durch ihn (Jesus) haben wir
Gnade und das Apostelamt empfangen“. Die heilige Zwölf sieht der Christ in den Rundfenstern in beiden westlichen Querhausarmen und
im Westchor. Er sieht sie ebenso im Kalendarium der Astronomischen Uhr. Hier
erfährt man auch, welchen Platz Paulus einnimmt. Er bildet die Mitte im Kreis der zwölf Monate im Kalendarium der Uhr und ist nie der dreizehnte. Paulus ist mit
Petrus der Apostelfürst und bildet die Mitte der heiligen Zwölf. Der Zwölf des Jahres, des Tages und des Kreises der zwölf Apostel.
Vom Studentenwohnheim Collegium Marianum aus in der Frauenstraße 3 kann man in den privaten Garten des Bischofs schauen. Das Betreten ist nur
Priesteramts-Seminaristen, Klarissen-Schwestern und Vorsehungsschwestern
erlaubt, die im Bischofshaus wohnen. Vielleicht kann man ihn auch schwimmend
durch ein rostiges Abflussgitter betreten? Denn ihn durchschneidet die Aa. Der
jetzige Bischof sieht ihn mit alten hohen Bäumen wie einer gut und gerne 150 Jahre alten Platane sowie Beeten mit Rosen,
Hortensien und Lavendel als Rückzugsraum an. Dort kann er selbst ein wenig gärtnern. Kartoffeln, Himbeeren, Rhabarber und Stachelbeeren wachsen hier.
Münster steht im Rufe, langweilig zu sein. Doch stimmt das? In Münsters Innenstadt wächst die Zahl der Galerien und der Kunsthandlungen zwischen Schlossplatz und
Ludgerikirche. Sie präsentieren eine eine Vielfalt von deutschen und internationalen Werken vom 19.
Jahrhundert bis zur Moderne in der Innenstadt. Diese Kulisse zieht jährlich Tausende von Besuchern an. In Münster musste bisher keines der dort ansässigen Einzelhandelsgeschäfte schließen. Dazu tragen in erheblichem Maße auch die unter Münsteranern beliebten Fernsehproduktionen „Wilsberg“ und „Tatort Münster“ bei, die diese Kulisse gerne verwenden. Kommissar Thiel radelt genauso durch
die Stadt wie die meisten Studenten der Hochschulen. Wie oft fragen Besucher
die Ortsansässigen nach dem Antiquariat Wilsberg an der Überwasserkirche als Sitz des bekannten Privatdetektivs; auch in der Realität befindet sich dort ein Antiquariat. In jedem Münster-Krimi erscheint zudem das prächtige Gebäude des aus Baumberger Sandstein erbauten spätromanischen Paulus-Doms, der viele Besucher anzieht. Mittlerweile fällt es sogar der Domverwaltung schwer, der hohen Nachfrage nach Führungen nachzukommen. Am buntesten wird es auf dem Domplatz, wenn mittwochs und
samstags von 7.00 Uhr bis 14.30 Uhr der Wochenmarkt stattfindet, der der schönste Deutschlands sein soll. Vielleicht ist noch ein Platz im Marktcafé frei. Auf dem Marktplatz und Prinzipalmarkt geht es aber auch immer wieder um
das Sehen-und-gesehen-werden. Ruhiger ist es dort in den Abendstunden, um zum
Beispiel auf die blaue Stunde für Fotos vom Dom zu warten. Bei strahlendem Sonnenschein kommt der Sandstein aber
auch wirklich schön zur Geltung.