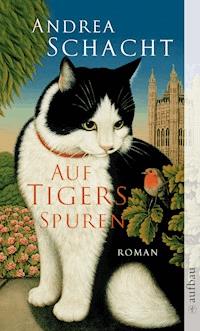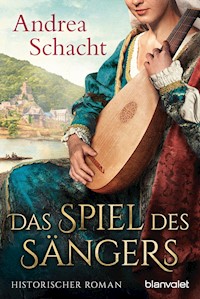Myntha, die Fährmannstochter Band 1 und 2: Die Fährmannstochter / Die silberne Nadel E-Book
Andrea Schacht
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gewitzt, originell und ihrer Zeit voraus: Die Fährmannstochter Myntha löst im mittelalterlichen Köln Kriminalfälle und kämpft gegen die Zwänge ihrer Zeit. Starten Sie mit der Reihe und lassen Sie sich in das Köln des 15. Jahrhunderts entführen - jetzt die ersten zwei Bände in einem E-Book lesen!
Zwei historische Romane in einem Band über die gewitzte Fährmannstochter Myntha!
» Die Fährmannstochter«
Brandstiftung in der Domstadt? Bei einem mysteriösen Feuer im Kloster der Machabäerinnen kommt die Oberin zu Tode. Verdächtigt wird eine kranke Pilgerin, die vor einigen Tagen von Myntha, der Tochter des Mülheimer Fährmanns, aus den Fluten des Rheins gerettet wurde. Myntha glaubt nicht an die Schuld der Pilgerin, zumal bekannt wird, dass die Oberin unmittelbar vor ihrem Tod mit einem Mann über die Qualität von Weihrauch gestritten haben soll. Steckt womöglich der düstere Fremde dahinter, der sich vor Kurzem mit einer Schar Kolkraben in der Nähe des Fährhauses einquartiert hat?
» Die silberne Nadel«
Köln 1420: Bei der Stammheimer Rheinmühle wurde ein grausiger Fund gemacht: Im großen Holzrad hängt die Leiche des Brotbeschauers Schroth. Die Würgemale an seinem Hals deuten darauf hin, dass sein Tod kein Unfall war. Unter Mordverdacht steht seine Geliebte, die ehrbare Witwe Ellen, ihr droht die peinliche Befragung und Folter. Doch die kluge Fährmannstochter Myntha glaubt nicht an Ellens Schuld und beginnt nach dem wahren Mörder zu forschen. Dabei steht ihr der geheimnisvolle Rabenmeister Frederic zur Seite, und er ist auch zur Stelle, als Myntha selbst in tödliche Gefahr gerät …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 814
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Autorin
Andrea Schacht (1956–2017) war lange Jahre als Wirtschaftsingenieurin und Unternehmensberaterin tätig, hat dann jedoch ihren seit Jugendtagen gehegten Traum verwirklicht, Schriftstellerin zu werden. Ihre historischen Romane um die scharfzüngige Kölner Begine Almut Bossart gewannen auf Anhieb die Herzen von Lesern und Buchhändlern. Mit »Die elfte Jungfrau« kletterte Andrea Schacht erstmals auf die SPIEGEL-Bestsellerliste, die sie auch danach mit vielen weiteren Romanen eroberte.
Die Fährmannstochter
Brandstiftung in der Domstadt? Bei einem mysteriösen Feuer im Kloster der Machabäerinnen kommt die Oberin zu Tode. Verdächtigt wird eine kranke Pilgerin, die vor einigen Tagen von Myntha, der Tochter des Mülheimer Fährmanns, aus den Fluten des Rheins gerettet wurde. Myntha glaubt nicht an die Schuld der Pilgerin, zumal bekannt wird, dass die Oberin unmittelbar vor ihrem Tod mit einem Mann über die Qualität von Weihrauch gestritten haben soll. Steckt womöglich der düstere Fremde dahinter, der sich vor Kurzem mit einer Schar Kolkraben in der Nähe des Fährhauses einquartiert hat?
Die silberne Nadel
Köln 1420: Bei der Stammheimer Rheinmühle wurde ein grausiger Fund gemacht: Im großen Holzrad hängt die Leiche des Brotbeschauers Schroth. Die Würgemale an seinem Hals deuten darauf hin, dass sein Tod kein Unfall war. Unter Mordverdacht steht seine Geliebte, die ehrbare Witwe Ellen, ihr droht die peinliche Befragung und Folter. Doch die kluge Fährmannstochter Myntha glaubt nicht an Ellens Schuld und beginnt nach dem wahren Mörder zu forschen. Dabei steht ihr der geheimnisvolle Rabenmeister Frederic zur Seite, und er ist auch zur Stelle, als Myntha selbst in tödliche Gefahr gerät …
Myntha, die Fährmannstochter bei Blanvalet:
1. Die Fährmannstochter
2. Die silberne Nadel
3. Das Gold der Raben
4. Mord im Badehaus
5. Das Erbe der Kräuterfrau
Andrea Schacht
Myntha, die Fährmannstochter Band 1 und 2:Die Fährmannstochter / Die silberne Nadel
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherheitsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © der Originalausgaben
»Die Fährmannstochter« 2014,
»Die silberne Nadel« 2015
by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Rainer Schöttle
Umschlaggestaltung und -illustration »Die Fährmannstochter« (li.): © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Bridgeman Art Library
Umschlaggestaltung und -illustration »Die silberne Nadel« (re.): © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von akg-images und Bridgeman Images
ISBN: 978-3-641-25682-1V001
www.blanvalet.de
Andrea SchachtDie Fährmannstochter
Historischer Roman
Viel Wunderdinge melden · die Mären alter ZeitVon preiswerten Helden · von großer Kühnheit,Von Freud’ und Festlichkeiten · von Weinen und von Klagen,Von kühner Recken Streiten · mögt ihr nun Wunder hören sagen.
Nibelungenlied
Dramatis Personae
Myntha, Tochter des Fährmeisters. Seit sie dem Tod von der Schippe gesprungen ist, hat sie erhebliche Probleme – sie ist mondsüchtig.
Reemt van Huysen, Fährmeister, der mitunter an Wahnvorstellungen von Rheinnixen und Goldschätzen leidet, aber ein gutmütiger Mann von großer Erzählgabe ist.
Witold und Haro, Mynthas bärtige Brüder.
Enna van Huysen, Mynthas Großmutter, eine schrullige Alte, die sich ihre eigene Welt zusammenspinnt.
Rickel und Swinte Moelner, Mühlenbesitzer. Rickel soll nach dem Willen seiner Schwester Swinte heiraten, trägt aber Bedenken.
Lore, lebenskluge Köchin im Fährhaus, die sich nichts vormachen lässt.
Frederic Bowman, Heimkehrer auf der Flucht vor einem unbekannten Rächer, der sein und das Leben seines zehnjährigen Sohnes bedroht. Herr der Raben.
Emery, Frederics abenteuerlustiger zehnjähriger Sohn, nachts manchmal auf Abwegen.
Karol, Weihrauchhändler, der in die eigene Tasche arbeitet und dabei einen Fehler begeht.
Magistra Rotraut, Oberin im Kloster Machabäern – ein Opfer ihres Misstrauens.
Die Pilgerin Agnes, die gerne Geschichten über Goldschätze im Rhein hört, von sich selbst aber nichts preisgibt.
Bilke, auf Geheiß ihrer Eltern Novizin bei den Machabäerinnen, nutzt jede Gelegenheit, aus dem Kloster zu entwischen.
Volmarus, Vikar von Mülheim, eine abergläubische Bangbotz.
Henning, ein Taschendieb ohne große Begabung.
Gevatterin Ellen, die Dorfzeitung, die alles weiß.
Ewwers, ein großmäuliger Fischer, der Unheil stiftet.
Frau Josepha, Meisterin im Beginenkonvent am Eigelstein.
Magistra Gesine, Nachfolgerin der Oberin Rotraut.
Rixa und Jorgen, Zeidler in der Heide.
Sybilla, eine weise Frau.
Robb und Crea, Ron und Cress, Raky und Creky, Frederics Wachmannschaft.
Mico, der obligatorische Kater.
Und natürlich:
Alyss vom Spiegel und Master John mit ihren Kindern Thomas, Jehanne und Gauwin.
Vorwort
Das Harz des Weihrauchbaums (Boswellia) wurde seit Menschengedenken als süß duftendes Räucherwerk verwendet. Olibanum, das graugoldene Granulat, stammt vorwiegend aus Afrika, den arabischen Ländern und Indien. Wegen der aufwendigen Ernte, der sorgfältigen Zubereitung und vor allem der langen Transportwege wurde es in Europa zu einem der wertvollsten Güter.
Nichtsdestotrotz durchwaberte Weihrauchduft das ganze Mittelalter. In Kirchen und Klöstern wurden Unmengen davon verbrannt, begleitete der heilige Rauch doch die Gebete der Frommen gen Himmel.
Eine Erfindung der christlichen Religion war das Räuchern natürlich nicht. Alle anderen Völker kannten das Rauchopfer ebenfalls, aber so heidnisch es auch sein mochte – auf den Wohlgeruch mochte kein Priester in seiner Zeremonie verzichten.
Aber nicht nur beim Beten unterstützt der Weihrauch: Man sagt ihm auch heilende Kräfte nach. Die beruhen allerdings eher auf dem angenehmen Geruch als auf pharmazeutisch wirksamen Inhaltsstoffen.
Auf jeden Fall vertrieb der Duft die nicht wirklich appetitlichen Gerüche aus wenig reinlichen Hütten und Kammern.
Was wertvoll ist, zieht aber auch kriminelle Energie an. Das Geschäft mit dem Harz blühte, und findige Händler hatten sehr bald heraus, wie man es strecken und damit die Ausbeute erhöhen konnte. Harze anderer Gewächse wurden dem Olibanum beigemischt – Kiefern, Tannen, Wacholder lieferten harzige Füllstoffe. Auch Holzspäne, Nadeln und Kräuter verlängerten den Weihrauch. Auch die Endverbraucher selbst, die sparsam mit dem kostbaren Gut umgehen wollten, entwickelten ihre eigenen Mischungen.
Zulasten der Qualität. Und dann knasterte und sprühte die Mischung auch schon mal. Funken stoben, es qualmte und roch stechend oder betäubend.
Wie weit das die inbrünstigen Gebete beeinflusste, die der Rauch zu Gott, den Heiligen oder Maria tragen sollte, möchte man lieber nicht ergründen. Und ob der Weihrauch die allgegenwärtigen Dämonen wahrlich bannte oder sie vielleicht gar anzog, können wir heute auch nicht mehr so genau beurteilen.
Die große Zeit der Dämonen ist vorbei. Zumindest jener, die im Mittelalter die Menschen drangsalierten. Ganze Bände voll Dämonenkunde sind verfasst worden. Allen voran der Abramelin, ein Basiswerk, im fünfzehnten Jahrhundert von einem Wormser Juden verfasst, der auf vielen Reisen allerlei Dämonen eingesammelt und in ordentliche Kategorien eingeteilt hatte. Für jedes denkbare Ungemach gab es einen Schuldigen.
In unserer aufgeklärten Zeit belächeln wir diesen Aberglauben selbstredend und schenken lieber den Aussagen von Werbung, Lebensratgebern und Ärzten Glauben.
Prolog
Winter 1415
Myntha erwachte, und das Erste, was sie wahrnahm, war der warme, süße Geruch von Weihrauch. Ihre Lider jedoch waren so schwer, dass sie sie nicht öffnen mochte. Für eine Weile ließ sie sich einlullen von dem Duft und dem leisen Psalmodieren, das an ihr Ohr drang. Ein klein wenig bewegte sie ihren Kopf, und ein Stöhnen kam über ihre trockenen, rissigen Lippen.
Mit einem Mal änderten sich die Stimmen, wurden barscher, fordernder, und es gelang ihr, die Augen einen Spalt zu öffnen.
Flackerndes Kerzenlicht erfüllte den Raum, und undeutlich hob sich vor ihr eine dunkle Gestalt ab. Angst kroch ihr den Rücken empor, und plötzlich ertönte ein Schrei.
Mit entsetzlicher Klarheit erkannte sie den angespitzten Pflock in der Hand des Priesters, der damit auf ihr Herz zielte.
Sie versuchte sich wegzudrehen. Doch schon wurde der Priester von ihr weggerissen, es gab ein dumpfes Krachen und Knirschen und einen weiteren Schmerzensschrei.
»Myntha! Myntha, Kleine, du lebst!«
Es war die tiefe Stimme ihres Vaters, und seine starken Arme hoben sie hoch und drückten sie an sich. Zitternd schmiegte sie sich an seine breite Brust, und salzige Tränen netzten ihre Wangen.
»Papa?« Ihre Stimme war raspelnd und kaum hörbar, ihre Kehle schmerzte.
Und nicht nur die, alle Knochen, alle Gelenke, jeder Muskel schmerzte – aber, ja, sie lebte. Eine weiche Decke wurde über sie gelegt, und ihre beiden bärtigen Brüder, Haro und Witold, nahmen sie aus den Armen ihres Vaters, hüllten sie in ihre Umhänge und trugen sie hinaus aus der weihrauchgeschwängerten Luft der Kirche in die dunkle Kälte.
Sie schloss wieder die Augen, sog aber die klare Frostluft tief in die Lunge, und in der sicheren Hut ihrer Brüder schlief sie wieder ein.
1. Kapitel
Mai 1420
Es hatte seine Vorteile, die Tochter des Fährmanns von Mülheim zu sein. Wann immer Myntha Lust hatte, die Annehmlichkeiten der großen Stadt zu genießen, begleitete sie ihre Brüder am Morgen auf der ersten Fahrt über den Rhein. So auch an diesem lieblichen Maitag, an dem die Vögel lauthals ihre Lieder zwitscherten und die leichte Brise, die durch das Tal wehte, an ihrem Gewand zupfte. Junge Federknäulchen folgten behäbigen Entenmüttern. Ihnen warf sie einige Krumen altbackenen Brotes zu und wurde mit einem vergnügten Schnattern belohnt.
Myntha zog den Schleier über ihren Kopf und betrat den Nachen. Mit ihr auf der Fähre fuhren einige Handwerker, die sie mit einem Nicken grüßte. Die Männer mit ihren Kiepen auf dem Rücken erwiderten ihren Gruß nicht, sondern schauten unangenehm berührt in die andere Richtung. Nur Rixa, das Weib des Honigsammlers Jorgen, lächelte sie an und erkundigte sich nach ihrer Großmutter Enna.
»Sie hat das Reißen in den Knochen, aber jetzt, wo es wärmer wird, geht es ihr wieder besser«, erzählte Myntha der krummrückigen Frau. Die schlug ihr vor: »Kannst ja mal die aal Sybilla aufsuchen, drüben in Merheim. Die hat Salben, die die Knochen wärmen.« Und dann senkte sie die Stimme zu einem geheimnisvollen Flüstern: »Aber frag nicht zu genau nach, woher sie das Fett hat.«
»Von Schweinen, Rixa. Ich kenne die Sybilla. Aber ich habe auch eine gute Tinktur aus der Apotheke am Neuen Markt bekommen. Die hat der Großmutter einige Erleichterung verschafft. Wie läuft das Geschäft? Honig hast du in den Fässchen da nicht drin.«
Myntha wollte nicht weiter über die Leiden ihrer Großmutter und irgendwelche quacksalberischen Vorschläge reden, und Rixa war leicht abzulenken.
»Nein, die Bienen fliegen noch nicht. Wir haben Harz gesammelt, gutes, feines Wacholderharz. Verkaufen wir an den Turm. Die Wachen verwenden es für ihre Waffen, gibt gutes Geld dafür.«
»Und du bekommst einen neuen Kittel?«
Rixa lachte und entblößte eine Zahnlücke.
»Der hier tut’s noch. Die Wolle hab ich selbst gesponnen und gewebt. Aber ein gutes Essen im Adler, das wird’s geben. Und, was treibt dich in die Gassen?«
Es waren natürlich nicht nur die städtischen Vergnügen, die Myntha suchte. Sie hatte auch einige ernsthafte Aufträge zu erledigen. Heute beispielsweise ging es darum, einige Fässer Wein zu ordern. Das erzählte sie Rixa auch, und darüber kamen sie an der Landestelle am Niehler Ufer an.
Rixa schulterte die Kiepe wieder, und sie und Myntha warteten, bis alle Fährgäste an Land waren. Dann stellten sie sich neben Mynthas Bruder Haro. Er überragte sie um mehr als Kopfeslänge, und in seinem dichten Vollbart schien ein Lächeln auf. Er zupfte ihr den Schleier vom Gesicht und meinte: »Bleibt beide auf dem Nachen. Wir treideln ein Stück stromaufwärts, das schont eure Füße.«
Myntha hatte damit gerechnet, denn damit die Fähre auf dem Rückweg von der Strömung flussabwärts nach Mülheim getragen wurde, musste eines der starken Zugpferde sie ein Stück am Ufer entlangziehen. Heute machte ihr Bruder Witold den Treideldienst. Rixa nickte, dankbar dafür, dass auch sie auf dem Nachen bleiben durfte. Während sie langsam dahinglitten, meinte Haro zu seiner Schwester: »Schau, ob Frau Alyss wieder ein hübsches Maidchen beherbergt, Myntha. Es wird Zeit, dass Witold sich ein Weib nimmt.«
»Ach, der Witold? Und du?«
»Na, wenn’s zweie sind, nehm ich auch eins.«
»Wenn ich nicht dem Jorgen sein Weib wär, tät ich dich nehmen«, kicherte Rixa.
»Dann werd ich mal sehen, ob der Jorgen nicht das nächste Mal mitten auf dem Rhein von einer Nixe ins Wasser gezogen wird«, unkte Haro.
Rixa, ein schlichtes Gemüt, lachte schallend und hieb ihm auf den Rücken. Haro musste sich an der Ruderpinne festhalten, um nicht selbst ins Wasser zu fallen.
Sie erreichten nach kurzer Zeit die zweite Anlegestelle, und Haro verabschiedete sich von ihnen.
»Dann macht euch mal auf den Weg. Myntha, zieh die Fahne hoch, wenn du wieder rüberwillst!«
»Am Nachmittag. Das Essen in Frau Alyss’ Hauswesen werde ich mir nicht entgehen lassen.«
Rixa und sie gingen an Land und machten sich am Ufer entlang auf den Weg in die Stadt.
»Ich wünschte, meine Brüder würden sich wirklich bald dazu entschließen, zu heiraten«, murrte Myntha.
»Sind zwei stramme Burschen. Um die müssten die Weibchen sich doch reißen.«
»Pah. Sowie eine junge Frau ihren Blick auf sie wirft, werden sie rot, beginnen zu stammeln, treteln mit den Füßen und suchen schnellstmöglich das Weite. Das sind Kerle wie Baumstämme, aber so was von schüchtern.«
»Was für ein Jammer. Hilft wohl nur beten.«
»Oder ein Holzhammer.«
Eine Weile schwatzten sie gemächlich über dieses und jenes, dann erreichten sie die Stadtmauer, und am Kunibertstor verabschiedete Rixa sich, um dem Turmmeister ihre Ware anzubieten. Myntha wanderte weiter durch die Gassen.
Auf dem Weg zu Frau Alyss, der Weinhändlerin in der Witschgasse, lag die Dombaustelle, an der sie mit immerwährendem Staunen einen Augenblick stehen blieb, um zuzusehen, wie der gewaltige Tretkran einen riesigen, sorgfältig behauenen Stein nach oben schweben ließ.
Dann musste sie aber zwei Männern aus dem Weg gehen, die zwischen sich einen Bottich mit Gips trugen, und wandte sich Richtung Alter Markt. Später würde sie hier an den Ständen noch einige Einkäufe tätigen, jetzt aber galt es zunächst, andere Dinge zu erledigen. Diszipliniertes Vorgehen hatte sie schon vor Jahren im Hauswesen von Frau Alyss und Master John gelernt. Dort hatte sie als junges Mädchen ihre Lehrzeit verbracht und großen Nutzen aus diesem Aufenthalt gezogen. Die Führung eines sehr lebendigen Haushalts hatte sie gelernt, die Buchführung eines schwunghaften Weinhandels, hartes Feilschen, kühles Beurteilen von Qualitäten und – nicht zu unterschätzen – die lateinische Sprache, in der sie der staubtrockene Magister Jakob unterrichtet hatte. Diese Kenntnisse wussten ihr Vater und ihre Brüder sehr zu schätzen, denn oftmals kamen Menschen aus fernen Ländern an die Fährstelle, die der heimischen Zunge kaum mächtig waren. Einige Brocken Latein jedoch konnte ein jeder, und Myntha half gerne, der Fremden Begehr zu übersetzen.
Doch bei Frau Alyss hatte sie nicht nur Arbeit kennengelernt, sondern auch überschäumenden Frohsinn. Manche wilden Scherze hatte sie mit den anderen Jungfern und jungen Männern getrieben, trauliche Gespräche beim Spinnen geführt und ernsthaftes Disputieren mit dem Hausherrn und den Gästen erprobt, die häufig das Hauswesen mit ihrer Anwesenheit beehrten. Besonders in ihr Herz geschlossen hatte Myntha aber Frau Alyss’ Eltern, den wohledlen Herrn Ivo vom Spiegel und die scharfzüngige Frau Almut. Anfangs hatte sie Angst vor dem brummigen Herrn gehabt, dessen Augen unter den buschigen Brauen vor geistiger Schärfe funkelten. Seine Donnerwetter, so munkelte man, waren furchterregend gewesen. Bis sie eines Tages entdeckte, dass sich hinter der Wortgewalt des großen Mannes ein tiefsinniger Humor und ein gütiges Herz verbargen und er auf eine treffende Erwiderung mit grollender Erheiterung reagierte. Sein Weib, eine ehemalige Begine, stand ihm an Witz in nichts nach, und die Beobachtung des Geplänkels der beiden hatte Myntha gezeigt, was es hieß, wenn sich zwei Menschen in grenzenloser Liebe zugetan waren.
Im vergangenen Jahr nun war Herr Ivo im gesegneten Alter von vierundachtzig Jahren sanft entschlafen, und sie betrauerte noch immer den Verlust.
Darum hielt sie auf ihrem Weg durch die Stadt an dem trutzigen Kloster von Groß Sankt Martin an, in dem Herr Ivo einst als Benediktinerpater gelebt hatte. Hier ruhte er nun auf dem Friedhof von Sankt Brigiden, der kleinen Kirche neben dem Kloster. An seinem Grab wollte sie eine Fürbitte für den gütigen Mann halten.
Dicht an der Kirchmauer hatte man ihn begraben, und zwei dunkelgrüne Eiben flankierten den Grabstein. Doch während Myntha den Lichhof überquerte, erkannte sie, dass sie nicht die Einzige war, die am Grab des wohledlen Herrn beten wollte. Es kniete eine Gestalt in einem dunkelgoldenen Gewand dort auf dem Grün, und ein Distelfink landete flatternd auf dem Grabstein des Herrn. Er begann, aus voller Kehle zu singen.
Myntha hielt in ihren Schritten inne. Frau Almut pflegte oft hierherzukommen, um Zwiesprache mit ihrem Gatten zu halten. Wie unsagbar musste sie ihn vermissen, denn sie hatte viele Jahrzehnte an seiner Seite verbracht.
Myntha sprach ihre Gebete still in schicklicher Entfernung, doch dann sah sie plötzlich, wie Frau Almut die Trauer derart übermannte, dass sie niedersank und lang ausgestreckt auf dem Boden zu liegen kam.
Leise näherte sich Myntha und räusperte sich vorsichtig. Das Gras war noch taufeucht und sicher nicht bekömmlich für eine alte Dame.
Frau Almut bewegte sich nicht.
Myntha trat noch näher, beugte sich nieder und berührte sanft die samtbekleidete Schulter. Ein leises Stöhnen kam über Frau Almuts Lippen, dann flatterten ihre Lider.
»Habt Ihr Schmerzen, Frau Almut? Geht es Euch nicht gut?«
»Atmen so schwer«, keuchte die alte Dame leise. Dann drehte sie langsam den Kopf. »Myntha, Kind. Hilf mir auf.«
Ganz vorsichtig hob Myntha Frau Almut an, sodass sie sitzen konnte. Etwas leichter ging ihr Atem, und ihre Augen blickten wieder klar.
»Ich hole die Mönche, sie werden Euch ins Hospiz tragen.«
»Nein, nein. Es geht schon. Stütz mich, Liebes, und bring mich heim. Es ist ja nicht weit.«
Das war richtig: Das Haus derer vom Spiegel lag am Alter Markt, eben um die Ecke von Groß Sankt Martin. Fest auf Myntha gestützt, wanderte Frau Almut den kurzen Weg, schweigend zunächst, doch vor der Eingangstür murmelte sie: »Er hat gesagt, er wartet.«
Es gab nicht viel zu überlegen, was die wohledle Dame damit meinte.
»Der Herr vom Spiegel.«
»Ivo, ja.« Und dann huschte ein geisterhaftes Lächeln über Frau Almuts Gesicht. »Geduld war nicht seine höchste Tugend.«
»So hörte man gelegentlich.«
Die wohledle Dame kicherte.
»Klopft an die Tür, Kind. Man wird sich um mich kümmern wollen. Sie sind alle so fürsorglich geworden die letzten Monate.«
So war es auch. Kaum hatte Myntha den Klopfer einmal bewegt, wurde die Tür auch schon aufgerissen, und eine füllige Matrone streckte ihre Arme nach Frau Almut aus. Die aber wehrte sie sacht ab und wandte sich noch einmal Myntha zu.
»›Ich sehe jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.‹«
Wieder lächelte sie, und ihr Gesicht wirkte wie verklärt. »Er hat seinen Paulus gerne zitiert.« Sinnend blinzelte sie in die Sonne. »Mit Paulus’ Worten auf den Lippen schied er aus dieser Welt.«
Frau Almut wurde von der Matrone ins Haus geführt, die Tür fiel zu.
Und Myntha flüsterte: »›Die Liebe hört niemals auf.‹«
Dann eilte sie zur Witschgasse.
2. Kapitel
Um die Mittagszeit des nächsten Tages ergriff Frederic Bowman die Zügel seines Reitpferds und die Lenkleine des Packtiers, um beide von dem Niederländer ans Ufer zu führen. Hinter ihm folgte Emery mit dem Pony, das gutmütig über die Planke trottete. Es war ein hübsches Tier, hellbraun mit einer noch helleren Mähne und Schweif, sanft im Gang und von heiterem Gemüt. Dem zehnjährigen Jungen folgte es aufs Wort, aber Fremden gegenüber war es zurückhaltend. Maldwyn, unerschrockener Freund, hatte Emery das Pferdchen genannt.
»Das ist die Kathedrale, von der du mir erzählt hast, Vater?«
»Ja, das wird einmal der Dom sein.«
Frederic schaute ebenso wie sein Sohn hoch zu dem Turmstumpf, auf dem der Kran stand. Der Turm war gewachsen, seit er ihn das letzte Mal gesehen hatte. Vierzehn Jahre war das nun her, und doch waren ihm der Geruch der Stadt, die Sprache der Menschen und der Anblick der Stapelhäuser am Ufer sofort wieder vertraut.
Sein Pferd schnaubte leise, als er es zum Trankgassentor führte. Es war vermutlich ebenso glücklich wie er, wieder auf festem Boden zu stehen. Etliche Wochen lang hatten sie Schiffsplanken unter den Füßen gehabt, und die Fahrt von King‘s Lynn durch die Nordsee war streckenweise recht stürmisch gewesen. Der April mit seinen Frühlingsstürmen war nicht der rechte Monat zum Reisen, aber es war notwendig gewesen, und so hatte er die Zähne zusammengebissen, um seinem Sohn ein Vorbild zu sein. Der Arme war mager geworden, das Salzfleisch und das harte Brot – ihre hauptsächliche Nahrung während der Reise – waren selten lange genug in ihm dringeblieben. Erst als sie Deventer erreicht hatten und dort im Hause des Tuchhändlers Robert van Doorne Rast machen konnten, hatten sie sich beide etwas erholt. Frau Catrin hatte sie mit allen Leckerbissen verwöhnt, die Markt und Speisekammer hergaben, und hätte sie auch gerne noch länger bei sich beherbergt. Frederic zog es jedoch weiter, und so hatten sie zwei Tage später das nächste Schiff bestiegen. Immerhin war der Rhein ein ruhigeres Gewässer, und eine Woche später nun waren sie am Ziel angekommen.
Am Kai lagen zwei weitere Schiffe, die eben entladen wurden, und Emery war stehen geblieben, um den Männern im Rad des Tretkrans zuzusehen, die mit großem Geschick Tuchballen vom Deck eines zweiten Niederländers hoben. Ein Wagen stand bereit, auf dem sich bereits mehrere Ballen stapelten, und eine helle Frauenstimme gab Anweisungen, wie das nächste Gebinde daraufzupacken sei.
»Du wirst noch häufiger zusehen können, Emery. Aber jetzt wollen wir einen Boten zu Master Johns Heim schicken.«
»Ja, Vater.«
Der Junge war bekümmert, aber daran konnte Frederic nun nichts ändern. Besser bekümmert als tot. Er legte seine Hand auf dessen magere Schulter und drückte sie sacht.
»Du weißt, was du zu tun hast, mein Sohn?«
»Ja, Vater.«
Ein Botenjunge wurde herbeigepfiffen und trabte mit der Meldung los, Emery Friederson sei am Trankgassentor eingetroffen.
»Es wird gleich jemand aus dem Hauswesen hier eintreffen. Stell dich nahe ans Tor, Emery. Ich werde dort hinter den Fässern warten, bis man dich erkannt hat.«
»Ist gut, Vater.«
»Emery, du bist ein guter Sohn. Und sobald ich kann, werde ich dich wieder aufsuchen und berichten, wo ich Wohnung genommen habe.«
Emery nickte, und seine Hände krallten sich fest um die Zügel seines Ponys. Er kämpfte mit den Tränen. Noch einmal zog Frederic ihn an sich, dann leitete er seine beiden Pferde zu dem Fässerstapel. Vollständig verborgen war er dort nicht, aber er hoffte, dass, wer immer auch Emery abholte, verstehen würde, dass er selbst nicht angesprochen werden wollte.
Lange brauchte er nicht zu warten. Es war John of Lynne selbst, der mit langen Schritten durch das Tor geeilt kam und zielgerichtet auf den Jungen zutrat.
»Emery Friederson?«
»Ja, der bin ich.«
»Ich bin John of Lynne. Ich grüße dich, mein junger Freund.«
Frederic registrierte, dass John englisch mit seinem Sohn sprach, und war dankbar dafür. Er hatte versucht, Emery während der Überfahrt einige Worte Deutsch beizubringen, aber dem Jungen war es viel zu schlecht gegangen. Doch es mochte sein, dass in der freundlichen Atmosphäre im Hauswesen von John und seinem Weib Alyss ihm die Kenntnisse der Sprache schnell vermittelt würden.
»Wo ist dein Vater, Emery?«
»Weg, Master.«
Johns schwerlidrige Augen schweiften über den Kai, und sein Blick blieb an dem Fässerstapel hängen.
»Das ist betrüblich, aber wohl nicht zu ändern. Emery, du bist willkommen in meinem Haus. Doch muss ich dir sagen, dass wir eben um die Mutter meines Weibes trauern.« Mit erhobener Stimme und Richtung Fässer sprach John. »Frau Almut ist heute Nacht ihrem Gatten gefolgt.«
Frederic sah, dass Emery blass wurde und zu zittern begann. John bemerkte es wohl auch und legte dem Jungen den Arm um die Schultern.
»Ist sie … ist sie gemördert worden?«
»Nein, mein Freund. Sie entschlief sanft nach einem sehr langen, sehr bunten Leben und wurde von Mutter Maria im Himmel aufgenommen. Wir bedauern ihren Verlust, aber ihr Scheiden, wie auch das von Ivo vom Spiegel, war friedlich.«
Emery hielt den Kopf gesenkt, und Frederic senkte den seinen ebenfalls. Mit Almut und Ivo hatten zwei gütige Menschen diese Welt verlassen, die er gerne wiedergesehen hätte.
Dann aber richtete er sich auf, um einen letzten Blick auf seinen Sohn zu richten.
Master John sah zu ihm hin und nickte unmerklich. Ja, die Worte waren auch für ihn bestimmt gewesen. Und mit großer Einfühlsamkeit wandte der Tuchhändler sich dann an Emery.
»Du hast deine Mutter verloren?«
»Ja, Master.«
»Das ist schlimm, mein Junge. Komm mit, wir wollen sehen, ob Frau Alyss und ihr Hauswesen deinen Kummer ein wenig lindern können. Ich habe einen Sohn in deinem Alter, und – gnade Gott – er hat ebenso rote Haare wie du.«
»Oh je.«
»Du sagst es.«
Master John nahm die Zügel des Ponys und führte es durch das Tor. Emery hielt sich an seiner Seite und schaute vertrauensvoll zu dem großen Mann mit den grau durchzogenen blonden Haaren auf.
Frederic atmete tief durch. Seine größte Sorge war behoben, sein Sohn war in Sicherheit.
Nun würde er sich eine Wohnstatt suchen. Er wandte sich dem Rhein zu. Das andere Ufer war weit genug entfernt – so weit, dass Emerys Schutz gewährleistet war –, und gleichzeitig doch so nahe, dass er dann und wann nach seinem Sohn würde schauen können.
3. Kapitel
Myntha rupfte Unkraut. Gerne tat sie das nicht, aber die Großmutter hatte noch immer zu sehr das Reißen in den Gliedern, als dass sie die Gartenarbeit hätte machen können. Aber sie hatte ein scharfes Auge darauf, dass ihre Enkelin wirklich auch nur die unerwünschten Triebe ausgrub und nicht etwa die Petersilie oder den Thymian.
In der Hecke tschilpten die Spatzen, Rotkehlchen und Finken zwitscherten fröhlich, und irgendwo über den Feldern mit ihrem jungen Grün krächzten ein paar Raben. Die murmelnde Stimme ihrer Großmutter sprach in eintönigem Rhythmus von den Taten der Könige früherer Zeiten. Es war Ennas Angewohnheit, lange Texte zu rezitieren. Sie behauptete, damit hielte sie ihren Geist beweglich und bekämpfe die Vergesslichkeit. Womöglich hatte sie recht. Seit Myntha denken konnte, wiederholte ihre Großmutter die langen, verschlungenen Verse eines gewaltigen Epos, das sie das Nibelungenlied nannte. Sie hatte es als Kind von einem alten Barden gelernt und memorierte Teile daraus beinahe täglich. Heute war sie bei der neunzehnten Aventüre angelangt, und eben sprach sie:
»Da sprach König Gernot · ›Eh’ wir solche Pein
Um dieses Gold erlitten · wir sollten’s in den Rhein
All versenken lassen · so gehört’ es niemand an.‹
Sie kam mit Klaggebärde · da zu Gieselher heran.
Kind, lass die Finger von der Kresse!«
Myntha zuckte zusammen und ließ die grünen Blättchen stehen, die sie eben ausrupfen wollte. Die Großmutter rezitierte schon weiter und sprach von den gewaltigen Schätzen des Nibelungenhorts und den bösen Folgen von Habgier und Rache.
Myntha kannte die verwickelte Geschichte, und manche Stellen mochte sie sogar ganz gerne. Die schöne Kriemhild hatte sie als Kind bewundert, der edle Recke Siegfried war der erste Mann, in den sie sich verliebt hatte. Aber die Intrigen des düsteren Hagen und die herrischen Ansprüche von Brunhilde hatten sie abgestoßen, und den König Gunther hielt sie für einen schlappen Weichling. Aber es war eine Mär, sie handelte von Liebe und Ritterlichkeit, von Mord und Verrat, und sie endete in einem gewaltigen Blutvergießen. Ob sich diese Geschichte wirklich jemals so abgespielt hatte, bezweifelte sie allerdings.
Anders ihr Vater Reemt. Auch er hatte von Kindheit an Enna die Verse sprechen gehört, und irgendwann hatte sich in ihm die Idee festgesetzt, dass es tatsächlich einen Goldschatz unter den Fluten des Rheines gab.
Myntha erhob sich mit einem leichten Seufzen. Ihr tat der Rücken weh vom ständigen Bücken, und sie wuchtete den Korb mit dem Unkraut hoch, um ihn zum Kompost zu tragen.
»Für heute sollte es genug sein, Großmutter. Die anderen Beete jäte ich morgen.«
»Morgen wird es regnen.«
»Mag sein, aber jetzt muss ich mich um die Kammern kümmern. Die Wäscherinnen haben die Laken gebracht, und Haro hat mir frisches Stroh für die Betten bereitgestellt. Außerdem frischt der Wind auf, und für dich ist es auch besser, im Warmen zu sitzen.«
»Mpf.«
»Doch, Großmutter. Am Küchenkamin. Es gibt einen Korb Strümpfe zu stopfen.«
»Mrrrpf.«
Myntha kannte die grollende Laune ihrer Großmutter und lachte leise.
»Du wirst dich viel besser fühlen, wenn du dich nützlich machen kannst. Außerdem bereite ich dir eine heiße Milch mit Honig.«
»Ich bin nicht bestechlich.«
»Doch, bist du. Komm, ich helfe dir auf.«
»Mrrrpf!«
Trotz ihres Grollens ließ Enna es zu, dass Myntha ihr von dem gepolsterten Hocker half, aber dann griff sie nach ihrem Stock und lahmte ohne Beistand in die geräumige Küche.
Myntha schürte die Glut und stellte den Kessel mit Milch auf den Dreifuß. Eben rührte sie Honig und eine Prise Zimt in die angewärmte Milch, als ihre Brüder in die Küche gepoltert kamen. Sie hielten den klatschnassen Reemt zwischen sich, der lauthals protestierte.
»Sie haben mich gerufen. Ihr könnt mich nicht immer daran hindern. Sie wollten mir verraten, wo er ist. Lasst mich los, Jungs!«
»Nein, Vater. Da waren keine Nixen im Wasser. Das war nur eine Lichtspiegelung.«
»Was weißt du denn schon, Witold? Mich rufen sie. Ich will …«
»Setzt ihn an den Herd!«, befahl Myntha und füllte den ersten Becher mit der süßen Milch. Ihre beiden kräftigen Brüder schoben ihren tropfenden Vater auf die Bank am Kamin, und sie hielt ihm den Becher an die Lippen. Gehorsam nahm er einen Schluck, und seine Augen klärten sich wieder.
»Oh, lecker!«
»Viel leckerer als schlammiges Rheinwasser.«
Er griff mit beiden Händen den Becher und wärmte sich daran. Haro legte ihm eine Decke um die Schultern und schüttelte leicht den Kopf.
»Mitten auf dem Rhein hat’s ihn diesmal erwischt. Gut, dass nur zwei Marktweiber und vier Esel auf der Fähre waren. Wir haben ihn gleich wieder rausgefischt und den beiden Frauen erzählt, dass er die Fieberhitze hat. Na, vielleicht glauben sie es.«
»Die Esel bestimmt.«
Myntha füllte weitere Becher mit süßer, heißer Milch und reichte sie ihren Brüdern. Großmutter Enna murrte prompt: »Die hast du mir versprochen!«
Den vierten Becher drückte Myntha ihr in die Hand, und das klägliche Restchen, gerade zwei Schlucke noch, trank sie selbst. Aber lecker war die Milch.
»So, und jetzt, Vater, geht in Eure Kammer und zieht Euch trockene Sachen an, und anschließend begleitet Haro Euch zum Bader. Heißes Wasser ist viel bekömmlicher als das des kalten Flusses, und der Bartscher könnte Euch auch mal wieder die Stoppeln schaben.«
»Du bevormundest mich, Tochter.«
»Manchmal.«
»Ich hab’s gerne!«
Reemt stand auf und trottete die Stiegen nach oben.
»Er kann auch alleine zur Badestube gehen. Wir müssen noch mal rüberfahren, Myntha.«
»Ja, kann er auch. Und anschließend wird er wieder die Mollie aufsuchen.«
»Und?«
Myntha zuckte mit den Schultern. Sie sollte sich nicht darüber aufregen. Nur zu wissen, dass der eigene Vater eine Dirne aufsuchte … Aber na gut, die Mutter war schon früh gestorben, und er hatte kein anderes Weib genommen. Und er war ein guter Vater. Myntha liebte ihn von Herzen, und seine seltsamen Grillen sah sie ihm mit Langmut nach. So taten es auch ihre Brüder, doch seit Reemt vor einigen Jahren angefangen hatte, mitten auf dem Rhein ins Wasser zu springen, weil ihn angeblich die Nixen riefen, hatten sie ihn überredet, sich bei jeder Fährfahrt ein Seil um die Taille zu knoten. Zwei, drei Mal im Jahr war es nötig, ihn daran wieder auf den Nachen zu ziehen. Außerdem achteten sie darauf, dass er nicht zu oft mitfuhr. Als Fährmeister von Mülheim hatte er genügend andere Aufgaben zu erfüllen, die ihn an Land hielten.
»Ach, Myntha, wir haben gehört, dass der Herr Wolter van Duytz von seiner Reise zurück ist«, sagte Haro und stellte den leer getrunkenen Becher auf den Tisch.
»Mit reicher Ladung, sagt man am Hafen«, ergänzte Witold. »Fässer voll Weihrauch und Myrrhe, Balsam und duftenden Gewürzen.«
»Und Karol«, fügte Haro grinsend hinzu.
»Oh!«
Die Neuigkeit tröstete Myntha ziemlich hurtig darüber hinweg, dass ihr nur der jämmerliche Rest süßer Milch geblieben war. Karol war ein junger Mann, der ihr im vergangenen Sommer seine Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Ein hübscher Bursche mit lachenden Augen und zärtlichen Händen. Lange hatte ihre Tändelei allerdings nicht gedauert, denn schon im August war er mit dem Kaufherrn van Duytz aufgebrochen, um in Venedig Waren aus dem Morgenland aufzukaufen.
Vielleicht erinnerte er sich ja an sie.
»Verschenk deine Zuneigung nicht zu schnell, Myntha. So, wie es aussieht, gibt es noch einen weiteren Bewerber, der wenigstens ein Auge auf dich geworfen hat«, sagte Witold.
»Wie ungewöhnlich.«
Beide bärtigen Köpfe nickten, aber dann erklärte Witold: »Der Rickel Moelner, dem die Mühle oben an der Vorinsel gehört, hat den Vater gefragt, ob du schon versprochen seist.«
»Kenn ich den?«
»Keine Ahnung. Scheint ein ordentlicher Mann zu sein, hat aber ein Auge verloren. Lebt mit seiner Schwester Swinte in einem Haus am Holzmarkt.«
Myntha räumte die Becher weg und stellte auch den Kessel in den Weidenkorb, um alles später am Brunnen auszuwaschen.
»Warten wir ab, was draus wird.«
»Tja, warten wir. Jetzt müssen wir los. Mit der Abendfähre bringen wir den Wein mit.«
»Ja, danke.«
Auch der Vater, inzwischen in trockenen Gewändern, verabschiedete sich, und die Großmutter murrte leise über die Löcher in den Strümpfen, die sich schneller vermehrten als Fliegen auf dem Misthaufen.
Myntha ließ sie knurren und widmete sich den Betten in der Gästekammer und in ihren eigenen Schlafräumen. Als sie nach getaner Arbeit wieder nach unten in die Küche kam, war Ellen bereits dabei, den Brotteig zu kneten und mit der Großmutter zu plaudern.
Ellen war eine rundliche Frau von vierzig Jahren, die ihnen hin und wieder zur Hand ging. Myntha war ihr dankbar, denn sie selbst war keine begnadete Köchin, und das Brot, das sie buk, hatte oft genug noch einen klebrigen Kern, auch wenn die Kruste schwarz gebrannt war.
»Ein düsterer Kerl, sag ich euch, aber sein Goldstück war echt, und er will einen Unterstand für die Pferde an die Kate anbauen.«
»Wer ist ein düsterer Kerl, Ellen?«, fragte Myntha.
»Der in Jens’ Hütte einziehen wird. Hat mich gefragt, recht höflich, und der Jens kommt erst nächstes Jahr wieder, also hab ich nichts dagegen, wenn einer drin wohnt und nach dem Rechten schaut. Den Mietzins kann ich gut brauchen, wo die Marie doch jetzt ihr Kind bekommt.«
»Und wie heißt der Düsterling?«
»Frederic Bowman, sagt er. Komischer Name, find ich. Na, wir werden sehen. Hat ein Packpferd dabei und einen Beutel Münzen und ein Reitpferd und eine bittere Miene.«
»Kann er alles bei sich behalten – Pferde, Münzen und Miene.«
Myntha schenkte der Ankunft des düsteren Frederic wenig Aufmerksamkeit. Sie setzte sich zur Großmutter, nahm Nadel und Faden auf, um den sich sprunghaft vermehrenden Löchern in den Strümpfen ihrer Familie Einhalt zu gebieten, und hing ihren Träumen nach.
In denen Karol einen nicht unbeträchtlichen Raum einnahm.
4. Kapitel
Die Kate bestand aus nicht mehr als einem Raum mit einem Herdstein, einem Bett mit Strohsack und einer rauen Decke, einem stabilen Tisch und einer Bank an der Wand. Eine Pfanne und ein Kessel, nicht eben sauber, standen neben der Feuerstelle, an der Wand waren einige Haken angebracht. Frederic hängte seine Kleider daran und stellte sein zweites Paar Stiefel darunter. Er war es zufrieden, mehr als diese Hütte brauchte er nicht. Das Dach war dicht, das einzige Fenster, mit Pergament bespannt, konnte mit einem Laden verschlossen werden. Vorräte würde er sich in den nächsten Tagen besorgen, vielleicht auch eine bessere Decke und ein Kopfpolster erstehen. Vor der Hütte befand sich ein Trog mit einer Pumpe, die unter Protest einen Strahl bräunlichen Wassers ausspie. Die Pferde störte das nicht, sie soffen zufrieden die Brühe. Nach einigen weiteren Hüben wurde das Wasser auch klarer, und schließlich reinigte Frederic Kessel und Pfanne mit Sand und spülte sie aus. Auch eine Schüssel und eine Kanne fanden sich in einer Ecke. Letztere füllte er mit Wasser und trug sie nach drinnen. Er zündete ein kleines Feuer auf dem Herdstein an, hängte den Kessel darüber, um seinen Haferbrei quellen zu lassen, und versorgte seine Pferde, die gemächlich das junge Gras am Rand der Hütte fraßen.
Der Tag neigte sich bald dem Ende zu, lange Schatten warfen die hohen Pappeln, die sich am Rheinufer entlangzogen. Es war an der Zeit, für ein Abendessen zu sorgen.
Frederic kehrte in die Hütte zurück und zog aus dem Lederbehältnis einen kurzen Bogen hervor. Den Köcher mit einigen Pfeilen hängte er sich über die Schulter und trat dann wieder ins Freie. Hier, außerhalb der Stadtgrenzen, gingen die Felder in Heide über, doch sie würde er erst in den nächsten Tagen erkunden. Jetzt wandte er sich dem Ufer zu, und, wie erwartet, schwammen im seichten Wasser etliche Enten umher. Ein Stein, hart geworfen, scheuchte sie auf, und als sie über ihm aufflatterten, schoss er den ersten Pfeil ab. Ein Vogel fiel ihm geradewegs vor die Füße. Der zweite Pfeil traf den nächsten, der wenige Schritt hinter ihm zu Boden kam. Frederic packte seine Beute an den Hälsen und trug sie zur Kate zurück. Die Pfeile konnte er retten, dann rupfte er die Enten und nahm sie mit seinem Dolch aus.
Der Haferbrei war inzwischen gequollen und fest geworden. Er rührte ihn ein paar Mal um und fügte etwas Salz hinzu. Von den Enten legte er Brust und Schlegel in die Pfanne und ließ sie in ihrem eigenen Fett braten. Während sie garten, trat er wieder vor die Tür, um die Abendstimmung seines neuen Heims kennenzulernen. Sie war friedlich. Die Glocken der kleinen Kirche, die auf ihrem Felsen in den Fluss hineinragte, läuteten zur Komplet, die Fähre kam vom anderen Ufer angeschwommen und legte am Fährhaus an, ein einzelner Fischer ruderte gegen die Strömung, und Flussmöwen tanzten in der Abendbrise. Über ihm aber kreisten vier schwarze Gestalten und stießen ihre rauen Schreie aus.
Raben!
Frederic sah zu ihnen hoch. Raben waren kluge Tiere. Wachsame Vögel mit harten Schnäbeln. Er drehte sich um und holte die Fleischabfälle aus der Kate. Auf dem breiten Hackklotz, auf dem das Feuerholz zerkleinert wurde, breitete er sie aus und setzte sich dann still auf den Schemel neben der Tür. Völlige Ruhe und unbewegliche Geduld hatte er gelernt. Beinahe unsichtbar mochte er einem zufälligen Beobachter erscheinen. Der Bratenduft aus der Hütte und das frische, blutige Fleisch lockten die Raubvögel an. Erst kreiste einer vorsichtig spähend über dem Dach, dann folgten die anderen. Es dauerte nicht lange. Flügelschlagend stieß der erste Rabe hinab und ergriff ein Stück von den Innereien. Er setzte sich mit seiner Beute auf den First und verschlang sie. Die drei andern brauchten länger, aber auch sie ergriffen die Überreste und flogen krächzend damit von dannen.
»Morgen wieder, meine Freunde«, murmelte Frederic mit einem Blick gen Himmel. Dann widmete er sich seiner eigenen Mahlzeit.
Die erste Nacht in seiner neuen Wohnstatt schlief er durch, obwohl er das kaum erwartet hatte. Aber der feste Boden unter seinen Füßen, vielleicht auch die Abwesenheit seines unruhig schlummernden Sohnes, hatten ihm den tiefen Schlaf beschert.
Als die Sonnenstrahlen durch die Tür- und Fensterritzen fielen, reckte er sich und dachte an Emery. Der Junge wurde oft von bösen Träumen geplagt. Er hoffte, dass man in Frau Alyss’ Hauswesen dafür Verständnis zeigte.
Vor der Hütte flötete eine Amsel, kreischten die Möwen, aber auch die Raben ließen ihre Schreie hören. Frederic beschloss, sich später wieder um sie zu kümmern.
Mit dem kalten Wasser aus dem Trog wusch er sich die Müdigkeit aus dem Gesicht, aß ein paar Löffel von dem pappigen Haferbrei und machte sich bereit, einige Vorräte zu beschaffen. Mülheim war eine kleine, aber reiche Stadt, in der sich eine Reihe wohlhabender Kaufleute angesiedelt hatten, sodass er sicher sein konnte, auf dem Markt alles für seinen Bedarf kaufen zu können. Dennoch zögerte er einen Augenblick. Er wollte nicht, dass zu viele Menschen seinen Aufenthaltsort kannten, und kleine Marktflecken waren Brutstätten der Neugier und Gerüchte. Andererseits – er lebte alleine, sein Sohn war in Sicherheit. Und wenn es ihm gelang, die Raben zu zähmen, dann hätte er eine zuverlässige Wachmannschaft.
Also legte er schließlich seinem Packpferd die leeren Körbe über den Rücken und nahm es an die Leine. Weit war der Weg nicht, und schon bald befand er sich innerhalb der Stadtgrenzen. Die Marktstände waren mit Waren wohlversorgt, und wenn auch die Bauern und Marktweiber ihn mit neugierigen Blicken musterten, als er seine Wünsche äußerte, so schien seine ernste Miene sie doch davon abzuhalten, ihm vorwitzige Fragen zu stellen. Als die Packkörbe auf seiner Stute gefüllt waren, wanderte er noch ein Stück zum Hafen hinunter, um sich bei den Fischern umzuschauen. Er konnte zwar sein Wildbret jederzeit selbst jagen, aber gegen einen schönen, fetten Lachs hatte er auch nichts einzuwenden. An diesem Morgen waren aber alle Boote auf dem Wasser, und so wanderte er am Ufer entlang Richtung Kate. Dabei kam er an der Anlegestelle der Fähre vorbei, die eben voll beladen abstieß, um den Rhein zu überqueren. Das Fährhaus, ein dreistöckiges Fachwerkgebäude auf einem steinernen Sockel, war frisch gekalkt, die Glasscheiben in den Fenstern blinkten, und in einem ordentlichen Gemüsegarten saß eine alte Frau und verlas Kräuter. Daneben befanden sich ein Stall und ein Schuppen sowie ein freier Platz mit festgestampftem Lehm, auf dem Holzbohlen lagerten und Werkzeuge davon sprachen, dass hier Wartungsarbeiten an den Fährkähnen vorgenommen wurden.
Holzbohlen und ein paar kräftige Hände würden ihm helfen, den Unterstand für die Pferde recht schnell zu errichten. Frederic nahm sich vor, im Fährhaus nach Unterstützung zu fragen. Doch zuerst musste er seine Ladung nach Hause bringen. Ihm knurrte der Magen – der Haferbrei war weder besonders schmackhaft noch sättigend gewesen.
5. Kapitel
Am Samstagmorgen ließen sich Myntha und ihr Vater übersetzen, um Abschied von Frau Almut zu nehmen. Die wohledle Dame und Gattin des Ratsherrn Ivo vom Spiegel war im Beginenhof am Eigelstein aufgebahrt – in der kleinen Kapelle, die sie einst mit eigenen Händen erbaut hatte. Myntha hatte während ihrer Ausbildungszeit im Hauswesen in der Witschgasse oft die Beginen aufgesucht, denn mit ihnen verband Frau Alyss eine wohlwollende Freundschaft. Sie waren Seidweberinnen und Kräuterkundige, Hebammen und Lehrerinnen, Klagefrauen oder einfach kluge Ratgeberinnen. Auch nachdem Myntha ihre Aufgaben im Fährhaus übernommen hatte, besuchte sie immer mal wieder die Meisterin Josepha, um bei ihr Rat und oftmals auch Trost zu suchen. In der Kapelle selbst hatte sie häufig stille Gebete verrichtet, und die geschnitzte Statue der heiligen Anna, die sich gütig und lehrend über Maria beugte, berührte immer wieder aufs Neue ihr Herz. Mutterliebe hatte sie selbst entbehren müssen.
»Sie war eine wundervolle Dame, die Frau Almut«, sagte ihr Vater, als sie an Land gingen. »Als ich um deine Mutter freite, hat sie mir Mut gemacht. Lieber Herr Jesus, was war ich damals schüchtern und verlegen. Aber Inez – ach Kind, es dauert mich so, dass du sie nie hast kennenlernen dürfen.«
Myntha nahm seine schwielige Hand in die ihre. Es gab dazu wenig zu sagen.
»Nur weil ihre Freundin Catrin noch mehr stammelte und stotterte als ich, gelang es mir überhaupt, die schöne Maid anzusprechen«, sagte er leise und lächelte dabei. »Sie hat mir tatsächlich geduldig zugehört. Und beide Mädchen haben sich dann Frau Almut anvertraut. Ich war noch nicht einmal Fährmeister damals, und mein Vater hielt mich für einen Hochhinaus. Aber Frau Almut hat für mich bei der Familie deiner Mutter gutgesprochen.«
Myntha kannte die Geschichte gut. Ihr Vater hatte oft von seiner gestammelten Werbung erzählt und von dem prächtigen Hochzeitsfest, den glücklichen Jahren, in denen erst ihre Brüder zu Welt kamen und sie selbst dann als Nachzüglerin acht Jahre später. Doch bei ihrer Geburt war ihre Mutter gestorben. Und auch ihre Anverwandten waren in den Jahren um die Verbundbriefstreitigkeiten aus der Stadt geflohen oder vertrieben worden. Frau Catrin, Frau Almut und später Frau Alyss aber hatten ihr die mütterliche Familie ersetzt.
Der Frühlingsmorgen in seinem hellen Sonnenschein vertrieb Myntha und ihrem Vater die Schwermut recht schnell, als sie am Rheinufer auf den Eigelstein zustrebten. Gleich hinter dem wuchtigen Tor führte die Straße zum Konvent der grauen Beginen, und hier wurden sie aufs Herzlichste begrüßt. Master John stand mit seiner Tochter Jehanne und seinen zwei Söhnen beim Backes und schwatzte mit der Köchin. Der dritte, ein sehr rothaariger Junge an seiner Seite, aber war Myntha fremd. Doch Frau Alyss nahm immer wieder junge Leute auf, und so vermutete sie einen neuen Schützling. Ein verschüchterter Knabe und, wie es schien, als Master John mit ihm sprach, wohl auch der heimischen Sprache nicht mächtig.
Obwohl …
Gauwin, der jüngste Schlingel der drei Kinder, machte eben einen Schritt nach vorne, um in den Korb mit süßen Wecken zu greifen, den die Köchin dem Grüppchen anbot, und mit lautem Geschepper folgte ihm der Brotschieber, mit dem gewöhnlich die Laibe aus dem Ofen geholt wurden. Alle drehten sich zu dem Jungen um, dem vor Schreck der Wecken aus der Hand gefallen war. Er machte einen Satz zur Seite, und der Schieber folgte ihm mit Gerassel. Myntha bemerkte, wie sich der verschüchterte Rotschopf auf die Wangen biss. So viel zu unschuldigen Knaben. Denn ganz offensichtlich hatte er den Schieber mit einem Lederbändchen am Zipfel von Gauwins Wams angenestelt.
»Ein kleiner Teufelsbraten«, flüsterte Reemt ihr zu, und sie nickte.
»Zwei, Vater. Gauwin ist auch kein Kind von Traurigkeit.«
»Und über beide geht sicher gleich ein Gewitter nieder.«
»Aber kein so gewaltiges wie das, was der wohledle Herr vom Spiegel veranstalten konnte. Ich bedauere es um der Jungen willen, dass er sein Donnerwetter nicht mehr auf sie niederprasseln lassen kann. Ein solcher Streich hätte ihm gefallen.«
»Und Frau Almut auch, weshalb die beiden jungen Ungeheuer ihrer Strafe diesmal entgehen mögen.«
Ein wohlgerundeter Priester in schwarzer Kutte, Vater Lodewig, der Abt von Groß Sankt Martin, trat in den Hof und wurde von den Beginen mit Achtung begrüßt. Er würde den Trauerzug nach Sankt Brigiden begleiten.
»Gehen wir in die Kapelle, Vater, und verabschieden wir uns von Frau Almut.«
Reemt nickte und machte den zwei schluchzenden Maiden Platz, die durch die Tür nach draußen traten.
Frau Almut schlief, angetan mit ihrem schönsten Gewand, die Hände um einen Strauß von Veilchen und Maiblumen gefaltet. Auf ihrer Brust lag an einem feinen Goldkettchen hängend die Träne Mariens, eine vollendete weiße Perle. Jung war ihr Gesicht, die Falten, die das Leben gegraben hatte, schienen geglättet, und ein feines Lächeln lag in ihren Zügen.
»Sie hat ihren Gatten gesehen, als sie starb«, flüsterte Myntha. »Möge sie in seine Arme zurückgekehrt sein.«
Reemt kniete nieder, und mit ihm tat es Myntha, und sie beide beteten das Ave-Maria. Und Myntha schloss ihr Gebet mit den Worten: »Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Doch die Liebe ist die Größte unter ihnen. Das hat Frau Almut oft gesagt.«
»Amen«, sagte Reemt.
Dann traten sie auch wieder in den Hof. Myntha hustete und sog tief die frische Luft ein.
»Dieser Weihrauch war eine seltsame Mischung.«
»Ein wenig streng und scharf, da hast du recht. Nun aber werden wir gleich aufbrechen.«
Der Trauerzug war gewaltig und erstreckte sich vom Eigelstein bis zu Sankt Brigiden. Hunderte von Menschen gaben Frau Almut das letzte Geleit, und die Glocken von Groß Sankt Martin läuteten sie aus dieser Welt.
In eine heile, barmherzige und auf ewig heitere, wie Myntha hoffte.
6. Kapitel
Rak, rak, rak!«, sagte der Rabe und ließ sich auf dem Hackklotz nieder.
Frederic saß bewegungslos auf dem Schemel an der Hauswand und betrachtete das schwarze Tier. Der Vogel wiederum betrachtete ihn.
»Frederic«, sagte er leise. »Frederic.«
»Ric, ric.«
»Frederic.«
Der Rabe legte den Kopf schief, als ob er nachdenken müsste.
»Ric.«
Frederic warf ihm ein Stück Fleisch zu. Der Rabe schlang es herunter, blieb aber sitzen.
»Gut. Und du bist Robb? Robb!«
»Ric!«
Frederic zeigte auf seine Brust und sagte: »Ric.« Gleichzeitig reichte er dem Raben ein Stückchen Fleisch. Der nahm es aus seinen Fingern, verschlang es und sah ihn wieder an.
»Robb?«
»Rrrobb?«
Wieder eine Belohnung. Ein zweiter Rabe kam hinzu und hüpfte vor Frederics Füßen auf und ab. Ein wenig kleiner vielleicht als Robb und mit einem weißen Fleck im Nacken. Vermutlich war das Robbs Weibchen. Sie verhielt sich noch etwas zurückhaltend, das Stückchen Fleisch zwischen seinen Fingern beäugte sie nur.
»Ric!«, sagte Robb und hüpfte näher.
»Nix da, das ist für Crea.«
Frederic warf das Fleischstückchen der Rabenfrau hin, die es sofort aufnahm und verschluckte.
Mit den beiden gelehrigen Vögeln vergnügte er sich nun schon seit vier Tagen, und diese Tätigkeit trug Früchte. Das eine Pärchen hielt sich jetzt dauerhaft in der Nähe der Kate auf, das zweite überlegte wohl noch, kam aber zur abendlichen Fütterung gerne vorbei.
Eben jetzt, um die Mittagszeit, hörte er ihr warnendes Krah! Krah!
Frederic stand auf und blickte in Richtung des Krächzens. Die schwingenden Röcke von Ellen beruhigten ihn sogleich. Kein ungebetener Besucher näherte sich, sondern seine Vermieterin. Vermutlich wollte sie ihre Dienste anbieten, und hoffentlich brachte sie ein, zwei Laibe Brot mit.
Sie hatte einen Korb dabei, der nicht nur zwei knusprige Brote, sondern auch seine gewaschenen Reisekleider enthielt.
»Habt Ihr Euch eingelebt, Meister Frederic?«, fragte sie und sah missbilligend zu den vier Raben auf dem First hoch.
»Ja, Gevatterin. Und auch schon vier Freunde gefunden.«
»Raben? Die bringen Unglück.«
»Nur jenen, die uneingeladen zu mir kommen. Ihr hingegen seid sehr willkommen.«
»Weil ich Euch Brot und Wäsche bringe?«
Frederic verneigte sich und nahm ihr den Korb ab.
»Wurst und Käse schmecken besser mit Brot als mit Brei. Sagt, von wem könnte ich ein Fässchen Wein beziehen?«
»Es gibt einen Winzer nach Deutz runter, aber … der Wein ist recht sauer. Weinhändler findet Ihr drüben in Köln etliche, aber wenn Euch der Weg zu umständlich ist, fragt bei Fährmeister Reemt nach. Er hat immer einen Vorrat von gutem Burgunder im Haus und wird ihn Euch verkaufen. Doch habt Acht, seine Tochter handelt geschickt.«
»Ich will es bedenken.«
»Die Lore braut auch ein gutes Bier, nur ist die zurzeit nicht dort, und wenn Myntha die Grut ansetzt, dann muss viel Glück im Spiel sein, wenn ein trinkbares Bier draus wird.« Und mit einem Grinsen fügte Ellen hinzu: »Für das Brot, das sie backt, gilt dasselbe.«
»Auch das ist gut zu wissen. Die Fährmannstochter scheint ein harthändiges Weib zu sein. Vermutlich ist sie mit dem Ruder geschickter als mit dem Kochlöffel.«
»So könnte man meinen. Aber macht Euch selbst ein Bild.«
Darauf, dachte Frederic, würde er gut verzichten können. Um dieses Thema nicht weiter zu erörtern, fragte er Ellen, warum Mülheim nicht wie früher von einer Stadtmauer umgeben war.
»Tja, Meister Frederic, vor drei Jahren hat man sie mal wieder niedergelegt. Wir hatten viele Fehdejahre hier, müsst Ihr wissen. Die Kölner und die Bergischen liegen ständig im Zank miteinander. Als anno vierzehn der neue Erzbischof gewählt wurde, haben die Bergischen Mülheim zur Festung ausgebaut. Wir hatten viel Verdruss durch diese Maßnahmen, denn der Handel zu Wasser und zu Land wurde stark behindert, und immer wieder gab es blutige Scharmützel rund um die Stadt. Und dann rüsteten die Moersischen, also die Verbündeten von Erzbischof Dietrich von Moers, ein Kriegsschiff aus, mit Kanonen und allem, um die Feste Mülheim zu zerstören. Das war die Ovelgötz.«
Ellen begann zu kichern.
»Ist das erheiternd, Gevatterin? Man sollte meinen, dass ein solches Schiff Schrecken verbreitet.«
»Ach wisst Ihr, Meister Frederic, wir haben Schlimmes erlebt, aber manches … Hört selbst. Die Ovelgötz wurde mit englischen Söldnern bemannt und ankerte drüben in Riehl. Die Mannschaft sollte die Bergischen hier auf der Seite beobachten und jeden Verkehr zwischen Köln und Mülheim verhindern, damit kein Proviant herüberkam. Die unseren aber bewaffneten sich mit Büchsen und beschossen das Schiff, sodass die anderen weiter nach Köln fuhren und dort am Kranenufer anlegten. Und der Rat der Stadt Köln versuchte, Verhandlungen zwischen den Parteien zu führen. Aber …« Wieder kicherte Ellen. »Wisst Ihr, mein Sohn Jens war dabei. Weil nämlich … Der Kommandant der Ovelgötz und der Fährmeister von Deutz und die ganze Mannschaft sind eines Abends in die Badestube am Frankenturm gegangen und haben sich dort dem Trunk hingegeben. Aber der damalige Pastor hat am nämlichen Abend ebenfalls in dieser Taverne vorbeigeschaut und das fröhliche Zusammensein entdeckt. Drauf ist er umgehend über den Rhein gerudert und hat unserem Junker von Cleve von dieser Sorglosigkeit berichtet. Der sammelte seine Mannen, und sie fuhren gen Köln und beschossen die Badestube. Die englischen Söldner wurden gefangen genommen, die Ovelgötz war keine Bedrohung mehr.«
»Leichtsinnig, der Kommandant. Oder bestechlich.«
Ellen zuckte mit den Schultern.
»Oder dumm, nicht wahr?«
»Oder das. Und der Streit wurde beigelegt?«
»Es ging noch ein paar Mal hin und her, aber vor drei Jahren schlossen sie dann Frieden, und die Festungsmauern von Mülheim und Riehl fielen.«
Frederic beschloss, sich dazu noch an anderer Stelle umzuhören. Zwischen zwei Fronten zu geraten, war das Letzte, was er sich wünschte. Vielleicht sollte er ein Badehaus aufsuchen, wo man ihm nicht nur die juckenden Stoppeln vom Gesicht schaben würde, sondern wo auch allerlei Nachrichten und Gerüchte zu erlauschen waren.
Ellen wusste auch hier Rat und empfahl ihm das Haus von Bader Juppes.
Doch als sie gegangen war, blieb Frederic vor seiner Kate sitzen, hörte den Raben zu, die sich auf dem First unterhielten, und hing seinen düsteren Gedanken nach.
7. Kapitel
Du kannst hier nicht sitzen bleiben«, herrschte die magere Ziege sie an, aber die Pilgerin schüttelte nur müde den Kopf. Schon waren die Mauern der Stadt Köln in Sichtweite, aber ihre Füße brannten wie Feuer, und Fieberschauer durchbebten ihren ausgemergelten Körper.
»Du musst weiter, du hast es gelobt!«
Ja, ja, sie hatte gelobt, im Kloster der heiligen Ursula für die Sicherheit ihrer Kinder zu beten. Aber schon seit Tagen schleppte sie sich nur mühselig im Tross der Pilger mit, blieb häufig zurück und taumelte bei jedem Schritt vor Erschöpfung.
Beten half nichts.
Essen hätte vielleicht geholfen, aber der Priester, der sie anführte, verlangte strenges Fasten.
Herrisch zerrte die Ziege sie auf die Beine. Wieder schwankte sie, ließ sich aber mitziehen. Das, was die Frau vor sich hin murmelte, klang weniger gottesfürchtig als vielmehr unflätig.
Schritt für Schritt kämpfte sie sich voran, erkannte kaum die Straße, auf der sie entlangwanderten, stolperte immer wieder und kämpfte gegen den Schwindel an.
Nach einer qualvollen Ewigkeit durchschritten sie das Stadttor, eine Schar grauer Pilger aus dem fernen Frankenland.
Jemand schubste sie weiter bis vor ein Haus. Dort nahm sie eine weitere Frau am Arm, und die Worte aus ihrem Mund klangen freundlicher, auch wenn sie ihren Sinn nicht verstand. Sie wurde in einen halbdunklen Raum geführt und durfte sich auf ein Bett legen. Es roch nach fauligem Stroh und ungewaschenen Decken, aber ihre Erleichterung war so groß, dass sie sich ausstreckte und umgehend in einen bewusstlosen Schlaf versank.
Einmal wurde sie wach, denn die Frau mit der freundlichen Stimme hielt ihr einen Becher mit einem Kräutersud an die Lippen. Er schmeckte süß und ein wenig bitter, und er wärmte ihr den Magen.
»Kannst du etwas essen, Fremde?«
Sie ahnte es mehr aus den Gesten der Frau und nickte erleichtert.
Essen!
Es war ein süßer Brei, den sie ihr Löffel für Löffel an die Lippen hielt, und dankbar schluckte die Pilgerin.
»Merci«, flüsterte sie, als die Schüssel geleert war. Und mit einem Restchen Kraft fragte sie: »Wo?«
»Im Hospiz Ipperwald. In Köln. Verstehst du?«
Sie nickte. Sie war am Ziel.
Beruhigt schlief sie wieder ein.
8. Kapitel
Myntha hatte vorgehabt, nach Frau Almuts Beerdigung einige Tage bei Frau Alyss zu verbringen, um ihr zur Hand zu gehen. Unzählige Besucher waren zum Leichenschmaus gekommen, und immer gab es etwas aufzuräumen, nachzufüllen oder abzuwaschen. Die alte Hilda, die in der Küche wirkte, konnte jede Hilfe brauchen, denn die beiden Jungfern Richmodis und Clara, Töchter von Frau Alyss’ Schwägerin Catrin, bedurften noch sehr der Beaufsichtigung und kosteten Hilda deshalb eher noch mehr Zeit, als dass sie ihr eine Hilfe gewesen wären. Jehanne, die zwölfjährige Tochter des Hauses, fand – genau wie ihre Brüder Gauwin und Thomas – immer wieder eine Ausrede, damit sie im Weingarten werkeln konnte, statt Gäste zu bewirten. Und Emery … Myntha hatte den Verdacht, dass er die deutsche Sprache weit besser verstand, als er zuzugeben bereit war. Doch er konnte seine Ohren wunderbar auf Durchzug stellen, wenn man die Erfüllung einer ungeliebten Pflicht von ihm verlangte.
Dennoch, das Jungvolk war ein fröhliches Häufchen, und an Tagen, an denen Frau Alyss und Master John ihnen mehr Aufmerksamkeit schenken konnten, erfüllten sie auch recht willig und fleißig ihre Aufgaben.
Nach einer Woche legte sich der Trubel allmählich, und der übliche Tagesablauf wurde wieder aufgenommen. Dennoch bat Frau Alyss Myntha, noch eine weitere Woche zu bleiben, denn es gab etliches im Haushalt ihrer Mutter zu regeln. Am Montag nach Pfingsten schließlich kletterte sie zu Jung-Thomas auf das Fuhrwerk, das mit vier Fässern Burgunder und zweien mit weißem Rheinwein beladen war, um damit zur Fähre zu fahren.
An der Anlegestelle zog sie die Fahne hoch, und kurz darauf trieb der Nachen über den Rhein. Mit seiner hochgebogenen, offenen Bugseite schob er sich knirschend an das flache Ufer. Witold half Thomas, die Fässer abzuladen und auf den Nachen zu rollen. Myntha verabschiedete sich von dem Jungen und verschleierte ihr Gesicht.
»Schöne Zeit gehabt?«, fragte Witold, als sie abstießen.
»Arbeitsreich. Anstrengend. Und lustig.« Und dann neckte sie ihn: »Zwei hübsche Jungfern sind zu Gast.«
Witold sagte darauf nichts, sondern bediente das Ruder, um ihr Fahrzeug mit der Strömung auf die Anlegestelle zuzusteuern.
»Clara ist vierzehn und ein wirklich hübsches Mädchen.«
Witold starrte über das Wasser.
»Dein Bruder meint, es sei an der Zeit, dass du dir ein Weib nimmst.«
Witold, jetzt mit einem roten Nacken, starrte weiter auf das Wasser.
Myntha verkniff sich ein Kichern.
Witold und Haro waren aufrechte Männer, stark und mutig genug, die Fähre sogar bei Eisgang über den Rhein zu steuern. Frauen gegenüber jedoch waren sie genau wie einst auch ihr Vater verschüchtert und befangen. Ohne einen kleinen Schubs würden sie wohl nie ein Weib nehmen.
Wäre es nicht eine lohnende Aufgabe, ihnen diesen Schubs zu geben?
Oder würde der Ruf, der ihr selbst anhaftete, eine jegliche Jungfer abschrecken?
Nicht sehr oft bedrückte Myntha die Vergangenheit, aber es gab Situationen, in denen sie sich daran erinnerte, dass sie für viele Menschen ein Ungeheuer war.
Eine Möwe kam im Sturzflug neben dem Nachen nieder und stieß ins Wasser. Es spritzte auf, und Myntha trat unwillkürlich einen Schritt zurück, um den Tropfen auszuweichen.
Ja, auch das war ein Vermächtnis, das sie nicht loswurde.
Das Mülheimer Ufer näherte sich, und sie griff zur Stake, um Witold zu helfen, den beladenen Nachen direkt vor dem Fährhaus an Land zu bringen. Je näher sie dem Hof waren, desto schneller konnten sie die Fässer entladen und in den Keller rollen.
»Der Düstere aus Jens’ Kate hat ein Fässchen Roten bestellt«, sagte Witold, als sie die Fähre am Poller festmachten.
»Vielleicht hebt der ja seine Laune.«
»Kaum. Aber er hat uns auch gefragt, ob wir ihm helfen, einen Anbau für seine Pferde zu bauen. Hab ihm zugesagt. Ist wohl nicht verkehrt, ihn etwas zu beobachten.«
»Hältst du ihn für gefährlich?«
Witold nickte.
»Trägt immer ein Messer im Gürtel und hat einen Bogen bei sich. Sagt, er jagt sich sein Fleisch selbst.«
»Dann soll er aufpassen, dass sie ihn nicht als Wilderer aufknüpfen.«
»Er schießt Karnickel, sagt er, und dafür ist ihm der Bauer sogar dankbar.«
»Woher kommt er?«
»Wie kommst du auf die Idee, dass gerade er mir das anvertraut hat?«
»Weil du ein netter Bursche bist, Witold. Oh, ist das Karol da am Steg?«
»Sagten wir dir doch neulich, dass er zurück ist. – Sei gegrüßt, Karol. Du kommst zur rechten Zeit, um die Fässer zu entladen.«
»Was zahlst du dafür?«
»Gottes Lohn?«
Karol lachte.
»Und du, Myntha?«
»En Bützje?«
»Gut, ich helfe euch!«
Die Arbeit war schnell getan, und Karol legte Myntha den Arm um die Taille und schwenkte sie herum.
»Es war eine lange, aufregende Reise, Myntha, aber ich habe an dich gedacht.«
»So, so!«
»Und jetzt bekomm ich das Bützje?«
Myntha zog den Schleier zur Seite und gab ihm ein hurtiges Küsschen auf die Wange.
»Ooch …«
»Bützje, keinen Kuss.«
»Ich habe aber auch Geschenke mitgebracht.«
»Geschenke sind Geschenke und keine Tauschware.«
»Du bist so hart, Liebschen.«
Myntha machte sich von ihm frei, lief zum Haus, aber schaute noch einmal neckisch über die Schulter. Ihre Laune war sonniger geworden, und sie hoffte, dass Karol ihr nachkommen würde.
Er tat ihr den Gefallen, und als er in die Küche trat, wurde er auch von der Großmutter freundlich willkommen geheißen.
»Frau Enna, Ihr seht blühend aus wie ein Rosenbusch. Und duftet wie die Gewürzgärten des Morgenlandes.«
»Honigmaul. Was Ihr riecht, sind die Pimpernellen, die ich gerade gepflückt habe, und keine morgenländischen Gewürze.«