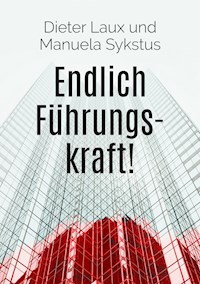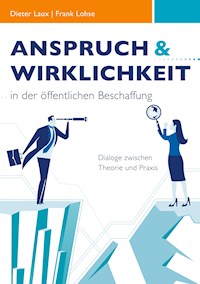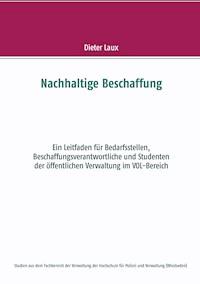
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Falsche günstig zu kaufen ist immer noch zu teuer! Mit diesem Ansatz versucht der Autor darauf hinzuweisen, dass Bedarfsstellen nicht als „Passagiere im Beschaffungszug“ der öffentlichen Verwaltung mitreisen müssen, sondern sie sehr wohl die Möglichkeit haben, sich in diese von außen betrachtet komplexe Thematik einzubringen. Dazu bedarf es des Wissens um die Stellschrauben im gesamten Beschaffungsprozess und des Bewusstseins der eigenen Möglichkeiten. Aus den vielen Aspekten, die es dabei zu berücksichtigen gilt, ist letztlich ein Handbuch für Praktiker geworden. Es kann als Leitfaden für den eigenen Beschaffungsprozess dienen oder als Nachschlagewerk, um verstehen zu können, wie sich die anderen Beteiligten im öffentlichen Beschaffungsprozess verhalten und warum das so ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor:
Dr. Dieter Laux ist Lehrbeauftragter für Betriebswirtschaftslehre im Fachbereich Verwaltung der Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV). Als langjähriger Leiter einer der drei zentralen Beschaffungsstellen des Landes Hessen trug er mit zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie in der hessischen Landesregierung bei. U.a. hat er in den Projekten „Nachhaltige Beschaffung“ des Landes Hessen sowie „REPROC“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) mitgearbeitet. Dieses Wissen bringt er in Seminaren zur Nachhaltigkeit der Zentralen Fortbildung im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) ein.
In Seminaren der HfPV versucht er gemeinsam mit den Studentinnen und Studenten neue Aspekte zu erarbeiten und für die Praxis verfügbar zu machen. Ebenso verantwortet er das strategische Bildungsmanagement der Polizeiakademie Hessen (HPA).
Kontakt: [email protected].
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 EINLEITUNG
1.1 D
AS
F
ALSCHE GÜNSTIG ZU KAUFEN IST IMMER NOCH ZU TEUER
!
1.2 S
IND
R
ECHTSVORSCHRIFTEN EIN
D
ILEMMA
?
1.3 N
UTZEN DES
B
UCHES FÜR
P
RAKTIKER UND FÜR
S
TUDENTEN
1.4 A
UFBAU DES
B
UCHES
2 THEORIE DER BESCHAFFUNG
2.1 D
EFINITIONEN BZW
. V
ORINFORMATIONEN
2.1.1 V
ERGABERECHT
2.1.2 B
ESCHAFFUNG UND
S
TRATEGIE
2.1.3 E
INKAUF
2.1.4 P
RODUKT
, W
ARE
, G
UT
, L
IEFERUNGEN UND
L
EISTUNGEN
2.1.5 Ö
FFENTLICHE
A
UFTRAGGEBER
2.1.6 F
RISTEN
2.1.7 B
EDARFE UND
B
EDARFSSTELLEN
2.1.8 W
IRTSCHAFTLICHKEIT UND
S
PARSAMKEIT
2.1.9 V
ERKÜRZTE BZW
.
BESCHRÄNKTE
M
ÄRKTE
2.2 WAS PASSIERT, WENN NICHTS PASSIERT?
2.2.1 A
LTERNATIVEN ZUR
B
ESCHAFFUNG
2.2.1.1 Strategische Ansätze - Beispiel Produktlaufzeit
2.2.1.2 Organisatorische Ansätze - Beispiel Prozessoptimierung
2.2.1.3 Technische Ansätze – Beispiel Technikausprägung
2.2.1.4 Reduzierung von Lagerbeständen
2.2.1.5 Verzicht auf unzweckmäßige Leistungen
2.2.1.6 Reduzierung auf das zwingend Erforderliche
2.2.2 W
AS KÖNNTE EINE SACHLICHE
B
ETRACHTUNG VON
A
LTERNATIVEN BEHINDERN
?
2.2.2.1 Wie der Eindruck von „Bürokratie“ und vom „Willen zur Rechtsbeugung“ entstehen kann
2.2.2.2 Werbung als Folge der Vergessenskurve nach Ebbinghaus
2.2.2.3 Der Primacy-Effekt
2.2.2.4 Der Recency-Effekt
2.2.2.5 Der Halo-Effekt
2.2.2.6 Der Framing-Effekt
2.2.2.7 Der Mere-Exposure-Effekt
2.2.2.8 Entwicklungspotenzial bis hin zur Korruption
2.2.3 W
IE KÖNNEN SICH ÖFFENTLICHE
A
UFTRAGGEBER AUF DIE
E
FFEKTE EINSTELLEN
?
2.2.4 N
UTZWERTANALYSE
–
EIN BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES
W
ERKZEUG ZUR
V
ERSACHLICHUNG
2.3 S
TRATEGISCHE
S
TEUERUNGSFUNKTION
2.3.1 B
EDARFSBÜNDELUNG
2.3.2 Z
ENTRALISIERUNG
2.3.3 ABC/XYZ-A
NALYSE
2.3.4 P
ROBLEMATIK
E
INKAUFSKARTELLE
2.4 V
ERLAUF EINER
B
ESCHAFFUNG MIT
V
ERGABEENTSCHEIDUNG
2.4.1 B
EDARF
2.4.1.1 Bedarfsentstehung
2.4.1.2 Notwendigkeitsprüfung und erste Wirtschaftlichkeitsprüfung
2.4.1.3 Bedarfsbestimmung
2.4.1.4 Fachliche Leistungsbeschreibung
2.4.1.5 Budgetvorplanung
2.4.1.6 Beschaffungsauftrag
2.4.2 V
ORBEREITUNG
2.4.2.1 Markterkundung
2.4.2.2 Technische Leistungsbeschreibung
2.4.2.3 Budgetverifizierung
2.4.2.3.1 Investitionen
2.4.2.3.2 Kosten für den laufenden Betrieb
2.4.2.3.3 Entsorgungskosten
2.4.2.3.4 Berücksichtigung der gesamten Lifecycle-Kosten
2.4.2.4 Abstimmung mit der Bedarfsstelle und Freigabe der Beschaffung
2.4.2.5 Budgetfreigabe
2.4.3 V
ERGABE
2.4.3.1 Vorbereitung des Vergabeverfahrens
2.4.3.1.1 Erstellung der Vergabeunterlagen
2.4.3.1.2 Formale Anforderungen
2.4.3.1.2.1 Festlegung der Zuschlagskriterien
2.4.3.1.2.2 Festlegung der zu fordernden Formalien
2.4.3.1.3 Eignungsanforderungen
2.4.3.1.4 Bedarfsspezifizierung
2.4.3.1.5 Kostenschätzung
2.4.3.1.6 Beschaffungsfreigabe
2.4.3.1.7 Festlegung des Vergabeverfahrens
2.4.3.1.7.1 Interessenbekundungsverfahren (IBV)
2.4.3.1.7.2 Nationale Vergabeverfahren
2.4.3.1.7.3 Europaweite Vergabeverfahren
2.4.3.1.7.4 Überlegungen zum Rechtsschutz der Unternehmen
2.4.3.2 Durchführung des Vergabeverfahrens
2.4.3.2.1 Bekanntgabe der Ausschreibung
2.4.3.2.2 Bearbeitung von Bieterfragen
2.4.3.2.3 Öffnung der Angebote
2.4.3.2.4 Bewertung und Auswahl von Anbietern und Angeboten
2.4.3.2.4.1 Erste Wertungsstufe - Formelle Prüfung
2.4.3.2.4.2 Zweite Wertungsstufe – Eignungsprüfung
2.4.3.2.4.3 Dritte Wertungsstufe – Angebotsprüfung
2.4.3.2.4.4 Vierte Wertungsstufe – Wirtschaftlichkeitsprüfung
2.4.3.2.5 Zuschlag oder Aufhebung des Vergabeverfahrens
2.4.4 E
INKAUF UND
A
BWICKLUNG
2.4.4.1 Festlegungen nach Vertragsabschluss
2.4.4.2 Organisation der Logistik
2.4.4.3 Bestellung bzw. Abruf
2.4.4.4 Wareneingangs- und Rechnungsprüfung
2.4.4.5 Rechnungsabwicklung
2.4.4.6 Inventarisierung
2.5 V
ERLAUF EINER
B
ESCHAFFUNG OHNE
V
ERGABEENTSCHEIDUNG
2.5.1 DIREKTKAUF
2.5.2 A
BRUF AUS
R
AHMENVERTRÄGEN
2.6 N
ACH DER
B
ESCHAFFUNG IST VOR DER
B
ESCHAFFUNG
!
2.7 O
RGANISATION DER
B
ESCHAFFUNG
2.7.1 A
NSÄTZE ZUR
S
TRUKTURIERUNG DER
R
EGELORGANISATION ZUR
B
ESCHAFFUNG
2.7.1.1 Einkäuferkonzept
2.7.1.2 Vergabespezialistenkonzept mit Fachabteilung
2.7.1.3 Vergabespezialistenkonzept ohne Fachabteilung
2.7.1.4 Fachgremien
2.7.2 P
ROJEKTORGANISATION ZUR
B
ESCHAFFUNG
3 NACHHALTIGKEIT
3.1 Z
IELPERSPEKTIVEN FÜR DIE ÖFFENTLICHE
V
ERWALTUNG
3.1.1 V
ORBEMERKUNG
: V
ERGABEFREMDE
Z
IELE
3.1.2 Ö
KONOMIE
3.1.2.1 Beschaffungsstrategie
3.1.2.2 Sortimentsstraffung
3.1.2.3 Langfristige Rahmenverträge
3.1.2.4 Nachhaltig optimierte Prozesse
3.1.3 Ö
KOLOGIE
3.1.3.1 Belastung durch die Erzeugung
3.1.3.2 Belastung durch den Transport bis zum Endkunden
3.1.3.3 Belastung durch die Nutzung im Wirkbetrieb
3.1.3.4 Belastung durch die Entsorgung
3.1.4 S
OZIALES
3.1.4.1 Verhinderung von Kinderarbeit
3.1.4.2 Weitere Sozialaspekte
3.1.5 B
ERÜCKSICHTIGUNG VON
S
EITENEFFEKTEN
3.2 E
RWEITERTER
H
ANDLUNGSRAHMEN FÜR
B
EDARFSSTELLEN
3.2.1 T
ERMINTREUE
3.2.2 Q
UALITÄTSTREUE
3.2.3 L
IEFERTREUE
3.3 I
NFORMATIONSQUELLEN FÜR
B
EDARFSSTELLEN
3.4 A
UF
B
EDARFSSTELLEN WIRKENDE
E
INFLUSSFAKTOREN
3.4.1 E
INFLUSS DER
M
ARKTGEGEBENHEITEN
3.4.2 E
INFLUSS DER EIGENEN
K
UNDEN
3.4.3 E
INFLUSS DER EIGENEN
O
RGANISATION BZW
.
DER
P
OLITIK
4 BESCHAFFUNGSPRAXIS
4.1 P
ROBLEMSTELLUNGEN
4.1.1 „G
UTER
W
ILLE
“
VS
. M
ARKTREALITÄTEN
4.1.1.1 Grenzen in der Analyse der Aufgabe
4.1.1.2 Grenzen in der Analyse der Arbeitsmittel
4.1.1.3 Grenzen in der fachlichen Analyse des Marktes
4.1.1.4 Grenzen in der wirtschaftlichen Analyse des Marktes
4.1.2 E
IN
K
ARDINALFEHLER LÄSST VERMEINTLICH
B
ÜROKRATIE ENTSTEHEN
!
4.1.3 S
CHLIEßEN SICH
W
IRTSCHAFTLICHKEIT UND
N
ACHHALTIGKEIT GEGENSEITIG AUS
?
4.2 B
ETRIEBSWIRTSCHAFT IM
S
PANNUNGSFELD RECHTLICHER
E
RFORDERNISSE
4.2.1.1 Erlasse und Dienstanweisungen
4.2.1.2 Haushaltsrecht
4.2.1.3 Beamtenrecht und Tarifvertrag
4.2.1.4 Vergaberecht und Vertragsrecht
4.3 T
IPPS
4.3.1 H
ÄUFIG VON
B
EDARFSSTELLEN GESTELLTE
F
RAGEN UND MÖGLICHE
A
NTWORTEN
4.3.1.1 Sind Produktinformationen von Unternehmen unlautere Handlungen?
4.3.1.2 Ich hatte noch keine Vorstellung von einem Bedarf und werde jetzt auf ein neues Produkt aufmerksam!
4.3.1.3 Produktneutrale Beschreibung eines spezifischen Produkts?
4.3.2 T
YPISCHE
F
EHLERSITUATIONEN UND DIESBEZÜGLICHE
V
ERMEIDUNGSSTRATEGIEN
4.3.2.1 Unzulänglichkeiten in der Vorbereitung durch Festhalten an Bewährtem
4.3.2.2 De-facto-Vergaben
4.3.2.3 Fehlentwicklungen hin zu dolosen Handlungen
4.3.3 S
TARTUP
-U
NTERNEHMEN
5 ÜBUNGSFÄLLE
5.1 A
NSÄTZE FÜR EIN
L
EITBILD
N
ACHHALTIGKEIT FINDEN UND IN DER
P
RAXIS UMSETZEN
5.2 D
IE SOZIALVERTRÄGLICHE
B
ESETZUNG DER
A
UßENSTELLE BEI ANGEORDNETEM
P
ERSONALWECHSEL
5.3 E
INE
M
ARKTANALYSE FÜR EINE
F
AHRZEUGBESCHAFFUNG MIT DER
N
UTZWERTANALYSE DURCHFÜHREN
5.4 L
EITFÄDEN DER
N
ACHHALTIGKEIT VERGABERECHTLICH INTERPRETIEREN UND IN DER
P
RAXIS NUTZEN
5.5 B
ESCHAFFUNGSPROJEKT
„N
EUE
U
NIFORM
“
5.6 Z
U KURZ GEDACHT UND DAFÜR
B
ÜROKRATIE BEKOMMEN
!
5.7 B
RAUCHE ICH DAS WIRKLICH
?
5.8 W
ER SAGT
,
DASS
T
ISCHE
„B
EINE
“
HABEN MÜSSEN
?
6 SCHLUSSWORT / AUSBLICK
7 LITERATURVERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
ABBILDUNG 1: DIE PROBLEMATIK UNBESTIMMTER RECHTSBEGRIFFE (LAUX, 2011)
ABBILDUNG 2: PRINZIP BESCHRÄNKTER BZW. VERKÜRZTER MÄRKTE
ABBILDUNG 3: VERGESSENSKURVE NACH EBBINGHAUS (KOVACS, 2013)
ABBILDUNG 4: NUTZWERTANALYSE - BEISPIEL FÜR DAS BEWERTUNGSSCHEMA (GPM, 2013)
ABBILDUNG 5: ZENTRALISIERUNG DER VOL-STELLEN IN HESSEN
ABBILDUNG 6: ABC–/XYZ–ANALYSE (ARNOLD & EßIG, 2002, S. 34)
ABBILDUNG 7: VERLAUF EINER BESCHAFFUNG MIT STRATEGISCHER STEUERUNG (ANGELEHNT AN PTLV, 2012)
ABBILDUNG 8: FIXE UND VARIABLE KOSTEN (WÖHE & DÖRING, 2010, S. 308)
ABBILDUNG 9: MAGISCHES DREIECK "ZEIT-KOSTEN-QUALITÄT"
ABBILDUNG 10: WESENTLICHE ELEMENTE DER VERGABE (LAUX, SEMINAR, 2012, S. 35)
ABBILDUNG 11: ENTSTEHUNG UND BEDIENUNG ELEKTRONISCHER RAHMENVERTRÄGE (ANGELEHNT AN LAUX, 2010, S. 15)
ABBILDUNG 12: VARIANTEN DER BESCHAFFUNGSORGANISATIONEN
ABBILDUNG 13: DIMENSIONSMÖGLICHKEITEN VON BESCHAFFUNGSPROJEKTEN
ABBILDUNG 14: NACHHALTIGKEITSDREIECK (MCDONOUGH & BRAUNGART, 2002, S. 254)
ABBILDUNG 15: ANPASSUNG DER PROZESSLANDSCHAFT (FISCHERMANNS, 2014)
ABBILDUNG 16: PROZESSLANDSCHAFT - VORSCHLAG FÜR ORGANISATIONEN MITTLERER GRÖßE
ABBILDUNG 17: PROZESSLANDSCHAFT - VORSCHLAG FÜR KLEINE ORGANISATIONEN
ABBILDUNG 18: MARKTEINGRENZUNG DURCH ZU FRÜHE FESTLEGUNG AUF ÖKOLOGISCHE KRITERIEN
ABBILDUNG 19: WIE SOLLTE ES NACH DER LEHRE ABLAUFEN? (LAUX, SEMINAR, 2012, S. 11)
ABBILDUNG 20: VORSCHLAG EINER WIRKUNGSMATRIX
ABBILDUNG 21: VORSCHLAG EINER MATRIX ZU „MUST“-EIGENSCHAFTEN
ABBILDUNG 22: WOHER KOMMEN KLASSISCHE FEHLER? (LAUX, SEMINAR, 2012, S. 22)
ABBILDUNG 23: SPANNUNGSFELDER IM RECHTLICHEN UMFELD (LAUX, SEMINAR, 2012, S. 6)
ABBILDUNG 24: WAS FÖRDERT UNWIRTSCHAFTLICHE BESCHAFFUNG? (LAUX, SEMINAR, 2012, S. 28)
ABBILDUNG 25: MARKTENTWICKLUNG MIT VERGABERECHT (LAUX, SEMINAR, 2012, S. 33)
ABBILDUNG 26: SCHEMA FÜR ÜBUNG 5.2
ABBILDUNG 27: TABELLE FÜR ÜBUNG 5.3
ABBILDUNG 28: LÖSUNGSANSATZ TEIL 1 FÜR ÜBUNG 5.3
ABBILDUNG 29: LÖSUNGSANSATZ TEIL 2 FÜR ÜBUNG 5.3
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
ABStHessen
Auftragsberatungsstelle Hessen
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
Bescha
Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGH
Bundesgerichtshof
BHO
Bundeshaushaltsordnung
BME
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.
BMI
Bundesministerium des Innern
BMWI
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
CPO
Chief Procurement Officer
EBP
Enterprise Buyer Professional (Produktname der Fa. SAP)
ElektroG
Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
EuGH
Europäischer Gerichtshof
EU-Kommission
Europäische Kommission
GIV
Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche
Forschung e.V.
GMO
Gentechnisch modifizierte Organismen
GPM
Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.
GVO
Gentechnisch veränderte Organismen
GWB
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HCC
Hessisches Competence Center
HGrG
Haushaltsgrundsätzegesetz
HVTG
Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz
HfPV
Hochschule für Polizei und Verwaltung
HGB
Handelsgesetzbuch
HMdF
Hessisches Ministerium der Finanzen
HMdIS
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
HPA
Polizeiakademie Hessen
HZD
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
IBV
Interessenbekundungsverfahren
LHO
Landeshaushaltsordnung
Lkw
Lastkraftwagen
NVS
Neue Verwaltungssteuerung
OFD
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main
OLG
Oberlandesgericht
PM
Projektmanagement
PTLV
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung
SAP
Eingetragener Firmenname (ursprünglich: Systeme, Anwendungen, Produkte)
StGB
Strafgesetzbuch
UStG
Umsatzsteuergesetz
VgV
Vergabeverordnung (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge
VK
Vergabekammer
VOB
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOB/A
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil A
VOL
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VOL/A
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen – Teil A
ZBSt
Zentrale Beschaffungsstelle
1 EINLEITUNG
Der Thematik Beschaffung kommt im Bereich der Wirtschaftsteilnehmer eine besondere Bedeutung zu. Deren Einkaufsabteilungen sorgen dafür, dass die Rohprodukte dem Herstellungsprozess in möglichst geringem Kostenumfang zur Verfügung gestellt werden, damit der Endpreis für den späteren Kunden1 möglichst niedrig ausfällt, um bei ihm eine für das Unternehmen positive Kaufentscheidung anzustoßen.
Die öffentliche Verwaltung verfügt im Gegensatz dazu im Regelfall über keine Anlässe, Produkte auf dem Markt zum Verkauf anzubieten. Das mag im Vergleich zur Wirtschaft einer der Gründe dafür sein, dass im behördlichen Ablauf die Thematik Beschaffung bislang nur eine untergeordnete Rolle spielt. Ein weiterer Grund könnte die „von Rechtswegen verordnete“2 Maßgabe zur sparsamen Haushaltsführung sein. Kritiker bemängeln, dass dies in der Vergangenheit bei den Bedarfsstellen die Auffassung erzeugte, nur wenig Haushaltsmittel ausgeben und sich nicht alles „leisten“ zu dürfen. In der Folge ist es demnach vorgekommen, dass Bedarfsstellen tatsächlich nicht diejenigen Materialien erhalten haben, die sie sich gewünscht hätten bzw. die sie für ihre Arbeit als notwendig erachtet haben. Mit Blick auf „die Wirtschaft“ mag seitens der Kritiker so manches Mal ehrfürchtig davon gesprochen worden sein, dass diese sich ja „alles leisten“ und deshalb auch "viel besser ihren Job“ machen könne. Die Kritik verkennt dabei, dass die Beschaffung der richtigen Produkte auch in der öffentlichen Verwaltung möglich ist.
Wie sich eine sparsame Haushaltführung und eine wirtschaftliche Beschaffung so durchführen lassen, dass die Bedarfsstellen letztlich auch das bekommen, was sie „wollen“ und benötigen, soll dieser Leitfaden für die Bedarfsstellen, Entscheidungsträger und Studenten der öffentlichen Verwaltung aufzeigen.
1.1 DAS FALSCHE GÜNSTIG ZU KAUFEN IST IMMER NOCH ZU TEUER!
Die Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen stellt sich offensichtlich sowohl für Wirtschaftsteilnehmer als auch für öffentliche Auftraggeber als schwierige Angelegenheit dar. In der praktischen Arbeit fällt auf, dass oftmals die Zeit, bis ein Beschaffungsgegenstand die anfordernde Bedarfsstelle erreicht, als zu lange bemängelt wird. Vielfach werden die „Schuldigen“ im Vergaberecht identifiziert und bei denjenigen, die diesem Rechtzweig Geltung verschaffen wollen. Ihnen wird zuweilen vorgeworfen, sich bürokratisch verhalten zu haben und teilweise sogar die Beschaffungen und damit das Arbeiten der Bedarfsstellen zu behindern. Bei besonders großem Ärger wird durchaus auch davon gesprochen, dass die Behinderung bewusst vorgenommen worden sei.
Den so Angesprochenen fällt es regelmäßig schwer, die Vorwürfe nachvollziehen zu können, haben sie sich doch aus ihrer Perspektive an die geltenden Vorschriften gehalten und dabei sogar noch ein schnelles Verfahren ermöglicht. Aber anstatt eines Lobes für die geleistete Arbeit, erhalten sie eher Kritik bzw. wenig „Gegenliebe“.
Ebenso wird bei Betrachtung aktueller Veröffentlichungen die Thematik Nachhaltigkeit seitens der Beschaffungsspezialisten und Bedarfsstellen noch immer eher als kritisch bewertet. Die Berücksichtigung zusätzlicher Aspekte, die nicht unmittelbar mit der Bereitstellung des benötigten Beschaffungsgegenstands zu tun haben, seien mit „entbehrlichem“ Zusatzaufwand verbunden, den vielbeschäftigte Organisationen eher vermeiden möchten, um mehr Zeit für die „eigentliche“ Arbeit zu haben.
Der Autor war sowohl langjähriger Projektleiter in der Informationstechnik des öffentlichen Dienstes und damit Kunde von Beschaffungsorganisationen, als auch selbst Leiter einer der zentralen Beschaffungsstellen, die mit übergreifenden Befugnissen ausgestattet war und komplexe Verfahren durchgeführt hat. Mit dieser Erfahrung und den dabei gewonnenen Perspektiven versucht er sich in dieser Arbeit den Vorwürfen zu nähern, den Bedarfsstellen einen Einblick in die Strukturen der Beschaffung zu verschaffen und ihnen Ansätze für eine erfolgreiche Vorbereitung und Beteiligung am Verfahren zu vermitteln. Den Bedarfsstellen sollen Handlungsoptionen für die Praxis an die Hand gegeben werden, damit sie „Klippen erkennen und umschiffen“ können.
Dabei versucht der Autor herauszustellen, dass beide Seiten (sofern sie denn als solche zu bezeichnen wären), also die Beschaffungsstellen und deren „Umfeld“, eine erfolgreiche Beschaffung nur gemeinsam und arbeitsteilig durchführen können. Denn, selbst wenn das „Falsche“ günstig einzukaufen wäre, bleibt es in der Gesamtbetrachtung doch das „Falsche“. Um fehlerhafte Beschaffungen zu korrigieren, muss Aufwand erbracht werden und das "Richtige" muss ebenfalls beschafft werden.
Deshalb ist das „Falsche“ günstig zu kaufen immer noch zu teuer!
Die Arbeit versucht darzulegen, was als „falsch“ zu bezeichnen wäre, woraus sich die „Erkenntnis“ des „Falschen“ ableiten lässt und welche Gegen- bzw. Verhinderungsstrategien denkbar und umsetzbar sind.
1.2 SIND RECHTSVORSCHRIFTEN EIN DILEMMA?
Der Begriff „Bürokratie“ hat seit seiner Entstehung damit „zu kämpfen“ Akzeptanz zu finden. Geprägt hat ihn Vincent de Gournay, der die Regelungen des Staates als Belastung anprangern wollte und dazu den Begriff „bureaucratie“ bzw. die „Macht der Schreibtische“ erfand. Diesen Ruf konnte die Bürokratie nicht ablegen, denn viele „Nachfolger“ von Vincent de Gournay hatten ebenfalls Schwierigkeiten in der Bewertung der hierarchischen Regelwerke des Staates, so dass sich diese Sichtweise bis zur Neubewertung durch Max Weber gehalten hatte.
Der Soziologe Max Weber brachte eine neue Sichtweise ein, indem er die Bürokratie als treibenden Faktor des Staates beschrieb. Er zeigte auf, dass die Trennung von Amt und Person zur Objektivität führen wird und die Dokumentation von staatlichem Handeln sowie verbindliche Regeln die „Ausführenden“ des Staates überprüfbar macht. Weber sah aber bereits voraus, dass sich gerade die Regeln als Schwachpunkt herausstellen könnten. Immerhin entzieht sich der Erfolg verbindlicher Regeln naturgemäß der Voraussicht ihrer Schöpfer, denn nicht alle Lebenssachverhalte sind vorhersehbar. Der beabsichtigte Zweck einer Vorschrift kann sich bei ungünstigen Bedingungen sogar ins Gegenteil umkehren3.
Abbildung 1: Die Problematik unbestimmter Rechtsbegriffe (Laux, 2011)
Um diese Problematik zu berücksichtigen, werden in Rechtsnormen sogenannte „unbestimmte Rechtsbegriffe“ eingefügt. Sie sollen Flexibilität für künftige Entwicklungen geben, bis die Rechtsvorschrift angepasst werden konnte. Die rechtssichere Auslegung dieser Rechtsbegriffe erfolgt durch die Rechtsprechung (siehe Abbildung 1).
Dies führt allerdings wieder zur nächsten Problematik. Denn bis es zur Rechtsprechung gekommen ist, müssen die Rechtsanwender die Rechtsbegriffe selbst auslegen. Ist die Rechtsprechung dann verfügbar, lässt sich die Auslegung von allen Beteiligten danach ausrichten.
Die mangelnde Flexibilität der Rechtsvorschriften geht vor allem zu Lasten der Verwaltungsmitarbeiter. Sie befinden sich in einem Dilemma, denn sie haben dem bestehenden Recht Geltung zu verschaffen und nicht zu interpretieren, ob eine Vorschrift möglicherweise zu einem unwirtschaftlichen Ergebnis führen kann. Insofern orientiert sich das in der Verwaltung praktizierte Wissensmanagement eher an juristischen als an betriebswirtschaftlichen Aspekten.
Die öffentliche Verwaltung prüft den anstehenden Sachverhalt und sucht nach der vorgeschriebenen Vorgehensweise in der anzuwendenden Rechtsnorm. Und gerade hier hat die Bürokratie ihre Vorteile, denn in einer bürokratisch handelnden Verwaltung kommen Aspekte „nur dann“ zur Beachtung, wenn es dafür eine anzuwendende Rechtsnorm gibt. Flexibilität bedeutet aber letztlich das Abweichen von den vorgegebenen Normen, was mit einer Reduzierung von Nachvollziehbarkeit und Berechenbarkeit einhergeht. Wer aber eine „überzogene“ Flexibilität in einer Bürokratie fordert, der akzeptiert gleichzeitig, dass Sachverhalte nicht mehr gleichartig sachorientiert betrachtet werden und lässt somit eine Ungleichbehandlung zu. Aber gerade die Gleichbehandlung ist ein wesentliches Grundprinzip, dessen Durchsetzung vom Staat erwartet werden kann und muss. Darauf ist die Rechtsanwendung ausgerichtet.
Weiterhin erfordert es Zeit Bürokratie zu betreiben. Wer ein rechtlich umfassend beleuchtetes Ergebnis erzielen möchte, muss alle in Frage kommenden Rechtsnormen prüfen und analoges Verhalten in vergangenen Fällen analysieren. Je mehr Rechtsnormen zur Verfügung stehen, desto mehr Zeit ist einzuplanen. Eine Reduzierung des Prüfaufwands führt zur Beschleunigung, aber auch zum Qualitätsverlust.
Insoweit sollten die Berücksichtigung von Rechtsnormen und der dafür erforderliche Zeitaufwand nur bei deren Unkenntnis oder mangelnder Beherrschung als Dilemma zu sehen sein.
Das Vergaberecht stellt einen zentralen Bestandteil der öffentlichen Beschaffung dar. Es zu beherrschen ist zweifelsohne ambitioniert, aber es ist unumgänglich, sich mit der Thematik zu befassen. Empfehlenswert ist es vor allem, im Recht eine Hilfe für die Qualität der eigenen Arbeit zu sehen. Es dagegen als Hinderung zur erfolgreichen Umsetzung der öffentlichen Beschaffung wahrzunehmen, sollte weder von Bedarfsstellen noch von den anderen Beteiligten am Beschaffungsprozess als ernsthafte „Option“ betrachtet werden.
Die hier vorgestellte Arbeit soll helfen, einen positiven Eindruck zum Vergaberecht und dessen Sinnhaftigkeit zu gewinnen, sich aber auch mit den Grenzen des Vergaberechts auseinanderzusetzen und Ansatzpunkte zu finden, um sich mit den „richtigen“ Fragen bei Profis „Gehör zu verschaffen“ und Hilfestellungen einzuholen.
1.3 NUTZEN DES BUCHES FÜR PRAKTIKER UND FÜR STUDENTEN
Diese Arbeit richtet sich vor allem an Leser, die nicht Teil einer Vergabestelle sind, auch wenn Vergabestellenmitarbeiter sicherlich ebenfalls interessante Informationen in einzelnen Kapiteln finden können. Deren Hauptarbeitsgebiet – das Vergaberecht – wird in dieser Arbeit bewusst kurzgehalten, um gerade den „Nicht-Vergabespezialisten“ einen Überblick über die Gesamtthematik zu schaffen. Wer sich nicht ständig im Vergaberecht bewegt, soll nicht „verschreckt“ werden, sondern auf Basis des eigenen vorhandenen Wissenshorizonts einen Einblick in die Komplexität des Beschaffens unter Berücksichtigung der Systematik des Vergaberechts erhalten. Dieser Ansatz kann für Vergabestellenbedienstete als Überblick sinnvoll sein, wird aber für die operative Betrachtung konkreter Vergabeverfahren nicht ausreichen.
Der Autor wendet sich sowohl an Praktiker als auch an Strategen. Für sie könnten die hier dargestellten Erfahrungswerte des Autors von Interesse sein. Der Autor nimmt für sich nicht in Anspruch, über ein umfassendes Wissen zu verfügen. Zwar hat er jahrelang einer zentralen Beschaffungsstelle vorgestanden, sich aber „nur“ im VOL-Bereich und dort vornehmlich in einem Arbeitsbereich für Spezialdienststellen bewegt.
In der Arbeit sind zusätzlich die Ergebnisse des zahlreichen Austauschs mit anderen Beschaffungsstellen und vor allem Bedarfsstellen enthalten. Dieses Wissen möge als Anhalt dienen, sofern die Praktiker und Strategen über das jeweilige Wissen noch nicht verfügten. Ist dies doch der Fall, könnte es als Vergleich mit den eigenen Erfahrungen von Nutzen sein.
Ebenso richtet sich der Autor an Studentinnen und Studenten des Verwaltungsmanagements oder solchen, die sich mit dem öffentlichen Beschaffungswesen befassen. Seine Erfahrungen aus der Lehre haben gezeigt, dass ein Bedarf für Beschaffungsthemen gesehen und von Hochschulen eine stärkere Befassung mit der Thematik erwartet wird. Insoweit möge diese Arbeit als Nachschlagewerk für ihre Hauptthematiken bzw. ihre Studien dienen. Sollten sie Anknüpfungspunkte zur Erweiterung der hier angesprochenen Themen finden, wäre dies gerne gesehen. Im Bedarfsfall steht der Autor auch gerne für Fragen oder Anregungen zur Verfügung.
1.4 AUFBAU DES BUCHES
Um einen ersten Einblick in die Abläufe und die Problematiken der Beschaffung zu erhalten, wird in Kapitel 2 die Theorie der Beschaffung behandelt. Sie zu kennen hilft, das Verhalten der Beschaffungsorganisation ebenso zu verstehen, wie die eigene Stellung als Bedarfsstelle oder Entscheidungsträger, um daraus Handlungsoptionen abzuleiten.
In Kapitel 3 wird die Thematik Nachhaltigkeit behandelt. Hier geht es um die praktische Möglichkeit zur Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte.
Kapitel 4 geht auf Problemstellungen ein, die vermutlich bei jeder Bedarfsstelle und jeder Beschaffungsorganisation auftreten. Es werden Lösungen erörtert, die bereits erfolgreich eingesetzt wurden. Dabei wird der Idee gefolgt, dass oftmals bereits die bloße Kenntnis möglicher Problemstellungen helfen kann, sich der Thematik mit „Gelassenheit und Wissen“ zu stellen.
Kapitel 5 enthält Übungsbeispiele, die aus den vorherigen Kapiteln abgeleitet wurden (sie folgen teilweise den Erfahrungen des Autors). Die Übungsbeispiele dienen der Sensibilisierung für die Thematik Beschaffung sowie den damit verbundenen Einflüssen bzw. Problemstellungen.
Im Schlusskapitel erfolgt eine Zusammenfassung mit einem Ausblick zur vermuteten weiteren Entwicklung im Bereich Beschaffung.
1 Aus Gründen der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit sowie in Orientierung an den grundsätzlichen Richtlinien der deutschen Rechtschreibung werden in dieser Arbeit nicht an allen Stellen explizit geschlechtsneutrale Begriffe verwendet. Soweit Begriffe, wie z. B. „der Kunde“ verwendet werden, wird darunter immer der Einbezug beider Geschlechter verstanden.
2 Mit dieser provokativen Bemerkung sind die Maßgaben der LHO gemeint. Immerhin stellt sich die Frage, ob öffentliche Verwaltungen für die Berücksichtigung von Sparsamkeitsaspekten einer Vorschrift bedürfen oder ob sie auch aus eigenem Antrieb heraus diesem Ansatz folgen würden.
3 Vgl. Weber, 1922, http://www.textlog.de/7292.html.
2 THEORIE DER BESCHAFFUNG
Für das grundlegende Verständnis der Beschaffungspraxis ist es notwendig, sowohl theoretische Grundlagen des Beschaffungsmanagements als auch psychologische Faktoren zu betrachten, die in der Beschaffungspraxis auf die Beschaffungsbeteiligten wirken. Gerade die teilweise komplexen Abläufe der Beschaffung sowie die dabei auftretenden Wirkungsmechanismen können sich in der Beschaffungspraxis schnell als „überbordende“ Bürokratie oder als wenig nachvollziehbar darstellen, wenn sie ohne Hintergrundwissen beobachtet werden. Mit der Kenntnis um die Theorie der Beschaffung erschließen sich die Abläufe der Beschaffung eher. Sie können helfen bei Problemstellungen Vermeidungs- bzw. Änderungsstrategien aufzusetzen.
Dazu werden in diesem Kapitel
Definitionen
vorgestellt, mit denen ein Basisverständnis für die wesentlichen, im Beschaffungsmanagement genutzten Fachbegriffe vermittelt werden soll. Vorinformationen mit Bezug zu den Kapiteltexten sollen an die Komplexität der Thematik Beschaffung in den weiteren Kapiteln heranführen.
Argumente erörtert, mit denen im Sinne der Frage „
Was passiert, wenn nichts passiert?
“ der Blick zunächst auf Alternativen zur Beschaffung gelenkt wird (soweit eine Beschaffung für öffentliche Auftraggeber entbehrlich ist, schont dies Steuergelder, so dass gerade diese Betrachtung attraktiv sein sollte). Ebenso wird erörtert, welche psychologischen Faktoren insbesondere in der Beschaffungsvorbereitung wirken können, die dazu führen, dass Beschaffungen veranlasst werden, die nicht notwendig wären. Diesbezüglich werden Gegenstrategien sowie eine betriebswirtschaftliche Methode als erster Anhalt vorgestellt.
Beschaffungsverfahren mit Vergabeverfahren
vorgestellt, wie sie erfahrungsgemäß üblicherweise verlaufen. Auf Besonderheiten und Sonderfälle kann dabei allerdings im Sinne einer übersichtlichen Darstellung (u.a. auch als Vorbereitung zu
Kapitel 3, Nachhaltigkeit
) nur in sehr beschränktem Maße eingegangen werden.
typische Beschaffungsverfahren ohne Vergabeverfahren
vorgestellt. Hierbei wird insbesondere auf Abrufe aus Rahmenverträgen eingegangen.
2.1 DEFINITIONEN BZW. VORINFORMATIONEN
Einen ersten Einblick in die Grundlagen der Beschaffungsthematik sollen die nachfolgenden Definitionen und Vorinformationen liefern. Aufgrund der Komplexität der Beschaffungsthematik ist es schwerlich möglich, Definitionen und Sachinhalte in den weiteren Kapiteln klar voneinander zu trennen. Dazu wäre es notwendig, knappe Definitionen anzuführen und alle weiteren Erläuterungen im Kapiteltext vorzunehmen. Dies reicht aber nicht aus, um die Komplexität der Beschaffung verständlich darzustellen. Deshalb erfolgt hier eine Vermischung von Definitionen und Textteilen, wobei Definitionstexte mit Querverweisen zu den Kapiteln versehen sind.
2.1.1 Vergaberecht
Das Vergaberecht bezeichnet die Gesamtheit der Regeln und Vorschriften, die den Staat, seine Behörden und Institutionen zu einer rechtlich vorgegebenen Verfahrensweise verpflichten, bei der es um die Beschaffung von Waren, Bau- und Dienstleistungen geht. Es dient u.a. als Mittel der Marktübersicht, der Verhinderung der unkontrollierten Verwendung von staatlichen Mitteln, zur Ordnung der wirtschaftslenkenden Wirkung der Vergabe, der Verhinderung vergabefremder Einflussnahme Dritter sowie zur Korruptionsbekämpfung und Verhinderung von Korruption (Byok, 2014).
In Bezug auf die Kommunikation öffentlicher Auftraggeber mit dem Markt lassen sich weitere Ziele des Vergaberechts formulieren:
Wirksamkeit des Marketings der Bieter verhindern.
Verkaufsargumente entlarven.
Messbare Leistungen in den Vordergrund rücken.
Vergleichbarkeit von Leistung und Preis herstellen.
Die benötigte Qualität einkaufen, nicht die angebotene.
Den erzielbaren Preis zahlen, nicht den geforderten.
Die notwendige Menge einkaufen, nicht die mögliche.
Mit folgenden Maßnahmen der öffentlichen Auftraggeber lassen sich diese Ziele erreichen:
Leistungsbeschreibungen erstellen, die das „was?“ vorgeben und das „wie?“ dem Markt überlassen.
Ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung und Preis vorgeben und einfordern.
Anstrengungen belohnen, indem sich die öffentlichen Auftraggeber an das Vergaberecht halten und keines der Unternehmen bevorzugen.
Dieses Leitmotiv findet sich an vielen Stellen dieser Arbeit mit jeweils anderen Blickwinkeln.
2.1.2 Beschaffung und Strategie
Nach Janz kann der Begriff Beschaffung als „eine aktive, auf das Zielsystem der Unternehmung als Ganzes gerichtete Führungsaufgabe verstanden werden, wodurch neben einer umfassenden Beschaffungsführungskonzeption, Komponenten wie eine langfristig orientierte Versorgungssicherung, Gesamtkostenminimierung, Marktausrichtung und Interdependenzen zu anderen internen und externen Bereichen in den Vordergrund rücken“ (Janz, 2004, S. 9).
Damit soll zum Ausdruck kommen, dass unter dem Begriff Beschaffung keine singuläre Aktivität untergeordneter Bereiche eines Unternehmens bzw. einer Behörde verstanden wird. Vielmehr handelt es sich bei der Thematik Beschaffung um einen komplexen Zusammenschluss aus Einzelaktivitäten (Bedarfsanalyse, Marktbeobachtung, Vergabe und Abwicklung; siehe Kapitel 2.4, S. →), der einer Steuerung bedarf, so dass am Ende der Prozesskette „Beschaffung“ die notwendigen Produkte oder Unterstützungsmaßnahmen bereitstehen, damit das Unternehmen seiner bzw. die Behörde ihrer originären Aufgabe nachkommen kann.
Mit Beschaffungsstrategie sind die Festlegungen der Leitungsebene gemeint, mit welchen Mitteln Beschaffungen durchzuführen und wie die Organisationsziele erreicht werden sollen. Dazu gehören
die Analyse geeigneter Beschaffungsmärkte,
die Auswahl geeigneter Lieferanten,
die Vereinbarung geeigneter Konditionen mit diesen Lieferanten,
die Auswahl geeigneter Beschaffungsformen.
Zur Selbstverständlichkeit sollte gehören, die Einhaltung des Vergaberechts als festgelegte Rahmenbedingung der Beschaffungsstrategie vorzugeben.
2.1.3 Einkauf
Im Gegensatz zum Begriff Beschaffung wird nach Janz unter dem Begriff Einkauf “die juristische und abwicklungstechnische Durchführung des Versorgungs– vorgangs mit Aufgaben wie Bestellerteilung und Terminüberwachung verstanden“ (Janz, 2004, S. 10).
Damit ist gemeint, dass es sich beim Begriff „Einkauf“ im Gegensatz zum umfassenderen Begriff „Beschaffung“ um eine Einzelaktivität im Zusammenhang mit dem Arbeitsschritt Abwicklung (siehe Kapitel 2.4.4, S. →) handelt. Dieser Arbeitsschritt beginnt, wenn die Arbeitsschritte Bedarfsanalyse, Marktbeobachtung und Vergabe abgeschlossen sind und gemäß der Vergabeentscheidung beim Vertragspartner eine Bestellung (siehe Kapitel 2.4.4.3, Bestellung, S. →) oder ein Abruf (siehe Kapitel 2.5.2, Abruf aus Rahmenverträgen, S. →) erfolgen kann.
2.1.4 Produkt, Ware, Gut, Lieferungen und Leistungen
Gabler definiert Produkt als „Ergebnis der Produktion und Sachziel einer Unternehmung oder auch Mittel der Bedürfnisbefriedigung. Die Einteilung in Sachgüter (materiell, Gebrauchsgüter und Verbrauchsgüter), Dienstleistungen (immateriell) und Energieleistungen“ (Gabler, 2013, Stichwort: „Produkt“) und Ware als „bewegliche Sache, die Gegenstand des Handelsverkehrs ist oder die nach der Anschauung des Verkehrs als Gegenstand des Warenumsatzes in Betracht kommen könnte (weite Auslegung; auch z.B. Elektrizität, nicht aber Grundstücke)“ (Gabler, 2013, Stichwort: „Ware“).
Gut definiert Gabler als „materielles oder immaterielles Mittel zur Befriedigung von menschlichen Bedürfnissen; insofern vermag es Nutzen zu stiften“ (Gabler, 2013, Stichwort: „Gut“).
Nach § 3 Abs. 1 UStG sind Lieferungen eines Unternehmers „Leistungen, durch die er oder in seinem Auftrag ein Dritter den Abnehmer oder in dessen Auftrag einen Dritten befähigt, im eigenen Namen über einen Gegenstand zu verfügen (Verschaffung der Verfügungsmacht)“.
Als sonstige Leistungen definiert § 3 Abs. 9 UStG „Leistungen, die keine Lieferungen sind. Sie können auch in einem Unterlassen oder im Dulden einer Handlung oder eines Zustands bestehen“.
Für eine Bedarfsstelle ist die Begriffsverwendung eher verwirrend und nur insoweit relevant, dass die Begriffe in der Literatur unterschiedlich verwendet werden.
Für diese Arbeit soll gelten, dass alle Begriffe gleichrangig zu sehen sind und sich inhaltlich nicht unterscheiden.
Es handelt sich jeweils um die Objekte zur Bedarfsbefriedigung, und zwar in Form von
dinglichen (also „berührbaren“) Sachverhalten (z.B. Maschinen),
geistigen Sachverhalten (z.B. Beratungen),
oder Rechten bzw. anderen abstrakten Werten.
In dieser Arbeit wird dennoch versucht, den Begriff „Produkt“ federführend als Synonym für alle anderen Begriffe zu verwenden. Soweit dies nicht möglich ist, wird versucht, die Begriffe so zu verwenden, wie sie im Kontext der Quellen genutzt werden. Da diese unterschiedlich sind, werden auch die Begriffe unterschiedlich genutzt. Der Leser möge dies nachsehen und alle Begriffe grundsätzlich als Synonym für den Begriff „Produkt“ sehen.
2.1.5 Öffentliche Auftraggeber
Die Definition für öffentliche Auftraggeber ergibt sich aus § 98 GWB. Danach handelt es sich bei öffentlichen Auftraggebern im Wesentlichen um Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen bzw. andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, z.B.
der
Bund
: Für den Bund werden eine Vielzahl Organisationen als öffentliche Auftraggeber tätig, u.a. das Beschaffungsamt des Bundes
4
sowie das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
5
.
die
Länder
: Bei den Ländern werden unterschiedliche Organisationen tätig (je nach Aufbau innerhalb der Länder). Im Land Hessen wurden beispielsweise für den Bereich der VOL-Beschaffungen drei zentrale Beschaffungsstellen eingerichtet: Das Hessische Competence Center (HCC)
6
, die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)
7
und das Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung (PTLV)
8
.
die
Kommunen
: Bei den Kommunen stellt sich die Frage der Größe der Kommune. Bei einer großen Stadt steht meist ein Sachgebiet zur Verfügung, das die Rolle einer zentralen Beschaffungsstelle übernimmt. Kleinere Kommunen können eine zentrale Beschaffungsstelle personell nicht abbilden. Oftmals wird dort die Beschaffung vom Bereich Finanzmanagement durchgeführt.
Gleich ist bei allen Ansätzen, dass eine spezifische Organisation der jeweiligen Körperschaft für Beschaffungen zuständig ist und nach außen als öffentlicher Auftraggeber am Markt auftritt.
Bedarfsstellen wird erfahrungsgemäß eher nur in begrenzten Ausnahmefällen zugestanden, Beschaffungen selbstständig durchführen zu dürfen.
2.1.6 Fristen
Der Begriff Fristen ist im Vergaberecht belegt. Im Zuge des Vergabeverfahrens sind verschiedene Fristen einzuhalten. Dabei handelt es sich um
Der Leser möge sich dessen bewusst sein und den Begriff Fristen im Bereich Beschaffung weitgehend für die vorgenannten Sachverhalte verwenden.
2.1.7 Bedarfe und Bedarfsstellen
Nach Gabler lässt sich der Begriff Bedarf in unterschiedlicher Weise interpretieren bzw. definieren:
„Ergebnis objektivierbarer Bedürfnisse, die messbar und in Zahlen ausdrückbar sind.
Ökonomischer Begriff für eine am Markt tatsächlich auftretende Nachfrage.
Objektorientierte Handlungsabsicht, die einem bestimmten Bedürfnis folgt“ (Gabler, 2013, Stichwort: „Bedarf“).
Geyer definiert den Begriff Bedarf als „die Absicht, die Verfügung über ein Gut zu erlangen“ (Geyer, 1970, S. 17). Dabei unterscheidet er u.a. nach der „Periodizität des Auftretens des Bedarfszeitpunkts“ (Geyer, 1970, S. 25):
Bedarfsstellen der öffentlichen Verwaltung sind im Regelfall die mittelbewirtschaftenden Dienststellen, die für sich und die ihnen nachgeordneten Bereiche bzw. Verwendungsstellen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Produkte benötigen. Sie sind zuständig für die Schritte Bedarf (siehe Kapitel 2.4.1, S. →) und Nutzung (siehe Kapitel 2.6, S. →).
Soweit eine Zentralisierung einzelner Bedarfe in einer Fachabteilung stattgefunden hat, z.B. die zentrale Beschaffung von Uniformen oder Fahrzeugen, übt die Fachabteilung sowohl die Aufgaben einer Bedarfsstelle als auch einer Fachabteilung aus. In der Praxis ist dieser Ansatz sowohl für die eigentlichen Stellen, deren Bedarf zu befriedigen ist, als auch für Fachabteilungen sprachlich nicht eindeutig nachvollziehbar, wenn auch in diesen Fällen von „Bedarfsstellen“ gesprochen wird. Zur Abgrenzung dieses Sachverhalts soll in dieser Arbeit der Begriff Bedarfsträger für die Stelle gelten, die den Bedarf hat.
2.1.8 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit stellen elementare Grundsätze der öffentlichen Verwaltung zur Mittelbewirtschaftung dar. Die Grundsätze zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ergeben sich sowohl aus § 6 als auch § 7 der Landeshaushaltsordnungen (LHO9) und der Bundeshaushaltsordnung (BHO):
§ 6
: „Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind nur die Ausgaben und die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren (Verpflichtungsermächtigungen) zu berücksichtigen, die zur Erfüllung der Aufgaben des Landes notwendig sind“. Bei dieser Vorschrift handelt es sich um die Forderung, nur die als notwendig klassifizierten Beschaffungsmaßnahmen vorzunehmen.
§ 7 Abs. 1
: „Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten“. Beim Begriff Wirtschaftlichkeit handelt es sich nach Gabler um die „für eine bestimmte Handlung ermittelte Beziehung zwischen dem Handlungsergebnis und dem dafür erforderlichen Mitteleinsatz“ (Gabler, 2013, Stichwort: „Wirtschaftlichkeit“). Mit Sparsamkeit ist der Ansatz zum möglichst geringen Mitteleinsatz gemeint. Die Reihenfolge der Begriffsaufzählung in § 7 Abs. 1 legt nahe, dass es in erster Linie um die Beziehung zwischen Aufwand und Ergebnis geht und erst in zweiter Linie um die Höhe des Aufwands.
§ 7 Abs. 2
: „Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen“. Die Vorschrift fordert, dass vor der Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen, diese zu planen und die Beschaffung an den Ergebnissen der Planung auszurichten ist.
Für die weiteren Kapitel möge sich der Leser bewusst sein, dass eine Prüfung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit keine singuläre Tätigkeit darstellt, sondern diesbezügliche Aspekte zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den Arbeitsschritten betrachtet werden. Insoweit lässt sich bei Beschaffungen vorab nicht „festlegen“, dass eine geplante Beschaffung wirtschaftlich und sparsam umsetzbar ist. Vielmehr sind weitere Betrachtungen im Verlauf der Beschaffungsmaßnahme erforderlich, sobald validere Daten vorliegen.
2.1.9 Verkürzte bzw. beschränkte Märkte
Mit den Begriffen „beschränkter Markt“ bzw. „verkürzter Markt“ ist gemeint, dass sich der vorhandene Markt in seiner Gesamtgröße für die öffentlichen Auftraggeber nicht auffächert oder der Markt selbst recht klein ist. Erkennbar wird dies am Prinzip der Sichtbarkeitsgrenze. Demnach sind für öffentliche Auftraggeber nicht immer alle Produkte oder „Verkäufer“ sichtbar. Diese Möglichkeit besteht, wenn
sich nur wenige Bieter an Ausschreibungen der öffentlichen Auftraggeber beteiligen bzw. überhaupt für die veröffentlichte Ausschreibung interessieren. Ursachen können sowohl auf der Marktseite vorliegen (z.B. kein Interesse an zu geringen Abnahmemengen der öffentlichen Auftraggeber), als auch auf der Seite der ausschreibenden Stelle (wenn z.B. ein Informationsmedium für die Bekanntmachung gewählt wird, das der Markt nur selten nutzt).
Spezialprodukte herzustellen sind, die nur von wenigen Spezialfirmen angeboten werden. Hierzu bedarf es oftmals spezifischen Know-hows, das nur von wenigen Anbietern aufgebracht werden kann.
wenige Nachfrager vorhanden sind, um die sich wenige Firmen bemühen. Bei öffentlichen Auftraggebern kommt dies zuweilen vor, wenn sie keine Standardprodukte des Marktes abfragen, sondern sich spezifische „Einzellösungen“ erstellen lassen.