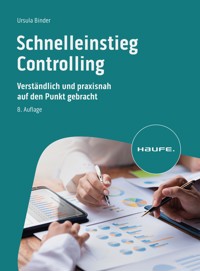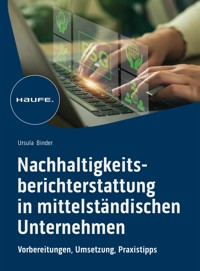
59,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
Die gesetzlich geforderte Nachhaltigkeitsberichterstattung stellt mittelständische Unternehmen in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen. Sie muss umfassend vorbereitet sowie Geschäftsmodell, Prozesse, Produkte und Dienstleistungen auf den Prüfstand gestellt werden. Ursula Binder beschreibt die Mindestanforderungen für Unternehmen. Dabei geht sie darauf ein, was unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten überhaupt zu berichten ist und wie umfangreich der Bericht sein muss. Ihr Buch unterstützt dabei, das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen zu analysieren und somit Schwachstellen wie Potenziale frühzeitig zu erkennen, zu beheben bzw. auszubauen. Es bietet einen Überblick über die zahlreichen Rahmenbedingungen und Guidances und führt Schritt für Schritt zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Unternehmen erfahren auch, wie sich finanzielle Ziele und Nachhaltigkeit in Einklang bringen lassen. Inhalte: - Was Nachhaltigkeit bedeutet und wann sie für Unternehmen relevant ist - Warum nachhaltiges Handeln sinnvoll und notwendig ist - Beispiele für Rankings von Nachhaltigkeitsberichten - Beispiele für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen - Wer berichten muss: rechtliche Grundlagen von CSRD und EU-Taxonomie - Was berichtet werden muss: Wesentlichkeitsanalyse und doppelte Wesentlichkeit - Wie vom GRI- oder DNK-Standard zu den ESRS-Standards übergeleitet werden muss - Was das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz hiermit zu tun hat - Dauerhafte Etablierung eines Nachhaltigkeitsmanagements mit Hilfe der Sustainability Balanced Digitale Zusatzmaterialien auf myBook+: - ESRS-Gliederung mit Seitenzahlen - Indikatoren des GRI-Standards - Vorlage für die Wesentlichkeitsanalyse - Outside-in-Listen für ESRS Jetzt nutzen auf mybookplus.de.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtmyBook+ImpressumVorwort1 Nachhaltigkeitsberichterstattung – worum geht es?1.1 Wie Sie dieses Buch am besten benutzen1.2 Im Dschungel der Regelungen – ein Überblick1.2.1 Die »Doppelspitze« der Berichterstattung – CSRD und EU-Taxonomie1.2.2 Regelungen zur Berichterstattung nach CSRD im Überblick1.2.3 Regelungen zur Berichterstattung nach EU-Taxonomie im Überblick2 Was bedeutet Nachhaltigkeit?2.1 Wie hat das mit der Nachhaltigkeit angefangen? 2.2 Über die Motivation zu nachhaltigem Handeln2.3 Stehen finanzielle und Nachhaltigkeitsziele im Widerspruch zueinander?2.4 Braucht mein Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie?2.5 Kleines Lexikon der Nachhaltigkeitsberichterstattung2.5.1 Die 17 Sustainable Development Goals (SDG)2.5.2 Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK)2.5.3 Global Reporting Initiative (GRI) – GRI-Standard2.5.4 Triple Bottom Line, CSR und ESG2.5.5 Non Financial Reporting Directive (NFRD) und CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz2.5.6 Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)2.5.7 European Sustainability Reporting Standards (ESRS) und EFRAG2.5.8 EU-Taxonomie 2.5.9 CO2, CO2e, THG, GHG, Scope 1, 2, 3 …3 Leitfaden für die eigene Nachhaltigkeitsberichterstattung3.1 Wer muss ab wann berichten?3.1.1 Berichtspflicht nach CSRD 3.1.2 Berichtspflicht nach EU-Taxonomie3.1.3 Nach welchem Berichtsrahmen kann freiwillig berichtet werden?3.1.3.1 Die 17 SDGs als Berichtsrahmen3.1.3.2 Die 10 Prinzipien des UN Global Compact als Berichtsrahmen3.1.3.3 Der Standard der Global Reporting Initiative (GRI) als Berichtsrahmen3.1.3.4 Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) als Berichtsrahmen3.2 Was muss berichtet werden?3.2.1 Was muss nach CSRD berichtet werden? 3.2.1.1 Wesentlichkeitsanalyse und doppelte WesentlichkeitSchritt 1: Erstellen einer Longlist von NachhaltigkeitsthemenSchritt 2: Stakeholder – Identifikation, Befragung, Auswertung Schritt 3: Unternehmenssicht – inside-out und outside-inSchritt 4: Erstellung einer Wesentlichkeitsmatrix Schritt 5: Bildung von SchwellenwertenSchritt 6: Priorisierung und Zuordnung zu den ESRS3.2.1.2 Die European Sustainability Reporting Standards (ESRS)ESRS 1 – Allgemeine AnforderungenESRS 2 – Allgemeine AngabenExkurs: Sechs wichtige Begriffe der ESRS ESRS E1 KlimawandelESRS E2 UmweltverschmutzungESRS E3 Wasser- und MeeresressourcenESRS E4 Biologische Vielfalt und ÖkosystemeESRS E5 Ressourcennutzung und KreislaufwirtschaftESRS S1 Eigene BelegschaftESRS S2 Arbeitskräfte in der WertschöpfungsketteESRS S3 Betroffene GemeinschaftenESRS S4 Verbraucher und EndnutzerESRS G1 Unternehmenspolitik3.2.1.3 Wie leite ich über vom GRI- oder DNK-Standard zu den ESRS?3.2.1.4 Querverbindungen zu den IFRS3.2.2 Was muss nach EU-Taxonomie berichtet werden?3.2.2.1 Schritt 1: Identifikation der Wirtschaftsaktivitäten – Prüfung auf Taxonomiefähigkeit 3.2.2.2 Schritt 2: Prüfung auf wesentlichen Beitrag3.2.2.3 Schritt 3: Prüfung auf Beeinträchtigung anderer Ziele (DNSH)3.2.2.4 Schritt 4: Prüfung der Einhaltung von Mindeststandards3.2.2.5 Schritt 5: KPIs berechnen3.3 Wie muss berichtet werden – der integrierte Lagebericht3.4 Wer prüft meinen Bericht und wie wird er testiert?3.5 Die digitale Umsetzung3.6 Marketing oder »Wie sieht ein schöner Nachhaltigkeitsbericht aus?«3.6.1 Äußere Darstellung 3.6.2 Inhalte des Berichts – Ist das schon Greenwashing?3.7 Und was ist mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz?4 Wie kann man Nachhaltigkeit sonst noch messen? 4.1 Bewertung von Nachhaltigkeitsberichten4.1.1 IÖW-Ranking für Nachhaltigkeitsberichte4.1.2 CDP-Rating für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsthemen in Unternehmen4.2 Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen4.3 Anforderungen an KPIs 5 Die Sustainability Balanced Scorecard5.1 Was ist eine Balanced Scorecard?5.2 Integration von Nachhaltigkeitsthemen in die Balanced Scorecard5.2.1 Die gesonderte Nachhaltigkeits-BSC5.2.2 Die Nachhaltigkeitsperspektive innerhalb einer bestehenden BSC5.2.3 Die integrative Sustainability Balanced Scorecard5.2.4 SBSC mit Triple Bottom Line6 SchlussbemerkungenIhre Online-Inhalte zum Buch: Exklusiv für Buchkäuferinnen und Buchkäufer!StichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
myBook+
Ihr Portal für alle Online-Materialien zum Buch!
Arbeitshilfen, die über ein normales Buch hinaus eine digitale Dimension eröffnen. Je nach Thema Vorlagen, Informationsgrafiken, Tutorials, Videos oder speziell entwickelte Rechner – all das bietet Ihnen die Plattform myBook+.
Und so einfach geht’s:
Gehen Sie auf https://mybookplus.de, registrieren Sie sich und geben Sie Ihren Buchcode ein, um auf die Online-Materialien Ihres Buches zu gelangen
Ihren individuellen Buchcode finden Sie am Buchende
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit myBook+ !
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-648-17541-5
Bestell-Nr. 12038-0001
ePub:
ISBN 978-3-648-17542-2
Bestell-Nr. 12038-0100
ePDF:
ISBN 978-3-648-17543-9
Bestell-Nr. 12038-0150
Ursula Binder
Nachhaltigkeitsberichterstattung in mittelständischen Unternehmen
1. Auflage 2024, Juni 2024
© 2024 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
www.haufe.de
info@haufe.de
Bildnachweis (Cover): © pcess, iStock
Produktmanagement: Dipl.-Kfm. Kathrin Menzel-Salpietro
Lektorat: Helmut Haunreiter
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Vorwort
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie sich auf das Abenteuer der Nachhaltigkeitsberichterstattung einlassen wollen. Ich schreibe dieses Buch, während gerade rund 15.000 deutsche Unternehmen in die Nachhaltigkeitsberichtspflicht hineinrutschen. Im Laufe des letzten Jahres (2023) sind fast täglich neue Verordnungen, Ergänzungen zu Verordnungen und Anhänge mit teilweise mehreren hundert Seiten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung herausgekommen. Als ich selber anfing, mich intensiv mit den neuen Verordnungen, speziell zur CSRD1 und EU-Taxonomie, zu beschäftigen, hätte ich mir ein solches Buch als Unterstützung gewünscht. Da es das zu dem Zeitpunkt nicht gab, habe ich es eben selbst geschrieben.
Ich hoffe, dass Ihnen das Buch mit seinen vielen Arbeitshilfen und Beispielen nicht nur eine gute Unterstützung bei der konkreten Anwendung und Umsetzung der verschiedenen Verordnungen leistet, sondern dass es Ihnen auch die positiven Seiten der Nachhaltigkeitsberichterstattung und der EU-Taxonomie näherbringen kann. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und auch ein bisschen Freude beim Lesen des Buchs.
1 Corporate Sustainability Reporting Directive.
1 Nachhaltigkeitsberichterstattung – worum geht es?
Im letzten Jahr hatte ich Kontakt zu Mitarbeitenden von insgesamt ca. 70 Unternehmen, die neu in die Nachhaltigkeitsberichtspflicht eintreten werden. Viele dieser Mitarbeiter:innen empfinden die zusätzlichen Aufgaben hauptsächlich als Belastung, die in ihrem Unternehmen personell nur schwer abzufedern ist. Es sind aber auch eine ganze Reihe Menschen darunter, die den Zweck der verschärften Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung aus intrinsischer Motivation heraus unterstützen und selber dazu beitragen wollen, dass das Unternehmen, in dem sie arbeiten, nachhaltiger wird. Um diese grundsätzlich positive Einstellung zu größerer Transparenz und zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen, bietet dieses Buch vor allem dort Unterstützung, wo sich in den Gesprächen und in meinen Seminaren2 ein konkreter Bedarf herausgestellt hat. Dabei geht es ganz oft um Reduktion von Komplexität, das Schaffen von Strukturen, das Arbeiten mit Leitfäden und Checklisten und anderen Arbeitshilfen; alles das bringt Übersicht in die teilweise chaotisch anmutende Struktur der Verordnungen. Aber dazu gleich mehr.
Sie werden feststellen, dass meine persönliche Haltung zur Nachhaltigkeit und zur Nachhaltigkeitsberichterstattung in diesem Buch immer wieder durchscheint. Ich habe zwar meine praktische Berufstätigkeit im Controlling gestartet und bin diesem Themenfeld auch treu geblieben, als ich als Professorin für Management & Controlling an die TH Köln gewechselt habe. Es war mir aber immer schon ein Anliegen, die Balance zwischen finanziellen und ökologischen sowie sozialen Belangen in der Wirtschaft mit voranzutreiben und aktiv zu gestalten. Auch in meinen Lehrveranstaltungen und Forschungsprojekten spielt Nachhaltigkeit schon lange eine große Rolle. Falls Sie übrigens Interesse an einer Kooperation mit der TH Köln resp. mit mir haben sollten, können Sie teilhaben an Praxisprojekten sowie Bachelor- und Masterarbeiten, sowohl in Bezug auf das Controlling als auch in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen. Schreiben Sie mir einfach eine Mail an: ursula.binder@th-koeln.de. Ich würde mich darüber sehr freuen.
Wen habe ich mir als Leser:in für dieses Buch vorgestellt? Das Buch ist explizit für Mitarbeitende in Unternehmen geschrieben, die für die Nachhaltigkeitsberichterstattung verantwortlich (gemacht worden) sind oder dies in naher Zukunft voraussichtlich sein werden, aber auch für diejenigen, die sich als Nutzer/Leser:innen von Nachhaltigkeitsberichten dafür interessieren. In meine Seminare zu dem Thema kommen auch immer wieder Wirtschaftsprüfer:innen. Sie möchten verstehen und nachvollziehen können, aus welchem Blickwinkel die Unternehmen die Nachhaltigkeitsberichterstattung betrachten, um ihre Klienten besser unterstützen zu können und frühzeitig zu erfahren, was und wie sie Nachhaltigkeitsberichte prüfen und testieren sollen. Auch wenn dieses Buch nicht explizit für Wirtschaftsprüfer geschrieben ist, habe ich der Vollständigkeit halber ein Kapitel für ihre Belange im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung geschrieben (Kap. 3.5).
2 Nachhaltigkeits-Express und Nachhaltigkeitsberichterstattung kompakt für die Haufe Akademie, Lehrveranstaltung Nachhaltige Entwicklung an der TH Köln und Modul Nachhaltigkeitsmessung und Controlling für den digitalen Zertifikatslehrgang zum:r Sustainability Manager:in der Haufe Akademie.
1.1 Wie Sie dieses Buch am besten benutzen
Das Regelwerk zur Nachhaltigkeitsberichterstattung inkl. EU-Taxonomie ist sehr umfangreich, steht bei allen Neuerungen und Ergänzungen erst einmal nur in englischer Sprache zur Verfügung und enthält eine Unmenge an einzelnen Vorgaben und Erläuterungen, die oft nicht gut strukturiert und/oder nicht anwenderfreundlich aufbereitet sind. Deshalb habe ich, anfangs nur um selbst den Überblick zu behalten, verschiedene Übersichten und Excel-Tabellen erstellt, die mir die Orientierung in dem Wust von Verordnungen, Standards und Inhaltsangaben erleichterten. Einige davon stelle ich Ihnen hier zur Verfügung, und zwar bei den Digitalen Extras, die Ihnen zusätzlich zu den Inhalten des Buchs zur Verfügung stehen. Darunter finden Sie außerdem mehrere Textdateien, die die wichtigsten Internetlinks enthalten, auf die ich in diesem Buch Bezug nehme. Diese Textdateien sind nicht nur für diejenigen von Ihnen interessant, die das Buch analog lesen, sondern auch, wenn Sie die digitale Version nutzen, da die Internetlinks in den Textdateien gesammelt an einer Stelle aufgelistet und nicht über den gesamten Text verteilt sind.
In der folgenden Liste habe ich die insgesamt 11 Dateien, die Sie über die Digitalen Extras erhalten können, aufgeführt, und zwar in der Reihenfolge, wie sie im Text erscheinen. Der Hinweis »myBook+« am Seitenrand verweist an den entsprechenden Stellen im Buch auf die jeweilige Datei. Damit Sie diese bei den Digitalen Extras schnell finden, habe ich sowohl in der folgenden Liste als auch an der entsprechenden Stelle im Buch in kursiver Schrift immer auch den Namen genannt, unter dem Sie die Dateien bei den Digitalen Extras finden. Außerdem habe ich für drei Links QR-Codes abgedruckt, die für diejenigen von Ihnen am ehesten relevant sind, die das Buch analog vorliegen haben: Das sind die Internetseiten des taxonomy compass, der NACE-Code-Liste und des Verordnungstextes für die ESRS3 (jeweils an der entsprechenden Stelle des Buchs).
Arbeitshilfen
Liste der in den Digitalen Extras zur Verfügung gestellten Dateien
Textdatei mit einer Liste der CSRD-Verordnungen und den Links zu den entsprechenden Texten (Links zu NFRD, CSRD-ESRS)
Textdatei mit einer Liste der EU-Taxonomie-Verordnungen mit Links zu den entsprechenden Texten (Links zur EU-Taxonomie)
Excel-Datei mit einer Liste aller GRI-Standards mit Untergruppen (insgesamt 115) (Indikatoren des GRI-Standards)
Textdatei mit einer Arbeitshilfe für die »Wesentlichkeitsanalyse in sechs Schritten« (Wesentl.analyse in 6 Schritten)
Excel-Vorlage für die Wesentlichkeitsanalyse (Vorlage für Wesentl.analyse)
Excel-Datei mit Listen möglicher outside-in-Aspekte für alle ESRS (Outside-in-Listen für ESRS)
Excel- Datei mit einer Liste der ESRS inkl. Themengruppen mit Angabe der Seite, an der die Erläuterungen im deutschen Text zu den ESRS jeweils beginnen (ESRS-Gliederung mit Seitenzahlen)
Excel-Datei mit einer Gegenüberstellung der Kriterien der Berichtsstandards GRI, ESRS, EU-Taxonomie, DNK (Vergleich GRI ESRS)
Textdatei mit einer Arbeitshilfe: »5 Schritte zur Prüfung der Taxonomiekonformität« (5 Schritte der EU-Taxonomie)
Excel-Datei mit zwei Listen der Wirtschaftsaktivitäten der EU-Taxonomie (Deutsch), einmal gegliedert nach den Aktivitäten und einmal nach den Umweltzielen (Aktivitäten vs. Umweltziele)
Textdatei mit einer Liste sonstiger wichtiger Links (Wichtige sonstige Links)
Zusätzlich habe ich im Kapitel 2.5 die aus meiner Sicht wichtigsten Namen, Begriffe und Abkürzungen im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung näher erläutert. Sollten Sie also beim Lesen des Buchs auf Begriffe stoßen, die Ihnen (noch) nicht bekannt sind, dann schlagen Sie einfach dort nach. Zusätzlich gibt es am Ende des Buchs ein Register mit Stichworten.
3 European Sustainability Reporting Standards.
1.2 Im Dschungel der Regelungen – ein Überblick
Falls Sie dieses Buch nicht sowieso schon genau deshalb gekauft haben, weil Sie einen Weg aus dem »Dschungel« suchen, werden Sie spätestens nach dem Durcharbeiten der nächsten Kapitel verstehen, was es damit auf sich hat: Nicht nur, dass die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung in zwei große Regelungswerke aufgeteilt ist, sondern zusätzlich bestehen beide Regelwerke auch noch jeweils aus mehreren Unterregelwerken. In diesem Dickicht verliert man tatsächlich sehr leicht die Orientierung; und daher soll dieses Buch Ihr Kompass sein, um Ihren Weg zum fertigen Nachhaltigkeitsbericht zu finden.
1.2.1 Die »Doppelspitze« der Berichterstattung – CSRD und EU-Taxonomie
Die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung speist sich aus zwei Verordnungen: der CSRD-Verordnung und der Verordnung zur EU-Taxonomie.
Das Kernziel der CSRD ist es, Transparenz und Vergleichbarkeit zu schaffen, indem jedes betroffene Unternehmen über seine wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen entlang eines fest vorgeschriebenen Berichtsrahmens (ESRS) berichtet.
Das Kernziel der EU-Taxonomie hingegen ist es, den Grad der Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu ermitteln und diesen in Form von drei vorgeschriebenen KPIs (taxonomiekonforme Anteile von Umsatz, Betriebsausgaben und Investitionsausgaben) zu veröffentlichen.
Beide Berichtsteile müssen im Lagebericht des Unternehmens veröffentlicht werden, also auf »Augenhöhe« mit der Finanzberichterstattung. Überschneidungen zwischen den beiden Teilen und somit Doppelungen scheinen zwar insofern möglich zu sein, als die ökologischen Standards der CSRD auch in den sechs Umweltzielen der EU-Taxonomie enthalten sind.
Tatsächlich wird aber entlang der ESRS »nur« beschrieben, inwiefern das Unternehmen Auswirkungen auf die in den ESRS definierten Nachhaltigkeitsaspekte ausübt bzw. diese auf das Unternehmen zurückwirken.
Im Rahmen des EU-Taxonomie-Berichtsteils werden dagegen die Wirtschaftsaktivitäten auf ihre Nachhaltigkeit hin bewertet und in den drei vorgegebenen Meldebögen mit den drei KPIs veröffentlicht. Im Extremfall besteht also der CSRD-Berichtsteil aus umfangreichen Inhalten zu allen 11 ESRS, während der Berichtsteil zur EU-Taxonomie nur aus den drei ausgefüllten Meldebögen besteht.
Dabei wird hier und da für beide Berichtsteile auf die gleichen Datenquellen zugegriffen, aber tatsächlich sind es trotzdem »zwei verschiedene Paar Schuhe«. Ein kurzes Beispiel zur Verdeutlichung: Während laut CSRD/ESRS die THG-Emissionen des Unternehmens erfasst und veröffentlicht werden müssen, muss z. B. ein Automobilhersteller nach EU-Taxonomie errechnen, wie groß sein Umsatzanteil an der Produktion CO2-armer Verkehrstechnologien ist.
Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die eben beschriebenen Zusammenhänge:
Abb. 1:
Struktur der Nachhaltigkeitsberichterstattung – eine Übersicht
So weit so klar – zumindest auf den ersten Blick. Was das Ganze aber sehr herausfordernd macht: Beiden »Arten« der Berichterstattung liegt eine Fülle an weiteren Verordnungen, Standards, Ergänzungen & Co. zugrunde.
Es ist nicht immer leicht, die jeweils gültigen Verordnungen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu finden, zumal sie sich teilweise in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden: Entwurf, finale Version, Ergänzung, Veränderung etc. Tatsächlich gibt es zur CSRD und zur EU-Taxonomie jeweils eine grundlegende »Hauptverordnung«, die inzwischen für beide in der finalen Version vorliegt. Darüber hinaus sind für die CSRD in einer ergänzenden Verordnung die ESRS definiert. Diese Ergänzung wird in der Zukunft regelmäßig angepasst und erweitert werden, etwa durch die geplanten sektorspezifischen ESRS.
Zu der Hauptverordnung der EU-Taxonomie gibt es bereits jetzt eine Vielzahl von ergänzenden Verordnungen, in denen die taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten aufgeführt sind mit den jeweiligen Kriterien zur Prüfung auf Taxonomiekonformität. Außerdem sind dort konkrete Definitionen für die zu meldenden KPIs sowie Vorlagen für die Meldebögen enthalten. Es ist auch hier zu erwarten, dass diese ergänzenden Verordnungen regelmäßig aktualisiert und weitere Ergänzungen hinzukommen werden. Insbesondere ist eine Aufnahme von sozialen Zielen im Rahmen der EU-Taxonomie-Verordnung geplant.
Um Ihnen das Auffinden zu erleichtern, stelle ich Ihnen mit den beiden Abbildungen in den Abschnitten 1.2.2 und 1.2.3 zwei Übersichten über die vorhandenen Texte
zur Non Financial Reporting Directive (NFRD) mit dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz, der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) mit dem Referentenentwurf zum deutschen Umsetzungsgesetz inklusive der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) und zur
EU-Taxonomie
zur Verfügung.
Im Anschluss an die jeweilige Übersicht sind die entsprechenden Texte noch einmal aufgelistet mit einer ganz kurzen Erklärung, was sich dahinter verbirgt und – ganz wichtig – mit den Links zu den jeweiligen Internetseiten, auf denen Sie die Texte finden.
Ich selbst habe mir alle dort angegebenen Texte heruntergeladen. Gleichzeitig habe ich die Links im Browser als Favoriten gespeichert und mich für jeden Newsletter eingetragen, den ich finden konnte, damit ich keine weitere Änderung oder Ergänzung verpasse. Denn damit müssen Sie in Zukunft immer wieder rechnen. Im Text der CSRD auf S. 37 steht dazu Folgendes: »Die Kommission überprüft mindestens alle drei Jahre nach deren Geltungsbeginn die gemäß diesem Artikel erlassenen delegierten Rechtsakte unter Berücksichtigung der fachlichen Stellungnahme der Europäischen Beratungsgruppe für Rechnungslegung (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) und ändert diese delegierten Rechtsakte, falls dies nötig ist, um relevanten Entwicklungen, einschließlich Entwicklungen im Zusammenhang mit internationalen Standards, Rechnung zu tragen.«
Einige Verordnungen bestehen aus mehreren Dokumenten. Wenn Sie dann die betreffende Internetseite öffnen, steht dort nur: »Link zum Dokument 1, Link zum Dokument 2, Link zum Dokument 3 …«. Anhand dieser Bezeichnungen können Sie natürlich nicht erkennen, bei welchem Dokument es sich um die Verordnung selbst handelt und bei welchem um deren Anhang oder Ergänzung. Daher habe ich in den beiden folgenden Listen auch jeweils eine kurze Überschrift angefügt, die erklärt, um was es sich bei den einzelnen Dokumenten handelt. Andernfalls müssten Sie jedes Mal alle Dokumente zuerst öffnen, um zu sehen, welches davon das von Ihnen gesuchte ist. Zusätzlich habe ich hinter manchen Verordnungen die Gesamtseitenzahl des jeweiligen Dokuments angegeben. Das dient nicht zur Abschreckung, sondern als Erkennungsmerkmal: Wenn Sie ein Dokument geöffnet haben, können Sie allein an der Seitenzahl ablesen, ob wir von demselben Text sprechen. Das mag Ihnen im Moment ein bisschen überorganisiert erscheinen, aber glauben Sie mir, Sie werden froh sein über jede Strukturierungshilfe: Allein die Texte zu den Verordnungen, Anhängen und Ergänzungen der EU-Taxonomie umfassen fast 800 Seiten (bis jetzt).
1.2.2 Regelungen zur Berichterstattung nach CSRD im Überblick
myBook+
Beginnen wir mit der Übersicht über die VerordnungenVerordnungen, NFRD, CSRD/ESRS im Zusammenhang mit NFRD und CSRD/ESRS und der anschließenden Liste mit den Internetlinks. Beides steht Ihnen auch als Datei auf der myBook+ Seite zur Verfügung.
Obwohl sie bereits mit dem Geschäftsjahr 2024 durch die Regelungen der CSRD ersetzt wurden, habe ich noch die NFRD (und das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz) in die Übersicht aufgenommen, da sie die Grundlage für die CSRD darstellen. Außerdem gehe ich im weiteren Verlauf des Buchs auch noch näher auf die Gründe für die Erweiterungen und Verschärfungen beim Übergang von der NFRD zur CSRD ein (z. B. im Kapitel 2.5.5).
Abb. 2:
Von NFRD zu CSRD/ESRS in zeitlicher Abfolge
Liste mit Links zu den Verordnungen von NFRD und CSRD/ESRS
1. Text der NFRD Verordnung 2014/95/EU vom 22.10.2014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095
2. Text des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 11.04.2017 (Umsetzung der NFRD in deutsches Recht)
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*%5B@attr_id=%27bgbl117s0802.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s0802.pdf%27%5D__1698315161741
3. Text der CSRD Verordnung 2022/2464 14.12.2022 (66 Seiten)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464
4. Referentenentwurf zum deutschen Umsetzungsgesetz der CSRD vom 22.03.2024
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2024_CSRD_UmsG.html?nn=110490
5. Verordnung mit den Angabepflichten zu den ESRS (EU) 2023/2772 vom 31.07.2023
Deutscher Text (284 Seiten):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302772
Internetseite mit dem Text in 24 Sprachen:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202302772
Link zur Excel-Tabelle mit allen Tags (Datenpunkten):
https://efrag.sharefile.com/share/view/s1a12c193b86d406e90b1bcd7b6bb8f6f/fo37c90b-9d9b-4432-a76b-27760cfcc01b
Explanatory note der EFRAG zur Excel-Tabelle:
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FDraft%2520EFRAG%2520IG%25203%2520DPs%2520explanatory%2520note%2520231222.pdf
6. Sektorspezifische Standards – Die Erweiterung der ESRS durch sektorspezifische Standards sollte ursprünglich bereits bis zum 30.06.2024 erfolgen. Laut Beschluss des EU-Parlaments wurde dies aber bis zum 30.06.2026 verschoben.
Wie weit die Entwicklung der sektorspezifischen Standards gediehen ist, können Sie immer aktuell auf der folgenden Internetadresse der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) einsehen:
https://www.efrag.org/lab5
Im Moment liegen konkrete Vorschläge für die Sektoren Öl und Gas sowie Kohle, Steinbruch und Bergbau vor; diese werden im nächsten Schritt im Sustainability Reporting Board (SRB) diskutiert; ein Termin ist dafür aber noch nicht festgelegt. Für die weiteren Sektoren Straßenverkehr, Agrar- und Fischwirtschaft, Kraftfahrzeuge, Energieerzeugung und -versorgung, Lebensmittel, Textil-, Accessoire-, Schuh- und Schmuckindustrie gibt es noch keine diskussionsfähigen Entwürfe.
1.2.3 Regelungen zur Berichterstattung nach EU-Taxonomie im Überblick
myBook+
Und jetzt schauen wir uns das Ganze für die VerordnungenVerordnungen, EU-Taxonomie und Anhänge der EU-Taxonomie an; auch hier gebe ich Ihnen zuerst eine Übersicht und habe dann eine Liste mit den einzelnen Texten und den zugehörigen Internet-Links angefügt. Auch diese Liste steht Ihnen auf der myBook+ Seite zur Verfügung.
Abb. 3:
Verordnungen und Anhänge zur EU-Taxonomie in zeitlicher Abfolge
Liste mit Links zu den Verordnungen und Anhängen der EU-Taxonomie
1. Delegierte Verordnung zur EU-Taxonomie (EU) 2020/852 18.06.2020 (31 Seiten)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=de
2. Ergänzung der Verordnung durch (EU) 2021/2139 04.06.2021(349 Seiten)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139
3. Ergänzung der Verordnung durch C(2021)4987 06.07.2021:
Von dieser Verordnung sind nur noch das Dokument 1 und vom Dokument 6 die Regelungen zum Anhang XI relevant. Die übrigen Dokumente bzw. Regelungen wurden durch die Regelungen in der Verordnung C(2023) 3850 aktualisiert (s. u. unter Punkt 6.).
Dokument 1. Delegierte Verordnung (19 Seiten)
Dokument 6. Anhänge; hier sind die Regelungen zu den Anhängen IX bis XI enthalten, davon sind aber nur noch die Regeln zum Anhang XI aktuell
XI: Qualitative Angaben für Vermögensverwalter, Kreditinstitute, Wertpapierfirmen sowie Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)4987&from=DE
4. Ergänzung für Atomkraft und Gas 09.03.2022 (45 Seiten), Umweltziele 1 und 2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1214
5. Ergänzung durch Verordnung C(2023)3850 mit weiteren Wirtschaftsaktivitäten und technischen Bewertungskriterien für Umweltziele 1 und 2 27.06.2023
Dokument 1. Delegierte Verordnung (18 Seiten)
Dokument 2. Anhang I: neue Wirtschaftsaktivitäten für Umweltziel 1 (46 Seiten)
Dokument 3. Anhang II: neue Wirtschaftsaktivitäten für Umweltziel 2 (36 Seiten)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2023)3850
6. Änderungen und Ergänzungen durch C(2023) 3850 27.06.2023
Dokument 1.Delegierte Verordnung (25 Seiten)
Dokument 2. Anhang I (26 Seiten): Wirtschaftsaktivitäten und technische Bewertungskriterien für Umweltziel 3
Dokument 3. Anhang II (88 Seiten): Wirtschaftsaktivitäten und technische Bewertungskriterien für Umweltziel 4
Dokument 4. Anhang III (40 Seiten) Wirtschaftsaktivitäten und technische Bewertungskriterien für Umweltziel 5
Dokument 5. Anhang IV (22 Seiten): Wirtschaftsaktivitäten und technische Bewertungskriterien für Umweltziel 6
Dokument 6. Anhang V (24 Seiten): Änderungen der Anhänge I, II, III, IV, V, VII, IX und X der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2178
Dokument 7. Anhang VI (9 Seiten): Meldebogen für die KPI von Kreditinstituten
Dokument 8. Anhang VII (4 Seiten) Anhang VII: Meldebogen für die KPI von Wertpapierfirmen
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2023)3851
Internetseite mit dem taxonomy compass
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/taxonomy-compass
Noch ein Hinweis in eigener Sache: Ich zeige Ihnen im Buch öfter einmal konkrete Beispiele dazu, wie bestimmte Themen von verschiedenen Unternehmen umgesetzt wurden. Diese Unternehmen habe ich ausschließlich danach ausgesucht, wie gut sie sich als Beispiele für das jeweilige Thema eignen. Dass dabei häufiger Firmen »zu Wort kommen«, die hohe Treibhausgas-Emissionen zu verzeichnen haben, ist beim Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel vermutlich keine Überraschung. Die Auswahl beinhaltet aber keine Bewertung meinerseits im Hinblick auf persönliche Präferenzen oder Abneigungen.
Damit Sie sich nicht gleich in die vielen Verordnungen und Richtlinien stürzen müssen, lade ich Sie ein, erst einmal wieder einen Schritt zurückzutreten und mir zu erlauben, Sie auf das Thema Nachhaltigkeit einzustimmen.
2 Was bedeutet Nachhaltigkeit?
2.1 Wie hat das mit der Nachhaltigkeit angefangen?
Auf die Frage, wann zum ersten Mal das Thema Nachhaltigkeit in wirtschaftlichen Zusammenhängen aufgekommen sei, wird gerne der Oberberghauptmann des Erzgebirges, Hans Carl von Carlowitz, zitiert, der schon 1713 eine »nachhaltende« Nutzung des Waldes gefordert hatte. Es sei darauf zu achten, dass nicht mehr Bäume zur Nutzung des Holzes gefällt würden, als nachwachsen könnten. Eine ganz einfache Rechnung und eine völlig einleuchtende Forderung, könnte man meinen, die aber in vielen Bereichen in den Industriestaaten bis heute nicht eingehalten wird. Diese »Übernutzung« von Ressourcen wird auch nicht durch kompensierende Effizienzsteigerungen, verbunden mit einer Kreislaufwirtschaft, ausgeglichen. Vielmehr werden die tatsächlich bereits in hohem Maße erzielten Effizienzsteigerungen nach wie vor überwiegend durch sogenannte »Rebound-Effekte«4 aufgebraucht oder sogar überkompensiert. Und eine Kreislaufwirtschaft, die relevante Mengen an Ressourcen zur Wiederverwendung und -verwertung freigibt, statt sie zu verbrauchen, ist mittelfristig leider auch nicht in Sicht.
Diese Erkenntnisse sind tatsächlich schon über 50 Jahre alt. Spätestens mit dem Bericht an den Club of Rome aus dem Jahr 1972 mit dem Titel Die Grenzen des Wachstums wurde das alles bereits aufgeschrieben. Die nicht erst mit der Letzten Generation aufgekommene Frage nach der Generationengerechtigkeit ist bereits fast 40 Jahre alt: Der nach der damaligen norwegischen Premierministerin Gro Harlem Brundtland benannte Brundtland-Report »Our Common Future«5 von 1987 enthält den folgenden, seitdem häufig als »Definition« von Nachhaltigkeit zitierten Satz:
Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.6
Gro Harlem Brundtland – Our Common Future – 1987
Fünf Jahre später, 1992, wurde in Rio de Janeiro die UN-Klimarahmenkonvention mit der Agenda 2021 beschlossen. Es handelte sich dabei um ein Aktionsprogramm der Vereinten Nationen für das 21. Jahrhundert, das Leitlinien für die Politik mit dem Ziel einer Nachhaltigen Entwicklung definierte. Auf dieser Basis finden seit 1995 jährlich7 die UN-Konferenzen unter dem inzwischen weltweit bekannten Namen COP – Conference of the Parties statt. 1997 wurde von den Vereinten Nationen in Kyoto mit der als Kyoto-Protokoll bekannt gewordenen Vereinbarung erstmalig eine CO2-Reduktion beschlossen: Die Vereinbarung besagte, dass die Industrieländer ihre CO2-Emissionen von 2008 bis 2012 um 5,2 % senken sollten. Diese Verabredung wurde 2012 verlängert und mit konkreten Emissions-Reduktionszielen bis Ende 2020 verknüpft. Das Klimaabkommen von Paris schloss sich diesen Zielen mit der Agenda 2030 an und definierte mit den 17 Sustainable Development Goals (SDG) erstmalig konkrete Ziele für eine weltweite nachhaltige Entwicklung, allerdings unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Ziele in der Regel für die Industrieländer leichter zu erreichen sind und sie auch eine größere historische Verpflichtung dazu haben.
Abb. 4:
Meilensteine der Nachhaltigen Entwicklung
Die Entwicklungs- und die Schwellenländer sollen beim Übergang zur Nutzung erneuerbarer Energien unterstützt werden. Außerdem gibt es eine Verabredung, den »globalen Süden«, also die am meisten vom Klimawandel betroffenen Länder (die aber gleichzeitig am wenigsten dazu beigetragen haben), ab 2020 mit insgesamt 100 Milliarden Dollar pro Jahr bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels zu unterstützen. Dieser Betrag wurde erstmals im Jahr 2022 tatsächlich aufgewendet. Die letzte (28.) COP fand 2023 in Dubai statt. In der Abschlusserklärung wurde zu einer Verdreifachung der weltweiten Kapazitäten an erneuerbaren Energien bis 2030 und einer Verdopplung der Energieeffizienz im gleichen Zeitraum aufgerufen; der Text enthielt aber nicht den von vielen erhofften Beschluss des Ausstiegs aus den fossilen Energien, sondern (nur – oder immerhin!?) die Forderung des »Übergangs weg von fossilen Energien in einer gerechten, geordneten und ausgewogenen Weise«.8
Obwohl es sich bei allen diesen Abkommen, auch beim Pariser Klimaabkommen, nicht um verbindliche Verträge, sondern um Absichtserklärungen und Selbstverpflichtungen handelt, sind aus dem Pariser Klimaabkommen und der Agenda 2030 immerhin tatsächlich konkrete Maßnahmen hervorgegangen, die auch Wirkung zeigen.
Speziell in Europa wurde mit dem Green Deal9 – und da sind wir beim Thema – und mit der Non Financial Reporting Directive (NFRD) die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung für große kapitalmarktorientierte Unternehmen ab dem Berichtsjahr 2017 beschlossen. Das war eine große Veränderung gegenüber der vorherigen Situation. Jetzt mussten die betroffenen Unternehmen neben ihrem finanziellen Bericht erstmalig auch nach – anfangs noch eher grob – vorgegebenen Themenbereichen aufzeigen, wie sie in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen aufgestellt waren.
Im CSR-Richtlinie-UmsetzungsgesetzCSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz10, der Umsetzung der EU-Richtlinie in deutsches Recht, sind die folgenden fünf Themenbereiche konkret genannt:
Umweltbelange
Arbeitnehmerbelange
Sozialbelange
Achtung der Menschenrechte
Bekämpfung von Korruption und Bestechung
Bei diesem ersten Schritt zur Berichtspflicht ging es erst einmal »nur« darum, Transparenz über die Behandlung von Nachhaltigkeitsthemen in Unternehmen zu schaffen, damit alle interessierten Stakeholder in die Lage versetzt würden, Firmen in Bezug auf ihr Handeln im Sinne der Nachhaltigkeit zu beurteilen. In diesem Zusammenhang etablierten sich verschiedene Rahmenwerke als Berichtsformate, die von den Unternehmen genutzt wurden, um ihre Nachhaltigkeitsberichte zu strukturieren und möglichst keine wesentlichen Themen auszulassen. Unter diesen Rahmenwerken haben sich u. a. der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) für den deutschen Raum und der GRI-Standard der Global Reporting Initiative international etabliert (s. auch Kap 2.5).
Nachdem man einige Jahre beobachtet hatte, wie die Unternehmen die Berichterstattungspflicht umsetzten, stellte man fest, dass es trotz der Anwendung etablierter Standards große Unterschiede im Hinblick darauf gab, was und wie genau in den einzelnen Unternehmen berichtet wurde, und dass die gewünschte Transparenz und Vergleichbarkeit durch den Einsatz von unterschiedlichen Indikatoren, Darstellungsformaten und Texterläuterungen nicht erreicht wurde. Schauen Sie sich einmal die Nachhaltigkeitsberichte verschiedener großer Unternehmen im Zeitablauf von 2017 bis heute an und versuchen Sie nur einmal herauszufinden, ob bzw. wie sich das Unternehmen im Zeitablauf im Sinne der Nachhaltigkeit verändert hat. Sie werden feststellen, dass das oft nur schwer oder gar nicht möglich ist, weil viele Unternehmen nicht konsistent jedes Jahr über die gleichen Inhalte berichtet haben und auch das äußere Format der Berichte immer wieder geändert wurde, sodass man die Themen immer wieder an anderer Stelle neu suchen musste. Noch schwieriger wird es bei dem Versuch, verschiedene Unternehmen miteinander zu vergleichen.
Aus dieser Erkenntnis heraus wurden drei Entwicklungen in Gang gesetzt: Zum einen wurde die Verordnung zur Berichterstattung nach EU-Taxonomie11 beschlossen, als Zweites die Überleitung der NFRD zur Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), und als Drittes trat das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in Deutschland in Kraft, das jetzt von der entsprechenden EU-Verordnung abgelöst bzw. durch diese verschärft werden wird (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD).
Während man mit der EU-Taxonomie einen Rahmen zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen schaffen wollte, indem man eine Möglichkeit zum Messen des Nachhaltigkeitsgrades von Unternehmen schuf, wird mit den zur CSRD gehörenden European Sustainability Reporting Standards (ESRS) erstmalig auch ein einheitliches Berichtsformat für die Nachhaltigkeitsberichterstattung vorgegeben. Damit sollen die Transparenz der Berichte erhöht und Zeitvergleiche sowie Vergleiche zwischen verschiedenen Unternehmen ermöglicht werden.
Auch über die Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) muss Bericht erstattet werden. In diesem Fall ist das aber nur ein Nebeneffekt des Gesetzes; der Fokus liegt auf der tatsächlichen Erfüllung der Sorgfaltspflichten und der Möglichkeit, Sanktionen für den Fall der Nicht-Erfüllung auszusprechen (Bußgelder). Im Rahmen der EU-Verordnung (noch im Entwurfsstadium) wird es sogar möglich sein, die Unternehmen auf Einhaltung ihrer Sorgfaltspflicht zu verklagen; dann würden sich die möglichen Sanktionen nicht mehr nur auf die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) als Kontrollbehörde verhängten Bußgelder beschränken.
Die folgende Grafik fasst den zeitlichen Ablauf für das Inkrafttreten der genannten VerordnungenVerordnungen, Zeitstrahl noch einmal zusammen.
Abb. 5:
Zeitstrahl für den Start der Berichtspflicht nach den verschiedenen EU-Verordnungen
Im Kapitel 3 werden die Verordnungen zu CSRD und EU-Taxonomie ausführlich erläutert und wir werden deren Anwendung Schritt für Schritt gemeinsam erarbeiten, veranschaulicht durch konkrete Fallbeispiele. Abgerundet wird das Kapitel 3 mit einem kurzen Überblick über das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (Kapitel 3.8).
4 Unter Rebound-Effekten versteht man Handlungen, die Effizienzsteigerungen oder andere positive Effekte im Sinne der Nachhaltigkeit zunichtemachen. Das geschieht z. B., wenn in Haushalten, die auf »Ökostrom« umgestellt haben, anschließend mehr Strom verbraucht wird als vorher, weil der Strom ja jetzt aus regenerativen Energien entsteht, oder wenn mit einem neuen Auto, das weniger Kraftstoff pro km verbraucht als das vorherige Auto, anschließend mehr Kilometer gefahren werden als vorher.
5https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
6 Übersetzung aus dem Englischen durch die Autorin.
7 Einmalige Ausnahme 2020 wegen Corona.
8https://www.deutschlandfunk.de/cop-weltklimakonferenz-abschlusstext-fossile-energien-100.html
9 Mit dem europäischen Grünen Deal soll der Übergang zu einer ressourceneffizienten Wirtschaft geschafft werden. Er enthält u. a. das Ziel des Erreichens der »Netto-Null« für Treibhausgase bis 2050 (bei Senkung der Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber 1990).
10https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*%5B@attr_id=%27bgbl117s0802.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s0802.pdf%27%5D__1698315161741
11 Kurzbezeichnung für: Verordnung über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen.
2.2 Über die Motivation zu nachhaltigem Handeln
Vielleicht haben Sie schon bemerkt, dass mir das Thema Nachhaltigkeit nicht nur aus professioneller Sicht wichtig ist, sondern auch persönlich am Herzen liegt. Für die Frage, wie intensiv Nachhaltigkeitsthemen in Unternehmen umgesetzt werden, spielt die persönliche Motivation einzelner Mitarbeiter:innen im Unternehmen und natürlich vor allem die Einstellung der Führungskräfte eine große Rolle: Werden nur die Mindeststandards (die gesetzlich vorgeschrieben sind) eingehalten oder führt die intrinsische Motivation der Führungskräfte zu einer stärkeren Verankerung von Nachhaltigkeit im Unternehmen oder wird nachhaltiges Verhalten sogar als Möglichkeit gesehen, eine Vorreiterrolle in der Branche zu übernehmen und dadurch Marktanteile zu gewinnen?
Wie im vorhergehenden Kapitel bereits dargestellt, haben die Abkommen, die auf den verschiedenen UN-Konferenzen (COP) geschlossen wurden und jeweils als Meilensteine in Sachen Nachhaltiger Entwicklung angesehen wurden, dennoch nicht zu den Veränderungen geführt, die mit ihnen beabsichtigt waren. Es muss sich erst noch zeigen, inwieweit die hier erläuterten für Unternehmen in der EU beschlossenen Richtlinien die gewünschte Entwicklung weiter vorantreiben werden.
Definition
Man kann die Motivation zu nachhaltigem Handeln in Unternehmen grob in drei Stufen einteilen:
öffentlichkeitsorientierte Motivation (Gesetze einhalten, Reputation)
marktorientierte Motivation (Kunden und Wettbewerber)
managementorientierte Motivation (intrinsische Motivation)
Die erste Stufe beschreibt Unternehmen, in denen man sich an Regeln und Gesetze hält, allerdings weniger deshalb, weil man sie für gut und richtig hält, sondern eher, weil man sich nicht strafbar machen will und ggf. bei Nichteinhaltung an Reputation verlieren könnte. Diese Motivationsstufe entspricht der »Mindestmotivation« in Unternehmen für nachhaltiges Handeln.
Unternehmen, in denen zusätzlich eine marktorientierte Motivation zu nachhaltigem Handeln herrscht (zweite Stufe), haben verstanden, dass sich mit nachhaltigem Handeln und der Kommunikation darüber ein Nutzen gegenüber Kunden und Wettbewerbern erzielen lässt. Diese Unternehmen können sich positiv von der Konkurrenz abheben, wenn ihre Kunden nachhaltiges Verhalten einfordern. Unternehmen auf dieser Motivationsstufe veröffentlichen häufig aufwendig aufgemachte Nachhaltigkeitsberichte, die positive Entwicklungen besonders hervorheben, die aber auch die Gefahr des »Greenwashing« bergen.
Die dritte und höchste Stufe der Motivation zum nachhaltigen Handeln ist die intrinsische Motivation. Diese »von innen her kommende« Motivation werden im Regelfall nicht alle Mitarbeitenden des gesamten Unternehmens haben; tatsächlich sind in diesem Fall die Personen in der Geschäftsführung entscheidend dafür, ob das Unternehmen überzeugend und glaubwürdig auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist oder ob die getroffenen Maßnahmen eher doch auf Motivationsstufe 1 oder 2 angesiedelt sind.
Für die Stakeholder der Unternehmen ist es oft nur schwer zu erkennen, auf welcher Stufe der Motivation für nachhaltiges Verhalten sich das Unternehmen bewegt. Das ist auch tatsächlich weniger wichtig als die Frage, wie nachhaltig das Verhalten tatsächlich ist. Mit EU-Taxonomie, CSRD und LkSG wurde nun einiges getan, um auch von außen besser beurteilen zu können, wie nachhaltig Unternehmen tatsächlich sind. Familienunternehmen treten hier übrigens häufig glaubwürdiger auf als die von »fremden« Manager:innen geführten Unternehmen, da sich die Familienmitglieder, die das Unternehmen leiten, auch als Person mit dem Unternehmen identifizieren: Was durch das Unternehmen an negativer Reputation erzeugt wird, fällt negativ auf die Familie und die einzelnen Familienmitglieder zurück – und umgekehrt.
Zur Überprüfung der Frage, auf welcher Hierarchiestufe Nachhaltigkeitsthemen in Unternehmen angesiedelt sind, hat die »Disclosure Insight Action« (ehemals Carbon Disclosure Project – CDP) ein Ratingverfahren entwickelt, das von ihr jährlich für eine große Zahl von weltweit tätigen Unternehmen durchgeführt wird (s. auch Kap. 4.1.2). Dabei bedeutet ein Rating von A oder A-, dass das Nachhaltigkeitsthema auf »Leadership Level« angesiedelt ist, B und B- auf »Management Level«, C und C- auf »Awareness Level« und D und D- auf »Disclosure Level«. Das Disclosure Level entspricht also der niedrigsten Rating-Stufe und ist insofern vergleichbar mit der oben genannten ersten Stufe, nach der lediglich Regeln und Gesetze befolgt werden.
Apropos Familienunternehmen: In diesem Sinne ist bei der Firma HIPP beispielsweise das Nachhaltigkeitsthema zumindest nach eigener Aussage offenbar auf Leadership Level angesiedelt. Auf der Internetseite kann man es nachlesen: »Bei uns ist Nachhaltigkeit Chefsache.«12
Wenn sich die Geschäftsführung der Nachhaltigkeit verpflichtet, dann besteht die Möglichkeit, dieses als Wettbewerbsvorteil zu nutzen oder sogar zum Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit zu werden und damit eine ganze Branche in diesem Sinne anzuführen. Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte hat daher die Möglichkeiten der nachhaltigen Entwicklung in Unternehmen in die folgenden drei Stufen eingeteilt: 1. License to operate, 2. License to grow und 3. License to lead13. Mit operate ist die Einhaltung von Regeln und Gesetzen gemeint. Stufe 2 grow beinhaltet darüber hinausgehende proaktive Maßnahmen in Sachen Nachhaltigkeit, die zu Wettbewerbsvorteilen führen können. Und wer zu Stufe 3 übergeht, ist führend in Sachen Nachhaltigkeit; er kann den Markt mitgestalten und so möglicherweise durch Differenzierung und/oder Wachstum in oder Erschließung von neuen Märkten zusätzliche Marktanteile gewinnen. In der unten abgebildeten Darstellung werden von Deloitte die Unternehmen, die nur die license to operate innehaben, als »Nachzügler« bezeichnet. Interessant ist, dass alles, was jenseits der license to grow liegt, als Chance bezeichnet wird und alles davor als Risiko.
Abb. 6:
Deloitte: Von der License to operate zur License to lead
14
Beispiele für Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sind – wie schon gesagt – häufig unter den Familienunternehmen zu finden. Schauen Sie sich dazu einmal die Internetseiten von HIPP, VAUDE und EDDING an und vergleichen Sie selbst.
Interessant an der Darstellung von Deloitte ist auch, dass den Nachzüglern kurzfristige Profitorientierung unterstellt wird und davon ausgegangen wird, dass Unternehmen aus nachhaltigem Handeln dauerhaft einen finanziellen Vorteil ziehen können. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass finanzielle Vorteile und nachhaltiges Handeln als unvereinbare Gegensätze betrachtet wurden. Und damit sind wir beim nächsten Thema.
12https://www.hipp.de/ueber-hipp/bio-qualitaet-nachhaltigkeit/nachhaltigkeit-im-unternehmen/
13https://www.deloittegermany.de/corporate-governance-inside-03-2020/aufsichtsratsthema-nachhaltigkeit
14 Eigene Darstellung nach: https://www.deloittegermany.de/corporate-governance-inside-03-2020/aufsichtsratsthema-nachhaltigkeit
2.3 Stehen finanzielle und Nachhaltigkeitsziele im Widerspruch zueinander?
Eines der am häufigsten zitierten Argumente gegen nachhaltiges Handeln – sowohl im privaten als auch im unternehmerischen Umfeld – ist, dass Nachhaltigkeit hohe Kosten verursache und keinen vergleichbaren (finanziellen) Gegenwert biete. Also stark verkürzt gesagt: Nachhaltigkeit widerspreche dem Prinzip der Gewinnerzielung – so heißt es. Wie ist das nun wirklich?
Die Frage, ob es sich zumindest langfristig auszahlt, in Nachhaltigkeit zu investieren, ist inzwischen längst ziemlich einhellig mit Ja beantwortet worden. Selbst Unternehmen, die (zu) lange an nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen festgehalten haben, sind inzwischen schlauer geworden. Das kann man übrigens sehr eindrücklich anhand der ersten Veröffentlichungen von Unternehmen zur EU-Taxonomie ablesen, die ja genau dafür geschaffen wurde, um aufzuzeigen, inwieweit ein Geschäftsmodell bereits jetzt nachhaltig ist (taxonomiekonformer Umsatzanteil) bzw. inwieweit es zumindest für die Zukunft nachhaltig ausgerichtet wird (taxonomiekonformer Anteil an den Investitionsausgaben). In Kapitel 3.3 zeige ich Ihnen dazu konkrete Zahlen von verschiedenen Firmen, die das belegen.
Kommen wir aber nun zu der nicht ganz so einhellig beantworteten Frage, inwieweit dies auch kurz- und mittelfristig zutrifft. Dazu möchte ich Sie an das vorhergehende Kapitel erinnern: Die Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsprüfergesellschaft Deloitte weist mit ihrem Modell der license to operate/to grow/to lead darauf hin, dass es ein Risiko für Unternehmen darstellt, wenn sie sich unterhalb der license to grow aufhalten, also dauerhaft nur das gesetzlich Vorgeschriebene tun und die Möglichkeiten des Wachstums in Richtung Nachhaltigkeit nicht nutzen. Trotzdem könnte ja an dem Argument der höheren Kosten, die nicht durch einen entsprechend höheren Nutzen ausgeglichen werden, etwas dran sein.
Aus dem privaten Bereich kennen wir vermutlich alle das häufig herangezogene Beispiel mit dem Preisvergleich für Bio-Lebensmittel gegenüber Nicht-Bio-Lebensmitteln. Ich habe einmal die aktuellen Preise für Bio-Hackfleisch und Nicht-Bio-Hackfleisch herausgesucht: 400 g Bio-Hackfleisch (europäisches Biosiegel) kosten bei einer großen Supermarktkette derzeit 4,69 Euro, 800 g Nicht-Bio-Hackfleisch 5,79 Euro, auf 400 g heruntergerechnet also 2,90 Euro. Damit ist die Bio-Variante ca. 60 % teurer. Die Frage, ob das Bio-Fleisch auch einen um 60 % höheren Nutzen liefert, ist praktisch nicht zu beantworten, da hierzu die Frage nach der Gesundheit des Menschen, der das Fleisch kauft, und nach dem Tierwohl berücksichtigt werden müsste. Man müsste darüber hinaus in die Erwägungen auch einbeziehen, inwiefern sich die Person das teurere Fleisch überhaupt leisten kann oder ob sie noch satt wird, wenn sie entsprechend weniger Fleisch einkauft. Im privaten Zusammenhang ist es also eher eine politische Frage, ob man nachhaltiges Verhalten von Privatpersonen stärken will und dafür ggf. finanzielle Unterstützung leistet.
Kommen wir zurück zu der Kosten-Nutzen-Betrachtung aus unternehmerischer Sicht und unterstellen einmal, dass die Produktion eines nachhaltigen Produktes häufig höhere Kosten verursacht als die seines nicht nachhaltigen Pendants, was für Lebensmittel (bisher) meistens zutreffen dürfte. Wie sieht es mit dem (finanziellen) Nutzen aus, den das Unternehmen durch die Produktion und den Verkauf seiner nachhaltigen Produkte erzielt? Gehen wir von dem einfachsten Fall aus, dass das Unternehmen genau so viel auf den Verkaufspreis aufschlägt, wie es selbst an Mehrkosten tragen muss. In diesem Fall würde die nachhaltige Produktion dem Unternehmen per Saldo weder finanziellen Nutzen noch finanziellen Schaden bringen – vorausgesetzt, es kann die produzierte Menge zu dem höheren Preis auch absetzen. Damit wäre es »nur« eine Grundsatzentscheidung, ob sich das Unternehmen für oder gegen die nachhaltige Produktion entscheidet, eine Entscheidung gegen das nachhaltige Produkt aus rein finanziellen Gründen wäre in diesem Fall nicht glaubwürdig.
Wenn aber die höheren Kosten nicht vollständig durch einen höheren Verkaufspreis weitergegeben werden können, lohnt es sich nachzusehen, ob nicht durch ein insgesamt nachhaltigeres Handeln an anderer Stelle Kosten eingespart werden können, z. B. durch die Steigerung des Recycling-Volumens, Einsparungen beim Energieverbrauch oder den Einsatz preiswerterer (regenerativer) Energien. Auch im sozialen Bereich kann mehr Nachhaltigkeit zu Kosteneinsparungen führen: Kann z. B. die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht und dadurch die Fluktuationsrate reduziert werden, spart das Kosten für das Anwerben und Anlernen von Mitarbeitenden usw.
Wenn man es ernst meint mit der Nachhaltigkeit, tun sich eine Menge Möglichkeiten auf, wie die ggf. erhöhten Kosten wieder eingespart werden oder durch höhere Umsätze ausgeglichen werden können. Vergessen wir nicht den deutlichen Hinweis von Deloitte, dass Nachhaltigkeit Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, in der eigenen Branche Marktanteile zu gewinnen. Laut einem Report der britischen Business & Sustainable Development Commission werden durch die Umsetzung der 17 SDGs Marktpotenziale im Wert von mindestens 12 Billionen USD bis 2030 freigesetzt, möglicherweise sogar das 2- bis 3-Fache davon. Außerdem weist die Kommission darauf hin, dass die Verkaufspreise um 40 % höher lägen (liegen müssten), würde man die Umweltkosten korrekt einbeziehen15. Letzteres ist ein wichtiger Hinweis, denn inzwischen kommen einige der bisher als »externe Kosten« behandelten Umweltkosten tatsächlich bei den Unternehmen an, sei es in Form der CO2-Bepreisung oder durch Kosten, die für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel notwendig werden. Diesen können sich die Unternehmen nicht mehr entziehen.
Wer also denkt, nachhaltige und finanzielle Ziele stünden im Widerspruch zueinander, greift eindeutig zu kurz und verpasst es womöglich, Risiken abzumildern, die durch »Nachzügler«-Verhalten entstehen (s. o.), sowie Chancen zu ergreifen, die sich aus der Möglichkeit einer »License to lead« ergeben können. Dabei verweist Deloitte selbst explizit darauf, dass es beim Thema Nachhaltigkeit (in Unternehmen) auch um intrinsische Motivation geht, und zwar mit den folgenden Worten: »Köpfe, Prozesse und KPIs reichen nicht. Die Transformation zur Nachhaltigkeit muss auch in den Herzen der Mitarbeiter stattfinden.«16
Tatsächlich haben Unternehmen in der EU deutlich mehr Regelungen zu beachten und Auflagen einzuhalten, als dies im globalen Vergleich der Fall ist. Daher wird häufig gegen Verordnungen und Auflagen mit der These argumentiert, die Unternehmen würden global an Konkurrenzfähigkeit einbüßen. Mit den in diesem Kapitel erläuterten Ansätzen können aber viele dieser Einwände entkräftet werden. Das ist nicht überall so und wo es nicht der Fall ist, können und müssen Maßnahmen getroffen werden, die die Konkurrenzfähigkeit wieder herstellen. Tatsächlich gibt es z. B. für bestimmte Branchen in der EU deutliche Nachteile im Zusammenhang mit der Pflicht der von ihnen zu erwerbenden CO2-Zertifikate. Hier hat die EU eine Art »Klimazoll« zum Ausgleich geschaffen: Ab 2026 müssen Importeure von Zement, Eisen, Stahl, Aluminium, Düngemitteln, Strom und Wasserstoff eine Abgabe entsprechend der CO2-Bilanz der importierten Produkte zahlen, um den Wettbewerbsnachteil für die in der EU produzierenden Unternehmen wieder auszugleichen.
Wie stark sollten nun – je nach Motivationsstufe – Nachhaltigkeitsthemen in die Unternehmensstrategie integriert sein? Damit beschäftigt sich das nächste Kapitel.
15 Vgl. https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/news_events%2F9.3%2Fbetter-business-better-world.pdf
16https://www.deloittegermany.de/corporate-governance-inside-03-2020/aufsichtsratsthema-nachhaltigkeit
2.4 Braucht mein Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie?
Bis vor einigen Jahren gab es in vielen Unternehmen noch keine gesonderte Nachhaltigkeitsstrategie oder sie wurde zumindest deutlich getrennt von der sonstigen (eher finanziellen) Unternehmensstrategie kommuniziert. Das folgende Beispiel der Deutsche Post DHL Group (kurz: DHL) zeigt, wie sich dort (und auch anderswo) die Kommunikation in den letzten Jahren verändert hat. Im Jahr 2016 – also bevor die Nachhaltigkeitsberichterstattung in der EU (und für DHL) zur Pflicht wurde – konnte man im DHL-Geschäftsbericht unter dem Stichwort »Strategie 2020: Focus.Connect.Grow.« Folgendes lesen17:
Strategie 2020: Focus.Connect.Grow
Focus: Wir fokussieren uns auf unser Kerngeschäft Post und Logistik.
Connect: Wir arbeiten daran, uns bereichsübergreifend kontinuierlich zu verbessern.
Grow: Wir wollen vom Wachstum des E-Commerce-Bereiches und der Entwicklungs- und Schwellenländer profitieren.
DPDHL Geschäftsbericht 2016
Obwohl noch nicht dazu verpflichtet, hat DHL parallel zu diesem Geschäftsbericht 2016 bereits seinen »Bericht zur Unternehmensverantwortung 2016« veröffentlicht. Dort steht unter dem Stichwort Strategie Folgendes:
Mit unserer nachhaltigen und auf unternehmerische Verantwortung ausgerichteten Konzernstrategie wollen wir den Anforderungen des operativen Geschäfts und der Anspruchsgruppen von Deutsche Post DHL Group sowie den Bedürfnissen von Umwelt und Gesellschaft gerecht werden.
DPDHL Bericht zur Unternehmensverantwortung 2016
Fällt Ihnen etwas auf? Die Unternehmensstrategie war von der Nachhaltigkeitsstrategie noch vollständig getrennt. In der Unternehmensstrategie standen Begriffe wie Fokus, Kerngeschäft, verbessern und Wachstum; weder das Wort nachhaltig noch das Wort Verantwortung tauchen in dieser Kurzbeschreibung auf, obwohl sie im Bericht zur Unternehmensverantwortung als Konzernstrategie bezeichnet werden. DHL ist kein Sonderfall, diese offensichtliche Trennung war 2016 noch völlig normal.
Im Jahr 2022 bestand die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bereits seit sechs Jahren, es gab allerdings noch keine Verpflichtung zur Integration der Nachhaltigkeitserklärung in den Geschäftsbericht. Trotzdem waren 2022 bereits deutliche Bestrebungen erkennbar, diese Integration vorzubereiten, so auch bei DHL. Im Geschäftsbericht 2022 von DHL ist die Strategie 2025 mit »Spitzenleistungen in einer digitalen Welt« untertitelt. Sie hat die Strategie 2020: Focus.Connect.Grow aus dem Jahr 2016 abgelöst und ist im Geschäftsbericht durch die folgenden Stichworte näher beschrieben:
Unser Unternehmenszweck: Menschen verbinden. Leben verbessern.
Unsere Vision: Wir sind DAS Logistikunternehmen für die Welt
Unsere Werte: Respekt & Resultate
Unsere Mission: Excellence.Simply.delivered. – Arbeitgeber erster Wahl, Anbieter erster Wahl, Investment erster Wahl
Der Fokus unserer Unternehmensbereiche: Stärkung des profitablen Kerngeschäfts
Digitalisierung
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: