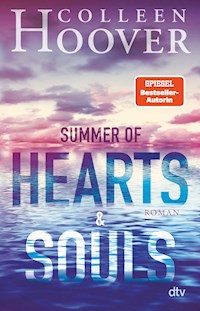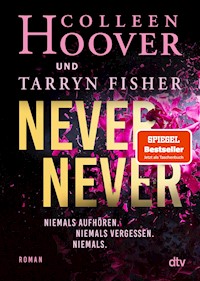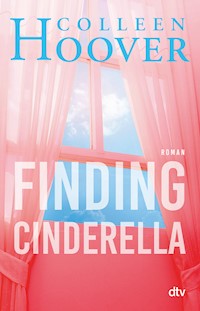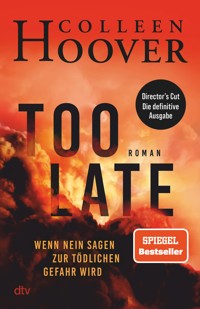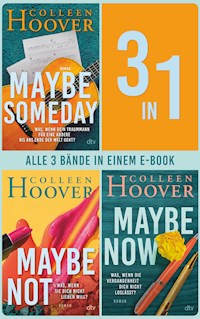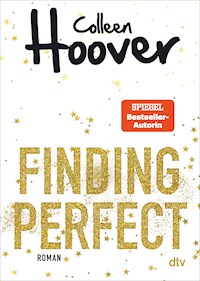10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
New York – Los Angeles, und dazwischen die große Liebe Ausgerechnet am Abend, bevor sie von Los Angeles nach New York zieht, lernen sie sich kennen: Fallon, Tochter eines bekannten Filmschauspielers, und Ben, der davon träumt, Schriftsteller zu werden. Für beide ist klar: Ihnen ist gerade die große Liebe begegnet – und so kosten sie jede Minute bis zum Abflug aus. Doch wie soll es weitergehen? Wollen sie sich wirklich auf eine Fernbeziehung einlassen und ihren Alltag nur halbherzig leben? Um das zu verhindern, beschließen sie, sich die nächsten fünf Jahre immer am selben Novembertag zu treffen, dazwischen jedoch auf jeglichen Kontakt zu verzichten. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja doch mit einem Happy End. Aber fünf Jahre sind eine lange Zeit – und so kommt ihnen trotz aller intensiver Gefühle, die bei jedem ihrer Treffen hochkochen, das Leben dazwischen … Ein süchtig machendes Konzept und dazu die schicksalhafte Wucht der Gefühle, die Colleen-Hoover-Fans und Romance-Leserinnen lieben. »Eine wundervolle, außergewöhnliche Liebesgeschichte.« Aachener Zeitung »Colleen Hoover reiht sich mit diesem Roman in die Gilde von Autorinnen wie Jojo Moyes ein.« Library Journal
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Ausgerechnet am Abend vor ihrem Umzug von Los Angeles nach New York begegnet Fallon Ben. Sie verlieben sich auf den ersten Blick ineinander und verbringen die Stunden vor dem Abflug zusammen. Doch wie soll es weitergehen? Wollen sie sich wirklich auf eine Fernbeziehung einlassen? Sie beschließen, sich die nächsten fünf Jahre immer am selben Tag im November zu treffen. Doch fünf Jahre sind eine lange Zeit – und so kommt ihnen trotz ihrer Gefühle das Leben dazwischen …
Von Colleen Hoover sind bei dtv lieferbar:
Weil ich Layken liebe | Weil ich Will liebe | Weil wir uns lieben
Hope Forever | Looking for Hope | Finding Cinderella
Finding Perfect
Love and Confess
Maybe Someday | Maybe Not | Maybe Now
Zurück ins Leben geliebt – Ugly Love
Nur noch ein einziges Mal – It ends with us
It starts with us – Nur noch einmal und für immer
Never Never (zusammen mit Tarryn Fisher)
Die tausend Teile meines Herzens
Too Late – Wenn Nein sagen zur tödlichen Gefahr wird
Was perfekt war
Verity
All das Ungesagte zwischen uns
Layla
Für immer ein Teil von dir
Summer of Hearts and Souls
Nur noch wenige Tage – Saint & The Dress. Zwei Stories
Colleen Hoover
NÄCHSTES JAHRAM SELBEN TAG
Roman
Aus dem amerikanischen Englischvon Katarina Ganslandt
Für Levi:
Du hast einen großartigen Musikgeschmack
und deine Umarmungen sind immer ein bisschen unbeholfen.
Bleib bloß, wie du bist.
Erster 9. November
Durchsichtig bin ich, ein Wasserwesen.
Ziellos umhertreibend.
Sie ist ein Anker, der in mein Meer sinkt.
Benton James Kessler
FALLON
Was es wohl für ein Geräusch machen würde, wenn ich ihm jetzt einfach mein Glas an den Kopf werfen würde?
Das Glas ist schwer. Sein Schädel ist hart. Das lässt auf ein sattes KLONK hoffen.
Würde er bluten? Auf dem Tisch steht ein Serviettenspender, aber es sind nur die billigen, die nicht dick genug sind, um viel Blut aufzusaugen.
»Tja, unglaublich, was? Ich stehe selbst noch ein bisschen unter Schock«, sagt er.
Ich umklammere mein Glas fester, um zu verhindern, dass es wirklich gleich an seinem Schädel landet.
»Fallon?« Er räuspert sich und setzt seinen sanftesten Blick auf, der aber nichts daran ändert, dass sich seine Worte wie Klingen in mein Herz gebohrt haben. »Möchtest du nichts dazu sagen?«
Ich ramme meinen Strohhalm in einen der hohlen Eiswürfel und stelle mir vor, es wäre sein Kopf.
»Was willst du denn hören?«, sage ich, was mehr nach einem trotzigen Kind klingt als nach der Achtzehnjährigen, die ich bin. »Soll ich dir etwa gratulieren?«
Ich verschränke die Arme, lehne mich ins Polster der Sitznische zurück und funkle ihn an. Er wirkt zerknirscht. Keine Ahnung, ob er spürt, wie sehr mich seine Ankündigung getroffen hat, oder ob seine Reue bloß gespielt ist. Obwohl wir uns erst seit fünf Minuten gegenübersitzen, ist es ihm wieder mal gelungen, seine Seite des Tischs zur Bühne zu machen. Und mich zu seiner Zuschauerin.
Er trommelt mit den Fingern auf sein Glas und sieht mich mehrere Takte hindurch schweigend an.
Tatapptatapp.
Tatapptatapp.
Tatapptatapp.
Natürlich rechnet er damit, dass ich wie üblich einlenke und ihm sage, was er hören möchte. Aber da wir uns in den letzten zwei Jahren nur noch selten gesehen haben, hat er nicht mitbekommen, dass ich nicht mehr das Mädchen bin, das ich früher mal war.
Als ich mich weigere, die gewünschte Reaktion zu zeigen, stützt er seufzend die Ellbogen auf den Tisch. »Ich hatte gehofft, du würdest dich vielleicht für mich freuen.«
»Mich für dich freuen?« Ich schüttle den Kopf.
Das kann nicht sein Ernst sein.
Er zuckt mit den Schultern und kann sich ein stolzes Grinsen nicht verkneifen. »Na ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal Vater werden würde.«
Ich lache ungläubig. »Dass man in der Lage ist, sein Sperma in eine Vierundzwanzigjährige zu spritzen, macht einen noch lange nicht zu einem Vater«, sage ich bitter.
Sein Grinsen erstirbt. Jetzt lehnt er sich zurück, neigt den Kopf und zieht leicht die Brauen zusammen. Diesen Blick hat er entwickelt, um ihn immer dann einzusetzen, wenn er nicht weiß, wie er eine Szene spielen soll. »Er ist perfekt, weil man jede beliebige Gefühlsregung hineininterpretieren kann: Traurigkeit, Bedauern, Mitgefühl oder Betroffenheit.« Hat er schon vergessen, dass er mein halbes Leben lang mein Schauspiellehrer war und das einer der ersten Tricks, die er mir beigebracht hat?
»Du denkst, ich habe kein Recht, mich Vater zu nennen?« Er klingt verletzt. »Was bin ich denn dann für dich?«
Ich gehe nicht davon aus, dass er auf diese Frage ernsthaft eine Antwort erwartet, spieße einen weiteren Eiswürfel auf, lasse ihn mir in den Mund gleiten und zerbeiße ihn gnadenlos. In der Nacht, in der meiner Karriere mit gerade mal sechzehn ein jähes Ende gesetzt wurde, habe ich aufgehört, ihn als »Vater« zu betrachten. Wobei er wahrscheinlich auch vorher weniger ein Vater für mich war als vielmehr mein Schauspielcoach.
Er streicht sich vorsichtig durch die für viel Geld frisch in seine Kopfhaut gepflanzten Haare. »Warum sagst du so etwas?« Jetzt kann er seine wachsende Gereiztheit nicht mehr verbergen. »Nimmst du mir etwa immer noch übel, dass ich nicht zu deiner Abschlussfeier gekommen bin? Ich habe dir doch erklärt, dass ich einen wichtigen Termin hatte, der sich nicht verschieben ließ.«
»Nein«, antworte ich ungerührt. »Das nehme ich dir nicht übel. Du warst ja gar nicht eingeladen.«
Er beugt sich vor und sieht mich fassungslos an. »War ich nicht?«
»Nein. Ich hatte nur vier Karten.«
»Wie bitte? Ich bin dein Vater! Warum hast du mich nicht eingeladen?«
»Du wärst doch sowieso nicht gekommen.«
»Woher willst du das wissen?«
»Du bist nicht gekommen.«
Er verdreht die Augen. »Natürlich nicht, Fallon. Ich war ja auch nicht eingeladen.«
Ich seufze. »Du bist echt unmöglich. Jetzt verstehe ich, warum Mom dich verlassen hat.«
Er schüttelt den Kopf. »Deine Mutter hat mich verlassen, weil ich mit ihrer besten Freundin geschlafen habe. Mit meinem Charakter hatte das rein gar nichts zu tun.«
Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Selbstzweifel kennt dieser Mann nicht. Obwohl mich genau diese Eigenschaft zur Weißglut treibt, beneide ich ihn gleichzeitig fast darum. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre ein bisschen mehr wie er und weniger wie Mom. Er ist vollkommen blind für seine Fehler, während ich nichts anderes sehe als meine Schwächen. Sie sind das Erste, woran ich morgens beim Aufwachen denke, und das Letzte, was mich Nacht für Nacht in den Schlaf begleitet.
»Wer von Ihnen hatte das Lachsfilet?«, fragt der Kellner. Perfektes Timing.
»Ich, bitte.« Er stellt den Teller vor mich hin und ich greife nach meiner Gabel, schiebe dann aber doch nur den Reis von einer Seite zur anderen, weil mir inzwischen der Appetit vergangen ist.
»Moment!«
Ich hebe den Kopf, aber der Kellner redet gar nicht mit mir, sondern mit meinem Vater. »Sind Sie nicht …?« Das musste ja kommen. »Na klar!« Ich fahre zusammen, als er laut in die Hände klatscht. »Sie sind es! Sie sind Donovan O’Neil! Sie haben Max Epcott gespielt!«
Mein Vater zuckt mit den Schultern, als wäre das keine große Leistung, dabei ist Bescheidenheit etwas, das ihm völlig fremd ist. Obwohl die Serie, in der er Max Epcott gespielt hat, schon vor zehn Jahren abgesetzt wurde, bildet er sich immer noch ein, sie wäre eine der Sternstunden der Fernsehgeschichte gewesen. Und das wird er auch weiterhin glauben, solange es immer wieder Leute gibt, die ihn erkennen und reagieren, als hätten sie noch nie in ihrem Leben einen Schauspieler vor sich gesehen. Hallo? Wir sind in L.A.! Hier ist jeder Schauspieler!
Ich steche voller Mordlust meine Gabel in den Lachs und will mir einen Bissen in den Mund schieben, als der Kellner fragt, ob ich ein Foto von ihm und meinem Vater machen kann.
Seufz.
In dem Moment, in dem ich aus der Nische rutsche und aufstehe, hält er mir sein Handy hin, aber ich schüttle den Kopf und gehe um ihn herum. »Sorry, ich muss dringend auf die Toilette«, sage ich. »Machen Sie doch ein Selfie mit ihm. Da steht er total drauf.«
Sobald kurz darauf die Tür der Waschräume hinter mir zugefallen ist, atme ich erleichtert auf. Keine Ahnung, wieso ich auf die bescheuerte Idee gekommen bin, mich mit meinem Vater zum Mittagessen zu treffen. Okay, vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass ich aus L.A. wegziehe und ihn eine ganze Weile nicht mehr sehen werde. Aber selbst das rechtfertigt nicht, dass ich mir das hier freiwillig antue.
Zielstrebig steuere ich die erste Kabine in der Reihe an, schließe mich ein, ziehe eine Schutzfolie aus dem Spender und breite sie über den Sitz. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass in öffentlichen Toiletten die Sitzfläche in der ersten Kabine immer am wenigsten verkeimt ist, weil die meisten Leute fälschlicherweise davon ausgehen, dass sie am häufigsten benutzt wird, und sie deshalb meiden. Ich nicht. Ich gehe sogar grundsätzlich immer nur in die erste Kabine. Seit ich als Sechzehnjährige mehrere Monate im Krankenhaus verbringen musste, bin ich, was Bakterien angeht, ein bisschen paranoid.
Als ich fertig bin, wasche ich mir sehr lange und gründlich die Hände, wobei ich starr nach unten schaue. Normalerweise bin ich ziemlich geübt darin, meinem Spiegelbild auszuweichen, aber als ich ein Papiertuch aus dem Spender ziehe, erhasche ich aus dem Augenwinkel doch einen Blick auf mein Gesicht. Ich habe es noch immer nicht geschafft, mich an den Anblick zu gewöhnen.
Nachdenklich streiche ich über die vernarbte Haut, die sich über die linke Hälfte meines Gesichts zum Hals hinunterzieht und im Kragen meiner Bluse verschwindet. Unter der Kleidung bedecken die Narben die gesamte linke Seite meines Oberkörpers bis zur Taille. Narben, die mich für den Rest meines Lebens daran erinnern, dass das Feuer damals real war und kein schrecklicher Albtraum, aus dem ich aufwachen könnte, wenn ich mich kneife.
Nach dem Brand war der größte Teil meines Körpers erst einmal monatelang unter Verbänden verborgen. Jetzt, wo die Wunden zu Narben verheilt sind, ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich sie fast zwanghaft berühre. Die verbrannte Haut fühlt sich ganz weich an, wie Nappaleder oder Samt. Eigentlich sollte man erwarten, ihre Beschaffenheit würde mich genauso abstoßen wie ihr Anblick, aber ich streiche mir oft gedankenverloren über den Hals oder den Arm, als würde ich eine Art Brailleschrift auf meinem Körper entziffern. Sobald ich merke, was ich tue, höre ich schnell wieder auf. Ich sollte nichts schön finden, das so untrennbar mit der Nacht verknüpft ist, in der mein Leben in Flammen aufging.
Am Aussehen der Narben finde ich natürlich überhaupt nichts Schönes. Es ist, als hätten die Flammen meine Haut mit pinkfarbenem Leuchtstift markiert, damit alle sehen, was sie mir angetan haben. Ich kann noch so sehr versuchen, die Narben unter meinen Haaren und meiner Kleidung zu verstecken, sie sind da und werden es für immer sein. Eine unauslöschliche Erinnerung an die Nacht, in der so viel von dem, was an meinem Leben gut und an mir schön war, zerstört wurde.
Eigentlich gebe ich nichts auf Jahrestage, aber als ich heute Morgen aufgewacht bin, wusste ich sofort, welches Datum ist. Das lag vermutlich daran, dass es das Letzte war, woran ich vor dem Einschlafen gedacht hatte. Heute vor zwei Jahren ist im Haus meines Vaters das Feuer ausgebrochen, in dem ich beinahe ums Leben gekommen wäre. Möglicherweise ist das der Grund, warum ich mich ausgerechnet heute mit ihm verabredet habe. Vielleicht habe ich ja insgeheim gehofft, er würde sich auch an das Datum erinnern und etwas sagen, das mich tröstet. Natürlich hat er sich schon oft bei mir entschuldigt, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich ihm jemals verzeihen soll, was passiert ist.
Obwohl ich seit der Scheidung meiner Eltern bei meiner Mutter wohne, habe ich vor dem Brand immer auch ein-, zweimal pro Woche bei meinem Vater übernachtet. Am Morgen des Tages, an dem das Haus brannte, hatte ich ihm per SMS angekündigt, dass ich bei ihm schlafen würde. Hätte er in dem Moment, in dem er die Flammen bemerkte, nicht sofort nach oben in mein Zimmer stürzen müssen, um mich zu retten?
Das hat er nicht getan. Schlimmer noch. Er hatte völlig vergessen, dass ich da war. Niemand wusste, dass noch jemand im Haus war, bis die Feuerwehrleute meine Schreie hörten. Ich weiß, dass mein Vater sich deswegen schuldig fühlt. Er hat sich wochenlang jedes Mal bei mir entschuldigt, wenn er zu mir ins Krankenhaus kam. Mit der Zeit sind seine Besuche dann seltener geworden, genau wie seine Anrufe und auch die Entschuldigungen. Seitdem habe ich mich innerlich immer weiter von ihm entfernt, auch wenn ich wünschte, es wäre anders. Ich weiß, dass der Brand durch eine Verkettung unglücklicher Umstände entstanden ist, für die niemand etwas kann. Ich habe überlebt. Das sind die Tatsachen, auf die ich mich zu konzentrieren versuche. Trotzdem fällt es mir schwer, keine Verbitterung zu empfinden, wenn ich mich im Spiegel sehe.
Oder wenn jemand anderes mich ansieht.
Die Tür schwingt auf. Eine Frau kommt herein, bemerkt mich und wendet schnell den Blick ab, bevor sie die letzte Kabine in der Reihe ansteuert.
Tja, wäre sie mal lieber in die erste gegangen.
Früher hatte ich einen schulterlangen Bob mit kurzem Pony, aber seit zwei Jahren lasse ich mir die Haare lang wachsen. Jetzt streiche ich mir die dunklen Strähnen wieder so hin, dass sie meine linke Gesichtshälfte fast völlig verdecken. Ich ziehe den linken Ärmel meiner Bluse bis zum Handgelenk herunter und klappe den Kragen hoch, um meinen Hals zu verstecken. Dadurch sind die Narben kaum sichtbar und ich ertrage es besser, mich im Spiegel zu betrachten.
Früher fand ich mich hübsch, jetzt können Haare und Kleidung nur einen Teil meiner Hässlichkeit kaschieren.
Als ich die Spülung rauschen höre, trete ich schnell die Flucht an, bevor die Frau aus der Kabine kommt.
Ich gehe anderen Leuten möglichst aus dem Weg. Nicht etwa, weil ich Angst hätte, sie könnten mich anstarren, sondern weil sie mich eben gerade nicht anstarren. Mir ist aufgefallen, dass die meisten Menschen sofort wegschauen, sobald sie meine Narben sehen. Wahrscheinlich aus Höflichkeit, weil sie mir nicht das Gefühl geben wollen, entstellt zu sein. Ich fände es schön, wenn mir zur Abwechslung mal wieder jemand in die Augen schauen würde. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Auch wenn ich es mir ungern eingestehe: Ich vermisse die bewundernden Blicke, die mir früher oft zugeworfen wurden.
Als ich wieder ins Lokal komme, bin ich fast enttäuscht zu sehen, dass mein Vater immer noch an unserem Tisch sitzt. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn er während meiner Abwesenheit einen Anruf bekommen und wegen irgendeiner dringenden Sache sofort hätte aufbrechen müssen.
Während ich darüber nachdenke, wie traurig es ist, dass ich lieber an einen leeren Tisch zurückgekehrt wäre, bemerke ich plötzlich jemanden in der benachbarten Nische.
Normalerweise achte ich nicht auf die Leute in meiner Umgebung, weil ich lieber gar nicht mitbekommen möchte, wie sie krampfhaft versuchen, jeglichen Augenkontakt mit mir zu vermeiden. Aber dieser Typ, der ungefähr in meinem Alter ist, sieht mich sehr eindringlich an. Neugierig. Offen.
Schade, dass ich die Zeit nicht um zwei Jahre zurückdrehen kann. Der Typ ist nämlich echt süß, und zwar nicht auf diese glatte, übertrieben gestylte Art, die in Hollywood so verbreitet ist. Hier sehen die Männer alle mehr oder weniger gleich aus, als gäbe es so etwas wie den Idealtypus des erfolgreichen Jungschauspielers, dem sie alle zu entsprechen versuchen.
Vor mir sitzt das genaue Gegenteil davon. Die Bartstoppeln auf seinen Wangen sind nicht zu einem exakt abgezirkelten Kunstwerk geschnitten, sondern sprießen so ungleichmäßig, als hätte er bis spätnachts gearbeitet und wäre nicht dazu gekommen, sich zu rasieren. Seine dunkelbraunen Haare sind nicht mit Gel in Form gezupft, um ihnen einen Ich-bin-gerade-aufgestanden-Look zu verpassen, sondern stehen zerzaust nach allen Seiten ab. So sieht man aus, wenn man tatsächlich verschlafen hat und keine Zeit hatte, in den Spiegel zu schauen.
Merkwürdigerweise finde ich seine abgerockte Erscheinung kein bisschen abschreckend, sondern im Gegenteil sogar ziemlich anziehend. Er wirkt, als wäre ihm sein Äußeres komplett egal, und ist dabei trotzdem einer der hübschesten Männer, denen ich je begegnet bin.
Glaube ich.
Vielleicht ist das ja auch nur eine paradoxe Nebenwirkung meines Hygienefimmels, und ich sehne mich insgeheim so sehr nach der Unbekümmertheit, die dieser Typ ausstrahlt, dass ich sie mit Attraktivität verwechsle.
Oder fühle ich mich vielleicht deshalb zu ihm hingezogen, weil er zu den wenigen Menschen gehört, die meinem Blick nicht ausweichen, sondern ihn erwidern?
Ich bin hin- und hergerissen, ob ich schneller gehen soll, um diesen Augen zu entgehen, oder extra langsam, um die Aufmerksamkeit zu genießen, die er mir schenkt.
Als ich an seinem Tisch vorbeikomme, wendet er sich mir zu, und jetzt wird mir sein Interesse doch zu viel. Ich spüre, wie ich rot anlaufe, senke hastig den Blick und lasse meine Haare wie einen Vorhang vors Gesicht fallen. Eben habe ich noch bedauert, dass niemand mich mehr anschaut, und jetzt, wo es jemand tut, will ich nur noch, dass er wegsieht.
Als ich im letzten Moment noch einmal kurz in seine Richtung spähe, erhasche ich den Anflug eines Lächelns.
Offensichtlich hat er meine Narben nicht bemerkt, sonst hätte er garantiert nicht gelächelt.
Gott. Es kotzt mich selbst an, dass ich solche Gedanken habe. Das ist einfach nur erbärmlich. Früher war ich ganz anders. Aber meine Selbstsicherheit von damals ist in den Flammen verschmort. Ich habe zwar daran gearbeitet, mir ein kleines bisschen davon zurückzuholen, doch es fällt mir trotzdem wahnsinnig schwer zu glauben, ich könnte jemand anderem gefallen, wenn ich meinen eigenen Anblick schon selbst nicht ertrage.
»Davon kriegt man einfach nie genug«, sagt mein Vater, als ich ihm gegenüber wieder in die Bank rutsche. Ich sehe ihn überrascht an, weil ich fast vergessen hatte, dass er ja auch noch da ist.
»Wovon?«
Mit der Gabel zeigt er in Richtung des Kellners, der jetzt an der Kasse steht. »Davon«, sagt er. »Fans.« Er schiebt sich einen Bissen in den Mund. »Also. Was willst du mit mir besprechen?«
»Warum glaubst du, dass ich etwas besprechen will?«
Er zuckt mit den Schultern. »Wir treffen uns zum Mittagessen. Offensichtlich hast du mir irgendwas zu sagen.«
Es macht mich traurig, dass unsere Beziehung mittlerweile einen solchen Tiefpunkt erreicht hat. Dass hinter einer simplen Essensverabredung nicht einfach der Wunsch einer Tochter stecken kann, mal wieder ihren Vater zu sehen.
»Ich ziehe morgen nach New York. Na ja, eigentlich schon heute Nacht. Aber mein Flug geht so spät, dass ich offiziell erst am 10. November in New York lande.«
Mein Vater greift nach seiner Serviette, presst sie sich an die Lippen und unterdrückt ein Husten. Jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass es eins ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich vor Schreck über meine Ankündigung verschluckt hat.
»New York?«, wiederholt er ungläubig.
Und dann lacht er.
Lacht. Als fände er die Vorstellung, dass ich in New York leben könnte, unfassbar lustig. Ganz ruhig, Fallon. Dein Vater ist ein arroganter Arsch. Das ist nichts Neues.
»Was um alles in der Welt willst du dort? Und warum? Wie kommst du ausgerechnet auf New York?«, fragt er. »Und sag jetzt bitte nicht, du hättest jemanden auf einer Dating-Website kennengelernt.«
Mein Puls rast. Kann er nicht wenigstens so tun, als würde er mich ernst nehmen?
»Na ja, ich finde, es wird langsam Zeit für mich, wieder Tritt zu fassen, und ich dachte … ich könnte es am Broadway versuchen.«
Als Siebenjährige hat er mich mal nach New York mitgenommen und ist mit mir in eines der großen Musical-Theater am Broadway gegangen, wo wir Cats gesehen haben. Der Abend gehört zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen. Mein Vater hat sich immer gewünscht, dass ich Schauspielerin werde, aber erst in dem Moment, in dem ich zum ersten Mal richtige, echte Menschen auf einer Bühne erlebt habe, wusste ich, dass ich Schauspielerin werden muss. Seitdem schlägt mein Herz fürs Theater. Aber obwohl ich immer davon geträumt habe, eines Tages selbst auf der Bühne zu stehen, habe ich dieses Ziel nie verfolgt, weil mein Vater jeden Schritt meiner Karriere für mich geplant hat. Und für ihn stand von Anfang an fest, dass ich natürlich zum Film gehen würde. Ich habe keine Ahnung, ob ich so mutig bin, tatsächlich an einem Vorsprechen teilzunehmen – immerhin habe ich seit zwei Jahren nicht mehr gearbeitet. Aber die Entscheidung, nach New York zu ziehen, ist zumindest ein erster Versuch, mich aus der Erstarrung zu lösen, die mich seit dem Brand lähmt.
Mein Vater nimmt einen Schluck von seinem Wasser. »Ach, Fallon«, seufzt er und stellt das Glas ab. »Ich weiß, dass du die Schauspielerei vermisst, aber meinst du nicht, dass es an der Zeit wäre, Alternativen auszuloten?«
Wie bitte? Wenn ich nicht so vor den Kopf gestoßen wäre, würde ich ihn jetzt darauf hinweisen, wie unglaublich inkonsequent es ist, so etwas zu sagen. Schließlich war er es, der mich mein gesamtes Leben lang gedrängt hat, in seine Fußstapfen zu treten. Allerdings war nach dem Brand nie mehr die Rede davon, dass ich weiterhin als Schauspielerin arbeiten kann.
Ich bin nicht naiv. Natürlich weiß ich, dass er denkt, ich würde nicht mehr die nötigen Voraussetzungen mitbringen. Und vermutlich hat er damit sogar recht. Aussehen spielt in Hollywood nun mal eine wahnsinnig wichtige Rolle.
Aber genau aus diesem Grund will ich nach New York. Wenn ich jemals wieder als Schauspielerin arbeiten möchte, habe ich am Theater vermutlich noch am ehesten eine Chance.
Es verletzt mich, dass er mir so offen zeigt, wie wenig er von meinem Plan hält. Im Gegensatz zu ihm fand meine Mutter die Idee sofort toll. Sie hat sich schon Sorgen um mich gemacht, weil ich kaum noch vor die Tür gegangen bin, seit ich nach dem Schulabschluss mit meiner Freundin Amber zusammengezogen bin. Natürlich ist sie traurig, dass ich so weit wegziehe, aber ich spüre auch, wie stolz und glücklich es sie macht, dass ich mich aus der Sicherheit meines Zuhauses hinauswage.
Warum kann nicht auch mein Vater sehen, was für ein großer und wichtiger Schritt das für mich ist?
»Wovon willst du leben?«, fragt er.
»Ich arbeite weiter als Sprecherin. Stell dir vor, in New York gibt es auch Tonstudios, in denen Hörbücher eingelesen werden.«
Er verdreht nur die Augen.
»Was hast du gegen Hörbücher?«
Er wirft mir einen ungläubigen Blick zu. »Ich bitte dich. Du weißt selbst, dass Sprecherjobs unterste Schublade sind. Warum suchst du dir nicht was Besseres, Fallon? Du könntest studieren.«
Mir wird richtig schlecht. Wie gefühllos kann ein Mensch sein?
Ein kleiner Funke Mitgefühl scheint ihm geblieben zu sein, denn er hört auf zu kauen und wischt sich mit der Serviette über den Mund. »Zieh nicht so ein Gesicht. Du weißt, dass ich das nicht so gemeint habe. Ich wollte damit nicht sagen, dass Hörbücher unter deiner Würde sind, sondern nur, dass du dir einen Beruf suchen solltest, in dem du angemessen bezahlt wirst … Jetzt, wo du nicht mehr schauspielern kannst, meine ich. Als Sprecherin verdienst du doch nichts. Am Broadway übrigens auch nicht.« Das Wort Broadway spuckt er verächtlich aus.
»Nur zu deiner Information, Dad: Es gibt sehr viele sehr erfolgreiche und angesehene Kollegen, die Hörbücher einlesen. Und wenn du noch ein paar Stunden Zeit hast, kann ich dir gern auch die Namen sämtlicher Top-Schauspieler aufzählen, die gerade am Broadway spielen.«
Mein Vater tut, als würde er sich achselzuckend geschlagen geben, aber ich sehe ihm an, dass ich ihn nicht überzeugt habe. Er hat nur ein schlechtes Gewissen, weil er die einzige Sparte schlechtgemacht hat, die mir als Schauspielerin noch offensteht.
Obwohl sein Glas leer ist, greift er danach, legt den Kopf weit in den Nacken und fängt den letzten Rest des geschmolzenen Eiswürfelwassers auf. Dann schwenkt er es in der Luft, bis der Kellner ihn bemerkt und zu uns eilt.
Ich probiere von meinem Lachs, der inzwischen kalt geworden ist. Hoffentlich hat Dad bald aufgegessen, damit ich von hier wegkomme. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn noch ertragen kann. Mein einziger Trost ist, dass ich morgen um diese Zeit schon am anderen Ende des Kontinents lebe, selbst wenn das bedeutet, dass ich Sonnenschein gegen Schnee eintauschen muss.
»Ach so, halt dir Mitte Januar bitte frei«, wechselt er unvermittelt das Thema. »Da bräuchte ich dich nämlich in L.A.«
»Warum? Was passiert im Januar?«
»Dein alter Herr kommt noch mal unter die Haube.«
Ich sinke in mich zusammen. »Erschieß mich bitte, ja?«
»Fallon. Du kannst gar nicht beurteilen, ob du sie magst oder nicht, bevor du sie nicht kennengelernt hast.«
»Ich muss sie nicht kennenlernen, um zu wissen, dass ich sie nicht mag«, widerspreche ich. »Es genügt mir zu wissen, dass sie dich heiratet.« Ich lächle, als wäre das ein Witz, bin mir aber sicher, er weiß, dass ich jedes Wort genau so meine.
»Darf ich dich daran erinnern, dass deine Mutter mich auch mal geheiratet hat? Und soweit ich weiß, hast du sie ganz gern«, antwortet er.
»Punkt für dich. Zu meiner Verteidigung möchte ich allerdings anführen, dass das schon die fünfte Frau ist, der du einen Antrag machst, seit ich zehn bin.«
»Aber erst die dritte, die ich auch wirklich heirate.«
Ich nehme noch einen Bissen von dem eiskalten Lachs. »Wenn ich mir dich so ansehe, vergeht mir die Lust, überhaupt jemals zu heiraten«, sage ich mit vollem Mund.
Er lacht. »Das dürfte für dich kein so großes Opfer werden. Meines Wissens hast du dich nur ein einziges Mal mit einem Jungen getroffen, und das ist mittlerweile zwei Jahre her.«
Mir bleibt der Bissen im Hals stecken.
Wo war ich, als die netten Väter verteilt wurden? Warum habe ich dieses katastrophale Exemplar abbekommen?
Jedenfalls ist jetzt klar, dass er wirklich keine Ahnung hat, was heute für ein Tag ist. Wenn er es wüsste, hätte er so etwas Gefühlloses nicht gesagt.
Er legt die Stirn in tiefe Falten, woran ich erkenne, dass er sich mies fühlt und gerade dabei ist, eine Entschuldigung zu formulieren. Mag ja sein, dass ihm das nur als gedankenloser Witz herausgerutscht ist, aber so leicht lasse ich ihn nicht davonkommen.
Ich nehme meine Haare im Nacken zusammen, sehe ihm fest in die Augen und setze mich so hin, dass er meine linke Gesichtshälfte sieht. »Tja, weißt du, Dad. Es gibt nicht mehr so viele Jungs, die sich mit mir treffen wollen, seit das da passiert ist.« Noch bevor der Satz ganz raus ist, bereue ich ihn auch schon.
Warum lasse ich mich immer wieder auf sein Niveau herab? Das habe ich nicht nötig.
Sein Blick huscht kurz über meine Wange. Er guckt betreten und sieht tatsächlich aus, als würde es ihm leidtun.
Ich beschließe, meine Verbitterung herunterzuschlucken und Milde walten zu lassen. Aber bevor ich etwas Versöhnliches sagen kann, steht der Typ, der in der Nische hinter Dad saß, plötzlich auf, und ich kann nicht mehr klar denken. Ich lasse den Haarvorhang schnell wieder vors Gesicht fallen, damit er mich nicht sieht, wenn er sich umdreht. Zu spät. Er lächelt wieder, und diesmal wende ich den Blick nicht ab, sondern starre ihn mit großen Augen an, weil er nämlich zu uns rüberkommt. Noch bevor ich reagieren kann, ist er auch schon neben mich in die Bank gerutscht.
Was wird das?
»Sorry, dass ich zu spät bin, Süße«, sagt er und legt mir einen Arm um die Schulter.
Er hat mich gerade »Süße« genannt. Dieser wildfremde Typ hat mich »Süße« genannt. Dieser wildfremde Typ hat gerade den Arm um mich gelegt und mich »Süße« genannt.
Was passiert hier?
Hat mein Vater irgendetwas damit zu tun? Aber der sieht noch verwirrter aus, als ich es bin.
Ich zucke zusammen, als der Typ mir einen Kuss auf die Schläfe drückt. »Du weißt ja, um diese Zeit ist immer ein Höllenverkehr.«
Der wildfremde Typ hat mich eben geküsst.
Hilfe!
Jetzt streckt er meinem Vater die Hand hin. »Hallo. Ich bin Ben«, stellt er sich vor. »Benton James Kessler. Der Freund Ihrer Tochter.«
Der … WAS?
Die beiden geben sich die Hand. Als ich merke, dass mein Mund offen steht, schließe ich ihn schnell wieder. Mein Vater soll auf keinen Fall merken, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, was hier vor sich geht. Aber ich will auch nicht, dass dieser Ben womöglich auf die Idee kommt, mein Mund würde offen stehen, weil ich ihn so umwerfend finde. Ich sehe ihn nur deswegen so an, weil er … na ja … weil er ganz offensichtlich wahnsinnig ist.
Er lässt die Hand meines Vaters los, lehnt sich zurück und zwinkert mir fast unmerklich zu. Dann beugt er sich so dicht zu meinem Ohr, dass ich ihm eigentlich eine knallen müsste, und flüstert: »Spiel einfach mit.«
Immer noch lächelnd, richtet er sich wieder auf.
Spiel einfach mit?
Ist das hier eine Impro-Übung, oder was?
Und dann begreife ich.
Er hat unser ganzes Gespräch mitangehört und tut jetzt aus irgendeinem unerklärlichen Grund so, als wäre er mein Freund, um meinem Vater eins auszuwischen.
Wow. Ich glaube, ich finde meinen neuen Fake-Freund ziemlich toll.
Nachdem ich jetzt weiß, dass er meinem Vater nur etwas vorspielt, lächle ich ihn verliebt an. »Cool. Ich hätte nicht gedacht, dass du es noch schaffst.« Ich kuschle mich an ihn und strahle meinen Vater an.
»Du weißt doch, dass ich deinen Dad unbedingt kennenlernen wollte, Schatz. Und so viele Gelegenheiten gibt es dazu ja nicht, weil ihr euch so selten seht. Mich hätte heute kein Stau der Welt davon abhalten können, herzukommen.«
Ich werfe meinem neuen Fake-Freund ein zufriedenes Lächeln zu. Dieser Ben hat anscheinend auch einen Arsch zum Vater, sonst wüsste er nicht so genau, was er sagen muss, um ihn auf die Palme zu bringen.
»Ach so, entschuldigen Sie bitte«, sagt Ben zu meinem Vater. »Fallon spricht von Ihnen immer nur als ›Dad‹, ich weiß gar nicht, wie Sie richtig heißen.«
Mein Vater runzelt leicht irritiert die Stirn. Es ist einfach zu schön!
»Donovan O’Neil«, sagt er. »Den Namen haben Sie vermutlich schon gehört. Ich habe die Hauptrolle in …«
»Nein«, unterbricht ihn Ben. »Der Name sagt mir leider gar nichts.« Wieder zwinkert er mir zu. »Aber Fallon hat mir schon viel über Sie erzählt.« Er zwickt mich liebevoll ins Kinn, bevor er sich wieder meinem Vater zuwendet. »Und was sagen Sie dazu, dass Ihre Tochter nach New York zieht?« Er sieht mich an. »Mich macht es natürlich todtraurig, dass sie so weit weggeht, aber wenn sie dadurch ihren Traum verwirklicht, bin ich der Letzte, der ihr Steine in den Weg legt. Im Gegenteil, ich sorge natürlich dafür, dass mein kleiner Käfer nachher auf keinen Fall den Flug verpasst.«
Mein kleiner Käfer? Dieser Ben kann froh sein, dass er nicht mein echter Freund ist, sonst würde ich ihm nämlich zum Dank für diesen bescheuerten Kosenamen in die Eier treten. Und das wäre dann garantiert echt.
Dad räuspert sich. Es ist offensichtlich, dass er schon jetzt nichts von Ben hält. »Ich kann mir eine ganze Reihe von Träumen vorstellen, die eine Achtzehnjährige verwirklichen sollte, Klinkenputzen am Broadway gehört ganz bestimmt nicht dazu. Besonders nicht nach der Karriere, die hinter ihr liegt. In meinen Augen ist das ein gigantischer Rückschritt. Fallon kann mehr aus ihrem Leben machen.«
Ich spüre, wie Ben sich neben mir aufrichtet und die Schultern strafft. Er riecht unheimlich gut. Glaube ich jedenfalls. Es ist lange her, dass ich einem Typen so nah war. Vielleicht riechen Männer ja einfach so.
»Dann ist es ja umso besser, dass sie volljährig ist«, sagt er. »Mit achtzehn interessiert es einen nicht mehr wirklich, wie Eltern ›was man aus seinem Leben machen sollte‹ definieren.«
Ich weiß natürlich, dass das alles nur Theater ist, aber es tut mir unglaublich gut, dass jemand so für mich eintritt. Mir wird innerlich ganz warm.
»In diesem Fall ist es aber nicht irgendeine elterliche Definition, sondern die Einschätzung von jemandem, der selbst aus der Branche kommt«, sagt mein Vater trocken. »Glauben Sie mir, ich bin lange genug im Showbusiness und weiß, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um auszusteigen.«
Ich drehe ihm ruckartig den Kopf zu, während sich Bens Griff um meine Schulter verfestigt.
»Aussteigen?«, fragt Ben. »Sie meinen, Ihre Tochter sollte ihren Beruf aufgeben?«
Mein Vater verschränkt die Arme vor der Brust und sieht Ben gereizt an. Ben lässt mich los, verschränkt ebenfalls die Arme und liefert sich ein stummes Blickduell mit ihm.
Obwohl mir die angespannte Atmosphäre unangenehm ist, bin ich gleichzeitig hingerissen. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand meinem Vater so die Stirn geboten hat.
»Hören Sie, Ben.« Dad sagt den Namen, als würde er faulig schmecken. »Fallon braucht niemanden, der ihren Kopf mit schwachsinnigen Ideen füllt, nur weil Sie die Vorstellung reizt, in Zukunft ein Betthäschen an der Ostküste zu haben.«
Hat mein Vater mich gerade als Betthäschen bezeichnet? Mein Mund steht wieder offen, während er weiterredet.
»Sie ist intelligent und selbstbewusst genug, um zu akzeptieren, dass sie in dem Beruf, auf den sie ein Leben lang hingearbeitet hat, keine Chance mehr hat, seit sie …« Er macht eine Handbewegung in meine Richtung. »Seit sie …«
Er beendet den Satz nicht, aber ich weiß natürlich ganz genau, was es ist, das er anscheinend nicht herausbringt.
Vor zwei Jahren war ich noch eine vielversprechende Nachwuchsschauspielerin, der eine große Karriere vorhergesagt wurde, aber nachdem mein Aussehen in Flammen aufgegangen war, hat mir der Sender den Vertrag gekündigt. Manchmal habe ich das Gefühl, mein Vater trauert mehr darum, dass er jetzt nicht mehr mit seiner erfolgreichen Tochter angeben kann, als dass ich durch seine Unachtsamkeit für immer entstellt bin.
Bisher haben wir nie darüber gesprochen, dass ich wieder mit der Schauspielerei anfangen könnte. Wir sprechen sowieso kaum noch über irgendetwas. Eineinhalb Jahre lang hat er praktisch jeden Tag mit mir am Set verbracht, jetzt sehe ich ihn maximal einmal im Monat.
Aber genau deswegen will ich, dass er seinen angefangenen Satz zu Ende bringt. Ich warte seit zwei Jahren darauf, dass er mir offen ins Gesicht sagt, die Brandnarben seien der Grund dafür, dass ich keine Angebote mehr bekomme. Bis jetzt haben wir nie darüber geredet, warum ich nicht mehr im Geschäft bin. Nur dass ich es nicht mehr bin. Und wenn er schon mal dabei ist, kann er ruhig auch zugeben, dass in dem Feuer damals nicht nur mein Äußeres, sondern auch unsere Beziehung dran glauben musste. Seit er nicht mehr mein Agent und Schauspiellehrer sein kann, hat er absolut keine Idee, wie er seine Vaterrolle ausfüllen soll.
Ich verenge die Augen. »Seit ich was …?«
Er schüttelt den Kopf, als würde er jetzt gern das Thema wechseln. Aber ich lasse nicht locker und sehe ihn auffordernd an.
»Müssen wir das wirklich hier und jetzt im Detail besprechen?«, fragt er schließlich, schaut dabei aber nicht mich an, sondern meinen neuen Fake-Freund.
»Definitiv. Ja.«
Mein Vater schließt einen Moment die Augen und seufzt schwer, dann beugt er sich vor und presst die Handflächen auf die Tischplatte. »Du weißt, dass du für mich die Allerschönste bist, Fallon. Leg mir also bitte nichts in den Mund, was ich nicht gesagt habe. Es geht hier einzig und allein darum, dass die Branche andere Ansprüche an das Aussehen eines Mädchens stellt als ein Vater. Uns bleibt nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Offen gestanden dachte ich bis gerade eben, wir hätten das längst begriffen.« Während er spricht, heftet er seinen Blick die ganze Zeit auf Ben. Mich sieht er nicht an.
Ich beiße mir auf die Innenseite der Wangen, damit mir nicht irgendetwas herausrutscht, das ich bereuen würde. Ich habe es immer gewusst. Als ich mich im Krankenhaus zum ersten Mal im Spiegel gesehen habe, war mir klar, dass alles vorbei ist. Jetzt aber meinen Vater laut sagen zu hören, ich solle meinen Lebenstraum endgültig begraben, trifft mich bis ins Innerste.
»Ernsthaft …« Ben sieht erschüttert aus. »Das ist …« Er schüttelt den Kopf. »Sie sind ihr Vater.«
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass die Empörung auf seinem Gesicht echt ist und nicht bloß gespielt.
»Ganz genau. Ich bin ihr Vater und nicht ihre Mutter, die ihr rosa Zuckerwatteträume in den Kopf setzt, weil sie hofft, dass sich ihr kleines Mädchen dann besser fühlt. In New York und Los Angeles laufen Tausende junger Frauen herum, die den gleichen Traum haben wie den, auf den Fallon ihr Leben lang hingearbeitet hat. Junge Frauen, die unfassbar talentiert sind und bildschön. Fallon weiß, dass ich davon überzeugt bin, dass sie mehr Talent hat als all diese Mädchen zusammen, aber sie ist auch Realistin. Jeder Mensch hat Träume – bedauerlicherweise stehen Fallon nicht mehr die nötigen Werkzeuge zur Verfügung, um ihren zu verwirklichen. Damit sollte sie sich abfinden, statt Zeit und Geld zu verschwenden und in eine Stadt zu ziehen, in der in beruflicher Hinsicht niemand auf sie wartet. Es wird nicht lange dauern, bis sie das selbst merkt.«
Ich schließe kurz die Augen. Wer auch immer gesagt hat, dass die Wahrheit wehtut, hat massiv untertrieben. Die Wahrheit ist ein mieses Dreckstück.
»Meine Güte«, murmelt Ben kopfschüttelnd. »Sie sind wirklich unmöglich.«
»Und Sie sind ein Träumer«, gibt mein Vater zurück.
»Ben?« Ich stupse ihn an, damit er mich rauslässt. Ich kann nicht mehr.
Statt aufzustehen, legt er unter der Tischplatte die Hand auf mein Knie und signalisiert mir, dass ich sitzen bleiben soll.
Ich erstarre unter seiner Berührung, weil mein Gehirn gerade die unterschiedlichsten Emotionen verarbeiten muss. Ich bin wütend auf meinen Vater. Wahnsinnig wütend. Gleichzeitig tröstet es mich unendlich, dass dieser wildfremde Mensch mir aus unerfindlichen Gründen beisteht. Ich würde am liebsten laut schreien oder lachen, und auf einmal merke ich auch wieder, wie hungrig ich bin. Ich brauche jetzt dringend eine Portion Lachs, verdammt noch mal. Warmen Lachs!
Ich versuche, tief durchzuatmen und mich zu entspannen, damit Ben nicht merkt, was seine Berührung in mir auslöst. Ich bin schon lange nicht mehr so angefasst worden und einfach nicht mehr daran gewöhnt.
»Beantworten Sie mir bitte eine Frage, Mr O’Neil«, sagt Ben. »Hatte Johnny Cash eine Hasenscharte?«
Ich sehe ihn erstaunt an und hoffe, dass diese merkwürdige Frage irgendeinen Sinn hat, der sich mir nur noch nicht erschließt.
Mein Vater wirft ihm einen Blick zu, als würde er an seinem Verstand zweifeln. »Was zum Teufel hat ein Countrysänger mit unserem Gespräch über Fallons Zukunft zu tun?«
»Eine ganze Menge«, antwortet Ben. »Und um die Frage selbst zu beantworten: Nein, hatte er nicht. Dafür hat der Schauspieler, der ihn in Walk The Line spielt, eine deutlich sichtbare Narbe auf der Oberlippe. Joaquin Phoenix ist für die Rolle sogar für den Oscar nominiert worden.«
Mein Puls beschleunigt sich, als ich begreife.
»Was ist mit Idi Amin?«, fragt Ben. »Hatte der ein hängendes Augenlid?«
Mein Vater sieht entnervt zur Decke, um zu zeigen, wie sehr ihn die Fragen langweilen. »Keine Ahnung. Hatte er?«
»Nein. Ganz im Gegensatz zu dem Schauspieler, der ihn spielt – Forest Whitaker. Der übrigens zufälligerweise nicht nur für einen Oscar nominiert war. Sondern ihn auch bekommen hat.«
Wieder schafft er es, meinen Vater sprachlos zu machen. Und obwohl mir die ganze Situation ziemlich unangenehm ist, ist sie mir nicht so unangenehm, dass ich diesen seltenen und kostbaren Moment nicht auch genießen könnte.
»Bravo.« Mein Vater tut völlig unbeeindruckt. »Unter Tausenden von Schauspielern mit körperlichen Makeln, die erfolglos herumkrebsen, ist es Ihnen gelungen, die einzigen beiden Ausnahmen herauszupicken.«
Ich versuche, seinen Kommentar nicht persönlich zu nehmen, auch wenn es mir schwerfällt. Mir ist klar, dass die beiden hier einen Machtkampf ausfechten, der nichts mehr mit mir zu tun hat. Trotzdem ist es bitter, dass mein Vater keinerlei Hemmungen hat, meine Gefühle zu verletzen, um aus einem Streit mit einem ihm völlig Fremden als Sieger hervorzugehen.
»Wissen Sie, was ich nicht verstehe, Mr O’Neil? Sie behaupten, an das Talent Ihrer Tochter zu glauben – warum ermutigen Sie sie dann nicht, ihren Traum weiterzuverfolgen? Warum wollen Sie, dass sie die Welt so sieht wie Sie?«
Mein Vater richtet sich auf. »Und wie sehe ich die Welt Ihrer Meinung nach, Mr Kessler?«
Ben lehnt sich zurück, ohne den Blickkontakt mit meinem Vater zu unterbrechen. »Mit den Augen eines vor Arroganz blinden Arschlochs.«
Das Schweigen, das jetzt folgt, scheint vor unterdrückter Wut beinahe elektrisch aufgeladen. Ich frage mich gerade, wer von den beiden als Erster aufspringen und dem anderen eine reinhauen wird, als mein Vater seinen Geldbeutel zückt und ein Bündel Dollarscheine auf den Tisch wirft. »Gut möglich, dass ich dich mit meiner Ehrlichkeit verletze, Fallon«, sagt er. »Wenn du dir lieber Lügen anhörst, dann ist dieser Schwachkopf genau der Richtige für dich.« Er rutscht aus der Nische und steht auf. »Ich wette, deine Mutter ist entzückt von ihm.«
Ich würde ihm gern etwas entgegenschleudern, das ihn genauso trifft. Irgendetwas, das so krass ist, dass sich sein Ego tagelang nicht davon erholt. Das Problem ist nur, dass es nichts gibt, womit man einen Mann verletzen könnte, der kein Herz hat.
Statt ihm also etwas hinterherzubrüllen, als er zum Ausgang geht, sitze ich nur schweigend da.
Mit meinem Fake-Freund.
Das ist der beschämendste und furchtbarste Moment meines Lebens.
Als ich spüre, wie die erste Träne aus meinem Augenwinkel quillt, stoße ich Ben mit dem Ellbogen an. »Ich muss raus«, flüstere ich mit rauer Stimme. »Bitte.«
Er steht auf. Ohne ihn anzusehen, schiebe ich mich an ihm vorbei und stürze zur Toilette. Es ist schlimm genug, dass er sich genötigt gefühlt hat, meinen Freund zu spielen und mich zu verteidigen. Aber dass er mitbekommen hat, wie ich in aller Öffentlichkeit den bislang heftigsten Streit mit meinem Vater hatte, ist noch schlimmer.
Wäre ich Benton James Kessler, hätte ich längst mit mir Schluss gemacht.
BEN
Den Kopf in die Hände gestützt, warte ich darauf, dass sie zurückkommt.
Ich sollte aufstehen und gehen.
Aber ich will nicht gehen. Mit der Nummer, die ich hier gerade abgezogen habe, habe ich ihr garantiert den Tag verdorben. Ich habe mich in ihr Leben gedrängt – leider nicht mit der Geschmeidigkeit eines Fuchses, wie ich es vorgehabt hatte, sondern mit der Brutalität eines tonnenschweren Elefanten.
Warum habe ich überhaupt geglaubt, mich einmischen zu müssen? Warum unterstelle ich ihr, dass sie nicht selbst mit ihrem Vater fertiggeworden wäre? Jetzt ist sie garantiert stinksauer auf mich, dabei ist unsere Fake-Beziehung gerade mal eine halbe Stunde alt.
Tja. Genau das ist der Grund, weshalb ich keine echte Freundin habe. Ich kann noch nicht mal so tun, als wäre ich mit einem Mädchen zusammen, ohne Mist zu bauen.
Immerhin habe ich ihr gerade eine neue – warme – Portion Lachs bestellt, vielleicht besänftigt sie das etwas.
Fallon kommt aus der Toilette und bleibt stehen, als sie mich sieht. Ihr verwunderter Gesichtsausdruck zeigt deutlich, dass sie damit gerechnet hat, ich wäre gegangen.
Hätte ich ja auch tun sollen. Schon vor einer halben Stunde.
Es gibt so einiges, das ich anders hätte machen sollen, aber jetzt ist es zu spät.
Ich stehe lächelnd auf. Sie kommt zum Tisch zurück, sieht mich aber misstrauisch an, als sie wieder in die Bank rutscht. Ich hole meinen Laptop, den Teller mit meinem kaum angerührten Burger und meine Cola aus der Nische, in der ich vorhin saß, und setze mich ihr gegenüber auf den Platz, an dem ihr Vater bis vor ein paar Minuten gesessen hat.
Sie schaut auf den Tisch und fragt sich wahrscheinlich, wo ihr Essen geblieben ist.
»Dein Lachs ist kalt geworden«, erkläre ich. »Ich hab den Kellner gebeten, dir einen neuen zu bringen.«
Sie lächelt nicht und bedankt sich auch nicht. Sie sieht mich nur an.
Vielleicht sollte ich erst mal abwarten, was sie sagt. Um die Zeit zu überbrücken, beiße ich von meinem Burger ab.
Sie schweigt. Aber das kann nicht daran liegen, dass sie schüchtern wäre, sonst hätte sie vorhin ihrem Vater niemals so Kontra gegeben. Ich schlucke den Bissen herunter, trinke von meiner Cola und sehe ihr die ganze Zeit in die Augen, während sie weiter stumm bleibt. Ich wollte, ich könnte behaupten, ich würde innerlich schon mal eine charmante Entschuldigung für meinen ziemlich dreisten Auftritt formulieren, aber das wäre gelogen. Mein Geist kreist um etwas, woran ich jetzt gerade wirklich überhaupt nicht denken sollte.
Genauer gesagt, sind es zwei Dinge.
Ihre Brüste.
Ich weiß. Völlig daneben. Aber ich kann nicht anders. Und gerade die Tatsache, dass sie trotz der Hitze draußen eine bis zum Hals zugeknöpfte langärmlige Bluse anhat, in der sie aussieht wie eine Klosterschülerin, befeuert meine Fantasie umso mehr.
Ein Pärchen, das ein paar Tische weiter gesessen hat, steht auf und schlendert an uns vorbei zum Ausgang. Fallon dreht sofort den Kopf weg und lässt ihre Haare wie einen Vorhang vors Gesicht fallen. Das passiert ganz automatisch. Ich glaube, sie merkt nicht mal, dass sie es macht. Wahrscheinlich trägt sie deshalb auch diese hochgeschlossene Bluse. Damit niemand sieht, was darunter ist. Wie weit die Narben nicht nur ihr Gesicht, sondern auch ihren Körper bedecken.
Es passiert mir nicht oft, dass ich jemanden so faszinierend finde, dass ich den Blick nicht abwenden kann. Eigentlich hat meine Mutter mir Manieren beigebracht und eingebläut, Mädchen nicht so ungeniert anzustarren. Allerdings hat sie mich nicht davor gewarnt, dass es Mädchen gibt, die meine guten Manieren durch ihre bloße Existenz pulverisieren.
Eine ganze Minute vergeht, vielleicht zwei. Ich esse den größten Teil meiner Fritten auf und sehe dabei Fallon an, wie sie mich ansieht. Sie wirkt nicht wütend. Auch nicht eingeschüchtert. Komischerweise versucht sie noch nicht mal, die Narben vor mir zu verstecken.
Irgendwann neigt sie den Kopf und lässt ihren Blick wandern. Zuerst zu meinem T-Shirt, dann über meine Arme und meine Schultern zum Gesicht hinauf, bis er schließlich kurz bei meinen Haaren verharrt, bevor sie mir wieder in die Augen sieht.
»Was war heute Morgen bei dir los?«
Die Frage ist so abwegig, dass ich mitten im Kauen innehalte. Ich hatte damit gerechnet, dass sie mich als Erstes fragen würde, was mir einfällt, mich so in ihr Leben einzumischen. Um meine Verwirrung zu überspielen, trinke ich einen Schluck Cola, wische mir mit der Serviette über den Mund und lehne mich zurück.
»Warum?«
»Deine Haare. Die sind total ungekämmt.« Sie zeigt auf mein T-Shirt. »Und du hast ziemlich sicher dasselbe an wie gestern.« Ihr Blick fällt auf meine Hände. »Aber du hast keine Schmutzränder unter den Nägeln.«
Woher weiß sie, dass ich das Shirt gestern schon anhatte?
»Also? Warum hattest du es heute Morgen so eilig?«
Ich betrachte meine Nägel. Woher zum Teufel weiß sie das?
»Jemand, der grundsätzlich keinen Wert auf sein Äußeres legt, hätte niemals so saubere Nägel«, erklärt sie ruhig. »Das passt aber nicht zu dem Senffleck auf deinem T-Shirt.«
Ich sehe erstaunt an mir herunter. Stimmt, da ist ein Senffleck.
»Zum Frühstück isst man normalerweise keinen Senf und auf deinem Burger ist nur Mayonnaise, also stammt der Fleck wahrscheinlich noch von deinem Abendessen gestern. Dass du die Fritten eben so in dich reingestopft hast, obwohl sie bestimmt längst eiskalt sind, lässt darauf schließen, dass du heute noch nichts gegessen hast. Und in den Spiegel hast du eindeutig auch noch nicht geschaut, sonst wärst du nicht aus dem Haus gegangen, ohne dir wenigstens mit den Fingern durch die Haare zu fahren. Hast du gestern Abend vielleicht noch geduscht und bist dann mit nassen Haaren ins Bett?«
Sie dreht eine Strähne ihrer langen Haare zwischen den Fingern. »Bei so dicken Haaren wie deinen kannst du das nicht machen. Die kriegst du am nächsten Morgen nur wieder hin, wenn du sie noch mal nass machst.« Sie beugt sich vor und sieht mich interessiert an. »Ich verstehe nur nicht, warum sie über der Stirn so komisch hochstehen. Oder hast du auf dem Bauch geschlafen?«
Was ist sie? Detektivin?
»Äh …« Ich sehe sie ungläubig an. »Ja. Tu ich immer. Außerdem hatte ich vergessen, meinen Wecker zu stellen, und hab mein Seminar verpasst.«
Sie nickt, als hätte ich damit nur bestätigt, was sie sowieso schon wusste.
Der Kellner kommt, stellt den Lachs vor sie hin und füllt ihr Wasserglas auf. Er öffnet den Mund, als wollte er etwas sagen, aber sie achtet nicht auf ihn, sondern sieht weiterhin mich an, während sie ein knappes »Danke« murmelt.
Er nickt und wendet sich zum Gehen, dann dreht er sich noch einmal um und knetet nervös die Hände. »Äh, sagen Sie … Donovan O’Neil? Ist er Ihr Vater?«
Sie sieht ihn mit unergründlicher Miene an. »Ja.«
Der Kellner lächelt. »Wahnsinn«, sagt er und schüttelt den Kopf. »Das ist ja ein Ding. Und wie ist das so, die Tochter von Max Epcott zu sein?«
Ihr Gesicht bleibt reglos. Nichts deutet darauf hin, dass sie diese Frage wahrscheinlich schon eine Million Mal gehört hat. Aber nachdem ich mitbekommen habe, wie sarkastisch sie vorhin auf ihren Vater reagiert hat, bin ich mir sicher, dass der Kellner auch nicht ungeschoren davonkommt.
Doch statt die Augen zu verdrehen, atmet sie nur langsam aus und knipst ein strahlendes Lächeln an. »Es ist total surreal. Ich bin die glücklichste Tochter der Welt.«
Der Kellner grinst. »Cool.«
Als er weg ist, fragt sie: »Was für ein Seminar?«
Ich brauche einen Moment, um ihre Frage zu verstehen, weil ich noch darüber nachdenke, warum sie dem Kellner gerade so einen Blödsinn erzählt hat. Vermutlich ist es einfacher, den Leuten zu sagen, was sie hören wollen, anstatt sie mit der harten Wahrheit zu konfrontieren. Außerdem ist sie anscheinend der loyalste Mensch, dem ich je begegnet bin. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage gewesen wäre, irgendetwas Nettes über den Mann zu sagen, den ich vorhin erlebt habe. Schon gar nicht, wenn er mein Vater wäre.
»Kreatives Schreiben.«
Fallon lächelt in sich hinein und greift nach ihrer Gabel. »Ich wusste, dass du kein Schauspieler bist.« Sie probiert von dem Lachs und schiebt sich gleich den nächsten Bissen auf die Gabel, während sie noch kaut. Ein paar Minuten vergehen, ohne dass einer von uns etwas sagt, weil wir beide mit unserem Essen beschäftigt sind. Ich lasse von meinem Burger und den Fritten keinen Krümel übrig, während sie ihren Teller nach der Hälfte zur Seite schiebt.
»Eine Frage.« Sie beugt sich vor. »Warum hast du geglaubt, du müsstest mir beistehen und diese ›Ich tu so, als wär ich dein Freund‹-Nummer abziehen?«
Also ist sie doch sauer. Hab ich mir doch gleich gedacht.
»Ich habe nicht geglaubt, dass du unbedingt Hilfe brauchst. Es ist nur so, dass es mir angesichts der Absurdität dieser Welt manchmal schwerfällt, meine Empörung im Zaum zu halten.«
Sie zieht eine Augenbraue hoch. »Okay, das ist der Beweis, dass du wirklich Kreatives Schreiben studierst. Wer redet denn so?«
Ich lache. »Tut mir leid. Eigentlich wollte ich damit nur sagen, dass ich ein Idiot bin, der sich manchmal nicht im Griff hat, und dass ich mich lieber um meine eigenen Angelegenheiten kümmern sollte …«
Sie nimmt ihre Serviette vom Schoß, knüllt sie zusammen und legt sie auf den Teller. »Ich fand es okay, dass du dich eingemischt hast«, sagt sie lächelnd. »Es war ziemlich witzig zu sehen, wie mein Vater immer wütender wurde. Außerdem hatte ich noch nie einen Fake-Freund.«
»Hey, da haben wir was gemeinsam«, sage ich. »Und falls es dich interessiert: Ich hatte überhaupt noch nie was mit einem Mann.«
Ihr Blick wandert zu meinen Haaren. »Keine Sorge, ich hätte dich niemals für schwul gehalten. Dann wärst du nämlich auf gar keinen Fall so aus dem Haus gegangen.«
Ich bezweifle, dass sie das wirklich schlimm findet, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand, der wegen seines eigenen Aussehens so unsicher ist, bei anderen Menschen gesteigerten Wert auf Äußerlichkeiten legt. Also will sie mich mit ihren Bemerkungen wahrscheinlich eher ein bisschen aufziehen. Kann es sein, dass sie … mit mir flirtet?
Jep. Es wäre definitiv vernünftiger gewesen, wenn ich vor einer Stunde gegangen wäre, aber ich habe in meinem Leben schon haufenweise schlechte Entscheidungen getroffen, und die hier gehört zu den wenigen, die ich ausnahmsweise mal nicht bereue.
Der Kellner kommt mit der Rechnung. Als ich meinen Geldbeutel heraushole, greift Fallon nach dem Bündel Dollarscheine, das ihr Vater auf den Tisch geworfen hat, und hält es ihm hin.
»Danke. Behalten Sie den Rest.«
Nachdem die Teller abgeräumt sind, kommt leichte Unruhe in mir auf. Der Moment des Abschieds rückt gnadenlos näher. Verdammt, ich würde so gern irgendetwas sagen, um ihn hinauszuzögern, aber mir fällt nichts ein. Sie zieht nach New York, was bedeutet, dass ich sie höchstwahrscheinlich nie mehr wiedersehe. Keine Ahnung, warum mich der Gedanke so nervös macht.
»Und wie geht es jetzt mit uns weiter?«, fragt sie. »Sollen wir Schluss machen?«
Ich lache, obwohl ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob sie einen unglaublich trockenen Humor hat oder zu den Menschen gehört, deren absolute Humorlosigkeit schon wieder witzig ist. Die Grenze zwischen beidem ist sehr unscharf, aber eigentlich bin ich mir sicher, dass sie wirklich so witzig ist. Jedenfalls hoffe ich es.
»Wir sind erst seit einer Stunde zusammen und du willst mich schon abservieren? Ich scheine kein besonders guter Freund zu sein.«
Sie grinst. »Im Gegenteil. Du bist mir ein bisschen zu gut. Das ist fast schon gruselig. Kommt jetzt der Moment, in dem du die Illusion des perfekten Traumfreunds zerstörst und mir gestehst, dass du meine Cousine geschwängert hast?«
Ich pruste los. Sie hat Humor. »Ich hab sie nicht geschwängert«, sage ich. »Als ich mit ihr im Bett gelandet bin, war sie schon im siebten Monat.«
Ihr Lachen ist so ansteckend, dass mir warm wird. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so dankbar dafür, einigermaßen schlagfertig zu sein. Verdammt, ich kann diesem Mädchen auf gar keinen Fall erlauben zu gehen, bevor sie mich nicht mindestens noch drei- oder viermal dieses Lachen hat hören lassen.
Sie wird wieder ernst und sieht zum Ausgang. »Heißt du wirklich Ben?«
Ich nicke.
»Okay. Was bereust du im Leben am meisten, Ben?«
Die Frage ist ungewöhnlich, aber was an diesem Mädchen ist schon gewöhnlich? Die Wahrheit kann ich ihr natürlich trotzdem auf keinen Fall sagen. »Ich glaube nicht, dass ich das, was ich am allermeisten bereuen würde, schon getan habe«, lüge ich.
Ihr Blick ist nachdenklich. »Also bist du ein anständiger Mensch? Du hast niemanden getötet?«
»Bis jetzt jedenfalls zum Glück noch nicht.«
Sie unterdrückt ein Lächeln. »Das heißt, dass du mich nicht umbringen wirst, falls wir heute noch ein bisschen länger zusammenbleiben?«
»Höchstens aus Notwehr.«
Sie greift lachend nach ihrer Tasche, hängt sie sich um und steht auf. »Das ist doch schon mal beruhigend. Dann schlage ich vor, dass wir jetzt zu Pinkberry gehen. Wir können ja nach dem Nachtisch Schluss machen.«
Ich mag keinen Joghurt. Ich mag kein Eis.
Und noch weniger mag ich Joghurt, der so tut, als wäre er Eis.
Aber das hält mich nicht davon ab, nach meinem Laptop und meinem Schlüsselbund zu greifen und ihr zu folgen, wohin auch immer sie mich führt.
»Du bist mit vierzehn nach Los Angeles gezogen und warst noch nie in deinem Leben bei Pinkberry?« Sie klingt so empört, als würde sie das als persönliche Beleidigung auffassen. »Hast du wenigstens schon mal von Starbucks gehört?«
Ich lache und zeige auf die Gummibärchen, worauf das Mädchen hinter der Theke mir eine Portion davon in den Becher löffelt. »Machst du Witze? Starbucks ist praktisch mein zweites Zuhause. Das gehört sich so, wenn man Schriftsteller werden will.«
Fallon wirft einen Blick in meinen Becher und rümpft die Nase. »Nicht zu fassen«, schimpft sie. »Man kann doch nicht zu Pinkberry gehen und sich dann nur Toppings nehmen!« Sie sieht mich an, als hätte ich gerade ein Katzenbaby erwürgt. »Bist du überhaupt ein Mensch?«
Ich schaue streng. »Hör auf, an mir rumzunörgeln, oder ich trenne mich von dir, noch bevor wir uns hingesetzt haben.« Nachdem ich bezahlt habe, schlängeln wir uns durch das überfüllte Lokal, müssen aber schnell feststellen, dass kein einziger Platz mehr frei ist. Fallon geht zur Tür, also folge ich ihr nach draußen, wo wir nach ein paar Metern eine Parkbank entdecken. Sie setzt sich im Schneidersitz darauf und stellt ihren Becher in den Schoß – Frozen Joghurt ohne irgendwelche Toppings.
Ich schaue auf meinen eigenen Becher, der ausschließlich mit Toppings gefüllt ist.
»Ich weiß«, sagt sie lachend. »Wir sind wie dieses Paar aus dem Kinderreim. Jack Sprat, der mochte kein Fett, seine Frau dagegen sehr …«
»… und teilten sie ihr Essen, wurde der Teller immer leer«, beende ich den Vers.
»Genau.« Fallon steckt sich grinsend den Löffel in den Mund, zieht ihn wieder heraus und leckt sich Joghurteis von der Unterlippe.
Als ich heute Morgen aufgewacht bin, hätte ich damit niemals gerechnet: diesem Mädchen dabei zuzusehen, wie sie sich Eis von der Lippe leckt, und nach Luft zu schnappen, um sicherzustellen, dass ich noch lebe.
»Und du bist also Schriftsteller?«
Mit dieser Frage gibt sie mir zum Glück etwas, an dem ich mich festhalten kann, bevor ich wie Frozen Joghurt in der Sonne zerschmelze. Ich nicke. »Zumindest würde ich gern mal einer werden. Bis jetzt habe ich aber noch nichts veröffentlicht, deswegen weiß ich nicht, ob ich mich überhaupt schon so nennen darf.«
Sie stützt einen Ellbogen auf die Rückenlehne der Bank und dreht sich zu mir. »Man muss noch kein Geld mit Schreiben verdient haben, um zu gerechtfertigen, dass man ein Schriftsteller ist.«
»Gerechtfertigen ist kein Wort.«
»Siehst du?«, sagt sie. »Das beweist, dass du mit Sprache umgehen kannst und ein echter Schriftsteller bist. Für mich bist du jedenfalls einer. Deswegen werde ich dich auch so nennen. Schriftsteller-Ben.«
Ich lache. »Und wie nenne ich dich?«
Sie knabbert an ihrem Löffel und verengt die Augen, während sie nachdenkt. »Gute Frage«, sagt sie. »Ich bin im Moment ein bisschen in einer Übergangsphase.«
»Die vorübergehende Fallon«, schlage ich vor.
Sie lächelt. »Das trifft es ganz gut.« Dann streckt sie die Beine aus und lehnt sich zurück. »Und was willst du später mal schreiben? Drehbücher oder Romane?«
»Da möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen, ich bin ja erst am Anfang. Am liebsten würde ich alles mal ausprobieren, aber so richtig leidenschaftlich werde ich definitiv, wenn es um Romane geht. Und Lyrik.«
Sie seufzt leise und nimmt noch einmal einen Löffel von ihrem Eis. Hat meine Antwort sie traurig gemacht?
»Wie sieht es bei dir aus, Vorübergehende Fallon? Was hast du dir für ein Lebensziel gesteckt?«
Sie wirft mir einen Blick zu. »Reden wir jetzt über unsere Leidenschaft oder unser Lebensziel?«
»Ist das nicht praktisch das Gleiche?«
Sie lacht, ohne zu lächeln. »Nein. Das ist sogar ein Riesenunterschied. Meine Leidenschaft ist die Schauspielerei, aber es ist nicht mein Lebensziel, um jeden Preis als Schauspielerin zu arbeiten.«
»Warum nicht?«
Fallon sieht mich mit schmalen Augen an, bevor sie wieder in ihren Becher schaut und mit dem Löffel darin herumrührt. Sie seufzt noch einmal. Diesmal mit dem ganzen Körper, als würde es sie innerlich zerreißen.
»Weißt du, Ben, ich finde es ja echt schön, dass du so nett bist, aber du kannst jetzt damit aufhören, mir was vorzuspielen. Mein Dad ist nicht mehr da.«
Ich wollte mir gerade eine Ladung Gummibärchen in den Mund schieben, erstarre aber mitten in der Bewegung. »Warum sagst du so was?«, frage ich, erschrocken darüber, dass unsere Unterhaltung diese plötzliche Bruchlandung gemacht hat.
Fallon hört auf, in ihrem Frozen Joghurt zu rühren, dann beugt sie sich unvermittelt zur Seite und wirft den Becher in den Mülleimer. Sie zieht die Beine hoch, schlingt die Arme um die Knie und sieht mich wieder an. »Soll ich dir meine Geschichte wirklich erzählen oder tust du bloß so, als wüsstest du nicht, wer ich bin?«
Ich schüttle den Kopf. »Jetzt verwirrst du mich. Sehr sogar.«
Sie seufzt wieder. Ich glaube nicht, dass ich schon jemals ein Mädchen in so kurzer Zeit so oft zum Seufzen gebracht habe. Leider ist es nicht die Art von Seufzer, die einen Mann stolz auf seine Fähigkeiten macht, sondern die, bei der man sich fragt, was man falsch gemacht hat.
»Mit vierzehn hatte ich das Glück, für eine neue Krimiserie für Jugendliche gecastet zu werden. Sie hieß Teen Detective – vielleicht hast du ja sogar mal was davon gehört.« Sie pult mit dem Daumennagel an einem Holzsplitter in der Rückenlehne und konzentriert sich so darauf, ihn herauszuhebeln, dass ich das Gefühl habe, sie redet mehr mit der Bank als mit mir. »Es ging um ein Mädchen, das eine Mischung aus weiblichem Sherlock Holmes und Veronica Mars ist und Verbrechen aufklärt. Ich hab die Rolle eineinhalb Jahre lang gespielt, die Quoten wurden immer besser und dann … ist das da