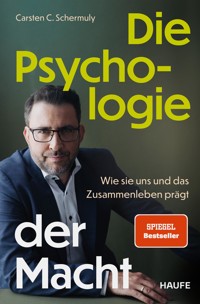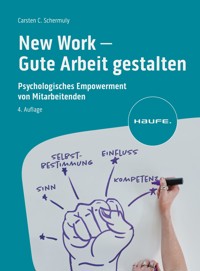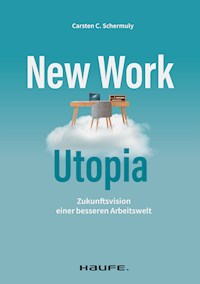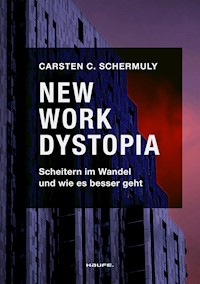
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
Spätestens seit 2020 hat die Popularität des Begriffs New Work sprunghaft zugenommen, wird aber auch zunehmend für Änderungen jeglicher Art in der Arbeitswelt missbraucht. Carsten C. Schermulys Buch greift dieses Scheitern von New Work in Form einer Dystopie auf und gibt ihm ein Gesicht. Dazu stellt er das fiktive Unternehmen Kaltenburg als "bösen Bruder" von Stärkande aus "New Work Utopia" vor. Hier beschreibt er, wie der Begriff "New Work" trivialisiert und instrumentalisiert wird, einzig um das Unternehmen profitabler zu machen. Kaltenburg zeigt, wie man die Ideen von New Work verraten und seine Mitarbeitenden damit "quälen" kann. Carsten C. Schermuly lässt Sie jedoch mit diesen Aussichten nicht allein und schlägt Ihnen inspirierende Maßnahmen vor, damit die Wende zum Positiven wieder gelingt. Ein Buch, das zum Nachdenken anregt! Carsten C. Schermuly gehört zu den 40 führenden HR-Köpfen, ausgezeichnet vom Personalmagazin 2021 und 2023. Inhalte: - Eine kleine Geschichte des Unternehmens Kaltenburg - Die wichtigsten Axiome der Kaltenburger: Kontrolle statt Vertrauen, die DEAD-Kulturwerte oder die Organisation als Maschine - New Work ist das, was gerade passt - Instrumentalisierung von Vertrauensarbeitszeit, offenen Büroflächen, Homeoffice, Agilität oder KI - Was Unternehmen tun können, um beim Thema "New Work" weniger zu scheitern: New Work aus der Zukunft denken, anständiger Umgang mit Führungskräften oder Diagnostik und Dialog "Beide Bücher 'New Work Utopia' und 'New Work Dystopia!' enthalten wertvolle, praxisnahe Anregungen für Führungskräfte und sollten in Qualifikationsmaßnahmen als Inspirations- und Reflexionsquelle genützt werden." Brigitte Winkler (Co-Editorin Zeitschrift OrganisationsEntwicklung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
[7]Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumDedicationVorwort: Warum die New-Work-Utopia einen teuflischen Zwilling brauchtTeil I: Die Wurzeln1 Eine kleine Geschichte des Unternehmens Kaltenburg: Kämpfe und Siege in Pirmasens2 Die vier Geschäftsbereiche von Kaltenburg2.1 Autositzbezüge und Innenausstattung von Kraftfahrzeugen2.2 Autohäuser2.3 Tankstellen2.4 Software für Tankstellen, Autohäuser und AutosTeil II: Die Gegenwart3 Axiom Nr. 1: Kaltenburg schnurrt wie eine gut geölte Maschine4 Axiom Nr. 2: Die Maschine muss regelmäßig in die Inspektion5 Axiom Nr. 3: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser6 Axiom Nr. 4: Das Organisationssystem bei Kaltenburg – jeder versteckt sich in seiner Box7 Axiom Nr. 5: Zwischen laissez faire und autoritär, doch ohne Teilhabe – Führung bei den Kaltenburgern8 Axiom Nr. 6: Die Kaltenburger spielen Theater – nur manche kennen ihre Rolle nicht9 Axiom Nr. 7: Die DEAD-Werte – Defensivität, Aggressivität und Diskriminierung10 Axiom Nr. 8: Bei der Auswahl und Beförderung des Personals sind alle Führungskräfte BundestrainerTeil III: Die Zukunft – New Work11 Wie New Work zu den Kaltenburgern kam12 New Work ist das, was gerade passt13 Wir werden flacher – das Hierarchie-Harakiri14 Vertrauensarbeitszeit für unbezahlte Überstunden – der Stundenstinkefinger15 Seit an Seit sitzen wir im Großraumbüro – die Bürobeleidigung16 Zu Hause ist es auch schön – hohles Homeoffice17 Wir sind agil – wir sprinten noch schneller als bisher18 New Work ist natürlich auch Digitalisierung – Piter, die KI, die alles wissen willTeil IV: Was Unternehmen tun können, um beim Thema »New Work« weniger zu scheitern19 E-Mail an das Mitglied der Geschäftsführung Karl-Heinz Kuhr von Prof. Dr. Carsten C. Schermuly20 Experteneinschätzung zum Fall Kaltenburg für Herrn Kuhr20.1 Es gibt mehrere Wege zu New Work und keiner führt sicher zum Erfolg: New Work aus der Zukunft denken20.2 New Work braucht Sinn und Evidenz20.3 New Work braucht Diagnostik und Dialog20.4 New Work braucht New Worker*innen und Verantwortungsübernahme20.5 New Work braucht Haltung und gute Kommunikation20.6 New Work braucht Führung und einen anständigen Umgang mit Führungskräften20.7 New Work braucht vorbereitete Mitarbeitende20.8 New Work braucht eine geregelte Freiheit20.9 New Work braucht Vertrauen20.10 New Work braucht eine passende Kultur, um wachsen zu können20.11 Fazit21 E-Mailantwort von Karl-Heinz Kuhr an Prof. Dr. Carsten SchermulyLiteraturDanksagungStichwortverzeichnisDigitale ExtrasHinweis zum Urheberrecht:
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem Sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Haufe Lexware GmbH & Co KG
[6]Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-648-16963-6
Bestell-Nr. 10952-0001
ePub:
ISBN 978-3-648-16964-3
Bestell-Nr. 10952-0100
ePDF:
ISBN 978-3-648-16965-0
Bestell-Nr. 10952-0150
Carsten C. Schermuly
New Work Dystopia
1. Auflage, Mai 2023
© 2023 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
www.haufe.de
Bildnachweis (Cover): Foto von Sacha T’Sas auf Unsplash
Produktmanagement: Dr. Bernhard Landkammer
Lektorat: Ursula Thum, Text+Design Jutta Cram, Augsburg
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/ Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
[7]»Fair is foul, and foul is fair.«
William Shakespeare, Macbeth, Akt 1, Szene 1
[13]Vorwort: Warum die New-Work-Utopia einen teuflischen Zwilling braucht
Kürzlich fuhr ich in einem Bremerhavener Hotel mit einem Personaler im Aufzug. Wir kamen gerade von einer Tagung mit dem Titel »New Work – Unternehmen im Wandel«. Als wir in den Aufzug stiegen, bemerkte der Kollege auf einem in den Spiegel eingelassenen Bildschirm Werbung für die Hotelbar. »Krass«, sagte der Kollege vollkommen ernsthaft, »hier heißt sogar die Bar ›New Work‹«. Ich schaute auf den Bildschirm, doch da war die Werbung schon auf das Restaurant umgesprungen. Gespannte Stille im Aufzug, während ich mich fragte, ob das Hotel oder der Kollege verrückt geworden waren. Es folgte Werbung für den Spa-Bereich: »Ganzkörpermassage 60 Minuten für 79 €«, »Entwachsen Oberlippe für 9 €« und »Entwachsen Unterschenkel für 29 €«. »Anscheinend wird in dem Hotel das Entwachsen pro Quadratzentimeter abgerechnet«, dachte ich. Dann endlich, kurz vor dem Ausstieg, der erlösende Cut zur Werbung für die Hotelbar: »NEW YORK BAR – Cocktails und Drinks mit Bremerhavens bestem Blick auf den Hafen.« Das Hotel war kerngesund. Für den armen Personaler war es in letzter Zeit einfach ein bisschen zu viel New Work gewesen.
Seit über 15 Jahren beschäftige ich mich wissenschaftlich und praktisch mit den Themen »New Work« und »Empowerment«. Ich habe zu diesen Themen habilitiert und viele Unternehmen dabei begleitet, New Work und Empowerment in ihren Unternehmen zu implementieren. In den 2000ern war das Thema »New Work« ein Nischenthema. Es gab eine engagierte Szene, die sich mit den Gedanken von Frithjof Bergmann beschäftigte, aber sie war klein. Forschung wurde kaum betrieben. Doch die Welt wurde immer volatiler, komplexer und unvorhersehbarer. 2016 fasste ich meine Forschung erstmals praxisnah in meinem Buch »New Work – Gute Arbeit gestalten: Psychologisches Empowerment von Mitarbeitern« zusammen. Das Interesse an New Work stieg und Beratungen entdeckten das Thema als Goldgrube. Doch niemals hätte ich es für möglich gehalten, dass ein Virus, das 500-mal kleiner als ein Haar ist, den Begriff »New Work« in den Google-Rankings und den Gehirnen von Personaler*innen so präsent machen könnte. Im November 2022 schaffte es der Begriff dann auf die Titelseite der Apothekenumschau und auf die Homepage der Tagesschau. New Work war im Mainstream angekommen.
[14]Die Popularität des Begriffs nahm durch die Pandemie zu, doch gleichzeitig kam es zu einer Verschiebung, die ich zunächst ungläubig beobachtete. Zeitungen wie die FAZ luden zu Konferenzen ein, die behaupteten, dass New Work nun im Alltag der Deutschen angekommen sei, denn diese könnten von zu Hause aus arbeiten. Die Bitkom titelte in einer Pressemitteilung: »New Work: Die Hälfte der Deutschen arbeitet im Homeoffice«1. Das Magazin Möbelkultur schrieb: »Home und Office verschmelzen, New Work und Lifestyletrends wachsen weiter zusammen«.2 Immer mehr Architekt*innen waren bei LinkedIn auf einmal New-Work-Expert*innen. Jährlich erheben wir in unserem Institute for New Work and Coaching zusammen mit dem Personalmagazin, dem Bundesverband der Personalmanager und HRpepper Management Consultants Daten für das New-Work-Barometer. Schon 2021 verstanden fast zwei Drittel der Unternehmensvertreter*innen unter »New Work« Homeoffice. Frithjof Bergmann, der Begründer des Begriffs »New Work«, starb am 23. Mai 2021 im Alter von 90 Jahren. Er hat das hoffentlich nicht mehr registriert. Doch es kam noch schlimmer.
Der Begriff »New Work« wurde mit steigender Popularität zum »Buzzword«. Ich spreche hier gern auch von einem Containerbegriff. Container haben die Eigenheit, dass jede*r hineinwerfen und herausholen darf, was er*sie möchte. Genau das geschieht heute beim Thema »New Work«. Verhandelt der Betriebsrat mit der Geschäftsführung über eine Betriebsvereinbarung zur mobilen Arbeit, dann wird das »New Work« genannt. Möchte ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin Open-Space-Büros einführen, um Mietfläche zu sparen, dann nennt er oder sie das »New Work«. Will eine Trainerin Achtsamkeitskurse oder eine Unternehmensberatung agile Projektarbeit an ihre Kund*innen verkaufen, dann ist das auch New Work. Dadurch wird New Work zunehmend mikropolitisch instrumentalisiert.3 New Work ist dann das, was den eigenen Interessen nützt. Solche Container haben die Eigenschaft, dass sie nach einiger Zeit zu riechen beginnen. Dann hält man lieber Abstand. Auch der Begriff »New Work« scheint erste unangenehme Aromen zu entwickeln.
An dieser Stelle erfahren Sie deshalb, was ich unter »New Work« verstehe. Mein Verständnis ist abgeleitet aus den Gedanken von Bergmann und ich kombiniere sie mit dem psychologischen Empowermentansatz von Gretchen Spreitzer. Ich verstehe
[15]»New Work« als Praktiken in Organisationen, die das Ziel haben, das psychologische Empowerment der Mitarbeitenden zu steigern. Psychologisches Empowerment setzt sich aus vier Wahrnehmungen der Arbeitsrolle zusammen: Bedeutsamkeit, Kompetenz, Selbstbestimmung und Einfluss.4 Menschen mit hohem Bedeutsamkeitserleben spüren Sinn in ihren täglichen Tätigkeiten. Zwischen den eigenen Werten und den Werten, die für die Arbeit notwendig sind, besteht Übereinstimmung. »Kompetenz« bezieht sich auf das Erleben von Selbstwirksamkeit bei der Arbeit. Menschen trauen sich die Fähigkeiten zu, die für ihre Arbeitstätigkeiten notwendig sind. »Selbstbestimmung« bedeutet, dass empowerte Menschen das Gefühl haben, mitentscheiden zu können, wie, wann und wo sie arbeiten. »Einfluss« bezieht sich auf das Machterleben während der Arbeit. Menschen mit hohem Einflusserleben sind überzeugt davon, dass sie etwas in ihrem Arbeitsumfeld bewirken können.5
Psychologisches Empowerment hat viele positive Konsequenzen für Arbeitgeber und Mitarbeitende, die in zahlreichen Studien belegt werden konnten.6 So steigen z. B. die Leistung und das Innovationsverhalten7 der Mitarbeitenden. Fluktuationsabsichten, Stress, Burn-out und Depressionsneigung8 sinken und gleichzeitig wachsen die Arbeitszufriedenheit, das Flow-Erleben9, die Bindung an das Unternehmen sowie die Attraktivität des Arbeitgebers10. Sogar der Renteneinstieg wird erst für einen späteren Zeitpunkt geplant, wenn Menschen sich psychologisch empowert fühlen.11 In Abbildung 2 sehen Sie, wie wir in unserem Institute for New Work and Coaching die Felder »New Work« und »Empowerment« erforschen und auf welcher Grundlage wir mit Unternehmen zusammen arbeiten.
Abb. 2: Rahmenmodell zur Erforschung und Praktizierung von New Work in Unternehmen (Schermuly, 2020)
New-Work-Praktiken führen nicht automatisch zu den gewünschten Ergebnissen wie z. B. mehr Innovationsverhalten oder weniger Stress. Sie werden psychologisch interpretiert und nur, wenn sie das psychologische Empowerment stimulieren, kommt es zu positiven Konsequenzen. Doch New-Work-Praktiken stimulieren nicht immer das Empowermenterleben. Dafür verantwortlich sind die beiden Faktoren (= Pfeile), die in der Grafik von »unten« und »oben« auf die Wirkung der New-Work-Praktiken Einfluss nehmen. Organisationsfaktoren wie z. B. die Organisationskultur verstärken oder vermindern die Wirkung. Wir konnten beispielsweise in unseren Untersuchungen zeigen, dass eine Kultur für psychologisches Empowerment hilft, dass sich Maßnahmen positiv auswirken. Doch auch Persönlichkeitsfaktoren haben laut unserer Forschung einen Einfluss. Zum Beispiel scheinen manche New-Work-Praktiken vor allem Menschen zu gefallen, die eine hohe Ausprägung von »Sensation Seeking« besitzen. Sensation Seeker sind Menschen, die viel Abwechslung und Stimulation in ihrem Leben benötigen und denen schnell langweilig wird.12
Auf der Basis dieses Modells und der Forschung in unserem Institut habe ich 2022 »New Work Utopia« veröffentlicht.13 Das Buch sollte eine Zukunftsvision einer Organisation in einer besseren Arbeitswelt sein. Eine Utopie ist ein Möglichkeitsraum und ein Gedankenexperiment, das einen Zustand beschreibt, der den gegenwärtigen Verhältnissen positiv widerspricht.14 Ich habe das fiktive Unternehmen Stärkande [17]skizziert und dessen langen Weg zu New Work beschrieben. Die Stärkander*innen haben das Ziel, das psychologische Empowerment der Mitarbeitenden zu steigern und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu sein. In der Utopie beschreibe ich, wie eine radikal alternative Zusammenarbeit aussehen könnte, und versuche damit, Mut und Neugierde für eine bessere Zukunft zu schaffen, denn die Utopie ist »eng mit der Hoffnung auf ein besseres Leben sowie mit dem Streben nach einem solchen verknüpft«15. Seit der Veröffentlichung des Buches erreicht mich eine Vielzahl von Mails und es haben sich spannende Gespräche ergeben. Einige Unternehmen haben schon Schritte von Stärkande bewältigt und setzen Axiome und Maßnahmen der Stärkander*innen um. Die Fiktion wird Realität und das erfreut mich sehr.
Doch mit der Popularität und Banalisierung von »New Work« scheint der nächste Schritt in der Evolution des Begriffs erreicht worden zu sein. »New Work« wird immer mehr zum Synonym für gescheiterte organisationale Transformationen. Viele Unternehmen sind von New Work enttäuscht, da selbst die Einführung von Homeoffice zu größeren organisationalen Herausforderungen geführt hat, als dies erwartet und den Kolleg*innen versprochen wurde. Bei einigen Mitarbeiter*innen scheint New Work vermehrt Verzweiflung auszulösen, denn nicht wenige Unternehmen setzen Praktiken unter dem Label »New Work« um, die weniger der Steigerung des Empowermentlebens, sondern eher der Maximierung des Profits dienen. Der Begriff »New Work« wird instrumentalisiert, um einen Changeprozess attraktiver und weniger bedrohlich klingen zu lassen. New Work wird zum Schleifchen oder zum Geschenkpapier. Sie werden in diesem Buch erkennen, dass viele New-Work-Maßnahmen, je nach Haltung des Unternehmens und der Inhaber*innen, für oder aber auch gegen die Mitarbeitenden eingesetzt werden können. Bei New Work gilt, was die Hexen dem tragischen Helden im Macbeth am Anfang des Stücks zurufen:
»Fair is foul, and foul is fair.«
Mit dem vorliegenden Buch möchte ich deswegen dem Scheitern von New Work einen Raum, ein Gesicht und einen Namen geben. Das fiktive Unternehmen, das ich dieses Mal beschreibe, heißt »Kaltenburg«. Kaltenburg trivialisiert und instrumentalisiert den Begriff »New Work«. Ohne Ziel und trotz fehlender kultureller und personeller Voraussetzungen wird New Work seelenlos »missbraucht«, um das [18]Unternehmen profitabler zu machen. Dabei werden bei der Einführung von New Work folgenschwere organisationspsychologische Fehler gemacht und die Mitarbeitenden mit New Work gequält. Für das, was Kaltenburg macht, gibt es bisher keinen Namen. Deswegen nenne ich in Anlehnung an das Wort »New Work« und in Reminiszenz an J. R. R. Tolkien Kaltenburg einen »New Ork«.
In der Welt von Tolkiens »Herr der Ringe« sind Orks Geschöpfe der Dunkelheit. Sie scheuen das Licht, denn die Sonne verbrennt ihre Haut. Sie dienen Melkor und Sauron und kämpfen gegen die freien Völker von Mittelerde. Tolkien vermutet, dass die Orks ihren Ursprung in Züchtungen von gequälten Elben genommen haben. Etwas Gutes wie die Elben wird in etwas Verdorbenes verwandelt. Ähnliches geschieht heute beim Thema »New Work«. Tolkien beschreibt auch die Kultur der Orks: Ihre Gesellschaft ist streng hierarchisch aufgebaut und die Orks folgen blind einem Fürsten oder Häuptling, solange er stark ist. Der Fürst oder Häuptling hat sich durch besondere Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit in seine Position gebracht.16 Mehr und mehr Mitarbeiter*innen assoziieren mit »New Work« nicht mehr die Hoffnung auf gute Arbeit, sondern die Angst vor dem nächsten Changeprozess. Um das zu verdeutlichen, habe ich den New Ork Kaltenburg erfunden und das Genre der Dystopie gewählt.
Vorab noch etwas Akademisches: Ich habe bewusst keine Anti-Utopie geschrieben. Die Anti-Utopie ist an eine spezifische Utopie gekoppelt. Sie beschreibt, wie die Realisierung der Utopie »albtraumhafte Konsequenzen« nach sich zieht und wie dadurch das gesellschaftliche Zusammenleben gefährdet wird.17 Ich greife nicht das utopische Denken und die »New Work Utopia« an. Ich halte weiterhin das Denken in positiven Möglichkeitsräumen für sehr wichtig und glaube, dass Stärkande ein lohnenswertes Zielbild für Organisationen sein kann.
Die Dystopie ist nicht die Gegnerin der Utopie. Sie ist der Utopie ähnlich und wird stattdessen »utopia’s evil twin« genannt18. Die Dystopie zeigt einen fiktiven, unerwünschten Möglichkeitsraum auf. Sie zeichnet, nein überzeichnet einen negativen Gesellschaftsentwurf, sodass es zu einem bestürzenden Zustand kommt. Ähnlich sind sich Dystopie und Utopie darin, dass mit ihnen Missstände in der Gegenwart aufgezeigt werden sollen: »Demzufolge übt die Dystopie eine radikale Negativkritik [19]an bestehenden Gesellschaftsverhältnissen und leistet gerade durch diesen Ansatz einen wesentlichen Beitrag für extensive Überlegungen zur imaginären Neuordnung der Gesellschaft.«19
»Dys« steht im Griechischen für »schlecht« und »Topos« für »Ort«. Die Dystopie ist ein schlechter Ort. Ich beschreibe in meinem Buch einen schlechten Ort für New Work. Dieser schlechte Ort für New Work ist das fiktive Unternehmen Kaltenburg, das seinen Hauptsitz in der südwestdeutschen Stadt Pirmasens hat. Ich stamme aus Rheinland-Pfalz und habe mir deswegen diese Ortswahl erlaubt. Kaltenburg könnte aber auch in Osnabrück, Passau oder Berlin zu finden sein. Unternehmen wie Kaltenburg gibt es überall.
Meine Dystopie hat vier Teile. Im ersten Teil führe ich Sie in die Geschichte des Unternehmens ein. Hier wechsele ich in das generische Maskulinum. Bei den Kaltenburgern wird nicht gegendert (bei Tolkien werden auch keine weiblichen Orks erwähnt). Damit Sie sich besser in die Dystopie einfühlen können, habe ich an vielen Stellen die Sprache der Kaltenburger übernommen. Im zweiten Teil der Dystopie stelle ich Ihnen die wichtigsten Axiome der Kaltenburger vor. Axiome sind die Arbeitsprinzipien, die das tägliche Handeln der Kaltenburger leiten. Es sind die elementaren Grundsätze der Zusammenarbeit. Wie bei Dystopien üblich, überzeichne ich den negativen Zustand. Die Kaltenburger besitzen weder die strukturellen noch die kulturellen noch die menschlichen Voraussetzungen, um New Work und Empowerment positiv in ihrem Unternehmen wachsen zu lassen. Den Umgang mit New Work im Unternehmen Kaltenburg lernen Sie im dritten Teil kennen. Mit unterschiedlichen Maßnahmen versucht die Geschäftsleitung von Kaltenburg gemeinsam mit wechselnden Unternehmensberatungen, »New Work« in der Organisation durchzusetzen. Sie werden sehen, wie man die Ideen von New Work verraten und mit New Work seine Mitarbeitenden »quälen« kann. Kaltenburg lässt mich hilflos zurück; Kaltenburg macht mir auch Angst. Doch ist es nicht mein Ziel, Sie als Leser*innen ein Buch mit Unbehagen zuklappen zu lassen. Deswegen habe ich mich entschlossen, noch einen vierten Teil zu verfassen. Ich möchte mich und Sie nicht allein mit dem Ork zurücklassen und habe Maßnahmen formuliert, die helfen sollen, damit Ihr Unternehmen nicht zum New Ork wird. Die Maßnahmen sind angelehnt an die Fehler, die die Kaltenburger beim Thema »New Work« gemacht haben.
[20]Orks gibt es in der Realität nicht. Orks und New Orks entsprechen doch sicher der Fantasie von Professoren, die sich durch das Erschaffen fremder Welten von ihrem tristen Hochschulalltag ablenken möchten?
Wie soll nur aus dem schönen New Work ein New Würg werden?
Sie werden sich beruhigen, dass es so in der Praxis nicht ablaufen kann (»der Schermuly kennt doch als Hochschullehrer sicher keine Unternehmen«). »Bei uns wäre doch ein New Würg oder New Ork nicht denkbar«, könnte Ihre Schlussfolgerung sein. »Vielleicht kann New Work gegen die Interessen der Mitarbeitenden eingesetzt werden, aber dann würden doch alle Mitarbeitenden sofort den Arbeitgeber wechseln«, mögen Sie sich selbst einreden. Doch was machen Menschen, die nicht in Hamburg, sondern in Pirmasens leben, wo Kaltenburg der größte Arbeitgeber ist? Was machen Menschen, die zu Hause einen Mann pflegen und/oder drei Kinder großziehen müssen? Was passiert, wenn der Arbeitnehmermarkt aufgrund einer Rezession wieder zum Arbeitgebermarkt wird? Das Buch soll zum Nachdenken anregen. Ich möchte Ihnen Angebote zum Reflektieren über New Ork und New Würg machen! Wie denken Ihre Mitarbeitenden über New Work, wenn Sie als Personaler*in und/oder Führungskraft den Raum verlassen haben? Was denken Sie als Arbeitnehmer*in über New Work, wenn Sie das Unternehmen verlassen haben? Was sind Ihre wirklichen New-Work-Ziele? Und gibt es New Orks und das Gewürge vielleicht doch? Bitte lesen Sie das Buch aufmerksam durch und entscheiden Sie danach selbst.
Noch ein letzter Hinweis: Der Dezember 2022 war ausnahmsweise kalt und dazu voller Infekte. Die Kinder konnten weder in Schule noch Kita und wir haben auch unter der Woche viel Zeit miteinander verbracht. Darin sind wir seit Corona wie Millionen andere Familien geübt. Aus dem gemeinsamen Kritzeln wurden erste Skizzen und dann entstanden Zeichnungen. Die Figuren der Dystopie hatten schon lange mit und in mir gelebt und purzelten in diesen Wochen visuell aus meinem Kopf. Der Entschluss entstand, zum ersten Mal ein Buch selbst zu illustrieren. Es gab manchmal Streit um die Buntstifte und nicht immer sind mir bei den Zeichnungen die Hände gelungen. Hände zeichnen fällt mir schwer; zu viele Knochen sind involviert. Schrecklich! Ich bin also kein Profi, aber die Illustrationen geben die Gefühle wieder, die ich mit den Protagonist*innen verbinde. Vielleicht helfen Sie auch Ihnen, Alfred, Margot, Tiberius und die anderen besser zu verstehen.
Achtung: Sie betreten nun einen dystopischen Raum!
Abb. 3: Eintritt in den dystopischen Raum
1 Bitkom (2022)
2 Möbelkultur (2022)
3 Siehe Schermuly (2022)
4 Siehe dazu Spreitzer (1995) und Schermuly (2021)
5 Siehe dazu Spreitzer (1995) und Schermuly (2021)
6 Siehe z. B. die Metaanalyse von Seibert et al. (2011)
7 Schermuly, Meyer & Dämmer (2013)
8 Schermuly & Meyer (2016)
9 Schermuly & Meyer (2020)
10 Koch & Schermuly (2021)
11 Schermuly, Büsch & Graßmann (2017)
12 Koch & Schermuly (2021)
13 Schermuly (2022b)
14 Siehe Schermuly (2022b)
15 Stoltenberg (2016, S. 64)
16 Der Herr der Ringe Wiki (2022)
17 Stoltenberg (2016, S. 64)
18 Claeys (2013, S. 155 nach Stoltenberg (2016, S. 67)
19 Stoltenberg (2016, S. 69)
[23]Teil I: Die Wurzeln
[25]1Eine kleine Geschichte des Unternehmens Kaltenburg: Kämpfe und Siege in Pirmasens
Kaltenburg wurde 1902 in Pirmasens gegründet. Alleiniger Inhaber ist seit 1975 Alfred Kaltenburg. Unterstützt wird er in der Geschäftsführung von seinen Söhnen Tiberius und Alfred Jr. sowie seiner Frau Margot und Karl-Heinz Kuhr. Pirmasens liegt in Rheinland-Pfalz, ganz in der Nähe des Pfälzer Waldes. Die Grenzen zum Saarland, aber auch zu Frankreich sind nicht weit. Pirmasens war im 19. und 20. Jahrhundert ein Zentrum der deutschen Schuhindustrie. Dieser Industriezweig bekam im zweiten Teil des 20. Jahrhunderts immense Probleme und die Betriebe mussten nach und nach schließen. Das kann man auch an der Einwohnerzahl von Pirmasens ablesen. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Pirmasens noch 58.848 Einwohner. Heute leben in der Stadt nur noch um die 40.000 Menschen. Der Niedergang hat sich nicht nur tief in die Seele der Stadt, sondern auch in die Psyche der Kaltenburger eingeschrieben.
Überall in Pirmasens stehen die ehemaligen Schuhfabriken: Donauberger, Nitter, Kapp, Ohr. 5.000 Schuhe wurden früher pro Tag in jeder dieser Fabriken produziert. »Alle mussten sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die Insolvenz. 9.500 Quadratmeter beim Kapp, 10.500 beim Nitter und 25.000 Quadratmeter beim Donauberger« – Alfred Kaltenburg kennt die Zahlen auswendig und sagt seinen Mitarbeitern und Kindern gern triumphierend: »Alle stehen leer und mir habbe die Hallen voll!« Alfred Kaltenburg wird bei dem Thema sehr emotional und dann rutscht er manchmal in den Dialekt. In den Gefühlen und im Triumph steckt aber auch eine deutliche Warnung. Nichts ist in der Welt sicher und der Kampf ums Überleben hört niemals auf.
Zwei Kämpfe haben sich ins Gedächtnis des Unternehmens eingebrannt. Beide waren schwere Kämpfe, die Alfred und die Kaltenburger mit vielen Mühen konfrontiert und viele Stunden Angst produziert haben. Sie sind verankert im Kopf von Alfred, aber auch tief verwurzelt in der Kultur des Unternehmens. Und so erlauben die Kaltenburger der Vergangenheit, dass sie ihre Gegenwart und Zukunft prägt. Darin ähneln die Kaltenburger vielen anderen Unternehmen. Bei den Kaltenburgern sind es der Kampf um das wirtschaftliche Überleben und der Kampf um Anerkennung, der sie geprägt hat.
[26]Die Schuhfabrikanten Donauberger und Kapps bauten sich zu einem Zeitpunkt ihre Industriepaläste, als die Kaltenburger erst aus Niederbayern in die Pfalz umsiedelten. Die Kaltenburger sprachen in der ersten Generation nicht nur anders als die Pirmasenser. Sie waren die Underdogs. Die Kapps wohnten in einer Villa, die Kaltenburger über ihrer Fabrik. Die Nitters rochen nach Geld, die Kaltenburger nach Schweiß, denn sie mussten mit anpacken. Sie mussten sich behaupten und wurden belächelt, weil sie nur eine kleine Fabrik hatten. Die Kaltenburger saßen nicht im Stadtrat, sie tafelten nicht mit dem Bürgermeister oder luden sich einen Professor aus Heidelberg zum Spaziergang nach Pirmasens ein. Die Kaltenburger hatten keine Zeit. Die Kaltenburger mussten arbeiten und sich beweisen.
Doch die kleine Fabrik war am Ende der entscheidende Vorteil der Kaltenburger. Die Kapps und Donauberger hatten riesige Fabriken und immense Arbeiterschaaren zu bezahlen. Während des Zweiten Weltkriegs allerdings arbeiteten zunächst Tausende Menschen aus dem Lager Biebermühle in den Fabriken als Zwangsarbeiter und fertigten Militärstiefel für die Ostfront. Der Zweite Weltkrieg war kein Problem für die großen Fabriken. Sie verdienten prächtig am Krieg, während die Familie Kaltenburg und ihre Arbeiter an der Front starben.
Das Problem der großen Fabriken waren dann aber die veränderten Gegebenheiten des Weltmarkts nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Reallöhne in Deutschland stiegen nach dem Krieg und die D-Mark wurde mehrmals aufgewertet. Schuhimporte wurden billiger und die großen Pirmasenser Fabriken waren weder national noch international konkurrenzfähig.
Die Kaltenburger waren klein und bauten die Fabrik und ihr Produktportfolio radikal um. Statt Schuhen wurden Autositze aus Leder und Kunstleder produziert. Wilhelm Kaltenburg, der Vater von Alfred, hatte das Auto als Zukunftstechnologie erkannt. Er war vernarrt in Autos und diese Neigung erwies sich als Glücksfall. Die Menschen in Deutschland trugen zwar noch Lederschuhe, aber sie liefen damit nicht mehr zur Arbeit. Sie fuhren mit dem Auto und saßen auf einem Autositz, der mit Leder bespannt war. Also wurden in den Fünfzigerjahren neue Maschinen angeschafft und das beste Personal aus den anderen schließenden Großfabriken übernommen. Die Arbeiterfamilien wechselten in Scharen zu den Kaltenburgern und waren dankbar dafür. Sie wurden alle umgeschult und so wurden Autositze in nie für möglich gehaltenen Stückzahlen produziert. Wilhelm und die Autoproduzenten waren begeistert. [27]Aber die Autositze mit den dazugehörigen Autos fuhren nicht von allein. Sie benötigten Kraftstoff und so kaufte der alte Kaltenburger jedes Jahr von dem Gewinn, den er mit den Autositzen erwirtschaftete, mehrere Tankstellen in der Region. Zu diesem Zeitpunkt waren die Tankstellen im näheren Umfeld Einzelunternehmen und damit angreifbar. Mit 10, 20 oder 30 Tankstellen konnten die Kaltenburger vollkommen andere Preise für Benzin erhandeln als die kleinen Einzelbetriebe. Viele selbstständige Tankstellen schlossen sich irgendwann proaktiv den Kaltenburgern an, um von der günstigeren Beschaffung zu profitieren.
Aber auch die Tankstellen waren dem Unternehmen als Ergänzung des Portfolios nicht genug. Alfred Kaltenburg hatte in den Achtzigerjahren Lust auf etwas Neues und ihn nervte, dass die großen Dienstwagen der Belegschaft so teuer waren. Also gründete und kaufte er Autohäuser und verkaufte dort Autos, die Leder- und Kunstledersitze von Kaltenburg eingebaut hatten. Die letzte Stufe dieser Evolution war erreicht, als die Kaltenburger begannen, Software für Tankstellen, Autohäuser und irgendwann sogar für Autos zu schreiben. Wieder war das Hauptargument, dass man lieber selbst produziert als teuer einkauft. Erneut waren die Kaltenburger erfolgreich. Die Kaltenburger erkannten das Auto als Wachstumsfeld und hatten damit Erfolg. Das Auto fuhr die Kaltenburger aus dem Sumpf!
1977 waren die Kämpfe gewonnen. Kaltenburg war der größte Arbeitgeber der Region Pirmasens und machte hohe Gewinne. Im Selbstverständnis hatten sich die Kaltenburger das Existenzrecht als Unternehmen erkämpft und keine staatlichen Hilfen abgegriffen, wie das viele Unternehmen heute tun, denkt Alfred fast täglich. Im selben Jahr heiratete Alfred Kaltenburg Margot Nitter. Margot Nitter war nicht irgendeine Großnichte von Kurt Nitter, dem letzten Patriarchen der Schuhfabrik Nitter. Nein, Margot war dessen Tochter. Mehr Anerkennung konnte Alfred Kaltenburg für seine Familie nicht erreichen. Seinem Vater kamen während der Hochzeitszeremonie die Tränen. Der alte Wilhelm, Träger des Eisernen Kreuzes am weißen Bande und ehemaliger Panzerkommandant des 7. Panzerregiments, weinte. Das hatte Alfred noch nie beobachtet. Seinem Schwiegervater war keine Regung im Gesicht abzulesen, als er seine Tochter zum Altar führte. Ein Jahr später zog die junge Familie in die Villa der Nitters, die die Familie nicht weiter unterhalten konnte. Jetzt waren die Kaltenburger die Schuh-Könige von Pirmasens, obwohl sie keine Schuhe mehr produzierten. Seit damals kommt jeder neue Bürgermeister nach seiner Wahl zum Antrittsbesuch in die Villa.
Abb. 4: Offizielles Porträtbild von Alfred Kaltenburg. Das Porträtbild wird für Presseangelegenheiten und als Ölbild im Eingangssaal des Hauptgebäudes genutzt.
[29]2Die vier Geschäftsbereiche von Kaltenburg
Derzeit gehören 2.350 Mitarbeiter zu Kaltenburg (KB). Diese arbeiten in vier Bereichen, die alle ihre eigene kleine Historie besitzen:
Autositzbezüge und Innenausstattung von KraftfahrzeugenAutohäuserTankstellenSoftware für Tankstellen, Autohäuser und Autos2.1Autositzbezüge und Innenausstattung von Kraftfahrzeugen
Das Kerngeschäft von Kaltenburg war nach dem Zweiten Weltkrieg die Produktion von Autositzbezügen. Mit diesem Geschäft hatten die Kaltenburger ihre Firma gerettet. Doch war es schon im 20. Jahrhundert immer schwerer geworden, mit Autositzbezügen aus Deutschland Gewinn zu erwirtschaften. Das hat ausnahmsweise nichts mit der aktuellen Transformation der Automobilindustrie zu tun. Denn der Kunde möchte auch in einem Elektrowagen bequem sitzen. Der Grund ist ein anderer: Die Kaltenburger sind wieder einmal zu teuer geworden (im Kopf von Alfred sind die anderen stehts zu billig geworden). Sie kontern das, indem sie extrem hohe Qualität anbieten: Dauerfaltverhalten, Lichtechtheit, Geruch, Knarzverhalten, Reibechtheit, Weiterreißkraft, Stärke – alles muss perfekt sein und wird ständig im Werk durch eine künstliche Intelligenz evaluiert. Spaltleder (hier wird die Rinderhaut in mehrere Schichten aufgeteilt, um mehr Fläche bespannen zu können) und Kunstleder verarbeiten die Kaltenburger seit über zehn Jahren nicht mehr.
Außerdem nutzen die Kaltenburger den Standort, der eigentlich eine Schwäche ist, als Stärke. Die Hauptbotschaft an den Kunden ist: »Wir produzieren ausschließlich in Deutschland und bieten höchste Qualität.« Das Leder kommt aus Deutschland, Österreich, Polen, Ungarn und bis zum Angriffskrieg von Putin auch aus der Ukraine. Die Transportwege sind dadurch relativ kurz. Der Rest und auch die Gerbung werden in Deutschland erledigt. Darauf sind die Kaltenburger stolz und das platzieren sie bei den Autoherstellern.
[30]Die Kaltenburger haben sich voll und ganz dem Luxussegment verschrieben. Es gibt sogar eine Linie Autositze, die nur mit Bio-Leder von bayerischen Alpenrindern bespannt wird. Hier wird dem Kunden beim Kauf mitgeteilt, auf welcher Alm die Kuh gegrast hat. So weiß der Kunde, wo das Leder herkommt, auf dem er sitzt. Manche Kunden fahren dann zur Alm und schauen sich diese an. Andere Autos werden mit Büffelleder bespannt. Es stammt von Wasserbüffeln, die in Deutschland oder Polen gegrast haben. Gern lassen sich die Kunden auch ihre Initialen ins Leder sticken. Die Kaltenburger schaffen es auch, komplizierte Wappen großformatig auf den Fahrersitz zu zaubern. Manche Menschen sitzen eben gern mit dem Hintern auf ihrem Status.
Das Geschäft der Kaltenburger lohnt sich entsprechend nur noch bei Autos der S- oder E-Klasse (Mercedes). Auch die Limousinen von anderen deutschen Automarken fahren mit Ledersitzen, die von den Kaltenburgern bespannt wurden. Da immer mehr Autos in der Luxusklasse verkauft werden, ist die Nachfrage stabil. Hoffnung macht auch, dass immer mehr Kunden eine Volllederausstattung wünschen. Hier wird das gesamte Interieur mit Rinderhaut bespannt.
Mittlerweile gibt es sogar drei kleine Außenbetriebe, die räumlich nah bei den Autoherstellern Ledersitze produzieren. So kann perfekt just in time geliefert werden und die Autohersteller vergessen manchmal, dass die Bezüge fremdgefertigt werden. Aber die Aussage von Alfred, dass die Hallen bei den Kaltenburgern voll sind, ist so nicht richtig. Es arbeiten nur noch knapp 500 Menschen in diesem Unternehmensbereich, auch wenn das Leder weiterhin am stärksten das Wesen und die Kultur des Unternehmens bestimmt.
2.2Autohäuser
Die Autohäuser gibt es bereits seit 1977. Wilhelm Kaltenburg schenkte seinem Sohn das erste Auto zur Hochzeit. Viele Jahre galt die eiserne Regel: In einem Kaltenburger Autohaus werden nur Autos verkauft, die einen Kaltenburger Autositz im Fahrzeug haben. In den ersten 20 Jahren war diese Regel einfach umzusetzen. Da 50 Prozent der in Deutschland verkauften Automarken einen in Pirmasens gefertigten Autositz hatten, war das alles kein Problem. Die Kaltenburger konnten fantastisch die Autohäuser in die Verhandlungen mit der Autoindustrie einbeziehen. »In Ordnung«, sagte dann Alfred, »wir gehen noch einmal 5 Prozent bei dem Preis pro Autositz runter. Dafür bekommen wir 50 Audi Quattros« und schon war der Deal gemacht. Die Autos wurden dann in den [31]Autohäusern im Rahmen einer Sonderaktion verkauft und das Geschäft florierte. Wenn Alfred von seinem Chauffeur im Mercedes 300 SE durch Pirmasens gefahren wurde, dann dachte er oft: »Ich sitze auf meinem Geschäft« – und lächelte dabei zufrieden.
Doch dann drehte sich die Welt um die Kaltenburger schon wieder. Toyota stürmte auf den europäischen Markt, dann Kia, Hyundai, Nissan. Und die fuhren ohne die Kaltenburger Autositze. Zuerst merkte man das. Die Sitze waren unbequem. Alfred machte sich keine Sorgen, er lachte sogar über die »Reisschüsseln«, wie er sie nannte. Vor allem für Menschen mit Übergewicht waren die Autositze der Asiaten zu klein und zu unbequem. Doch die Hersteller lernten schnell, wie dick und bequem Deutschland schon damals war. Sie lernten und sie passten ihre Sitze an.
Auch wurden die Deals schwieriger. Die jungen Einkäufer der deutschen Marken lachten Alfred Senior aus, wenn er 100, 50 oder 25 neue Audis haben wollte, um sich beim Preis zu bewegen. »Die arbeiten nur noch mit der geladenen Pistole«, dachte er. »Geh 5 Prozent runter oder wir kaufen in Asien ein«, sagten sie und nur wenige nahmen wie früher ein paar Tausend Euro Handgeld an (einer nahm sogar das Handgeld an und ließ dennoch den Deal platzen). »Was ist nur aus der Welt geworden? Gibt es keine Ehre mehr? Wo kommen plötzlich all die Schweinehunde her?«, fragt sich Alfred oft. Alfred hasst die junge Generation der Einkäufer mehr als den Deutschlandchef von Aral.
2010 wurde die »Kaltenburger Sitz-Regel« in den eigenen Autohäusern abgeschafft und Regeln werden bei den Kaltenburgern nur äußerst selten infrage gestellt. Alfred ärgerte sich Monate darüber. Aber er wollte unbedingt weiter ein erfolgreicher Autohausbesitzer sein. Seit 2015 werden sogar Kias in den Autohäusern verkauft. Kia hatte im Jahr 2014 eine Schwächephase im deutschen Wachstumsmarkt. Es wurden nur knapp über 50.000 neue Autos zugelassen. Das nutzten Alfred und vor allem Tiberius für einen günstigen Geschäftseinstieg. Seine Vorurteile gegenüber Koreanern hat Alfred zwar nicht überwunden, weil er nur mit deutschen Führungskräften verhandelt. Aber er setzt sich zumindest ab und zu heimlich in einen Kia Stinger und drückt aufs Pedal. »Die Reisschüssel hat Kraft!«, denkt Alfred dann.