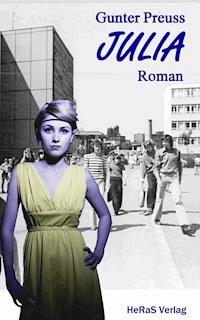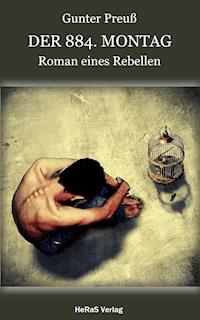Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der zwölfjährige Niccolò ist eigentlich mit seinem Leben zufrieden. Doch da passiert es ihm, dass er sich innerhalb einer Woche gleich dreimal verliebt: In Paula Klette, ein Mädchen aus seiner Klasse, in Imke Liebstöckel aus der Zehnten und in die junge Lehrerin Rebekka Mandelstern. Niccolò ist völlig aus dem Häuschen. Aber so einfach geht es mit der Liebe nicht. Obendrei muss er sich noch der brutalen Angriffe Josefs, dem Anführer der Faschos, erwehren. Gunter Preuß, inzwischen ein Altmeister der Kinder- und Jugendliteratur, langt wieder voll ins Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gunter Preuß
NICCOLÒ und die drei Schönen
pernobilis edition
Bibliografische Information durch Die Deutsche Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2014)
pernobilis edition
im
Engelsdorfer Verlag
Alle Rechte beim Autor
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2014
Die Liebe allein versteht das Geheimnis,
andere zu beschenken
und dabei selbst reich zu werden.
(Clemens Brentano)
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Zitat
1. Teil: Paula Klett
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2. Teil: Imke Liebstöckel
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
3. Teil: Niccolò und Rebekka Mandelstern
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1. Teil: Paula Klette
1.
Niccolò drückte die Tür des Häuschens hinter sich zu, in dem er mit seiner Mutter und seinem Großvater wohnte. Hüpfend lief er die abschüssige Straße hinunter. Sie führte aus der Siedlung zur kleinen Stadt Scheunitz, die sich am Rand des Auenwaldes lang und schmal hinzog. Auf der einen Seite seines Schulwegs standen Einfamilienhäusern, vor denen hinter niedrigen Zäunen frisch gepflanzte Stiefmütterchen und Primeln dem andauernden Wintergrau bunte Tupfer aufsetzten. Auf der anderen Seite breitete sich ein dunkelerdiges Feld aus, auf dem es grün spross. Am Horizont waren die Spitzen der beiden Hochhäuser der Großstadt L. zu sehen.
Der frühe Morgen war ganz nach Niccolòs Geschmack. Die Sonne stieg wie ein orangefarbener Fesselballon auf. Obwohl der Frühling nach dem Kalender noch nicht begonnen hatte, würde es heute wohl warm werden. Niccolò liebte die Sonne. Aber er mochte auch den Regen. Ihm gefielen die Blumen, die Tiere, und überhaupt das ganze Leben. Doch am meisten liebte er seine Mutter. Gleich danach kam der Großvater. Den dritten Platz hatte bisher sein Freund Ole Grabow eingenommen. Niccolò wusste nur nicht, wie er die drei Schönen, die sich plötzlich in sein Leben gedrängt hatten, einordnen sollte.
Niccolò war zwölf Jahre alt. Bisher hatte er sich wie alle Jungen seines Alters hauptsächlich für die Fußballbundesliga, die Autorennen der Formel 1 und Computerspiele interessiert. Etwas Aufregenderes als ein Championligaspiel zwischen Bayern München und Manchester United hatte er sich nicht vorstellen können. Doch dann hatte sein Herz innerhalb von ein paar Wochen dreimal heftig zu klopfen begonnen. Das Blut war ihm in den Kopf geschossen, als hätte einer seiner brasilianischen Lieblingsfußballer gerade ein Traumtor erzielt.
Den ersten „Schwindelanfall“ hatte er bei der Weihnachtsfeier in der Schule bekommen. Da hatte er noch geglaubt, dass dahinter eine Erkältung steckte und ein plötzliches Fieber ihn verwirrte. Alle Schüler und Lehrer hatten sich vor den Ferien in der Aula versammelt. Die kleine Bühne war weihnachtlich geschmückt. Der Schulchor sang alte und neue Weihnachtslieder. Niccolò hatte leise mitgesungen. Doch dann hatte er nur noch eine Stimme gehört. Hell und weit schwingend, wie Glockenläuten in einer Sternennacht, hatte sie geklungen– „... Al-les schläft, ein-sam wacht nur das trau-te, hochhei-li-ge Paar. Hol-der Knabe im lok-ki-gen Haar, schlaf in himm-li-scher Ruh, schlaf in himm-li-scher Ruh!...“
Er war auf seinen Stuhl gestiegen und hatte die Bühne abgesucht. Die Aufregung hatte ihn heftig schlucken lassen, seine Kehle war trocken, und hinter der Stirn schienen ihn tausend Nadeln zu pieken. Einen Sänger nach dem anderen sortierte er aus, und mit einmal war er sich sicher: Ihr gehörte die traumhafte Stimme! Bevor die Feier zu Ende war, hatte er herausgefunden, wer sie war: Imke Liebstöckel, eine Schülerin der zehnten Klasse.
Nach den Weihnachtsferien, er war noch immer von Imke beeindruckt, da erlitt er den zweiten Schwindelanfall. Die untersten Klassen hatten eine neue Lehrerin bekommen. Die Jungen aus den höheren Klassen schickten scharfe Pfiffe hinter ihr her, wenn sie auf hochhackigen Schuhen, in einem glänzend schwarzen Lederrock und hautengem dunkelrotem Pulli vorbeiklackte. Sie nannten sie, wenn sie unter sich waren, nach dem mexikanischen Vulkan „Señorita Popocatepetl“. Mehr noch als von den anderen äußeren Reizen der neuen Lehrerin, fühlte Niccolò sich von ihren geheimnisvollen dunklen Augen angezogen. Einmal war er ihr ziemlich nahe gekommen, als sie in einer Unterrichtspause über den langen Schulflur durch eine enge Gasse von gaffenden und pfeifenden Jungen gehen musste. Der Stoß Bücher, den sie vor sich hertrug, war ihr aus den Händen gerutscht. Niccolò sprang hinzu und half ihr die Bücher aufzusammeln. Sie knieten einander gegenüber, beim Vorbeugen stießen ihre Stirnen zusammen und sie mussten lachen. Als die junge Frau längst im Lehrerzimmer verschwunden war, atmete Niccolò noch ihren Duft, der ihn in Unruhe versetzte. Die zweite Schöne hieß Rebekka Mandelstern und war erst vor ein paar Jahren von Israel nach Deutschland gekommen. Sie hatte hier studiert und unterrichtete nun an ihrer ersten Schule. Mehr konnte Niccolò erst einmal nicht über sie erfahren.
Keine Woche später war Niccolò zum dritten Mal ins Schlingern gekommen, als wäre er ein winziges Schiff, das auf hoher See in einen Sturm geraten war. Das passierte in der Hofpause. Niccolò und sein Freund Ole waren einem Papierflieger nachgerannt, den der Wind über den Schulhof trieb. Ole, lang aufgeschossen, mit Burattinonase, war plötzlich stehen geblieben, weil er sich wohl schämte, wie ein Erstklässler umherzuhaschen. Doch Niccolò war weitergerannt und hatte in hohen Sprüngen nach dem wirbelnden Papier gegriffen. Dann war er mit irgendetwas zusammengestoßen.
Als er die Augen wieder öffnete, saß er neben Paula Klette auf dem Schulhof. Seit seiner Einschulung ging er mit ihr in dieselbe Klasse. Im Klassenzimmer saß sie eine Reihe vor ihm. In all den Jahren hatten sie nur ein paar Worte miteinander gewechselt.
Paula Klettes Augen rollten zornig hinter ihrer roten Herzbrille.
„He, kannst du denn nicht aufpassen, Rosenbusch!“
„Tut mir leid, Klette. Tut’s denn weh?“
„Du kannst vielleicht dreimal bekloppte Fragen stellen. Das wird bestimmt eine Beule wie ein Riesenkürbis. Warum musst du auch herumspringen wie ein verliebter Affe.“
„Wie springt denn der?“ Niccolò drückte die Faust auf seine schmerzende Stirn. Die zierliche Paula Klette hatte einen ziemlich harten Kopf.
„Der Affe springt gerade so wie du“, sagte Paula und kicherte.
„Aber ich bin überhaupt nicht verliebt“, entgegnete Niccolò.
„Und warum wirst du dann rot wie ein Feuerwehrauto?“
Niccolò stand auf, reichte Paula die Hand und zog sie hoch. Er wünschte „Gute Besserung“ und ging zu Ole, der in der Nähe der Großen stand, um ihre Gespräche aufzuschnappen.
„Welcher Intercity war denn da entgleist?“, wollte Ole wissen. Niccolò zuckte nur mit den Schultern.
In der nächsten Unterrichtsstunde starrte Niccolò auf Paulas Hinterkopf, bis sie sich umdrehte und fragte: „Ist bei dir vielleicht ein Backenzahn locker?“
„Nein, das nicht.“ Niccolò hielt seine kühlen Handflächen auf die heißen Wangen gepresst und schüttelte heftig den Kopf.
Nachts und auch am Tag träumte Niccolò von einer der drei Schönen. Da sang er mit Imke Liebstöckel im Duett die neusten Popsongs. Oder er übte mit Rebekka Mandelstern Schnellrechnen, und sie fragte ihn: „Na, Niccolò, wie viel ist 3’704 mal 8’592?“ Er sah in ihre schwarzen Augen und fand die Antwort: „31’824’768!“ Und dann wieder probierte er mit Paula Klette in einem Optikergeschäft Brillen, bis es ihm schwindlig wurde.
War es denn möglich, dass ihn die Liebe erwischt hatte? Im Fernsehen und im Kino hatte er jede Menge Liebesgeschichten gesehen. Das war ihm immer ziemlich langweilig gewesen. Er hatte nicht verstehen können, dass am nächsten Schultag die Mädchen über ihre Filmhelden schwärmten und manchmal sogar in Tränen ausbrachen. Noch nie hatte er davon gehört, dass ein Junge drei Mädchen geliebt hätte. Da war er aber in eine verrückte Geschichte hineingeraten. Er hatte absolut keine Ahnung, wie das weitergehen sollte.
Niccolò drehte sich auf seinem Schulweg immer wieder im Kreis und hielt Ausschau nach Paula Klette. Sie wohnte auch in der Siedlung und hatte denselben Schulweg wie er. Er hatte noch nicht herausbekommen, um welche Zeit sie am Morgen das Haus verließ. Ob er sich nun früher oder später auf den Weg machte– einmal war sie vor ihm im Klassenzimmer und das andere Mal später.
Auch ihr Lachen, dass gewöhnlich weithin schallte, war nicht zu hören. Es gehörte zu ihr wie die blonden Igelhaare und die Brille, deren Gläser in Herzform rot umrahmt waren. Niccolò hatte Paulas Lachen früher dumm gefunden. Jetzt fand er ihr Lachen einfach großartig. Jedes Mal war es ihm, als würde er ein Schwall Wasser abbekommen, in dem bunte Fische zappelten.
„He, Niccolò! Alter, hier bin ich!“
Ole saß auf einem Pfeiler des Friedhofzauns. Er ruderte mit den langen Armen, seine schrille Stimme klang mal wieder, als sei gerade Fürchterliches passiert.
Niccolò griff in die Schulterriemen seiner Schultasche und begann zu rennen.
2.
„Hierher!“, rief Ole und rutschte beiseite, damit Niccolò sich neben ihn auf den Pfeiler setzen konnte.
„Hier gibt’s was zu sehen“, sagte Ole. „Mach’s dir bequem?“
„Was gibt es denn schon zu sehen?“
Schüler aus verschiedenen Klassen standen zusammen, sie lachten und schrien durcheinander. Paula war nicht darunter. Niccolò sagte missmutig: „Der Unterricht fängt gleich an.“
„Unterricht haben wir jeden Tag“, erklärte Ole. Seine spitze Nase schnüffelte neugierig. „Aber hier passiert gerade ein Verbrechen.“
„Was spinnst du dir denn da wieder zurecht, Mann?“
Gegenüber dem Schülerpulk stand am Feldrand ein alter Lindenbaum. Ein Schäferhund sprang kläffend und zwischendrin aufjaulend am Stamm hoch. Die Zweige der Linde waren noch kahl. Im oberen Geäst entdeckte Niccolò eine graugetigerte Katze, die sich wie zu einem Ball zusammengerollt hatte.
„Pass jetzt auf“, sagte Ole. „Der Weimann aus der Zehnten wirft gut. Peng! Der hat gesessen!“
Die Wucht des Steins riss die Katze fast vom Ast. Ihre Vorderpfoten krallten noch im Holz, der Körper pendelt lang gestreckt hin und her, und erst nach Sekunden gelang es dem Tier, sich auf den Ast zurückzuziehen. Doch schon warf der nächste Junge unter dem Gejohle der anderen einen Stein, der sein Ziel aber verfehlte und mit Pfiffen quittiert wurde.
„Der Hauswald ist doch wohl blind“, meinte Ole. „Mal sehen, ob es Rudigkeit hinkriegt.“
Der Stein streifte die Katze nur. Sie stieß einen klagenden lang gezogenen Ton aus, der selbst das wilde Bellen des Schäferhundes und das Gegröle der Meute übertönte.
Niccolò drückte sich die Hände auf die Ohren und sah sich hilfesuchend um. Auf der Straße fuhren Autos langsam vorbei, weil sie am Bahnübergang stoppen mussten. Andere Erwachsene waren mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit, oder sie beeilten sich zu Fuß die nächste Straßenbahn zu erreichen. Keiner von ihnen schien die Steinigung der Katze zu bemerken.
„Das Katzenviech macht’s nicht mehr lange“, sagte Ole erregt. „Entweder ein Volltreffer erwischt sie. Oder der Köter beißt sie kaputt.“
„Nein“, widersprach Niccolò leise. „Nein, nein.“
„Misch dich da bloß nicht ein“, warnte Ole. „Oder bist du vielleicht lebensmüde? Die nehmen dich glatt auseinander. Und ich darf dich dann wieder zusammenbauen.“
Niccolò fröstelte, er schüttelte Oles Hand ab und rutschte vom Pfeiler. Ein Auto hielt gegenüber der Linde. Paula stieg aus, warf die Tür zu und stellte sich in die kleinere Gruppe der Mädchen, die den Steinewerfern zuschauten. Das Auto hupte kurz und fuhr weiter.
Niccolò sprang vom Zaunpfeiler und lief zu den anderen hinüber. Ole rief ihm hinterher: „Bleib hier, Niccolò! Sei doch nicht blöd! Du sollst hier bleiben, du Doofmann!“
Ein schmächtiger Junge hatte einem riesigen Jungen aus der Zehnten, der nach einem Filmmonster Godzilla genannt wurde, einen faustgroßen Stein in die Hand gedrückt. Godzilla wog den Stein in seiner Pranke und lachte siegessicher.
„Nun drück schon ab, Godzilla!“, drängte es aus der Gruppe. „Hau das Ding vom Ast!“
Godzilla holte mit dem Wurfarm weit aus. Da stellte sich Niccolò vor ihn. Der große Junge sagte ärgerlich: „Verschwinde, du Laus.“
Niccolò gehörte zu den Kleinsten in seiner Klasse und war auch sonst nicht von starkem Körperbau; er stellte sich auf Zehenspitzen und streckte beide Arme hoch. Er sagte ruhig, denn das Zittern und die Übelkeit waren nun verschwunden: „Hör auf damit. Bitte.“
Godzilla musterte ihn erstaunt und brach dann in dröhnendes Gelächter aus, in das die anderen einstimmten. Als Godzilla verstummte, schwieg auch sein Publikum. Der Junge sagte mit Bassstimme, die bei den Selbstlauten piepste: „Nun schieb schon ab, du Laus.“
Dann senkte er den Arm, schüttelte ihn und holte erneut zum Wurf aus. Doch Niccolò stand noch immer zwischen ihm und seinem Ziel.
„He“, sagte Godzilla unwirsch. „Was willst du eigentlich, kleiner Skunk?“
Ole hatte sich herangeschlichen, er kauerte hinter Niccolò, zupfte ihn an der Jacke und flüsterte heiser: „Komm endlich, Niccolò! Bei drei hauen wir ab! Auf mein Kommando: Eins– zwei– und drei!“
Ole rannte mit Indianergeheul davon. Niccolò rührte sich nicht vom Fleck. Er sagte: „Ich möchte, dass du die Katze in Ruhe lässt.“
„Und du meinst, irgendein Hosenscheißer kann mir irgendwas befehlen, was?“
„Ich habe bitte gesagt.“
„Du hast also bitte gesagt“, sagte Godzilla. „Und dafür soll ich dir wohl ein Mountainbike kaufen und dich jeden Abend in den Schlaf singen, was?“
„Nein“, sagte Niccolò. „Du sollst nur die Katze in Ruhe lassen.“
„Weißt du, dass du Laus mir langsam den Nerv tötest?“
„Bitte“, sagte Niccolò eindringlich. „Bitte hör auf damit.“
Godzilla sah ärgerlich und zugleich belustigt auf Niccolò herunter. Am liebsten hätte er wohl den Stein fallen und die Katze, die ihn ohnehin nicht interessierte, auf dem blöden Baum sitzen lassen. Aber da waren noch die anderen, Mädchen und Jungen, die ihn drängten, endlich zu werfen. Vor allem war da noch Lottelore, die den Spitznamen Loreley hatte, wie die Nixe auf dem Rheinfelsen, die mit ihrem Gesang die Fischer ins Verderben gelockt hatte. Auch von Lottelore hieß es, dass sie zuerst die Männer mit ihrer Schönheit verzauberte und dann unglücklich machte. Tatsächlich stöhnte mancher Junge, als hätte er Bauchkrämpfe, wenn Loreley in seiner Nähe war.
Loreley lehnte lässig an einem Gartenzaun, kämmte ihre über die Schultern fallenden roten Haare, blätterte dann in einer Illustrierten, rauchte und gähnte herzhaft.
Godzilla schaute zwischen Niccolò und Loreley hin und her. Dann sagte er wütend: „Na, dann sag hundertmal bitte. Nein, tausendmal. Aber beeile dich. Wegen dir Laus will ich mir keinen Bruch stehen.“
„Bitte“, sagte Niccolò, „bitte, bitte, bitte...“, und in Gedanken zählte er mit. Er hatte zum elften Mal „bitte“ gesprochen, da brüllte Godzilla mit sich überschlagender Stimme: „Schafft mir diesen Skunk aus dem Weg! Haut ihm von mir aus die Ohren ab!“
Godzilla ließ den Stein fallen, wischte sich die Handflächen an seiner Lederjacke ab und stakste breitbeinig zu Loreley. Er legte ihr einen Arm um die Schultern, ließ sich eine angerauchte Zigarette zwischen die Lippen stecken und ging gemächlich mit seiner Freundin in Richtung Schule.
Ein Mädchen packte Niccolò bei den Haaren. Ein paar Jungen boxten auf ihn ein. Niccolò versuchte den Schlägen auszuweichen. Er krümmte sich, die Beine knickten ihm weg, er sackte auf den Erdboden. Da ließ die Meute von ihm ab und lief mit Geschrei weg.
Niccolò blieb noch ein paar Sekunden liegen. Die plötzliche Ruhe tat ihm gut. Erst jetzt spürte er bohrenden Schmerz im Kopf und im Bauch. Dann stützte er sich auf die Knie und stemmte sich hoch, bis er endlich auf beiden Beinen stand. Sein erster Blick galt der Katze. Sie saß in der Astgabel und leckte sich das Fell.
Niccolò lächelte. Er schaute sich um– Paula Klette war verschwunden. Von Ole war weit und breit nichts zu sehen. Auch der Schäferhund war weggelaufen.
3.
Die Lessing-Schule stand an der vielbefahrenen Fernstraße. Nur ein paar Schritte entfernt gab es einen Metzger und Bäcker, eine Drogerie und den Friseur- und Kosmetiksalon „Elegant“. Hinter dem roten Klinkerbau der Schule befanden sich ehemalige Bauernhäuser, die in den letzten Jahren neue Dächer und helle Anstriche bekommen hatten. Ein steil abfallender Weg führte an einer kleinen Kirche, deren Turm wie ein zum Klappern hochgereckter Storchenschnabel aussah, vorbei in den Auenwald.
Niccolò trabte über den asphaltierten Schulhof, wischte sich den Schweiß von der Stirn und drückte auf die von unzähligen Handgriffen polierte Eisenklinke der Schultür. Die Tür war verschlossen, also hatte der Unterricht schon begonnen.
Niccolò morste mit dem Klingelknopf SOS. Nach einer Ewigkeit öffnete der Hausmeister die Tür. Herrn Heidicke nannten die Schüler Bismarck, was er gern hörte. Der Hausmeister war etwa dreißig Jahre alt, ein Männlein, das sich zackig bewegte, mit goldenen Händen, denn was auch kaputtging, er konnte es reparieren. Vor Prüfungen standen an der Pförtnerloge, die dem Hausmeister als Verkaufsstand diente, die Schüler Schlange. Wer zur deutschen Geschichte eine Frage hatte, dem konnte Bismarck sie leicht beantworten. Er wusste genau, wann und wo was geschehen war. Es hieß, er habe zu Hause eine Sammlung alter Waffen, zu der sogar ein Sauspieß aus dem Bauernkrieg und eine Flinte aus Napoleons Russlandfeldzug gehörten. Bismarcks Markenzeichen war ein Schnauzbart, dessen Enden mit Hilfe von Pomade bis zu den Augen hochgezwirbelt waren. Er war Dritter Vorsitzender des neugegründeten sächsischen Vereins „Deutscher Mann und Bart“.
Bismarck blieb im Türrahmen stehen und fragte streng: „Ja und?“
Niccolò stellte sich stramm hin, wie es der Hausmeister gern sah, und sagte: „Entschuldigung. Guten Tag. Ich bin spät dran. Lassen Sie mich bitte schnell rein.“
Der Hausmeister musterte ihn kopfschüttelnd, beugte sich nach draußen, spähte nach links und rechts und trat dann zögernd beiseite. Niccolò sprang die breite Treppe hoch, er hörte Bismarck noch rufen: „Soll ich dich nicht erst einmal verarzten, Junge?“
Niccolò huschte ins Klassenzimmer, murmelte eine Entschuldigung, ließ Herrn Wedekinds strafenden Blick über sich ergehen und setzte sich neben Ole.
Niccolòs Freund rutschte auf seinem Stuhl hin und her. Seine Langnase schnüffelte, als wollte sie Witterung aufnehmen. Er sah Niccolò immer wieder an; aber wenn der sich ihm zuwandte, blickte er weg.
Niccolò konnte sich nicht auf den Unterricht konzentrieren. In seinem Kopf schienen Wespen zu schwärmen, er fühlte sich matt und müde. Die leise Stimme des Lehrers, den sie Donnerhall nannten, störte ihn heute besonders. Es war Donnerhalls Sing-Sang anzuhören, dass er, wie er selbst sagte, gern Pfarrer geworden wäre. Aber dann hatte er in der damaligen DDR doch lieber Pädagogik, anstatt Theologie studiert. Er hätte sich nicht mit der Staatsmacht, der die Kirche ein Dorn im Auge war, anlegen wollen. Ein Held sei er nun mal nicht, sagte er, und im übrigen kenne er auch keinen.
Vor Niccolò saß Paula Klette. Ihm war, als tschilpten Spatzen aus ihren Stoppelhaaren. In seiner Phantasie versuchte er, sich in einen Sperling zu verwandeln und in Paulas Haarnest niederzulassen.
Niccolò flüsterte Ole zu: „Du musst nicht so herumrutschen. Das war in Ordnung, dass du dich nicht geprügelt hast.“
Ole raunte erleichtert zurück: „Was hätte ich denn auch tun können? Du hörst ja einfach nicht auf Onkel Ole. Die sind ja dann alle über dich hergefallen. Na, wenn ich einen von ihnen allein erwische, dann haue ich ihm alle fünfzig Zähne aus.“
„Zweiunddreißig“, korrigierte Niccolò und lachte schmerzhaft in seine Hand. „Bei einem Milchgebiss sind es zwölf weniger.“
Nun lachte auch Ole, sein Lachen war blechern, wie auf dem gefluteten Tagebau die Blesshühner bei Gefahr keckerten: „Kröck– pui, kröck– pui!“
Donnerhall rief auffahrend: „Bit-te!“ und sah Ole ein paar Sekunden lang durchdringend an.
Ole, der sich unwillkürlich geduckt hatte, flüsterte bald weiter: „Du siehst aus, als hättest du in einer Wäscheschleuder gesteckt. Tut das denn nicht weh, Alter?“
„Doch. Ja.“ Niccolò legte sich die kühle Hand auf die heiße Stirn. „Aber das ist nicht weiter schlimm.“
„Manchmal verstehe ich dich wirklich nicht, Niccolò. Ich an deiner Stelle wäre sauer wie eine Essiggurke. Ich würde mir wünschen, das Godzillamonster vor einem Millionenpublikum in der ersten Runde k. o. zu hauen. Hast du auch solche irre Angst, dich zu prügeln?“
Niccolò überlegte kurz. „Ich weiß nicht. Eigentlich nicht.“
„Aber Mensch, ja warum haust du dann nicht zu?“
„Mir ist es lieber, wenn es friedlich zugeht.“
Ole verdrehte die Augen. „Jaja, ich weiß. Du lässt dich lieber wegen einer blöden Katze zu Pflaumenmus verarbeiten.“
„Eine Katze ist nicht blöd“, entgegnete Niccolò. „Niemand ist blöd.“
„Und doch ist jemand blöd“, beharrte Ole.
„Wer denn?“
„Du, zum Beispiel. Weil du dir wegen einer blöden Katze ein blödes blaues Auge hauen lässt.“
Niccolò zuckte mit den Schultern. Vielleicht war er ja wirklich blöd. Aber was spielte das schon für eine Rolle. Er hatte ganz andere Sorgen. Seine größte Sorge saß eine Tischreihe vor ihm. Sie spuckte gerade auf die Gläser ihrer Herzbrille und polierte sie am Ärmel ihres gelbschwarz karierten Pullis. Paula Klette schien völlig vergessen zu haben, dass es ihn gab.
Niccolò beugte sich etwas vor und richtete seinen Blick auf Paulas Hinterkopf, um sie zu hypnotisieren. In einem Buch hatte er gelesen, dass man allein mit der Kraft seines Blickes einen anderen Menschen seinen Willen aufzwingen könne. Paula sollte sich umdrehen, die Sonnenstrahlen würden in ihrer Herzbrille golden aufflackern, und sie würde sagen: „Na, Niccolò? Wie geht’s denn so?“
„Gut“, würde Niccolò antworten. „Einwandfrei.“
Paula würde sagen: „Mir geht’s auch einwandfrei. Ich freue mich, dass es uns beiden gut geht.“
„Ich freue mich auch, Paula. Wirklich. Riesig.“
Niccolò, der das Kopfbrummen für Augenblicke nicht mehr gespürt hatte, fühlte erneut Schmerz. Ole knuffte ihn mit seiner knochigen Faust in die Rippen. Nun hörte Niccolò auch die gereizte Stimme des Lehrers: „Niccolò! Rosenbusch! Soll ich dir ein Rezept für ein Hörgerät ausstellen lassen?“
Die anderen lachten pflichtschuldig. Donnerhall war nicht gerade erfinderisch in seinem Spott. Aber er war beleidigt, wenn er keinen Beifall bekam.
Niccolò sprang auf und rief: „Hier!“
„Großartig, dass du noch da bist“, sagte der Lehrer. „Dann sei auch so gut und bewege dich zur Tafel.“
Niccolò ging nach vorn, verschränkte die Hände auf dem Rücken und sah in Donnerhalls kummervolles Gesicht. Darin war alles zu klein geraten und irgendwie starr, nur die hellen Augen wirkten lebendig. Sie huschten hin und her, nichts entging ihnen. Der Lehrer konnte anscheinend– wie manche Insekten– ohne den Kopf zu drehen in alle Richtungen sehen. Seine Hände fuhren über den kahl rasierten Schädel, als hätten sie eine schwer zu bändigende Haarfülle zu ordnen.
„Ich höre und höre, und ich höre immer noch“, sagte Donnerhall.
Niccolò wollte nur schnell auf seinen Platz zurück und den Hypnoseversuch fortsetzen. Eigentlich musste man dabei seinem Gegenüber in die Augen gucken. Aber Niccolò meinte, wenn er sich nur genügend konzentrierte, würde sein Blick auch durch Paulas Hinterkopf dringen.
Ole war von seinem Platz aufgestanden und gab ihm Flaggenzeichen, als wollte er ein Schiff davor bewahren, auf einen Eisberg aufzulaufen. Auch die anderen Mitschüler bemühten sich mit Grimassen, ihm anzuzeigen, was Donnerhall von ihm verlangt hatte.
Da sah Niccolò in Paula Klettes aufblitzende Brillengläser und begann wie auf Zuruf, ein Lied vorzusingen, das die Klasse auswendig lernen sollte. Es gehörte zu Donnerhalls Spezialitäten, seine Schüler Lieder aus dem Gesangbuch für die evangelisch-lutherische Landeskirche des Königreichs Sachsen lernen zu lassen. An jedem Montagmorgen musste die Klasse zu Beginn des Unterrichts ein neues Lied singen, wobei Donnerhall mit zuckenden Armen und artistischen Körperverrenkungen den Chor dirigierte. Bis zur Mittagspause hatten die Schüler das Lied modernisiert und rappten es ins Englische übersetzt auf dem Schulhof.
Niccolò sang für sein Leben gern. Seine Stimme war noch mädchenhaft hoch und doch schon männlich kräftig. Wenn er vorsang, hörten seine Mitschüler, die nur allzu gern über „Donnerhalls Musikantenstadel“ spotteten, gern zu. Der Lehrer bewegte sich nach kurzer innerer Gegenwehr zu Niccolòs Gesang wie eine Schlangentänzerin.
„Lasset uns mit Jesus ziehen,
seinem Vorbild folgen nach,
in der Welt der Welt entfliehen
auf der Bahn, die er uns brach,
immerfort zum Himmel reisen,
irdisch noch schon himmlisch sein,
glauben recht und leben rein,
in der Lieb den Glauben weisen.
Treuer Jesus, bleib bei mir,
gehe vor, ich folge dir.“
Als Niccolò endete, war es sekundenlang still. Donnerhall legte ihm die Hand auf den Kopf und sagte bewegt: „Danke.“ Die anderen klatschten, trampelten und pfiffen, bis der Lehrer ihnen energisch Ruhe gebot.
Niccolò setzte sich auf seinen Platz zurück und drückte Oles Hand.
„Du singst wie Robbie Williams, Alter“, lobte Ole. „Du wirst bestimmt mal ein Superstar. Ich werde dann dein Manager. Ist das okay so?“
Niccolò konzentrierte sich wieder auf die Hypnose von Paula Klette. Es konnte nur noch Sekunden dauern, bis sie sich umdrehen und ihn lachend ansehen würde. Ihre Schultern zuckten immer stärker, ihr Kopf nickte, drehte sich nach links und rechts...
Nun aber musste sie sich endlich umdrehen und Niccolò ansehen
4.
Auch in den folgenden Unterrichtsstunden war es Niccolò nicht gelungen, seine Hypnoseversuche zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Entweder war sein Blick zu schwach, um Paulas Hinterkopf bis zu den Augen zu durchdringen, oder aber er ließ sich zu sehr von seinen Kopfschmerzen, Oles Geflüster und Donnerhalls Getöne ablenken.
Niccolò nahm sich vor, in der Hofpause Paula direkt in die Augen zu blicken. Bei dem Durcheinander und Geschrei im Speiseraum hatte das keinen Sinn. Hier musste man aufpassen, dass man überhaupt am Leben blieb. Aber dann würde er seine Chance nutzen.
Um die drei Rosskastanien, die zwischen ihren grünfingerigen Blättern harzige Knospen austrieben, gruppierten sich Schüler der verschiedenen Altersklassen.
Die „Pampers“, zu denen die Mädchen und Jungen der ersten bis vierten Klasse gehörten, haschten einander um den kleinsten Baum. Die Grundschule und der Hort waren neben dem Gymnasium in einem Flachbau untergebracht. Obwohl ein Drahtzaun die Kleinen von den Älteren trennte, fanden sie immer wieder ein Loch, um durchzuschlüpfen. Die älteren Schüler duldeten sie schließlich wie lästige Insekten, die man zwar für kurze Zeit verscheuchen, aber doch nicht für immer vertreiben kann.
Die mächtigste Kastanie, die den Mittelpunkt des Schulhofes bildete und in deren Stamm Herzen und Liebesschwüre eingekerbt waren, wurde von den „Eierköppen“ besetzt, zu denen man sich ab dem Besuch der zehnten Klasse rechnen durfte. Die Eierköppe wiederum bestanden aus drei Untergruppen. Die größte bildeten die „Neutralen“, die sich aus allem heraushielten und nach guten Zensuren strebten. Dann folgten die „Godzillas“, eben Godzilla mit seiner Anhängerschar. Und in der dritten Gruppe waren die „Glatzen“ vereint, rechte Skins, Faschos eben, die nicht alle wirklich eine Glatze hatten. Sie waren eine Hand voll Jungen und Mädchen, die von Josef aus der Elften kommandiert wurden. Der Junge war groß und durchtrainiert, die meisten Mädchen schwärmten von ihm. Aber die Jungen fürchteten seine kalte Freundlichkeit noch mehr als Godzillas tapsige Kraftmeierei.
Um den dritten Baum schließlich scharten sich die „Halben Pfunde“, die sich aus den Klassen fünf bis sieben zusammensetzten.
Die Jungen und Mädchen aus der Achten und Neunten, die „Hauspflaumen“, lehnten am rechten Ende des Schulgebäudes an der Hauswand, wo um die Mittagszeit die Sonne für ein paar Minuten wärmte.
Am Zaun zur Hauptstraße liefen die „Bolschewiken“ auf und ab. Es waren zwei Mädchen und drei Jungen, deren Familien– wie Donnerhall erzählt hatte– im siebzehnten Jahrhundert mit anderen Deutschen von der russischen Zarin Katharina II. an der Wolga angesiedelt wurden. Im Zweiten Weltkrieg hatte Stalin sie nach Zentralasien verbannt. Nun waren sie nach Deutschland zurückgekehrt und konnten sich einfach nicht an ihre neue Heimat gewöhnen.
Niccolò und Ole standen nebeneinander bei den Hauspflaumen. Ole, der nicht nur wie Burattinos älterer Bruder aussah, sondern auch so phantastisch lügen konnte, sagte: „Die Eierköppe wollen unbedingt, dass ich zu ihnen gehöre. Was soll der gute alte Onkel Ole auch noch bei den Halben Portionen oder den Hauspflaumen? Ich war ja schon erwachsen, als ich noch unter den Pampers herumhüpfte.“
Während Niccolò nach Paula ausschaute, die sich ungewöhnlich lange im Speiseraum aufhielt, schaute Ole sehnsüchtig zu den Eierköppen, wo Godzilla und Loreley eng umschlungen vor und zurück wippten. Godzilla nahm einen Zug aus der Zigarette, schob sie dann Loreley zwischen die Lippen, die daran sog, dass der Tabak aufglühte.
„Ich möchte meine Nase drauf wetten, dass die beiden Hasch kiffen“, sagte Ole abgestoßen und doch bewundernd. „So ein Riesendino, der Godzilla!“
Niccolò entzog sich Oles rüttelndem Griff. Paula hatte den Schulhof betreten. Sein Blick huschte zwischen den drei Schönen hin und her. Frau Mandelstern hatte Hofaufsicht. Sie wurde von den Pampers beschäftigt und musste die Kleinen trennen, von denen ein paar Jungen immer wieder zu Raufen begannen. Er hörte Frau Mandelstern in verschiedenen Sprachen schimpfen, drohen und bitten. Wenn sie mit Worten nichts erreichen konnte, warf sie ärgerlich die Arme empor. Aber bald lachte sie versöhnt, ließ ein Mädchen einen Taschenspiegel halten, kauerte sich davor, schminkte ihre Lippen nach und steckte sich die langen braunen Haare hoch.
Imke Liebstöckel, die zu den Eierköppen gehörte, lehnte abseits an der Gebäudewand und reckte ihr Gesicht der Sonne zu. Niccolò sah bewundernd, dass sie zu den Längsten ihrer Klasse gehörte. Selbst wenn er sich auf die Zehenspitzen wippen würde, überragte sie ihn noch um Kopflänge. Imkes Haare waren schulterlang, tiefschwarz gefärbt, dazwischen schienen winzige Sterne zu glitzern. Niccolò zählte dreizehn schwarze Ringe, die ihre Ohrränder und Nasenflügel zierten. Sie hatte immer lange und weite schwarze Kleider und Mäntel an, als wollte sie von sich so wenig wie möglich zu erkennen geben. Andererseits zog sie mit ihrer auffallenden Erscheinung die Blicke auf sich. Wenn sie sich mit ihren schwarzen Turnschuhen durch die Flure der Schule bewegte, sah es aus, als würde sie flach über dem Fußboden dahinschweben.
Imke Liebstöckel hatte die Augen geschlossen, ihr Körper zuckte kaum merklich. Auf ihren Ohren klemmten die Kopfhörer eines CD-Players, der in der Tasche ihres Kleides steckte. Das schöne Mädchen erschien Niccolò unerreichbar weit weg.
Da hörte Niccolò Paulas Lachen, und obwohl man es gewohnt war, schaute jeder unwillkürlich zu ihr hin. Niccolò fand, die Gelegenheit war günstig, seinen Hypnoseversuch erfolgreich zu gestalten.
Paula lehnte mit ihrer Freundin Carola Sanddorn Rücken an Rücken. Die Schöne hatte die Hände im Nacken verschränkt und sah zu zwei Jungen aus der Achten, die einander eine leere Coladose zuköpften. Der eine Junge hieß René Kiekhahn und galt als großes Fußballtalent. Die Herzbrille saß keck auf Paula Klettes murmeliger Nasenspitze, dass sie neugierig über den Brillenrand sehen konnte.
Niccolò spannte seine Muskeln an, sein Blick schleuderte einen Blitz, der sich in Paulas blaue Augen bohrte.
Und jubelte innerlich, als Paula nun nicht mehr René Kiekhahn, sondern ihn ansah. Sie blickte zwar böse, aber das würde sich schnell ändern.
Paula Klette sagte mit ihrer großartig piepsigen Stimme: „Warum schielst du denn so?“
„Ich schiele doch nicht“, sagte Niccolò, der sich ihre ersten an ihn gerichteten Worte ganz anders vorgestellt hatte.
„Und doch schielst du“, beharrte Paula. Sie wischte sich energisch mit dem Ärmel ihres Hemdes über die Nase.
Niccolò blickte zur Seite, dann nach oben und unten, und rollte seine Augen schließlich links- und dann rechtsherum. Dann sah er Paula wieder an.
„Ist es so besser?“
Paula nahm ihre Hände vom Nacken und löste sich von Carola Sanddorns Rücken.
„Was soll denn besser sein?“, sagte sie. „Du schielst, als wolltest du dreimal links um die Ecke sehen.“
Niccolò beauftragte seinen Hypnoseblick, Paula freundlicher zu stimmen. Sie sollte sagen: Das war doch nur Spaß, Niccolò. Wie geht’s denn so?
Doch Paula rief: „Sieh doch mal, Carola. Wie gemein der Rosenbusch schielt!“
„Soll er doch schielen“, sagte Carola Sanddorn gelangweilt. „Alle Jungen sind schwer behindert und schielen. Wusstest du das denn noch nicht?“
„Wusste ich nicht“, sagte Paula Klette. „Ich weiß nur, dass Rosenbusch mächtig schielt.“
An Paula versagte anscheinend die Macht der Hypnose. Niccolò begann am Wahrheitsgehalt des Buches Die Kraft der Gedanken zu zweifeln. Er sagte freundlich: „Es macht mir nichts aus, wenn du sagst, dass ich schiele, Paula. Aber du schielst ja viel mehr. Einfach wunderbar, wie du schielst.“
Paula errötete jäh, für einen Augenblick schienen sogar ihre Igelhaare in Flammen zu stehen. Sie flüsterte krächzend, als hätte sie Niccolò ein Geheimnis mitzuteilen: „Ich schie-le doch ni-cht.“
Niccolò, der sich in den Gefühlen der Mädchen nicht auskannte, meinte, dass eine Freudenwelle Paula überrollt hätte. Also hatte Ole recht, wenn er behauptete: „Die Weiber wollen doch nur Komplimente hören.“
„Ich habe noch nie jemand so schielen sehen wie dich, Paula. Ich finde, du schielst wundervoll.“
Paula wurde von einer zweiten Hitzewelle erfasst, nach der sie jedoch erbleichte. Sie zischelte: „Du spinnst doch wohl dreimal, Rosenbusch! Sag bloß nicht noch einmal, dass ich schielen würde!"
Niccolò wurde stutzig, irgend etwas stimmte da nicht. Er wollte sich vorsichtshalber entschuldigen, da sagte Ole: „Niccolò hat schwer recht. Na klar, du schielst umwerfend, Klette.“
„Halt du dich da raus, Grabow!“
„Ich sage dir, du schielst wie das Schielmonster im Gruselschocker Wenn der Tod eine schwarze Brille trägt.“
Paula schnappte nach Luft, ihr Mund stand weit offen, ihre Zahnspange blitzte im Sonnenlicht. Sie wollte etwas sagen, aber es war nur ein rabenähnliches „Krrchz, krrchz“ zu hören.
„Halt den Mund, Ole“, befahl Niccolò seinem Freund. Er konnte nicht mit ansehen, wie Paula Klette litt. Er sagte tröstend zur ihr: „Vielleicht schielst du ja auch gar nicht, Paula. Du schielst sogar kein bisschen.“
„Sie schielt aber doch“, beharrte Ole. „Mit dem Blick kannst du gleichzeitig nach oben und unten und nach rechts und links gucken.“
„Krrchz! Krrchz!“
Paula verschluckte sich, sie hustete und stieß Carola Sanddorn weg, die ihr auf die Schultern klopfen wollte. Dann spuckte sie aus, wischte sich mit dem Ärmel kreuz und quer übers Gesicht, rückte die Herzbrille zurecht, dass ihre Augen wieder hinter den getönten Gläsern verborgen waren. Sie sagte mit abgrundtiefer Verachtung: „Du bist ein saublöder, hundsgemeiner, ochsendummer Kerl, Rosenbusch. Und quatsche mich nur nie wieder an. Sonst haue ich dir auch noch dein anderes Auge blau.“
Für einen Augenblick verlor Niccolò sein Gleichgewicht, er musste sich an Oles Schulter festhalten. Er hörte sich stottern: „A– aber, aber ich wo– wollte dir doch nur sa– sagen...“
„Dass du schielst, Klette“, ergänzte Ole ungerührt.
Da gab es einen Knall, Niccolò sah in ein Feuerwerk und schwankte. Als er endlich wieder klar sehen konnte, erklärte Ole ihm, dass Paula ihm eine einwandfreie Ohrfeige versetzt hätte.
5.
Auf dem Nachhauseweg schwiegen die beiden Freunde. Niccolò stand noch immer unter Schock. Ole fühlte sich anscheinend auch nicht gut. Er wurde schweigsamer, je näher er seinem Zuhause kam.
Niccolò ging mit Ole, obwohl das ein Umweg für ihn war. Der Freund wohnte mit seinen Eltern am anderen Ende der Siedlung, in der „Gammel- Bude“, wie Ole das heruntergekommene Einfamilienhaus nannte, das in einem großen verwilderten Garten stand. Das Grundstück wurde von einem Bahndamm begrenzt, hinter dem die Züge vorbeipfiffen. Wenige Meter entfernt führte eine neue gebaute Bundesstraße zur Autobahn und zum nahegelegenen Flugplatz.
Sie standen vor dem wackeligen Holzzaun und schwiegen. Ole lauschte zum Haus hin. Hastig trug er dem Freund eines seiner vielen Mathe-Rätsel vor, als wollte er verhindern, dass der ihn allein ließ.
„Hör doch mal zu, Alter, welche Nuss der gute Onkel Ole da wieder geknackt hat: Charly, ein abenteuerlustiger und stets zu Rätseln und Denkaufgaben aufgelegter Globetrotter, berichtet am Lagerfeuer: ‚Ich ritt auf dem Rücken eines Maulesels mit gleichbleibender Geschwindigkeit von Bixley über Pixley nach Quixley.‘ Nach 40 Minuten fragte ich Don Pedro, den eingeborenen Führer, wie weit wir inzwischen wären. Don Pedro antwortete: ‚Wir haben gerade halb soviel hinter uns, wie wir bis Pixley vor uns haben.‘ Nach weiteren 7 Meilen fragte ich: ‚Wie weit ist es noch bis Quixley?‘ Und er sagte: ‚Halb so weit wie von hier bis Pixley.‘ Eine Stunde später erreichten wir Quixley.“
„Ja und?“, fragte Niccolò, der wenig Interesse an Oles Leidenschaft zeigte.
„Und nun, mein Alter, sollst du aus diesen Angaben folgendes rauskriegen“, fuhr Ole eifrig fort. „Erstens: Wie viele Meilen ist Bixley von Quixley entfernt? Zweitens: Wie viele Meilen legte mein Maulesel in einer Stunde zurück? Drittens: Wie viele Meilen ist Bixley von Pixley entfernt?“
Niccolò tat so, als überlegte er angestrengt, bis er die angehaltene Luft zischend ausstieß und sagte: „Teuflisch schwer.“
„Kindisch einfach“, entgegnete Ole zufrieden, er präsentierte Niccolò auch gleich die Ergebnisse und den Rechenweg mit der Flüchtigkeit eines Genies.
Niccolò wusste, dass Ole zu Hause Probleme hatten. Früher hatten sie in Oles Bodenkammer Spielerporträts von ihren Lieblingsfußballern getauscht, an Oles Computer experimentiert und miteinander geschwatzt. Wenn dann Oles Eltern nach Hause kamen, hatte es zwischen ihnen lauten Streit gegeben. Der Vater war fast zwei Meter lang, kantig und wortkarg. Er arbeitete auf dem Bau und war zwischendrin immer wieder arbeitslos. Es hieß, dass er mehr in den Kneipen des Städtchens als zu Hause sei. Die Mutter war klein und muskulös, sie trainierte Bodybuilding und hatte schon Wettkämpfe gewonnen. In ihrer Jugend hatte sie zu den Punks gehört, noch immer färbte sie ihre Haare grellrot oder hellgrün. Sie arbeitete in einem Supermarkt als Kassiererin. Ole hatte auch eine Schwester, die „Große“, sie verschwand öfter von zu Hause und tauchte dann wieder auf, ohne ein Wort zu verlieren.
Die Nachbarn waren sich einig, dass die Grabows „Assis“ wären, eben Leute, die sich nicht in das normale Leben einfügen könnten. Balanca, Niccolòs Großvater also, hingegen meinte, dass solche Reden „verschimmelter Schlauquark“ seien. Manche Menschen passten eben nur nicht zusammen, und je eher sie sich trennen würden, um so mehr Unheil könnten sie verhindern.
Dass Ole überhaupt das Gymnasium besuchte, war wohl nur einem Lehrer zu verdanken, der frühzeitig die außergewöhnliche mathematische Begabung des Jungen erkannt hatte. Es war ihm gelungen, Oles Eltern zu überzeugen, dass sie nicht das Recht hätten, ihrem Sohn einen höheren Bildungsweg vorzuenthalten. Ole löste im Handumdrehen die schwierigsten Matheaufgaben, und wo andere sich quälten, begann bei ihm der Spaß.
Manchmal fehlte Ole tagelang in der Schule. Es hieß, er sei krank. Wenn Niccolò bei ihm zu Hause klingelte, öffnete niemand. Oles Zimmerfenster blieb dann auch geschlossen, wenn Niccolò kleine Steine gegen die Scheibe warf. Nur die Gardine wurde leicht bewegt.
„Ist noch was?“, fragte Ole, als Niccolò sich schon verabschiedet hatte und doch stehen blieb.
Niccolò stöhnte leise und druckste dann: „Sag mal, Ole, wie sehe ich eigentlich aus?“
„Wie sollst du denn aussehen? Wie immer, denk ich mal.“
„Versuch doch mal zu gucken, als ob du ein Mädchen wärst.“
Ole bohrte mit dem kleinen Finger in der Nase, ein sicheres Zeichen, dass er schwer am Überlegen war. Schließlich fragte er: „Wie guckt denn so ein Weib? Weißt du das vielleicht?“
Niccolò zuckte bedauernd die Schultern und sagte: „Guck einfach mal.“
Er hielt sein Gesicht dicht vor Oles Augen.
„Hast du überhaupt eine Ahnung, wie schwer das für einen Mann ist“, sagte Ole, hielt den Kopf schief und klimperte mit den Augenlidern.
„Nun? Wie findest du mich?“
„Tja“, sagte Ole und rieb sich das Kinn. „Wenn ich wie ein Mädchen gucke, siehst du ziemlich blöd aus. Aber wenn ich dich wie ein Junge ansehe, siehst du ganz normal aus.“
„So ist das also.“ Niccolò senkte betrübt den Kopf. „Danke, Ole. Nun weiß ich also die Wahrheit.“
„Was denn für eine Wahrheit, Mann?“ Ole war selbst schlechter Laune, wenn sein Freund nicht froh war.
Als Niccolò beharrlich schwieg, sagte Ole: „Denke nicht, dass ich völlig ahnungslos bin. Ich weiß nämlich, was mit dir los ist. Denn geisteskrank bin ich nicht.“
„Was soll denn mit mir los sein?“
„Du bist krank, Mann. Schwer krank bist du. Dich hat nämlich die Liebe gepackt!“
„Meinst du wirklich?“, fragte Niccolò zaghaft. „Na, wie geht denn so was?“
„Das geht ganz einfach“, antwortete Ole, als könnte er auf ein erfahrungsreiches Leben zurückblicken. Er angelte eine zerknitterte Zigarette aus der Jackentasche, zündete sie an, paffte wie eine alte Dampflok, hustete und spuckte angeekelt aus. „Willst du auch mal zie-ziehen? Schme-schmeckt einwand-frei.“
„Nein, danke“, sagte Niccolò. „Und wie einfach geht die Liebe nun?“
„Du musst dir einen Schnupfen vorstellen“, erklärte Ole und sog mit verdrehten Augen erneut an der Zigarette. „Manchmal kann es auch wie eine Grippe sein. Ich kenne das von Ramona, unserer Großen. Die ist jeden Monat mindesten dreimal liebeskrank. Manchmal will sie sogar sterben.“
„Das kann ich gut verstehen“, sagte Niccolò mit leidender Stimme. „Und weiter?“
„Sie stirbt aber eben nicht“, berichtete Ole weiter. „Manchmal wäre es mir ganz recht. Sie nervt nämlich mit ihrem Geseufze und Gestöhne. Vor allem will das Weib dann immer ein anderes Fernsehprogramm sehen als ich.“
Nun seufzte und stöhnte auch Niccolò. Er malte sich aus, wie er an der Liebeskrankheit sterben würde. Die drei Schönen würden an seinem Grab stehen. Imke Liebstöckel würde ein Kirchenlied rappen. Rebekka Mandelstern müsste sich auf den Grabstein stützen und würde ihm eines der Bücher, die er aufzuheben geholfen hatte, unter die kalte Erde schieben. Paula Klette schließlich müsste sich von ihren Eltern führen lassen, unter ihrer Herzbrille würden die Tränen wie kleine Bäche hervorströmen. In der Trauerweide, die an seinem Grab stand, würden die Krähen sitzen und lautlos mit den Flügeln schlagen.
Niccolò musste die aufkommenden Tränen unterdrücken, da sagte Ole: „Es gibt etwa sechs Milliarden Menschen auf der Welt. Wie konntest du dich nur in die dusselige Sehkuh Klette verlieben? Das hätte selbst ich nicht ausrechnen können. Aber keine Bange, der gute Onkel Ole wird sich was ausdenken, womit du dich grausam an ihr rächen kannst.“
Die Freunde schlugen zum Abschied die Handflächen gegeneinander. Ole stieg über den Holzzaun und verschwand auf dem schmalen Weg durch das Gesträuch zur Haustür. Niccolò stapfte müde nach Hause.
6.
Als Niccolò zu Hause ankam, ließ auch er das Gartentor unbeachtet und stieg über den Zaun, wie sich das gehörte.
Das „Affenhaus“ seines Großvaters war nicht so fein herausgeputzt wie die meisten Nachbarhäuser. Die Siedlung war vor dem Krieg von arbeitslosen Eisenbahnern erbaut wurden, meist einstöckige Doppelhäuser mit ein paar kleinen Räumen und angebauten Hühner- und Kaninchenställen. Die Gärten waren schmal und lang, und wo jetzt Tannen und Ziersträucher wuchsen, wurden früher Gemüse und Futterrüben für ein Schwein angebaut. Jeder Quadratmeter Erdboden wurde genutzt, selbst noch um die Stämme der Obstbäume hatte man Kohl gepflanzt.
Die Urgroßeltern hatten auf der ehemaligen Müllhalde Stein auf Stein gesetzt, bis endlich das erträumte Haus stand. Wenn Niccolò nach „damals“ fragte, ließ der Großvater mit ein paar Bleistiftstrichen auf einem Blatt Papier Bilder entstehen, dass Niccolò sich gut vorstellen konnte, wie es hier ausgesehen hatte.
Das Affenhaus, dem der Großvater den Namen gegeben hatte, weil Niccolòs Mutter mit ihrem oft überschäumenden Temperament manchmal „verrückt spielte“, hatte zwei Gesichter. Während die Vorder- und Rückseite noch den oft ausgebesserten grauen Putz zeigte, war die Giebelseite frisch verputzt und lindgrün angestrichen. Die eine Dachhälfte war mit glasierten roten Ziegeln neu gedeckt, während auf der anderen Hälfte bei Sturm die alten Schindeln klapperten. Einige Fenster waren erneuert und der Schornstein neu gesetzt worden. Aber die Haustür war aus altersschwachem Holz und von einem Dieb, wie Balanca lachend meinte, mit einem Büchsenöffner zu knacken.
Nach dem Deutschland wieder eins wurde, hatte auch in der Siedlung eine rege Bautätigkeit begonnen, und aus manchem armseligen Häuschen war eine Villa geworden. Aber während in den Villen immer wieder einmal eingebrochen wurde, blieb das Affenhaus verschont. Die Diebe ahnten wohl, dass bei den Rosenbuschs keine Schätze zu finden waren.
Niccolò schloss die Haustür auf, blieb aber unentschlossen stehen. Heute verspürte er keine Lust, sich in seinem Zimmer an den Schreibtisch zu setzen und Hausaufgaben zu erledigen. Es zog ihn auch nicht an den Computer oder zu den Bolzern, die täglich auf dem Rasenflecken hinter dem „Kulturhaus“, der Siedlungskneipe, kickten.
Niccolò überlegte, ob er Manuela anrufen sollte. Aber die Mutter hatte ihm gesagt, dass er das nur in Ausnahmefällen, wenn es „lebenswichtig“ war, tun dürfe. Niccolò rief sie trotzdem täglich ein paarmal an. Aber heute wusste er nicht, was er ihr sagen sollte.
Und „Balanca“, so nannte Niccolòs Großvater sich seit seiner Zirkuszeit, war auch in der Arbeit. Er versuchte die Welt zu retten, wie er schmunzelnd sagte, dass sie nicht in ihrem eigenen Dreck, den sie täglich produzierte, erstickte. Er war beim Stadtreinigungsamt als Kehrwalzenfahrer angestellt; er aber nannte sich einfach nur Straßenkehrer. Manuela hörte das nicht gern, doch Balanca entgegnete, die Straße zu kehren sei eine ebenso ehrenwerte Tätigkeit wie als Clown im Zirkus aufzutreten oder als Bundeskanzler Deutschland zu regieren.
Niccolò setzte sich auf einen Baumstumpf und ließ sich von den Vögeln, die im Geäst der Birke hockten, etwas vorzwitschern. Er beneidete sie, wie sie ihr Gefieder in der Sonne plusterten und mit sich und der Welt zufrieden waren. Passte ihnen etwas nicht, erhoben sie sich in die Luft und flogen einfach davon.
Doch lange hielt Niccolò das Stillsitzen nichts aus; er schlenderte durch den Garten und blieb vor Großvaters „Atlantik“, dem Goldfischteich, stehen. Er nahm etwas Trockenfutter aus der Büchse, die zwischen Kieselsteinen steckte, ließ es auf die Wasseroberfläche rieseln und beobachtete die rot und silbern glänzenden Fische, die danach schnappten.
Als sich das Wasser wieder glättete, sah er vom Grund das Gesicht eines Jungen auftauchen. Es musste sein Gesicht sein, und doch erschien es ihm fremd. Wenn er bisher in einen Spiegel gesehen hatte, dann nur flüchtig und ohne mehr wahrzunehmen als eben irgendein Gesicht.
Doch heute sah er genauer hin.
„Na, Niccolò“, sagte er aufmunternd zu dem Gesicht im Teich. „Nun lass dich doch mal ansehen.“
Das Gesicht, das da von bunten Fischen umspielt wurde, wirkte blass gegen die schwarzlockigen Haare. Niccolò spuckte auf seine Handflächen und versuchte, die ungeliebten Locken zu glätten. Aber so sehr er sich auch mühte, die Haare wellten und kringelten sich bald wieder.
Nicht nur der Locken wegen erschien ihm sein Gesicht zu „niedlich“ oder gar „süß“, wie es manchmal Manuelas Kundinnen sagten, wenn die Mutter ihn als ihren Sohn vorstellte. Er wünschte sich auszusehen wie der vollbärtige und narbige Seeräuber „Stachelrochen“ aus dem Film „Kalt kommt der Tod auf hoher See“. Nur gegen seine Augen hatte Niccolò nichts einzuwenden. Sie waren fast so groß und dunkel wie die von Rebekka Mandelstern. Insgesamt aber fand er sein Aussehen einfach zu mädchenhaft. Er hoffte auf Großvaters Voraussage, dass bald die ersten Barthaare um sein Kinn und über der Oberlippe sprießen würden. Aber solange konnte er nicht warten, um Paula Klette zu erobern.
Niccolò wischte mit der Hand über das Wasser, dass es sich kräuselte. Die Fische huschten davon, das Spiegelbild erzitterte und verschwand schließlich. Als er aufstand war das Wasser grau und undurchsichtig, als sei es eine glänzende Steinplatte.
Niccolò musste etwas tun. Vielleicht war er ja wirklich liebeskrank, wie Ole behauptete. Bestimmt hatte er hohes Fieber und phantasierte stark. Jedenfalls fühlte er sich so. Man hatte ihm gelehrt, dass die mittlere Anzahl der Knochen eines jungen Menschen 200 beträgt, und nun erfuhr er, dass jeder einzelne ihm weh tat. Was aber sollte ein Mensch mit zweihundert kaputten Knochen und zweiundvierzig Grad Fieber tun? Balanca, der behauptete, sich in der Welt auszukennen wie in seiner Brieftasche, würde wohl sagen: Das Allerdümmste ist, sich selbst im Weg zu stehen.
Niccolò warf die Schultasche in den Hausflur, schloss die Tür wieder ab, zog sein Fahrrad aus dem Schuppen und fuhr eilig zur „Bolzacker“ hinter dem Kulturhaus. Er kam gerade recht zur Aufstellung der Mannschaften. Für die Nachmittagsstunden vergaß er alle Sorgen und Schmerzen. Selbst Paula Klette war in weite Ferne gerückt. Sein ganzes Leben schien an diesem runden Ding zu hängen, das meist dort herum sprang, wo man selbst nicht war. Er musste ihm nur pausenlos nachjagen, um es dann doch einmal zu erwischen und kräftig zu treten, dass es wie eine Kanonenkugel in die Maschen donnerte und alle „Tooor!“ schrien. Für das Glück eines Jungen bedurfte es eben nur– wie Niccolòs Großvater Manuela aufgeklärt hatte, wenn sie wieder einmal über das „idiotische Mannsgezappel“ schimpfte– eines aus einem Stück Leder gefertigten Hohlballes von achtundsechzig bis siebzig Zentimeter Umfang und vierhundertzehn bis vierhundertfünfzig Gramm Gewicht. Balanca selbst war zwar nie Fußballer gewesen, aber als Drahtseilartist hatte er einen blauen Ball auf der Spitze seines Zeigefingers drehen lassen, dass jeder sehen konnte, wie wunderbar die Erde sich im All bewegte.
„Gib doch ab!“, schrie Niccolò seinem Mitspieler zu. „Her mit dem Leder! Sei bloß nicht so ballverfressen!“
Als er den Ball endlich hatte, dribbelte er keuchend, die Rufe der anderen, den Ball doch endlich abzuspielen, missachtend, auf das gegnerische Tor zu.