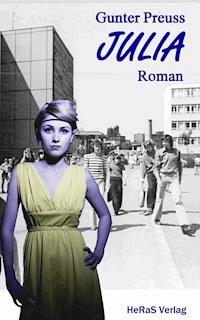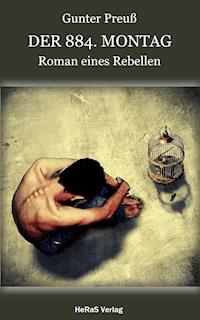Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hin- und hergerissen zwischen vorgesteckten Zielen und der Sehnsucht nach Unbekanntem und Wagnis ist das Mädchen Cornelia, genannt Conny. Und sie macht verwirrende, komische wie schmerzliche Erfahrungen: mit Jungen, Männern, der eigenen Schwester. Um Klarheit zu gewinnen, schreibt sie alles nieder. Geschehen in den Achtzigerjahren der DDR. Heute, als junge Frau liest sie nach. Denn plötzlich ist ihr Jugendfreund Ludwig wieder aufgetaucht, mit dessen Rennrad sie einmal vom Kilimandscharo fliegen konnte...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gunter Preuß
Wie ein Vogel aus dem Ei
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Einführung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Impressum neobooks
Prolog
Ach, weiß man in eurem Volk überhaupt, wie man lieben kann? Furcht, Müdigkeit und Zweifel verbrennen, verschwinden auf ewig. So sehr kann man lieben. Selbst die Bäume im Wald können zärtliche Worte mit uns wechseln und die Vögel und die wilden Tiere, weil Liebende alles verstehen und sich eins fühlen mit der ganzen Welt.
Einführung
Wer hätte das denn gedacht? Ludwig Zeller! Es gibt ihn noch. Da ist er mir doch mitten im Gedränge der Innenstadt wieder über den Weg gelaufen. Wie damals in der Schule, als ich nicht mehr weiterwusste. Bei etwa fünf Milliarden Menschen liegt die Wahrscheinlichkeit für so eine Wiederbegegnung der anderen Art dicht bei null.
Eine Woche ist es her, dass wir uns begegnet sind. Inzwischen haben wir eine Woche zusammengelebt. Wir sind Tag und Nacht nicht aus meiner Wohnung gekommen. Es war, als hätten wir beide viel nachzuholen und als hätten wir Angst, dass wir diese Leidenschaft nie wieder erleben könnten. Ich, Du und Wir - alles jetzt, in einem Augenblick, mit einem Mal. Ein Rausch. Aber der hält nicht ewig an. Irgendwann kommt man wieder zur Besinnung und beginnt, sich Fragen zu stellen. Von dem, was eben noch selbstverständlich war, bin ich nun im Nachhinein überrascht. Ich misstraue wohl meinem Glück. Bisher ist mir nichts leicht gefallen und alles musste ich mir schwer erarbeiten.
Ob ich will oder nicht, ich kehre immer wieder zu unserer Begegnung zurück, als könnte ich dort den Beweis, eine Art Zeichen finden, dass ich nicht einfach einem Teenager-Traum aufsitze. Obwohl ich - der Himmel bewahre mich - fast dreißig bin und ein gutes Dutzend Jahre vergangen sind, dass ich Ludwig Zeller gesehen hatte, habe ich ihn gleich wieder erkannt. Das heißt, ein Weilchen dauerte es schon, bis ich begriffen hatte: Er ist es. Da war er fast schon wieder in der Menschenmenge verschwunden: ein hoch gewachsener Mann, Jeans, T-Shirt, eine abgewetzte Ledertasche unterm Arm, dunkle, kurze Haare, leicht nach vorn gebeugt, wie ein Langläufer, der den Start trainiert.
Es ist später Abend. Ich sitze am Fenster meines Wohnzimmers, das ich auch zum Arbeiten und Schlafen benutze. Die Wohnung hat nur noch eine kleine Küche und ein Bad. Sie befindet sich im Erdgeschoss eines Mietshauses, das wohl am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts seine beste Zeit hatte. Das Haus steht in einer Tag und Nacht belebten Durchfahrtstraße am Rand der Innenstadt.
Ich habe die Gardine zurückgezogen und blicke auf die Straße. Eine Straßenlampe lässt draußen die Nacht zum Tag werden. Diese künstliche Sonne hat etwas Beängstigendes an sich, sie scheint ohne Unterbrechung und ganz gleichmäßig. Ich habe mindestens dreißig Grad im Zimmer, und doch fröstelt es mich oft. Meine Augen haben sich inzwischen an das Licht gewöhnt, das auch noch in den letzten Winkel des Raumes dringt, als sollte ich davon abgehalten werden, etwas zu verstecken. Aber ich besitze so gut wie nichts, das jemand begehren könnte. Da sind nur die paar Möbel, die nicht neu, aber auch nicht alt genug sind, um einen Wert zu haben: Liege, Schrank, zwei Sessel; überfüllte, sich bis zur Zimmerdecke hochziehende Bücherregale und der riesige Schreibtisch mit der Computeranlage und dem Chaos von handbeschriebenen Papierblättern.
Ich sehe wie durch den Sucher einer Kamera auf ein paar Quadratmeter Stadt, deren Bild sich ständig verändert und doch immer das Gleiche ist: vorbeifahrende Autos und Straßenbahnen verschiedener Linien in regelmäßigem kurzen Zeittakt, Menschen, die von irgendwo nach nirgendwo hasten.
Etwa schon seit einer Stunde sehe ich immer wieder einmal zu einem Pärchen, das sich schräg über der Straße in einen im Halbschatten liegenden Hauseingang drückt. Sie umarmen sich, als wollten sie einander nie wieder loslassen. Doch schon zweimal sind sie nach kurzem und heftigem Streit auseinander gelaufen und aus meinem Blickfeld verschwunden. Aber es dauerte nicht lange, da kehrten sie ins Bild zurück. Sie rannten aufeinander zu, um sich wieder in die Arme zu schließen.
Ich fühle mich als eine Art Voyeur, ich zwinge mich zum Wegsehen; aber es vergehen nur Sekunden, bis ich die zwei wieder beobachte. Ich spüre mein Herz klopfen, mein Hände schließen sich immer wieder zu Fäusten, und mein Kopf ist heiß.
Ich wollte an meinem Manuskript weiterarbeiten, einem Kinderbuch, die Geschichte der kleinen Hexe Toscanella Fliegsogern, die von ihren Eltern verlassen mit ihrem fetten Schwein Schlachtmichnicht im Hexenwald lebt. Toscanella ist weder sehr traurig noch recht froh, bis sie eines Nachts Rufe hört: "Toscanella ... Toscanella ... " Es ist eine wunderschöne Vollmondnacht, im Hexenwald liegen alle in den Betten, und die kleine Hexe schwingt sich auf ihren Hexenbesen und steigt hoch in die Lüfte, um den Rufer zu finden ...
Ich arbeite gern in der Nacht; ich finde, da hört, schmeckt und fühlt es sich genauer, und ich kann mich gut aus mir heraus in jemand anders hineindenken. Aber diesmal gelingt mir die Konzentration auf meine kleine Geschichte nicht. Ich finde nicht aus mir heraus, und ich wüsste auch nicht, wohin mit mir.
Heute, gegen Mittag, hat sich Ludwig Zeller aus unserer Umarmung gelöst. Ich habe es kaum gemerkt. Erst als die Wohnungstür ins Schloss fiel, bin ich hochgeschreckt. So elend und verlassen habe ich mich noch nie gefühlt. Aber dann fand ich auf seinem Platz neben mir ein Blatt Papier, und ich las: Liebe Conny. Ich wollte dich nicht wecken. Du hast im Schlaf gelächelt. So - glücklich. Bestimmt hattest du einen schönen Traum. Ich muss meine Reisepapiere abholen. Fast hätte ich es vergessen. Dann muss ich noch ein paar Sachen erledigen und meinen Koffer packen. Bin so bald wie möglich zurück. Bitte denk inzwischen über meinen Vorschlag nach. Ich wäre sehr froh. L.
Letzte Nacht, als ich in Ludwigs Armen vor mich hin träumte, sagte er mir wie nebenbei, dass er in zwei Tagen für ein Jahr als Korrespondent nach Brasilien müsse. Ob ich nicht Lust hätte nachzukommen. Endlich könnten wir doch unsere Träume von damals wahr machen. Wenn es auch statt des Kilimandscharo vorerst nur der Zuckerhut sei ... Und würde es nicht auch für mein Schreiben wichtig sein, die Welt kennenzulernen?
Immer wieder spielt sich in meinen Gedanken das überraschende Zusammentreffen mit Ludwig Zeller ab. Wie ein Stück Film, das sich am Ende jedes Mal zurückspult und von Neuem beginnt. Als wäre darin ein für mich lebenswichtiger Hinweis versteckt. "Hallo ... hallo!", habe ich diesem Mann hinterhergerufen. Und er hat sich herumgedreht, als wenn er nur auf meinen Ruf gewartet hätte. Ich sah in das Gesicht eines fremden Mannes, aus dem mich das vertraute Gesicht des Jungen Ludwig Zeller ansah. Es ist ein gutes Gesicht, blass, ein bisschen verträumt, aber doch wach, kindlich trotzig und zugleich männlich energisch.
"Ja? -Ja!", hat er gesagt.
"Sie sind ...? Du bist ...“
"Cornelia", hat er gesagt. "Mensch, Conny!"
Wir haben uns gegenübergestanden, ein paar Meter entfernt, und die Leute sind an uns vorbeigelaufen, als gäbe es uns nicht. Es hat gedauert, bis wir den ersten Schritt aufeinander zu gemacht haben. Ich habe diese Sekunden der Schwerelosigkeit genossen, und ich denke, Ludwig ist es ebenso ergangen. Es war ihm wenig anzusehen, er ist nur nicht mehr ganz so blass gewesen. Ludwig hat seine Gefühle auch damals nicht aller Welt zeigen können; aber ich weiß in seinen Augen zu lesen.
Eine Straßenbahn hält vor meinem Fenster, obwohl hier keine Haltestelle ist. Sie verstellt mir den Blick auf die beiden an der Haustür. Ich springe auf, bücke mich, als könnte ich es erzwingen, drunter durch oder darüber zu sehen. Ich laufe in die Küche, aber auch von hier ist der Blick von der Straßenbahn verstellt, deren grelle Werbung mir ein fleckenloses Weiß verspricht, wenn ich meine Wäsche mit ... wasche. Der Name des Produktes ist mit einem schwarzen Totenkopf übersprayt.
Als ich ans Fenster meines Zimmers zurückkehre, fährt die Straßenbahn los. Ich muss noch den sich auflösenden Autostau abwarten, dann kann ich endlich die beiden wieder sehen: Fast unverändert lehnen sie aneinander, vielleicht etwas tiefer im Schatten des Türbogens, noch enger gefasst. Ich kann nicht erkennen, wer wen hält. Mir ist, als verändere sich das. Mal ist er es, mal sie. Jetzt erkenne ich, die beiden, die wie eins scheinen, schwanken leicht, als würden sie hin und her geschoben.
"Ludwig", habe ich gesagt. "Du hast es wohl sehr eilig?"
"Nein", hat er gesagt, dann flüchtig auf seine Uhr gesehen und energisch den Kopf geschüttelt.
"Wollen wir ...?"
„Ja. Ja." Wir sind losgegangen, wie auf ein festes Ziel zu, immer wieder schoben sich Menschen zwischen uns, aber es fiel uns leicht zusammenzubleiben.
In einer Bäckerei haben wir uns an einen Tisch gestellt und Kaffee getrunken. Wir haben wenig gesagt, nur Belangloses, ich habe es vergessen. Wir waren nicht verlegen, und es gab auch keine Fremdheit zu überwinden. Ich denke, uns hat einfach überwältigt, dass wir uns nach all den Jahren noch so nahe sind, als hätten wir nur voneinander getrennt ein paar Tage Urlaub gemacht. So viel Kaffee auf einmal habe ich in meinem Leben noch nicht getrunken. Es hat nach frischem Brot und Kuchen geduftet. Die Türglocke hat geläutet, wenn ein Kunde den Laden betrat oder verließ. Hinter uns verplätscherten die knappen Kaufgespräche. Ludwig und ich sahen durch das große Schaufenster auf die entgegengesetzten, nicht abreißenden Fußgängerströme und den hektischen Autoverkehr. Ab und zu nur blickten wir einander in die Augen, und wieder empfanden wir überwältigende Freude. Und wie nebenbei erzählten wir aus unseren Leben der letzten Jahre.
Das fällt mir erst jetzt wieder ein. Mir war so, als hätten wir kaum ein Wort miteinander gewechselt, nur unsere Nähe sei noch wichtig gewesen.
Die beiden im Hauseingang haben die Köpfe aneinander gelehnt. Es sieht aus, als hätten sie endlich im Schweigen zusammengefunden. In diesem Schwanken, dieser Pendelbewegung, sind sie harmonisch, als wären sie nun völlig aufeinander eingestimmt. Ich kann mich kaum an Einzelheiten von dem erinnern, was Ludwig Zeller mir und ich ihm alles erzählte. Es war ja in der Welt so viel passiert in den letzten Jahren. Was für die Ewigkeit geplant gewesen war, hatte die Geschichtsschreibung innerhalb von ein paar Monaten als Episode notiert. Wer fragt denn da nach dem Leben eines Einzelnen. Oder doch jemand?
Ich weiß nur noch, dass Ludwig Zeller, wie ich, nicht geheiratet und keine Kinder hat. Und dass er kein Offizier geworden ist, sondern Wirtschaftsjournalist bei einer großen Zeitung. Und dass er mir wichtig ist wie kaum jemand.
Das Pärchen steht unverändert, als wäre es zur Skulptur geworden. Aber diese Bewegungslosigkeit, dieses erstarrte Eins sein macht mich doch unruhig, ich öffne hastig das Fenster und rufe hinaus: "Hallo? Hallo!" Doch die beiden hören mich nicht. Jetzt schäme ich mich, schließe das Fenster und ziehe die Gardine zu. Soll mit den beiden da draußen doch passieren, was will. Ich habe hier drinnen mit mir zu tun. Es treibt mich im Zimmer auf und ab. Dann bleibe ich vor den Bücherregalen stehen, ziehe irgendein Buch heraus und blättere darin.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, als Ludwig Zeller und ich die Bäckerei verließen. Wir standen auf einem Fußweg, unsere Hände hielten sich, und ich sagte, um unser Zusammensein noch ein Weilchen auszudehnen: "Was für ein Zufall. Das alles ist doch ziemlich verrückt."
"Ja", sagte er. "Verrückt ist gut. Ja, schön."
Wir standen in dieser brodelnden Stadt wie auf einer winzigen Insel. Ein paar Sekunden standen wir steif und wussten nicht weiter. Das war so ein Moment, der über das weitere eigene Leben entscheidet. Das sind diese Augenblicke, in denen man wie im Märchen an einer Wegkreuzung mit vielen Schildern steht, die einem die richtige Richtung für den weiteren Weg weisen wollen. Ich musste nicht überlegen, und Ludwig auch nicht, denn wir fielen uns in die Arme, drückten uns so fest aneinander, dass wir beide leise aufschrien, fassten uns an den Händen und rannten los.
Wie ferngelenkt ziehe ich einen Hefter, der zwischen Dickens und Tolstoi klemmt, aus dem Regal, und ich weiß, das ist es, was ich finden wollte: Wie ein Vogel aus dem Ei.
Meine Teeniegeschichten, die ich damals unbedingt Ludwig schicken wollte. Was ich nie tat.
Als ich von zu Hause weg bin, habe ich sie aufgeschrieben. Ich weiß nicht, was sonst mit mir passiert wäre, wenn ich nicht zu schreiben begonnen hätte. Vielleicht wäre ich explodiert oder verschimmelt.
Also Conny und die Jungs. Werner Branstner und seine Taubengeschichte. Hans Wegener und die Schauspielerei. Frank Peter und die Stübbe-Ranch. Das Menschenschwein Henning. Und natürlich auch Ludwig Zeller und sein Rennrad.
Dazu all die anderen Menschen, die mir einmal nahe waren: von der Kneipenwirtin Jolly Eisenarm über meine "Freundin" Franziska, das Biest, Klassenlehrer Kröger, das magenkranke Angsthäschen, bis zu unserer Großen, meine Schwester Helga, das Sprintwunder. Ich schlage irgendeine Seite auf und lese nach all den Jahren zum ersten Mal wieder Maurers Gedicht von den Nachtsorgen, das mir damals immer wieder Hoffnung gab, als ich schon am Verzweifeln war.
Ich bin aus den Nachtsorgen gekrochen
wie ein Vogel aus dem Ei.
Ich habe die Schale durchbrochen
und spaziere jetzt frei.
Bin ich denn frei? Wirklich frei? Und was ist das überhaupt: Freiheit? Tun und lassen können, was man will? Anarchie. Das Chaos. Ich würde sagen, frei sein ist: sich selbst verantwortlich sein. Vielleicht habe ich ja auch darum alles immer wieder hingeschmissen: das Mathematikstudium, eine Hand voll feste Beziehungen, eine Rolle in einer der Endlos-Serien im Fernsehen, die Büro-, die Zeitungs-, die Rundfunkarbeit. Ich bin Schriftstellerin geworden. Zwei Bücher für Kinder sind bisher erschienen, sie haben keinen umgeworfen, aber ich werde weiterschreiben, denn ich bin voll von Geschichten, die ich für wert halte, dass sie aufgeschrieben und von Menschen gelesen werden.
Ich weiß jetzt, was die Hühner wissen,
wenn sie picken.
Ich weiß, wen die Raben grüßen,
wenn sie mit dem Kopf nicken.
Und nun läuft mir doch Ludwig Zeller über den Weg und fragt mich, ob ich mit ihm nach Brasilien gehe. Nicht nur für vierzehn Tage Ferien unterm Zuckerhut an der Copacabana. Nein, du und ich für ein Jahr zusammen auf einem anderen Stern. Und was dann? Und wie überhaupt?
Es gibt keine Zweierkiste mit Garantieschein. Du hast ja Angst, Conny. Ja, die hab ich. Wenn ich es nicht schon erlebt hätte: nach dem kurzen Höhenflug der langsame Absturz und der harte Aufprall. Gegenseitige Vorwürfe. Wut. Vielleicht Hass. O nein. Nein, nein. Nicht mit mir!
Aber. Ja, aber. So schön war es nie wieder wie damals mit Ludwig Zeller. Auf seinem Rennrad die Abfahrten vom Kilimandscharo. Der streichelnde Wind. Die Helligkeit des Blaus. Die Wärme unter der Haut. Das Aufeinander Zugehen. Die Lust zu leben. Das alles gibt es noch zwischen uns. Und mehr noch. Diese Woche des Zusammenseins hat es bewiesen. Beweise. Die taugen doch nur für die Vergangenheit. Schon in der Gegenwart sind sie anzuzweifeln. Und für die Zukunft sind sie ausgeschlossen.
Was nun? Was werde ich Ludwig sagen, wenn er zurückkommt und mich in die Arme nimmt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Ich ziehe die Gardine wieder zurück und sehe über die Straße auf den Hauseingang. Noch immer stehen die beiden eng zusammen, als könnte sie nichts auseinander bringen. Doch ein Denkmal, das wegen seiner Schwere abgestellt und vergessen wurde? Morgen wird ein Auto vorfahren, Männer werden es aufladen und in einem Park aufstellen. Ein Spielplatz für Stadtsperlinge.
Aber da zeigt sich Leben, es sind doch zwei, du und ich, sie schwanken, die beiden, leicht rhythmisch, ein Pendeln, wie gesagt, der Schlag ihrer Herzen, wer weiß, die Unruhe in zwei Menschen.
Wie ein Vogel aus dem Ei. Ich schlage die erste Seite auf und lasse mich in eine Welt ein, die man Vergangenheit nennt. Für viele Menschen ein abgesperrter Müllplatz, auf dem unliebsames Leben entsorgt wird. Für andere das gelobte Land, in dem sie sich in ihren Tagträumen aufhalten, weil sie in der Gegenwart nicht bestehen können.
Ich weiß nicht, ob mein Rückblick gut und richtig ist, ob ich mich in der Vergangenheit verlaufen und vielleicht mutlos in der Gegenwart ankommen werde; ich weiß nur, dass ich es wagen muss, dass Ludwig und auch ich eine Antwort brauchen.
Denn noch einmal werden wir uns so nicht begegnen.
1.
Änni hat mir geschrieben. Änni, die Jolly Eisenarm genannt wird, in Künstlerkreisen. Sie braucht ein Stück für ihr Theater. Sie ist gerade bei der Gründung. Jolly Eisenarms tragische Bühne (worauf mit Kunst gezeigt wird, wie das Leben so spielt). Sie schreibt, sie brauche ein Stück Leben. Eine richtige Geschichte. Eine, in der die Liebe die große Rolle spielt. Wie's nun mal im Leben so sei. Ich solle mich auf den Allerwertesten setzen und aufschreiben, was mir aus dem Herzen fließe. Ich, Conny Warmbrunn, im blühenden Alter von achtzehn Jahren, sei auf jeden Fall eins der vielen unentdeckten Talente, die das Leben bietet. Gezeichnet Jolly Eisenarm. Künstlerische Leiterin der tragischen Bühne.
Änni, das gute Herz. Ihr Theater wird wohl immer ein Traum bleiben. Aber's ist ein guter Traum. Und der gehört zu ihr wie ihr Nettogewicht von drei Zentnern und zwei Pfund. Das lässt sie sich nicht nehmen. Kein Gramm. Und so wird sie auch ihren Traum festhalten. Mit Augenzwinkern.
Änni hat mich aufgefordert, meine Geschichte aufzuschreiben. Aber was ganz anderes zwingt mich dazu. Ich könnte's auch in Musik fassen. Nur fehlen mir die Töne und was man so braucht. Und's würde auch zu ungenau. Malen könnte ich's auch. Wie damals mit Ludwig Zeller. Aber im Augenblick kann ich die richtigen Farben dazu nicht finden. Nun versuche ich's mit Schreiben. Da habe ich's dann schwarz auf weiß. Und's gibt kein Entschuldigen und Verstecken mehr. Ich habe die Verantwortung für mich und meine Geschichte. Bin endgültig raus aus dem Behütetsein. Ich fürchte mich ein bisschen davor. Aber so muss es sein.
Was ich schreibe, wird für Ännis Theater auf keinen Fall geeignet sein. Stattdessen werde ich es Ludwig Zeller schicken. Es wird nichts mehr ändern. Ich hätte's früher tun müssen. Ich hatte nicht den Mut. Und nicht die Kraft. Und die gehören nun mal zur Wahrheit wie das Leben zur Kunst. Das ist aus Jolly Eisenarms von mir gesammelten Worten. Jetzt, wo's mir ziemlich dreckig geht, wo ich weiß, dass es für immer aus ist mit Ludwig Zeller, habe ich beides. Ich habe das alles wohl erst durchmachen müssen, um zu begreifen. Nun werde ich alles aufs Papier bringen. Wie ich's gesehen habe und jetzt erkenne. Kunst bringt Klarheit, hat Änni mir immer wieder gesagt. Und Klarheit brauche ich jetzt. Fürs Weitergehen. Und weitergehen muss es. Das ist klar.
Bin vor ein paar Tagen in der Kleinstadt C. angekommen. Fühle mich wie ein Boot, das nicht vom Ufer loskommt. Das große Wasser lockt mich manchmal. Der Wind hat aufgefrischt. Mir fehlen nur noch die Segel. Bildlich gesehen das Ganze. Erst mal raus aus dem Hafen. Irgendwie werde ich den Kahn schon steuern. Ich brauche Segel. Unbedingt.
Wieder ist dieses Gefühl in mir. Es macht mich ganz krank. Und zugleich erfüllt's mich mit Hoffnung auf etwas ganz Großartiges, Einmaliges. Ich könnte schreien. Vor Schmerzen und Freude. Da ist eine Musik in mir, nie gehört. Töne, die Farben malen, nie gesehen. Farben, aus denen Gestalten wachsen, die wie ein Vogelschwarm dahinziehen und mich rufen und locken.
Und irgendwann werde ich wieder fliegen können, mitten in diesem Vogelschwarm, der mich jetzt ruft und lockt. Daran will ich glauben. Ganz fest.
2.
Am besten, ich fange mit dem Tag an, als Werner Branstner mit seinen Eltern nach R. zog. Ich war damals in der achten Klasse. Hatte soeben begonnen mir Gedanken zu machen über die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Ich meine nicht nur die der Anatomie. Darüber wusste ich längst Bescheid. Aus Büchern und was man so hört. Meine Eltern hätten sich lieber die Zunge rausgerissen, als dass sie mit mir über so was geredet hätten.
Ich kriegte mit, warum unsere Jungen immer stärkeren Zirkus veranstalteten. Sie lernten auf Händen laufen, rauchten während des Unterrichts, spuckten in alle Ecken und fanden alles, was ihnen gerade noch Spaß gemacht hatte, blöd und kindisch. Wenn Hanni Wenzlau nicht in der Nähe war, wurden sie wieder relativ normal. Bei Hanni Wenzlau war schon alles dran. Sie ging in unsere Klasse, war aber ein reichliches Jahr älter als wir, da sie mal hängen geblieben war. Sie trug als Erste Strumpfhosen und hochhackige Schuhe. Eines Tages, aus lauter Blödsinn, wie sie sagte, hatte Hanni einen Fingernagel lackiert. Eine Woche später glänzten alle ihre Fingernägel karminrot. Ein paar Tage danach lag auf ihren Lippen eine Schicht Metallicrosa, die Augenlider hatten dunkelblaue Schatten, die Brauen waren schwarz nachgezogen.
Wir anderen Mädchen waren restlos erledigt. Wir versuchten sie einzuholen. Ich war ein Spätstarter. Bevor ich aus den Blöcken kam, waren die andern schon im Ziel. Ich gewöhnte mir das Fußballspielen ab, begann mir Hals und Füße gründlicher zu waschen, auch abends die Zähne zu putzen, achtete auf saubere Fingernägel, ließ mir die Haare lang wachsen und hatte immer öfter ein Taschentuch und einen Kamm bei mir.
Ich will von dem Tag erzählen, als Branstners nach R. zogen und Werner am Morgen noch einmal in unsere Klasse kam, um sich zu verabschieden. Er hatte das schon einen Tag vorher getan. Wir hatten ihm ein Lied gesungen. Er hatte uns alles Gute gewünscht. Und wir ihm. Nun stand er noch mal vor uns. Sagte kein Wort. Stand nur da, als warte er auf etwas. Frau Paulsen, unsere Klassenlehrerin, der jede Minute, in der sich die Menschheit nicht mit Mathematik abgibt, sinnlos vertan erschien, wurde ungeduldig. Die Paulsen war Mitte dreißig. Sah wirklich noch einwandfrei aus. Mich erinnerte sie immer an ein herausgeputztes Pferd, das ich in meiner Zirkuszeit kennengelernt hatte. Ich war damals sechs Jahre alt. Wollte unbedingt Clown werden, über Eimer stolpern, im verschütteten Wasser herumplantschen und darüber lachen und weinen dürfen. Das war mein größter Wunsch. Der Zirkus stand bei uns in der Nähe. Bin jeden Tag hin. Mit und ohne Erlaubnis. War in den Tierställen und zu den Nachmittagsvorstellungen. Dort habe ich auch ein Pferd kennengelernt, an das mich die Paulsen erinnerte. Es war ein schönes Pferd, schlank und schwarz, und verstand sich zu bewegen. Es hieß Marquise de Pompadour. Hatte alle Tricks gut drauf und war verflucht eitel. Der Mann, der mit der Pompadour auftrat, hieß Paul. Er war ein unscheinbarer stiller Mensch, den man erst wahrnahm, wenn er sein Kostüm anhatte. Pferde gingen ihm über alles. Wenn er die Pompadour tätschelte und lobte, dass sie wieder alles gut gemacht hatte, und sich dankbar zeigte, war's in Ordnung, und sie war zu ertragen. Aber wehe, er hatte mal etwas anderes im Sinn, als ihr Zucker zu geben; dann fing das Biest an herumzuspringen, zu beißen und zu treten.
Nun, der Werner Branstner stand im Klassenzimmer und rührte sich nicht.
"Was gibt es denn noch?", fragte ihn Frau Paulsen. "Nichts", sagte Werner Branstner und sah uns alle böse an.
Ich kannte ihn seit dem zweiten Schuljahr. Er war mit seinen Eltern vom Dorf in die Stadt gezogen. So richtig zu Hause gefühlt in der Stadt hatte er sich wohl nie. In der Schule war er mittelmäßig, er war oft krank. Wenn er mal sprach, erzählte er von seinem Dorf Das waren Geschichten, mit denen wir Großstadtkinder nichts anzufangen wussten. Er war uns immer etwas fremd geblieben. Wie einer, der von so weit her kommt, dass man's sich gar nicht richtig vorstellen kann.
Wir haben nur einmal miteinander gesprochen. Während eines Schulsportfestes. Ich war am schlechtesten gesprungen, obwohl ich favorisiert war. Hatte zu Hause Ärger gehabt, und mir war nicht nach weiten Sprüngen zumute gewesen. Saß im Gras, hörte die Jubelschreie der anderen, fand das Leben ungeheuer schwer und anstrengend. Da stand der Werner Branstner vor mir und sagte "Du warst nicht schlecht. Wirklich nicht"
"Na danke", sagte ich ziemlich überrascht. "Die anderen waren nur besser, was."
Ich saß und rupfte Unmengen Gras. Er strich sich übers Kinn wie ein Alter über seinen Bart. Dann erzählte er mir eine Geschichte, die ich bis heute nicht vergessen habe. Sie spielte in seinem Dorf. Er erzählte sie wie über einen anderen Jungen. Aber er hat sich selbst gemeint. Das begriff ich an dem Tag, als er so allein im Klassenzimmer stand und uns böse ansah. Der Junge in seiner Geschichte hielt sich Tauben. Brieftauben. Wenn irgendjemand aus dem Dorf verreiste, gab er ihm eine Taube im Käfig mit. Am Reiseziel sollten die Leute der Taube eine Nachricht übergeben und sie freilassen. Sieben seiner besten Tauben gab der Junge den Leuten mit. Keine kehrte in den Schlag zurück. Keine Nachricht von "draußen" erreichte ihn. Da hat der Junge den Schlag über Nacht offen gelassen, obwohl er wusste, dass der Marder nur darauf wartete. Noch vorm nächsten Morgen ist er zum Schlag raufgestiegen und hat die zerrissenen Tiere gesehen.
Werner Branstner rührte sich nicht. Frau Paulsen fing an zu tänzeln, wie die Pompadour im Zirkus, bevor sie bissig wurde und auszuschlagen begann.
Irgendwie machte es mich fix und fertig, den Jungen so dastehen zu sehen. Dachte, ich muss verbrennen oder zerspringen. Seine Geschichte fiel mir ein. Mir wurde noch heißer.
Werner Branstner rannte aus dem Klassenzimmer. Die Tür stand offen. Die Schritte verhallten auf dem Gang. In die Stille hinein sagte die Paulsen, ich solle die Tür schließen, damit wir endlich ungestört weiterarbeiten könnten. In mir war eine furchtbare Angst, etwas zu verlieren. Etwas, für das man keinen Namen findet, das man vergessen hat, aber das noch immer da ist. Etwas, das man auf gar keinen Fall verlieren darf. Und zugleich spürte ich große Freude. Hoffnung auf Unbekanntes. Ich hatte Sehnsucht nach einem Etwas, was ich unbedingt gewinnen musste. Ich sagte ja schon, es war nur ein Gefühl. Aber damals wie heute verwirrt's mich total. Ich bin hoch und aus der Schule raus, so schnell ich konnte. Auf der Hauptstraße, mitten im Menschentrubel, habe ich Werner Branstner eingeholt. Er stand vorm Schaufenster einer Drogerie, die Stirn an die Scheibe gedrückt. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen.
Ich wollte ihm etwas sagen, zu seiner Geschichte, über sein Dorf, von mir, von unserer Stadt.
"Heulst du?", fragte ich. Das war nun wirklich das Dümmste, was ich sagen konnte.
Und weil's so dumm war, was ich gesagt hatte, fragte ich gleich noch mal: "Heulst du?"
"Das geht dich einen Dreck an."
Werner Branstner nahm nicht die Stirn vom Schaufenster. Ich fragte mich, ob er all das Zeug dahinter sah. War voller Angst, dass er mir davonrannte, ohne dass ich ihm sagen konnte, was ich ihm sagen wollte. Aber er rannte nicht davon. Wir standen vor diesem mit Vitaminpräparaten, Kräutersäften. Gesichtswassern und Watte voll gestopften Schaufenster. Hinter unsern Rücken hechelte die Stadt wie ein jagender großer Hund. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir dort standen.
Schließlich sagte Werner Branstner, immer noch mit der Stirn an der Schaufensterscheibe: "Dann mach's gut."
"Mach's gut", sagte ich. Sah ihm nicht hinterher, als er ging. Bin dann durch die Stadt gelaufen, bis der Unterricht vorüber war.
3.
Heute weiß ich nicht mehr, wie Werner Branstner aussah. Aber seine Geschichte vom Jungen und von den Tauben habe ich nicht vergessen. Und dieses Gefühl, das ich an diesem Tag zum ersten Mal erlebt hatte, ist in mir geblieben. Ich glaube, damals habe ich begonnen erwachsen zu werden. Es ist mir verteufelt schwer gefallen. Und ich weiß bis heute nicht, ob ich übern Beginn hinaus bin, obwohl mir so einiges passiert ist. Weiß nur, man kann nie erwachsen sein. Man kann's immer nur werden.
Mit diesem Gefühl hatte mein Leben einen Sinn, ein Ziel bekommen. Das weiß ich heute. Damals war's nicht viel anders, als wenn mich ein Verrückter von hinten ins tiefe Wasser stoßen und rufen würde:
"Schwimm!"
Nachdem Werner Branstner weg war, habe ich ihm noch ein paar Mal geschrieben. Habe ihn gefragt, ob er mir ein Foto von sich schicken könnte. Er hat nie geantwortet. Heute weiß ich nicht einmal mehr, ob ich die Briefe abgeschickt habe. Damals habe ich fest daran geglaubt, dass ich's getan hätte. Jeden Tag bin ich von der Schule nach Hause gerannt. Jeden Tag war der Briefkasten leer. Ich befand mich wie auf einer Waage. Pendelte zwischen Angst und Erwartung. Geriet in Panik. Wollte dieses Etwas finden und festhalten.
Zu Hause probte ich ständig den Aufstand. Mal laut, mal leise. Der reinste Nervenkrieg. Ich wäre damals am liebsten weggerannt. Irgendwohin. Alles, was mich bisher umgeben hatte, war mir zu eng, zu dumm und zu langweilig geworden. Wir wohnten in einem der viergeschossigen alten Häuser an der Hauptstraße, fünf Minuten Straßenbahnfahrt entfernt vom Stadtzentrum. In den Erdgeschossen der Häuser reihte sich Laden an Laden. In unserm Haus war die Gaststube "Zum Roten Hirsch" untergebracht. Das war so eine richtige Eckkneipe mit blank gewetzten schweren Tischen und Stühlen, mit Bedienung an der Theke, Fassbier, roter Limonade, Bockwurst mit Brot. Hier wurde noch angeschrieben. Die Wirtin hieß Änni, wog gut und gern ihre drei Zentner und war früher im Zirkus als Kraftakrobatin aufgetreten. An den verräucherten Kneipenwänden hingen Bilder von ihr, wie sie im schillernden Kostüm, den Kopf voller Locken und Flittersterne, ihren Mann Fritz und jede Menge Eisenkugeln auf den Arm nimmt. Ihr Künstlername war Jolly Eisenarm. Fritz, ihr Mann, hatte sich scheiden lassen. Als Grund gab er "wachsendes Übergewicht" Ännis an. Auf Fotografien sieht er aus wie ein Gartenzwerg. Aber für Änni muss er wohl die große Liebe gewesen sein. Nach der Scheidung ist sie weg vom Zirkus, hat den "Roten Hirsch" übernommen und zu trinken angefangen. Mit jedem, der in ihren "Bierladen" kam, war sie sofort per du. Die Männer nannte sie alle Fritz, die Frauen Erna. Für mich war Änni wie eine Großmutter. So ein Ankerplatz, wenn das Schiff ein Leck hat und nicht mehr weiß, wohin. Ich habe zwei richtige Großmütter; aber ich kann mit beiden nichts anfangen. Die eine lebt "drüben", in Köln. In der Familie wird erzählt, sie wäre ein lustiges Kind vom Rhein. So eine, die zum Karneval die Betten verkauft, wenn's sein muss. Ich kenne nur ihre Pakete, die regelmäßig kommen. Die andere wohnt keine Viertelstunde Fußweg von uns entfernt. Sie lebt mit Großvater bis in den Winter hinein in ihrem Schrebergarten, der im Rosenthal am schlammigen Ufer der Pleiße liegt. Sie halten dort Kaninchen, ziehen Rosen und ernten die größten Tomaten. Den beiden kann man nichts erzählen. Sie fragen immer gleich: "Brauchst du Geld?" Dann drücken sie einem eine Mark in die Hand und meinen, nun hätten sie jedes Problem gelöst. Dafür muss man furchtbar dankbar sein und mindestens sieben Stunden lang in die Knie gehen und Unkraut stechen.
Änni war damals der einzige Mensch, der mich verstand. Wenn ich den Briefkasten leer fand, ging ich in den "Roten Hirsch". Änni sah, was mit mir los war. Sagte zu dem Mann, der an der Theke sein Bier trank: "Schluck mit Bedacht, Fritz. Ich muss nur mal." Sie ging mit mir in ihren "Geschäftsraum"; das war ein großes Zimmer, in dem ein riesiger Schreibtisch und alte Möbel herumstanden und eine bewundernswerte Unordnung herrschte, dass man allen Respekt verlor und sich sogar auf dem Teppich wohl fühlte. Änni wohnte in diesem Zimmer. Manchmal legte sie hier den Leuten die Karten. Mir hat sie auch das große Glück und ein langes Leben vorausgesagt.
Änni nahm mich in ihre Arme. Und obwohl sie doch so ein Riesenweib und so ein Kraftmensch ist, kann niemand sanfter und zärtlicher sein als sie. Sie sang mit rauer Männerstimme, die aber auch etwas Kindhaftes hatte: "Beim ersten Mal, da tut's noch weh ... " Ich heulte zwischen ihren großen weichen Brüsten. Sie weinte zur Gesellschaft mit. Schließlich zog sie ein Taschentuch aus dem Ausschnitt, putzte uns die Nasen, dass sie rot wurden und wir lachen mussten. "Geht's besser, Klein Erna?", fragte Änni. "Ich muss wieder hintern Tresen und die Welt bei Laune halten."
Änni stopfte mir Eukalyptusdrops, die eine ihrer süßen Leidenschaften waren, in die Jackentasche. Ich ging und hatte wieder etwas Mut.
Aber's wurde immer schlimmer mit mir. In der Schule hatte mich die Paulsen andauernd beim Kragen. Sie hatte nie Sie zu mir gesagt, jetzt sagte sie's meistens. "Warmbrunn", sagte die Paulsen, "Sie sollten mehr Selbstbeherrschung an den Tag legen. Letzten Endes entscheidet meine Beurteilung, wer auf die erweiterte Oberschule geht und wer nicht. Aus den Kinderschuhen sollten Sie ja nun wahrhaftig raus sein. Sie schweigen jetzt. Ich verbitte mir diesen Ton!" Ich muss in diesen Tagen allerhand Blödsinn angestellt haben. Und wenn man bedenkt, dass ich vorher ein "disziplinierter Charakter" war, verwundert's nicht, dass ich Miss Pompadour nervös und bissig und trittig machte. Ich kann nicht mehr wiedergeben, was ich alles an Unsinn aufgeboten habe, um mich abzulenken und aus dieser Stimmung rauszukommen.
Was die Paulsen fuchsig machte, war meine Neigung zu Fremdwörtern.
Das Gefecht mit Frau Paulsen spielte sich ungefähr so ab:
Paulsen: "Warmbrunn. Was soll das Gekicher? Stehen Sie bitte auf, wenn ich mit Ihnen rede."
Warmbrunn: "Frau Paulsen, ich ... "
Paulsen: "Schweig! Nehmen Sie den Rechenstab zur Hand. Den Rechenstab, habe ich gesagt! Nicht das Lineal."
Warmbrunn: "Frau Paulsen, ich ... "
Paulsen: "Halt! Erklären Sie erst einmal, was man unter der Hypotenuse und den Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks versteht. Sag mal, was ziehst du denn für ein Gesicht?"
Warmbrunn: "Weiß nicht. Glaube, ich habe eine Blow-out- Fraktur."
Frau Paulsen: "Was hast du?"
Warmbrunn: "Fraktur des Orbitabodens mit hernienartigem Übertritt von Orbitainhalt in den Sinus maxillaris."
Frau Paulsen: "Nehmen Sie den Rechenstab zur Hand, Warmbrunn."
Warmbrunn: "Ich glaube, ich kann's nicht."
Frau Paulsen: "Was soll denn das heißen?"
Warmbrunn: "Wenn ich's auch wollte, ich könnt's nicht."
Frau Paulsen: "Warmbrunn! Ich gehöre auch zur Spezies Mensch! Treiben Sie es nicht auf die Spitze! Den Rechenstab, sagte ich. Und stellen Sie sich gerade hin! Ziehen Sie ein anderes Gesicht!"
Warmbrunn: "Ich tät's ja gern, wenn ich's könnte. Ihnen zuliebe. Das Orbitale Syndrom, Frau Paulsen. Das macht mir zu schaffen."
Frau Paulsen: "Das was ... ?"
Warmbrunn: "Enthemmung der Antriebs- und Willenssphäre, Euphorie, Moria, Minderung der Kritikfähigkeit, fehlende Krankheitseinsicht ... "
Die Paulsen gehörte zu den Leuten, die zusammenbrechen, wenn sie andere nicht mit ihrem Wissen belehren können. Die Frau wusste wirklich eine ganze Menge; aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie sich selbst und andere damit quälte. Sie benutzte selber oft und gern Fremdwörter. Es tat ihr gut, wenn man ständig nachfragen musste, was dies und das heißt. Für unsere Auseinandersetzungen suchte ich mir immer schwierige, selten gebrauchte Wörter heraus. Ich lieh mir aus Bibliotheken Fachwörterbücher und ein Bibellexikon aus. Frau Paulsen konnt's einfach nicht verkraften, dass ich immer wieder Wörter fand, von denen sie in ihrem Leben noch nichts gehört hatte. Man konnte die Blässe unter ihrem Make-up erkennen.
Einmal begegnete ich ihr in einer Bibliothek. Sie hatte gerade das Wörterbuch der Antike in den Händen. Sie tat so, als hätte sie mich nicht gesehen, obwohl sie fast über mich gestolpert wäre. Damals tat sie mir kein bisschen Leid. Ohne mit der Wimper zu zucken, hätte ich zugesehen, wie sie kaputtgeht. War selber überrascht von meiner Grausamkeit.
Dabei hatte ich die Paulsen nie so übel gefunden. Sie drangsalierte uns zwar mit ihrer Bildung und ihrem Wissen, aber sie setzte sich auch für uns ein, ohne sich zu schonen.
Eines Abends tauchte Frau Paulsen ohne Voranmeldung in unserer Wohnung auf. Wir wohnten im vierten Stock unterm Dach. Es hatte anhaltend geklingelt. Ich war öffnen gegangen und sagte: "Sie?" "Guten Abend, Warmbrunn", sagte die Paulsen. Sie atmete ziemlich schnell. "Ich will Ihre Eltern sprechen."
Ich schloss die Tür auf Spaltbreite und sagte: "Die sind nicht da. Leider. Sind im Kino. Leider."
Die Paulsen sah mich prüfend an, wollte schon kehrtmachen, als Mutter, von Neugier geplagt, rief: "Na, wer ist's denn? Lass die Leute nicht an der Tür stehen!"
"Bitte", sagte ich kalt. "Treten Sie ein. Muss mich getäuscht haben."
Wir waren gerade beim Abendbrot. Vater studierte die Rennzeitung. Mutter sah die Annoncen in der Volkszeitung durch. Der Fernseher lief sich schon warm. Aus Mutters Augen sah der blanke Schreck, als sie meine Lehrerin erkannte. Sie sah erst mich an, dann Frau Paulsen, so als könnte sie mit ihren Blicken erraten, was passiert war. Mutter hat immer Angst, dass was passiert. Wenn im Fernsehen die Nachrichten kommen, geht sie raus. "Die Leute sollten in Frieden leben", sagt sie. Aber die "Leute" hören wohl nicht, was sie sagt, oder sie richten sich nicht danach. Meine Mutter arbeitet als "Chefsekretärin" in einer Metallbude. Wenn sie abends nach Hause kommt, weint sie manchmal und sagt, die Welt sei ungerecht, weil's immer die Kleinen erwische. Aber sie fängt sich bald wieder, indem sie wie wild die Fenster putzt, den Teppich saugt und mit dem Staubtuch hantiert. Ich kenne sie nur in mausgrauen Kostümen, schwarzen Rollkragenpullis und mit frisch gelocktem Haar.
Mutter schwirrte aufgeregt um die Paulsen herum. Bot ihr Platz an. Erkundigte sich nach dem Befinden. Schimpfte aufs Wetter. Stellte trotz Widerspruchs noch ein Gedeck auf den Tisch. Schenkte Vater und der Paulsen einen Klaren ein. Dabei fragten ihre Augen, was passiert sei. Und zugleich war sie nahe dran, aufzuspringen und in ihrer Küche zu verschwinden. Vater blieb ruhig. Nur die unzähligen Furchen in seinem Gesicht gerieten in Bewegung, von den Stirnmuskeln gezogen. Er legte die Rennzeitung in Reichweite, stand auf, und für Sekunden hielt er die Hand der Paulsen in seiner rauen warmen Hand. Gleich setzte er sich wieder. Trank auf einen Zug die zweite Flasche Bier leer. Vater arbeitet in der Gießerei. In einer mörderischen Hitze. Er ist klein und zäh. Seine Haut ist wie trockene Rinde. Er hat immer Durst. Meistens schläft er nach dem Abendbrot im Sessel vor dem Fernseher ein. Wenn das Programm zu Ende ist, weckt Mutter ihn, und sie gehen ins Bett. Vater ist sparsam mit Worten und mit Bewegungen. Was er tut, hat Hand und Fuß. An dem, was er sagt, ist was dran.
"Langen Sie nur zu, Frau Paulsen", sagte Mutter eifrig. "Die Leberwurst ist vom Pöltitz um die Ecke, dem Fleischer. Hier ist Schweizer Käse. Ich darf Ihnen doch nachschenken."
Ich saß auf meinem Stuhl, aß die vierte Schnitte, sah aufs Fernsehbild und tat so, als ginge mich das alles nichts an. Irgendwas musste ja passieren. Ich fühlte es schon lange. War zwar aufgeregt; aber alles in mir verlangte nach einem großen Krach.
Frau Paulsen musste trinken und essen. Es war ihr gar nicht recht, dass die Sache so anlief. Sie musste die Zügel in der Hand haben.
Meine Mutter: "Möchten Sie einen Kaffee? Ich koche Ihnen eine Tasse. Das macht mir gar keine Mühe. Wenn Sie wüssten, wie viele Tassen Kaffee ich jeden Tag kochen muss."
Frau Paulsen: "Frau Warmbrunn, ich ... "
Mutter: "Sie haben auch einen schweren Tag hinter sich. Lehrerin. Ich kann mir das vorstellen. Trinken Sie schwarz oder weiß?"
Frau Paulsen: "Ich bin gekommen ...“
Mutter: "Zucker! Natürlich Zucker! Conny, Mädchen, hast du eingekauft, was ich dir aufgeschrieben habe?" Sie wollte in die Küche entschlüpfen.
Frau Paulsen setzte das Schnapsglas hart ab und sagte wie zu einem ungehorsamen Schüler: "Bleiben Sie! Ich bin gekommen, um mit Ihnen zu reden. Es geht um Ihre Tochter."
Mutter seufzte und setzte sich. Vater sah mich fragend an. Ich sah in den Fernseher und lachte, obwohl gerade gezeigt wurde, wie ein auf einem Dachgarten aufgestelltes Maschinengewehr eine Menge Menschen niedermähte.
"Dass ich hier bin, scheint Cornelia überhaupt nicht zu beeindrucken", sagte Frau Paulsen.
Ich sagte zum Fernseher: "Sancta simplicitas", was so viel wie "heilige Einfalt" bedeutet. Hatte nicht übel Lust, in ein neues Fremdwortgefecht einzusteigen. Sah aber das abgespannte Gesicht meines Vaters und schwieg.
Die Paulsen brachte sich in Lehrerpositur. Stand auf, trat hintern Stuhl, dass sie alle im Blick hatte. "Nun", sagte sie. "Ich sah mich gezwungen, Sie aufzusuchen. Ich mache mir Sorgen um die Entwicklung Ihrer Tochter. Ich habe Cornelia mit einer sechsten Klasse übernommen ... " Nun hielt sie einen zehnminütigen geschliffenen Vortrag über meine Entwicklungsgeschichte. Erzählte, was ich doch für ein lernbegieriges, diszipliniertes, hilfsbereites, gesellschaftlich aktives Kind gewesen und was ich nun für ein "Widerspruchsgeist" geworden wäre. Die schulischen Leistungen wären zwar noch immer ausgezeichnet, aber das Verhalten gäbe zu immer größeren Klagen Anlass. Wenn es mit mir so weiterginge, würde es nichts mit meiner Delegierung zur erweiterten 0berschule. Sie schloss mit einem strengen Blick auf mich und dem Satz, den sie mir schnell übersetzte: "Quasi vero mensuram ullius rei possit agere, qui sui nescit. Als ob der andere Dinge messen könnte, der selbst für sich kein Maß hat."
Die Paulsen blieb hinterm Stuhl stehen. Mein Vater hatte den Kopf gesenkt, als hätte das alles ihm gegolten. Meine Mutter trank eine Tasse Kaffee nach der anderen und schwitzte furchtbar. "Also das ist doch", begann sie immer wieder. "Ich weiß gar nicht Conny ..."
Und dann erzählte Mutter von "unserer Großen", die meine Schwester und das große Vorbild für mich ist. Helga ist acht Jahre älter als ich. Ich bin ein Nachzügler und sollte ein Junge werden. Unsere Große hat ihr Leben fest in der Hand. So sagen's alle Leute, die unsere Große kennen. In der Schule gab's nie Schwierigkeiten mit ihr. Spartakiadesiegerin im Sprint. Abitur mit Auszeichnung. Europameisterin auf der Hundertmeterstrecke. Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Heirat mit dem Zahnarzt Doktor Eisner. Sportlehrerdiplom. Neubauwohnung. Wartburg. Garage. Trainerin beim Sportklub. Meister des Sports. Vaterländischer Verdienstorden in Silber.
"Unsere Große", sagte Mutter, "die hat uns nur Freude gemacht. Aber glauben Sie mir, Frau Paulsen, unsere Conny ist nicht schlecht. In ihr steckt vielleicht nicht das Zeug wie in unserer Großen. Aber wir werden alles tun, damit sie ihre Sache macht. Verlassen Sie sich drauf. Sie sollen keinen Grund zur Klage mehr haben."
"Schön", sagte die Paulsen und sah meinen Vater an, der nicht den Kopf hob. Ich saß und konnte sehen, wie's in seinem guten Gesicht arbeitete. Ich hätte die Paulsen vergiften können.
Frau Paulsen sagte zu mir: "Ich hoffe, Cornelia, wir verstehen uns." Sie verabschiedete sich und ging wie Miss Pompadour aus der Manege.
Als die Paulsen weg war, ging Mutter in die Küche. Sie ließ die Türen etwas offen, um zu hören, ob und was Vater sagen würde. Aber Vater sagte nichts. Er blätterte in der Rennzeitung, sah aufs Fernsehbild. Immer wenn mit Mutter oder uns Kindern etwas nicht ganz in Ordnung ist, eine Krankheit, oder Mutter hat Ärger im Büro, macht es ihn stumm. Dann wirkt er wie ein alter Mann, völlig verbraucht, hilflos wie ein Kind. Nun wartete er, dass Mutter aus der Küche zurückkam. Und Mutter kam. Man konnte sehen, dass sie geweint hatte. Sie wusste genau, ich konnte sie nicht weinen sehen. Wenn ich mich gegen etwas sträubte und sie's schwer mit mir hatte, weinte sie. Dann tat ich, was sie von mir verlangte. Manchmal hasste ich sie dafür.
Sie räumte das Geschirr vom Tisch, und ich musste mir den Lebenslauf unserer Großen anhören. Bei so einem Lebenslauf verschlägt's jedem Normalbürger die Sprache. Die Wörter "Entbehrung, Entsagung, Ziel, Wille, Disziplin" kamen in Mutters Rede sehr oft vor. Solche Wörter wie "Freude, Spaß, Vergnügen, Lust, Spiel" benutzte sie dabei nie. Tatsächlich hat sie's immer geschafft, mit dem Lebenslauf unserer Großen meinen Ehrgeiz anzustacheln. Wie Helga wollte ich werden. Auf alles verzichten, um als Erste ins Ziel zu kommen. Mein Ziel kannte ich noch nicht. Aber meine Mutter und die Lehrer würden's schon rechtzeitig für mich ausmachen, wie sie's für unsere Große auch getan hatten.
An diesem Abend, nach dem Auftritt der Paulsen, regte mich der Lebenslauf der Großen zum ersten Mal zum Widerspruch an. Ich sagte irgendwas von einem fehlerlos programmierten Computer. Ich hätt's besser nicht gesagt. Meine Mutter weinte. Nannte mich undankbar und neidisch auf unsere Große, die doch so viel von ihrer kleinen Schwester halten würde. Mein Vater sagte zu mir: "Mach mal 'nen Punkt." Auf unsere Große lässt er nichts kommen. Es gab eine Zeit, da hatte er zu trinken begonnen, und es stand schlecht um ihn. Da hat Helga ihn aus den Kneipen geholt. Und sie hat's geschafft, ihn wieder zu Hause zu halten. Manchmal trifft Vater sich mit Helga in der Innenstadt. Ich habe sie mal beobachtet. Sie sind durch die Straßen gelaufen, und Helga hat die ganze Zeit auf Vater eingeredet. Vater hat nur genickt. Und manchmal hat er gelächelt, ist stehen geblieben, hat Helgas Hand gedrückt und hat zu ihr aufgesehen.
Mutter fing wieder an zu weinen. Und ich entschuldigte mich, versprach, dass ich mich zusammenreiße und alles wieder so sein würde, wie's gewesen war. Im Fernsehen lief das Schlagerstudio. Meine Mutter bekam einen Weinkrampf. Es ging ihr nicht gut in letzter Zeit. Zum Arzt wollte sie nicht. Sie fürchtete sich immer vor etwas ganz Schlimmem. "Mutter", sagte Vater, und sie wurde etwas ruhiger. Ich legte ein Versprechen nach dem anderen ab, wo und wie ich mich überall bessern wollte.
Vater schrieb sich das Gewicht und die Form der Pferde und Jockeis und was weiß ich noch alles aus der Rennzeitung. Er errechnet in einem komplizierten Verfahren den Sieger und die Einläufe. Er geht zu jedem Pferderennen. Wettet aber nie. Die Wetter holen sich Tipps von ihm. Er steht immer auf dem Sattelplatz, um die Pferde ganz nahe vor sich zu haben. Steigen die Jockeis in den Sattel, ist zugleich Glück und Traurigkeit in seinen Augen.
Meine Mutter beruhigte sich endlich und sagte: "Ach, Conny, Kind. Wir wollen doch nur dein Bestes. Dass du mal deinen Weg gehst. Wie unsere Große ihren Weg gegangen ist. Dass du es mal zu etwas bringst. Du sollst es gut haben. Du bist doch unser Kind."
In der Nacht konnte ich nicht schlafen. Es war Frühling. In den Hinterhöfen schrien die Katzen. Über mir, auf dem Dachboden, hockte die Wärme des Tages. Auf der Straße fuhren die Lastwagen und Straßenbahnen. Und doch erschien mir die Stadt bedrückend still.
Ich hörte, wie Änni die Tür vom "Roten Hirsch" abschloss. "Ab durch die Mitte", sagte Änni. "Jeder Fritz geht hübsch ruhig zu seiner Erna. Und jede Erna geht auf Zehenspitzen zu ihrem Fritz. Stört die Nacht nicht, Leute."
Weiß nicht, was mich nicht schlafen ließ. Dachte, es stieg aus dem Duft der alten Linde, die in unserm Hof blühte. Wusste nicht, wohin mit mir. Hätte laut schreien oder singen können.
Ich bin heimlich zu Änni runter. Sie saß in ihrem "Geschäftsraum" auf dem Bett und legte sich die Karten. Die Fenster waren geschlossen. Es war kühl im Zimmer. Es roch nach Bier, Tabak und Bockwurst. "Änni", sagte ich. "Schick mich bitte nicht weg. Bitte nicht."
"Zitterst ja, Klein Erna", sagte Änni. "Nun mach's mal halblang. Leg dich ins Bett. Na los schon."
Ich kuschelte mich in ihr riesiges Bett, das so sanft schaukelte, als befände man sich in einem Boot auf einem freundlichen Wasser. Änni setzte sich in einen Sessel und schaltete das Licht aus. Sie sagte: "Das musst du aushalten. Jede Frau muss das. Träum was Schönes."
4.
Obwohl ich schnelle Besserung versprochen hatte, legte ich mich doch immer wieder mit Frau Paulsen an. Werner Branstner schrieb nicht.
Die Mädchen meiner Klasse hatten alle einen Freund. Die Jungen aus unserer Klasse fand ich für die Liebe nicht brauchbar. Sie waren für mich wie Brüder, mit denen man oft im Streit liegt. Meine Freundin Susanne, mit der ich sonst jede freie Minute zusammen gewesen war, ging mit Albert Kreisler aus der zehnten Klasse. Susanne spielte vor mir die First Lady. Behandelte mich wie ein Küken. Erzählte mir alles, was sie mit Albert Kreisler erlebte, bis ins Kleinste. Es war andauernd von Disko, Spaziergängen im Mondschein und Küsserei im Hauseingang die Rede. Albert Kreisler war ein lang aufgeschossener, pubertierender Junge, der mit Schwefelpuder gegen seine Pickel kämpfte. Wenn er lachte, steckte er den kleinen Finger seiner rechten Hand ins linke Nasenloch. Er lachte ziemlich oft. Ich hätte den Jungen nicht geschenkt genommen. Trotzdem machte's mich fuchsteufelswild, wenn Susanne von ihrem Zusammensein mit ihm erzählte.
Eines Tages erzählte sie mir lang und breit, dass sie eben von Albert Kreisler komme und mit ihm geschlafen habe. Ich bat sie aufzuhören, doch sie ließ nichts aus. Da schlug ich sie ins Gesicht. Sie langte zurück. Wir prügelten uns mächtig. Eine ganze Woche sprachen wir keinen Ton miteinander. Später gestand sie mir, dass sie die Geschichte aus mehreren Büchern zusammengereimt hatte. Aber ich hatte es ihr geglaubt. Und ich glaubte auch den anderen Mädchen, was sie erzählten. Ich fühlte mich scheußlich einsam und zurückgelassen.
Da ich nach Meinung meiner Mutter auf dem besten Weg war, "aus der Art zu schlagen", wurde unsere Große informiert. Helga war sofort zur Stelle. Das heißt, sie schrieb mir eine Karte, mit der sie mich "zwecks Aussprache" aus "terminlichen Gründen" ins Sportforum an die Aschenbahn bestellte. Das war natürlich Taktik. Ich hab's damals nur nicht erkannt. Nach einer kurzen Umarmung ließ sie mich erst einmal an der Sprintstrecke stehen und zusehen, wie sie "ihre Mädchen" auf Trab brachte. Die Mädchen waren alle jünger als ich. Sie himmelten unsere Große an, dass es mir schon peinlich war. Aber unsere Große schien das überhaupt nicht wahrzunehmen. Sie war wie immer ganz bei der Sache. Und ihre Sache war, kleine Mädchen, die lieber mit ihren Puppen gespielt hätten, zu Spitzensprinterinnen zu trainieren. Ich muss zugeben, unsere Große machte ihre Sache geschickt. Sie hatte aus dem Training eine Art Spiel entwickelt, dessen Grenzen von ihr bestimmt wurden. Kam's vor, dass eins der Mädchen einen Ausbruchsversuch unternahm, erklärte unsere Große das als einen Regelverstoß. Die anderen Mädchen reagierten sofort und verlangten die Bestrafung des Mädchens. Die Bestrafung war, dass sie vom nächsten Spiel ausgeschlossen wurde. Unsere Große nannte jedes Training Spiel. Die Mädchen waren ganz versessen darauf, obwohl sie aus dem Schwitzen nicht rauskamen. Strengte eins der Mädchen sich besonders an, stellte unsere Große sie vor den anderen heraus.
"Seht euch mal Regina an", sagte sie. "Wie hoch sie das Bein bekommt. Und noch einmal. Spitze, Regina!" Nun versuchten alle, ihre Beine höher zu schwingen, als Regina das getan hatte. Ich sagte ja schon, unsere Große verstand ihre Sache. Dabei blieb sie immer freundlich, wurde aber nie kumpelhaft, war hart und gerecht. Sie hielt die Zügel fest in den Händen, und die Mädchen waren damit einverstanden. Zum Schluss des Trainings gab's einen Wettlauf über fünfzig Meter. Ans Ziel legte unsere Große immer eine Überraschung, ein Geschenk für die Siegerin. Das sind Kleinigkeiten, die kleinen Mädchen große Freude machen: ein paar Stammbuch- oder Abziehbilder; ein Emaillekäfer zum Anstecken; ein Faserstift; ein Stück Kreide; Puppensachen. Jedes Mädchen wollte als Erste den Karton, der das große Geheimnis barg, in den Händen halten. Eins der Mädchen wurde von einem anderen knapp geschlagen. Die Siegerin jubelte. Sie hatte im Karton ein Geschicklichkeitsspiel gefunden, bei dem man winzige Kugeln in ein Loch bringen muss.
Die Verliererin weinte. Konnte sich gar nicht beruhigen. Es war das Mädchen, das vorhin das Bein am höchsten bekommen hatte. Unsere Große sagte: "Na, na, Regina! Wer wird denn weinen. Aber doch nicht unsere Regina. Sieh nur, dort schaut uns jemand zu. Viele Menschen sehen dir später einmal zu. Sollen die denken, dass du schwach bist?"
Das Mädchen sah zu mir und versteckte ihr Gesicht hinter den Händen. Nach ein paar Sekunden nahm sie die Hände vom Gesicht. Sie weinte nicht mehr. Sie sah aus, als wäre ihr eine künstliche Haut übers Gesicht gezogen worden. Ich konnte einfach nicht mehr in dieses Gesicht sehen, das eben noch so traurig gewesen war und nun lachte.
Unsere Große übergab die Mädchen ihrer Assistenztrainerin, die die Laufzeiten notiert hatte und die Kleinen nun unter die Duschen führte.
Helga legte ihren Arm um meine Schulter und ging mit mir die Aschenbahn rauf und runter. Sie ist einen Kopf größer als ich. Hat eine gute Figur. Gerade, straffe Haltung. Beim Gehen spielten ihre Beinmuskeln. Ihre Hand drückte meinen Oberarm. Unsere Große hat Kraft wie ein Pferd. Ihre Haare trägt sie ziemlich kurz. Das Gesicht ist klein und herb. Mich erinnert's an eine Blume, wenn sie sich abends schließt. Ihre Augen halten einen immer auf Entfernung. In der Zeitung, nach ihren Siegen, habe ich sie richtig lachen sehen. Ich glaube, sie sieht gut aus, unsere Große. Wundere mich nur, dass die Jungen nie hinter ihr her waren.
"Schön, dich zu sehen", sagte sie. "Na, wie hat dir das Training gefallen?"
"Die Kleine", sagte ich, "die verloren hat. Hättest du ihr nicht auch so ein Spiel geben können?"