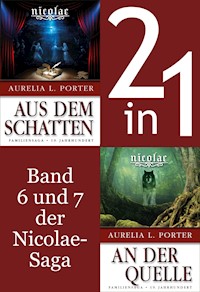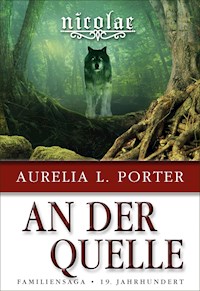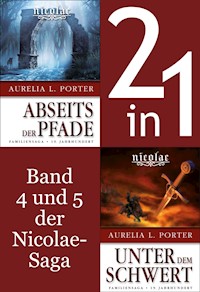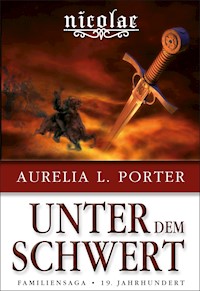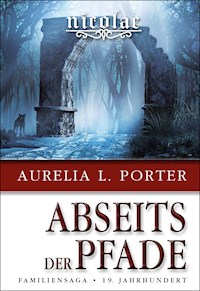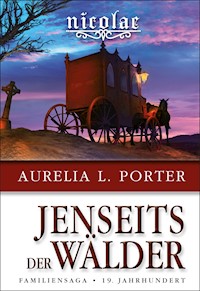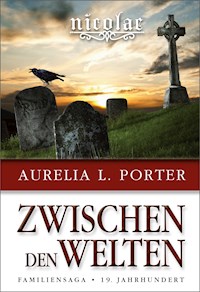7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fesselndes Familienepos – geheimnisvoll und mystisch
"Komm mein Sohn, lass uns in die Tiefen unserer Geschichte hinabsteigen ..."
Im zweiten Teil der Nicolae-Saga führt das Schicksal den jungen Titelhelden nach Rumänien. Dort lebt er am Hofe eines Adligen nahe einem in der Zeit stehen gebliebenen Karpatendorf. Der Unterschied zum fortschrittlichen England könnte nicht größer sein. Für Nicolae aber geht in der ursprünglichen Bergwelt der Südkarpaten ein lang gehegter Traum in Erfüllung.
Seine den Wissenschaften verschriebene Tante Judith hingegen stößt auf allerlei Befremdliches und Unerklärliches im Reiche ihres neuen Dienstherrn, bei dem sie sich als Gouvernante ihrer Nichte verpflichtet hat. Sie glaubt sich in einem Labyrinth gefangen.
Durch die Bekanntschaft mit ihrem Landsmann, einem Historiker und Volkskundler, kommt sie hinter ein schreckliches Familiengeheimnis. Verzweifelt sucht sie für sich und die Kinder nach einem Ausweg.
Lebendig und bildgewaltig beschreibt Aurelia L. Porter das von Mythen durchzogene Karpatenland, in welchem ihr Titelheld einer beängstigenden Wahrheit ins Auge blicken muss.
"Hinter den Pforten" führt den Leser in das sagenumwobene „Dracula-Reich" voller Märchen und Magie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Nicolae
Hinter den Pforten
Familiensaga 19. Jahrhundert
(1869 bis 1871)
Band 2 der Nicolae-Saga von
Aurelia L. Porter
© 2021 Aurelia L. Porter
Umschlaggestaltung: Saeed Maleki, Hamburg
Umschlagmotiv: Shutterstock
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Neuauflage der Printausgaben
ISBN 978-3-347-06032-6 (Paperback)
ISBN 978-3-347-24459-7 (Hardcover)
Verlag & Druck: tredition GmbH,
Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Autors zulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Zur Nicolae-Saga gibt es Musik!
Hören Sie kostenlos in den Soundtrack hinein.
Info: www.aurelia-porter.de
Träume sind für die Sehnsüchtigen,
damit sie, gefangen in ihrer falschen Welt,
weiterhin nach ihrem wahren Ziel suchen.
(Nicolae)
Kapitel 1
Wieder war sie in diesem trügerischen Labyrinth gefangen, das sich als Irrgarten entpuppte. Ratlos schaute sie umher und suchte nach einem Ausweg. Aber gleich für welche Richtung sie sich entschied, sie gelangte immer wieder an denselben Scheideweg.
Mit klopfendem Herzen stand sie davor, unfähig, sich für einen der beiden Wege zu entscheiden. Erneut drohten die unterschiedlichen Kräfte sie zu zerreißen. Drängende Stimmen riefen ihr zu, den einen und bloß nicht den anderen Weg zu wählen. Auf welche sollte sie hören, welcher Glauben schenken?
Als sie den Irrgarten betreten hatte, war sie sich sicher gewesen, dass – wenn sie nur stetig voranschritte, ohne unterwegs unnötig zu pausieren oder die Blicke schweifen zu lassen – sie ihr Ziel bald erreichen würde. Sie war sich darüber im Klaren gewesen, dass sie manch schwieriges Gelände zu passieren und allerlei Versuchungen am Wegesrand zu widerstehen hätte.
Bisher hatte sie alles mit Bravour gemeistert, hatte aller Mühsal getrotzt und allen Verführungen widerstanden. Nicht ein einziges Mal war sie ins Straucheln geraten und hatte sich durch nichts und niemanden von ihrem Ziel abbringen lassen. Sie konnte mit Recht stolz auf sich sein.
Aber jetzt war sie auf ein unvorhergesehenes Hindernis gestoßen; ein Hindernis tief in ihrem Inneren, welches es ihr erschwerte, die richtige Entscheidung zu treffen. Ihr Schatten fiel in zweierlei Richtungen und zwang sie, einen von beiden hinter sich zu lassen.
Es war unmöglich. Sie stand sich selbst im Wege.
Ewas Dunkles schob sich vor das Licht und tauchte den Scheideweg in Finsternis. Die Schatten verschwanden, die Stimmen verstummten. Nur der Schlag ihres Herzens war ihr geblieben, sie zu leiten. Vorsichtig setzte sie einen Schritt auf den Weg, den ihr Herz ihr befahl zu gehen. Da vernahm sie eine donnernde Stimme, die sie auf ewig verbannte und der Verdammnis preisgab; grausame Bilder von sich windenden, geschundenen Leibern in der Höllenglut taten sich vor ihr auf, der sie selbst anheimfallen sollte, falls sie diesen Weg fortsetzte. Angst nahm sie gefangen, doch ihr Herz gebot ihr weiterzugehen. Und als sie so tat, war ihr auf einmal, als ob sie den Boden unter den Füßen verlöre und ins Nichts fiele.
Erschrocken wich sie zurück.
Wie festgewurzelt stand sie wieder an gleicher Stelle, umhüllt von totaler Finsternis und absoluter Stille. Nur ihr Puls rauschte ärger als zuvor in ihren Ohren.
Der rechter Hand liegende Weg der Vernunft schien weit weniger Gefahren zu bergen. Diesmal entschied sie sich für diesen und tat beherzt den ersten Schritt. Weder eine mahnende noch eine verführerische Stimme erklang. Alles blieb ruhig, geradezu leblos. Das angestrebte Ziel lag verlockend nahe. Aber der Pfad dorthin führte durch nichts als eine steinige Wüste. Zögerlich setzte sie einen Fuß vor den anderen. Ihr Herz blieb dabei seltsam unberührt; dumpf lag es in ihrer Brust und erlahmte mit jedem Schritt mehr. Bliebe ihr am Ende überhaupt noch genügend Kraft, ihr Ziel zu erreichen?
Abermals wich sie zurück und stand erneut am Scheideweg.
Warum gab es keinen goldenen Mittelweg, der sich ihr auftat?
Während die Verzweiflung sie hin- und herriss und sie gleichsam an Ort und Stelle bannte, erhob sie sich auf einmal in die Lüfte. Etwas Fremdes trug sie empor.
Unter ihr lag der Irrgarten des Lebens. Sie sah die geraden öden Pfade der Tugend mit Leichen gepflastert; verdorrt lagen sie mit ausgestreckten Händen da, das unsichtbare Ziel zum Greifen nahe, und doch hatten sie es nicht mehr erreicht. Andere wiederum hatten mehr Kraft besessen, nur um enttäuscht festzustellen, dass ihr Ziel sich in Luft auflöste, sobald es erreicht war. Mit verkümmerten Herzen umklammerten sie das Nichts noch im Tode, die verhärmten Gesichter bizarr verzogen vor vergänglichem Stolz.
Die verschlungenen Pfade der Versuchung hingegen waren mit fröhlich im Wind spielenden Wesen versetzt, die ihr Ziel längst aus den Augen verloren hatten. Sie gaben sich unbekümmert den Lustbarkeiten hin, drehten sich unentwegt um ihre eigene Achse, immer schneller, bis ihre längst leere Hülle wie eine Seifenblase zerplatzte. Es blieb nichts von ihnen, nicht einmal die Reue.
Beides war furchtbar anzusehen.
Schließlich entdeckte sie tief unter sich welche, die zwischen den Wegen suchend umherirrten. Sie hasteten weder nach einem Ziel, noch ließen sie sich von den schillernden Wesen verlocken, es ihnen gleichzutun. Diese Wenigen waren auf der Suche nach einem Ausweg. Denn die scheinbar richtigen Wege entpuppten sich als die falschen, andere wiederum führten bloß in die Irre. Mancherorts gebar das Laster schnell vergängliches Glück, das vermeintlich Gute jedoch führte ins sichere Verderben. Dieser Irrgarten hatte die Weltordnung auf den Kopf gestellt. Die Verwirrung, das Verlorengehen, schien sein einziges Ziel.
Judith ahnte, dass es einen Ausweg aus dem Ganzen geben musste, ein verstecktes Portal, das den Zugang zu anderen Welten bot und aus dem Universum der falschen Ziele und zerstörenden Versuchungen hinausführte. Vielleicht lag es sogar ganz in der Nähe! Vielleicht konnte sie es nur nicht erkennen! Weil sie, selbst ein Ziel vor Augen, blind für andere Möglichkeiten geworden war?
Ihre luftige Warte bot ihr eine neue Perspektive. Losgelöst von allem Bisherigen und aus der Distanz wurde ihr Blick klarer. Fasziniert beobachtete sie, wie die Dinge andere Wertigkeiten bekamen. Vormals Wichtiges wurde belanglos, Nichtigkeiten erhielten Bedeutung. Unsichtbares trat hervor, während Vorherrschendes verblasste wie der Boden tief unter ihr. Sie schien über allem zu schweben.
Doch was war es, das sie hielt?!
Mit Schrecken erkannte sie, dass sie nicht mehr die alleinige Kontrolle über sich besaß. Schon wurde sie in einen nicht enden wollenden Strudel gezogen und fiel ins Bodenlose. Taumelnd suchte sie irgendwo Halt zu finden, doch sie versank immer tiefer im Nichts, bis schwarze Schwingen sie umfingen und sicher hielten. Erst da ließ der Schwindel nach, erst da kam sie wieder zu Sinnen und sah wieder klar. Ihr Herz glücktaumelte und war gleichsam vor Furcht erstarrt.
Ein Donnergrollen rauschte über sie hinweg. Sie lag geborgen. Ein Pochen, ein Hämmern ... Ihr Herz? Das des fremden Wesens?
»Ma’am?! – Darf ich eintreten?«
Mit einem heftigen Ruck schreckte Judith in ihrem Sitz hoch. Sie brauchte einen Augenblick, bis sie begriff, dass sie angekleidet im Sessel saß und es zum wiederholten Male an die Kabinentür klopfte. Noch ganz benommen bat sie den Schiffssteward einzutreten und das Frühstückstablett auf dem in der Wand verankerten Tisch abzustellen. Sie würde vorerst nichts weiter benötigen, teilte sie ihm dankend mit, woraufhin er leise dienernd die Tür hinter sich schloss.
Mit der Hand auf ihrem aufgebrachten Herzen wartete Judith ab, bis sich ihr Puls wieder normalisierte. Dann rieb sie sich den tauben Unterarm, den sie im Schlaf ungünstig belastet hatte. Nach einem kurzen Blick in die Koje ging sie beruhigt zum Waschtisch, wo sie sich mit einem feuchten Tuch Schläfen und Handgelenke kühlte.
Mein Gott, dieser immer wiederkehrende Traum würde ihr noch den Verstand rauben! Sie war nach einer fast schlaflosen Nacht und der anschließenden Morgentoilette auf ihr Frühstück wartend eingenickt, weil dieser verstörende Traum sie bereits abends nicht zur Ruhe kommen ließ.
Sie sah furchtbar aus, wie ein Blick in den Spiegel ihr schonungslos kundtat. Ihr Teint wirkte noch teigiger als sonst und ihre auffallend blauen Augen lagen, umgeben von dunklen Schatten, tief in ihren Höhlen. Ein Wunder war es nicht nach allem, was sie die letzten Tage und Wochen durchgemacht hatten.
Sie steckte die verrutschten Haarnadeln fest und prüfte ihren schweren Haarknoten auf seinen Halt. Dann richtete sie die Brosche an der hochgeschlossenen Bluse und strich sich über den schlichten Rock, um wenigstens den Anschein der Form zu wahren, die sie geradewegs zu verlieren drohte.
Formlos, ja, so kam sie sich vor. Form- und haltlos. Schwebend, wie in jenem Albtraum, ständig in Gefahr, in die Tiefe zu stürzen. Die Wirklichkeit selbst kam ihr inzwischen wie ein Traum vor. In beiden Zuständen war ihr Herz von einer vagen Furcht umklammert. Ihr schwankte permanent der Boden.
Sie wandte sich wieder zu dem großzügig bemessenen Kabinenraum um. Erst jetzt nahm sie den leichten Seegang wahr. Ein Blick aus dem Bullauge gab jedoch die Sicht auf einen strahlend blauen Morgenhimmel frei.
Es wäre ihrer Gesundheit gewiss förderlich, an Deck zu gehen und sich die Seeluft um die Nase wehen zu lassen, aber sie scheute die Blicke der anderen Passagiere. Sie kam sich reichlich exotisch an Bord dieses englischen Handelsschiffes vor, auf dem lediglich einige italienische Händler, zwei französische Geologen sowie ein englischer Geschichtsprofessor mitreisten. Letzterer hatte ein paarmal versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen, doch sie war einsilbig geblieben. Sie hatte sich nicht in der Verfassung gefühlt, höfliche Konversation zu betreiben. Zu unwirklich erschien ihr alles.
Nach einem Blick auf die beiden noch im tiefen Schlummer versunkenen Kinder, band sie sich ihre Haube und legte ihr Schultertuch um. Die anderen Passagiere waren zu dieser frühen Morgenstunde vermutlich noch in ihren Kabinen und nahmen ihr Frühstück ein, daher wollte sie es wagen, kurz aus ihrem Mäuseloch aufzutauchen. Entschlossen stieg sie die steilen Stiegen zum Mitteldeck empor.
Der Seewind pustete die letzten Traumfetzen fort. Sie war es nicht gewohnt, von bösen Träumen verfolgt zu werden, gar überhaupt zu träumen. Bereits als Kind hatte sie, im Gegensatz zu ihrer Schwester, anderntags nichts über irgendwelche nächtlichen Abenteuer zu berichten gewusst. Dass Träume eine Bedeutung hätten und einem etwas mitzuteilen versuchten, hatte sie zwar gehört, aber ihr war so etwas völlig fremd. Sie kenne keine Träume, nur Ziele, hatte sie stets zur Antwort gegeben, wenn jemand sie danach gefragt hatte.
Worin der Ursprung dieses quälenden Traumes lag, war nicht schwer zu erraten. Bei Tage vermochte sie sich rational damit auseinanderzusetzen. Doch kaum brach die Dunkelheit über sie herein, nahmen diese unsinnigen Ängste, die der Traum mit sich brachte, wieder Besitz von ihr. Trotz der vielen Tage auf See hatten sich ihre Nerven noch immer nicht beruhigt. Ganz im Gegenteil, je näher sie ihrem unbekannten Ziel kam, desto intensiver und beängstigender wurde der Traum.
»Guten Morgen, Miss Woodward«, grüßte sie der Kapitän und tippte freundlich an seine Mütze. »Binden Sie sich lieber Ihre Haube etwas fester, es geht eine ordentliche Brise heute Früh! – Sind unsere beiden jüngsten Passagiere wohlauf?«
»Ja, danke, Capt’n Brix. Sie schlafen noch.«
»Beneidenswert die Jugend mit ihrem unbeschwerten Schlaf, nicht wahr?«
»Das kann man wohl sagen«, seufzte Judith und stellte sich an die Reling.
Das Kielwasser hinterließ eine schäumende Bahn unter den voll gesetzten Segeln. Nur noch wenige Tage bis sie das Schwarze Meer erreichten. Sie näherten sich bereits den griechischen Inselgruppen, wie der Kapitän ihr frohgelaunt mitteilte.
Eigenartig, wenn sie des Morgens zermürbt aus unruhigem Schlaf erwachte und das leichte Schaukeln des Seegangs oder bei Flaute das leise Vibrieren der Dampfkessel spürte, war ihr zwar jedes Mal schlagartig bewusst, dass sie sich auf See befand, nur in welche Richtung ihre Fahrt ging, ob sie sich auf der Heimreise nach England oder bereits wieder auf der Rückpassage nach Boston befand, hätte sie im ersten Moment nicht zu sagen gewusst. Nur die Anwesenheit der Kinder brachte ihr die schrecklichen Ereignisse wieder zu Bewusstsein sowie die Erkenntnis, dass das Wasser, auf dem sie dahinschaukelten, nicht der Atlantik, sondern das Mittelmeer war.
Zurück in der Kabine sah Judith die kleine Nataly sich allmählich regen. Die weichen Lippen, die sich kurz vor dem Erwachen zuspitzten, rührten sie. Mit Schmatzgeräuschen löste sich die Kleine aus der Umklammerung ihres Bruders. Die zarten Augenlider über dem dunklen Wimpernkranz begannen bereits zu zucken. Jeden Moment wäre es so weit, und sie würde mit ihren großen dunklen Augen ängstlich in der Kabine umherblicken, bis diese beruhigt auf ihrem noch schlafenden Bruder hängen blieben. Erst dann würde sie nach dem Gesicht ihrer Tante Ausschau halten und ihre Ärmchen nach ihr ausstrecken.
Nicholas hatte die halbe Nacht über seine Schwester gewacht. Als Nataly wie so oft weinend aus dem Schlaf aufgeschreckt war, hatte er ihr leise Wiegenlieder gesungen, bis sie wieder eingeschlafen war. Judith hatte nicht die Augen zu öffnen brauchen, um zu wissen, dass er anschließend stundenlang am Bullaugenfenster gesessen und in die Nacht hinausgestarrt hatte, das blasse Gesicht voller Hoffnung.
Nicholas’ Stärke erstaunte Judith immer wieder aufs Neue. Wenn man bedachte, wie viele böse Ahnungen und Ängste er so lange Zeit mit sich herumgetragen hatte, bis diese zur grausamen Wirklichkeit geworden waren, und wie sehr die anschließenden Enthüllungen sein bisheriges Leben ins Wanken gebracht hatten, grenzte es an ein Wunder, dass er nicht längst zusammengebrochen war. Sie wollte sich lieber nicht ausmalen, welch düstere Bilder er Nacht für Nacht erblickt haben mochte, die sich im Morgengrauen jedoch nicht in Wohlgefallen aufgelöst, sondern in aller bedrohlichen Deutlichkeit vor ihm entfaltet hatten. Ohne jeglichen Beistand hatte er monatelang dem Unheil zu trotzen versucht, hatte Mutter und Schwester vor dem Bösen bewahren wollen und sich zu guter Letzt sämtliche Schuld an dem unabwendbaren Verhängnis aufgeladen.
So zerbrechlich sein ausgemergelter Körper jetzt auch dalag, so tapfer hatte er sein altes und neues Schicksal angenommen. Abgesehen von ein paar stillen Tränen beim Abschied von seiner Lehrerin Miss Paxton, hatte er seiner Heimat und damit seinem bisherigen Leben gefasst den Rücken gekehrt. Selbst der Abschied von Granny Bridget und Grandpa Patty, welche sie nach Southhampton begleitet hatten, wo ihr Klipper vor etlichen Tagen in See gestochen war, hatte ihn kaum aus seiner unfassbaren Ruhe gebracht. Wacker hatte er seinen Abschiedsschmerz hinuntergeschluckt und seinem aufgelösten Urgroßvater versprochen, ihn eines Tages in Galway besuchen zu kommen. Bis dahin würde er in langen Briefen von seiner neuen Heimat und seinem Leben dort berichten und sich auf ihr Wiedersehen freuen.
»Warte nicht zu lange, mein Junge, denn ich bin nicht mehr der Jüngste«, hatte Grandpa Patty zu bedenken gegeben.
»Keine Sorge«, hatte Nicholas ihm versichert. »Vorher darfst du ohnehin nicht von dieser Welt gehen, versprich mir das!«
Unter Tränen hatte Grandpa Patty sein Versprechen abgegeben. Danach hatte Nicholas sehr lange Granny Bridget umarmt gehalten.
»Eines Tages werden wir uns wiedersehen, Nick«, hatte sie ihm zugeflüstert, »und dann werde ich sehr stolz auf dich sein, was ich jetzt schon bin. Ich werde dir nicht sagen, dass du gut auf deine Tante aufpassen sollst, denn das kann sie selbst. Aber ich bitte dich, sie in deiner neuen Heimat ein wenig an die Hand zu nehmen.«
»Das werde ich tun«, hatte er beteuert. »Und Nana werde ich für den Rest meines Lebens beschützen, das habe ich Mummy auf dem Sterbebett versprochen. Und diesmal werde ich meine Versprechen halten können, denn in jener Welt bin ich nicht mehr allein.«
»Nein, das bist du nun nicht mehr«, hatte Granny Bridget sichtlich erleichtert entgegnet. »Von jetzt an weiß ich dich in guten Händen. Lebe wohl, mein liebes Kind!«
Während Judith schweren Herzens Abschied von ihren Großeltern genommen hatte, war Nicholas bereits mit seiner kleinen Schwester auf dem Arm an Bord gegangen.
»Sei unbesorgt, Judith, er ist stärker, als er ahnt«, waren Granny Bridgets letzte Worte an sie gewesen.
Die dunklen Augen, die sie plötzlich auf sich spürte, rissen Judith aus ihren Erinnerungen und forderten ihre sofortige Aufmerksamkeit. Sie versorgte ihre Nichte mit Behutsamkeit und Sorgfalt und fühlte sich mit diesem kleinen Wesen insofern verbunden, als dass sie diese ebenso verloren glaubte wie sich selbst. Beide segelten sie einem unbekannten Ziel entgegen.
Geduldig ließ Nataly alle Handhabungen an sich verrichten, aber nicht, ohne in regelmäßigen Abständen einen Blick auf ihren noch schlafenden Bruder zu werfen. Auch wenn die Kleine niemals Unmut zeigte, wusste Judith nur zu gut, dass sie mehr aus Folgsamkeit denn aus eigenem Verlangen die Beschäftigungsversuche ihrer Tante artig über sich ergehen ließ. Judith gab sich da keinerlei Illusionen hin. Kaum würde Nataly die ersten Anzeichen des Erwachens an ihrem Bruder bemerken, gäbe es für sie kein Halten mehr.
Begierig lief sie auch dieses Mal nach seiner ersten Regung zur Koje und ließ ihn nicht eher aus den Augen, als bis er die seinen öffnete. »Nana«, war wie immer sein erstes Wort. »Nini spieln?«, erwiderte sie hoffnungsfroh. Schon zog er sie zu sich empor und ließ sie auf sich herumturnen, bis auch er richtig wach war.
Die nächsten Stunden wäre Judith Zeugin einer für sie nicht durchschaubaren Innigkeit zwischen den beiden, die in dem Wort Geschwisterliebe keinen würdigen Ausdruck fand. Ihre traute Zweisamkeit wagte sie kaum zu stören. Es waren genau jene Momente, in denen sie ins Grübeln geriet und Zweifel an der Richtigkeit ihrer Entscheidung hegte. Die Kinder Ihrer Schwester brauchen Sie jetzt, hatte Graf da Laruc zu ihr gesagt, aber diesen Eindruck hatte sie ganz und gar nicht. Nicholas sorgte für sich in stiller Gewohnheit und für seine Schwester mit großer Hingabe. Judith war sich sicher, dass er sogar an Bord dieses Schiffes bestens allein zurechtgekommen wäre.
Während Natalys Mittagsschlaf verbrachte Nicholas meist einige Zeit bei Kapitän Brix, der ihm geduldig die Bordinstrumente erklärte und Einblick in die Seekarten nehmen ließ. Der Funker war angewiesen worden, dem jungen Herrn das Morsealphabet beizubringen. Auch der erste Maat nahm sich seiner gelegentlich an. Nach nur einer Woche auf See hatte Nicholas bereits die verschiedenen Segel und Masten zu benennen gewusst und übte sich weiterhin fleißig im Binden von Seemannsknoten.
Am Nachmittag leistete Nataly ihrem Bruder dabei Gesellschaft. Sie vergnügte sich mit einem etwas dünneren Seil, während Nicholas ihr Grandpa Pattys Seemannsgeschichten erzählte. Obwohl Judith sich nicht vorstellen konnte, dass ihre knapp zwanzig Monate alte Nichte bereits viel davon begriff, wollte Nataly diejenigen, die von Meerjungfrauen und verwunschenen Fischen handelten, immer wieder hören. Kurze Zeit später konnte man beide Kinder an der Reling stehen und nach den Zauberwesen Ausschau halten sehen.
Judith konnte nicht umhin, sich in jenen Momenten völlig überflüssig vorzukommen. Was hatte sie sich nur dabei gedacht, auf die Bitte eines ihr völlig Unbekannten hin, von dessen abscheulichem Verhalten sie sich mehr als genug hatte überzeugen können, diesem auch noch in die Fremde zu folgen? Die Kinder brauchten sie nicht! Sie hatten einander und zudem einen Vater, dessen Pflicht es war, sich fortan um sie zu kümmern.
Es war zu spät für derlei Gedanken, rief sich Judith zur Raison. Sie hatte ihre Entscheidung getroffen.
Nach einem heftigen Sturm vor Iraklion und kippeliger See im Ägäischen Meer erreichten sie wenige Tage später das Schwarze Meer. In den frühen Morgenstunden liefen sie in den Hafen von Varna ein, wo ein großer Teil der Ladung gelöscht wurde und etliche der mitreisenden Händler von Bord gingen. Andere mit Kisten und Kasten bepackte Händler stiegen zu und brachten allerlei Viehzeug mit an Bord.
In Küstenja begleitete sie der Erste Maat von Bord und übergab sie im Zollgebäude einem Karawanenführer, der eine bunte Truppe von Händlern, Kaufleuten und sonstigen Reisenden nach Bukarest bringen sollte. Das laute Sprachgewirr und aufgeregte Durcheinander ließen Judith nervös umherblicken, doch Nicholas beteuerte, dass sie sich schon bald an den ungewohnten Anblick der fremden Gesichter gewöhnen werde. Er fühle sich jedenfalls sicher. Graf da Laruc habe schon damals dafür gesorgt, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreicht hätten.
»Ich kann trotzdem nicht verstehen, warum er uns alleine reisen lässt«, erwiderte Judith und blickte betroffen aus dem Fenster des einfachen Gefährts, in dem sie hatten Platz nehmen sollen. Eine große Ansammlung von Menschen, Tieren und Fuhrwerken aller Art hatte sich gleich einer Schlange vor und hinter ihnen gruppiert.
»Wieso? Er hat doch gesagt, dass er unterwegs noch einiges zu erledigen habe«, entgegnete Nicholas scharf. »Außerdem ist er mit der Eisenbahn viel schneller zu Hause, um alles für unseren Empfang vorzubereiten. Wohingegen die Schiffspassage für Nataly viel angenehmer war. Auf einer Zugfahrt hätte sie tagelang still sitzen müssen und es wäre viel schwieriger gewesen, sie zu beschäftigen. Wir hatten doch eine sehr komfortable Kabine und –«
»Schon gut, Nicholas. Es war gewiss die sinnvollste Lösung für uns alle. Vergiss bitte meine Bemerkung, sie war unangebracht.«
Beschwichtigend legte Judith ihrem Neffen, der im Sitz ihr gegenüber saß, die Hand aufs Knie und nahm sich vor, zukünftig vorsichtiger mit derartigen Äußerungen zu sein. Sie hatte schon ein paarmal festgestellt, dass er keinerlei Kritik an dem Grafen duldete, und sei sie in noch so versteckter Form vorgebracht.
Trotz des heftigen Schaukelns und der harten Stöße in dem alten Rumpelkasten, verstärkt durch die unzumutbare Wegstrecke, fuhr Judith fort, ihr kleines Wörterbuch zu studieren. Graf da Laruc hatte es ihr kurz vor der Abreise in die Hand gedrückt. Während der Schiffspassage hatte sie es nur selten und mit Widerwillen hervorgeholt, obwohl der Graf ihr angeraten hatte, die Zeit an Bord gut zu nutzen. Aber wie alles andere war ihr auch dies sinnlos erschienen. Jetzt jedoch, umgeben von den vielen fremdländischen Gestalten, wurde ihr bewusst, dass es sich nicht vermeiden ließ, sich mit der neuen Sprache auseinanderzusetzen, wollte sie den Kindern von irgendeinem Nutzen sein.
Nicholas, der diesbezüglich seine Zeit an Bord brav genutzt hatte, verfügte bereits über das notwendigste Vokabular und scheute sich nicht, mit dem Karawanenführer während einer Rast Kontakt aufzunehmen. So brachte er in Erfahrung, dass sie bald die Donau und damit die Grenze zum Fürstentum Rumänien erreichen würden.
Unter dem Menschengewirr am Fähranleger in Czernavoda entdeckte Nicholas ein ihm bekanntes Gesicht. »István!«, rief er schon von Weitem, woraufhin sich ein zum Fürchten aussehender Vagabund mit seinen wilden Gesellen um ihr Gefährt sammelte. Nach einer unerwartet ehrerbietigen Begrüßung gab István zu verstehen, dass die gräfliche Reisekutsche auf der anderen Seite der Donau für sie bereitstünde, wie Nicholas übersetzte. Der Gedanke erfüllte Judith, in Hinblick auf ihre malträtierten Knochen, mit Zuversicht.
Nach Überqueren der wässrigen Grenze wurden sie zu einer luxuriösen vierspännigen Kutsche geleitet. Ein Kutscher mit deutschem Namen – auch er schien ein alter Bekannter für Nicholas zu sein – hieß sie freundlich willkommen. Sein vollbärtiges Gesicht, das durchaus vertrauenerweckend wirkte, verriet ehrliche Freude über das Wiedersehen. Auf zuvorkommende Art war er ihnen beim Einstieg behilflich, während Istváns Männer das Gepäck verluden.
Nicholas lehnte sich frohen Mutes in dem weichen und gut gefederten Sitz zurück. Der geräumige Wagen machte auch Judith die Weiterfahrt etwas erträglicher. Jedoch die ständige Gegenwart ihrer persönlichen Eskorte, die aus zwanzig dieser Raubeine bestand und ihre Kutsche nach allen Seiten hin absicherte, hielt sie für übertrieben und hätte auf den Anblick dieser wüsten Gesellen lieber verzichtet. Dass ihr Neffe zu einem von ihnen Kontakt unterhielt, ausgerechnet zu dem Finstersten von allen, empfand sie geradezu als unschicklich. Nataly hingegen betrachtete die derben Gesichter interessiert. Sie spürte wohl am Verhalten ihres Bruders, dass sie diese nicht zu fürchten brauchte.
»Ich weiß, dass sie gefährlich aussehen, Tante Judith«, suchte ihr Neffe, der ihr ihre anhaltenden Bedenken anscheinend vom Gesicht abgelesen hatte, sie zu beruhigen. »Das sind sie auch, denn sie sollen uns ja beschützen. István, ihr Anführer, ist sehr kampferprobt und ein Held. In jungen Jahren hat er an Dobuschs Seite gekämpft, der unserem Robin Hood glich. Dabei hat er sich so manche Narbe eingehandelt und seinen Daumen gelassen. Mit der Zeit gewöhnt man sich an sein Aussehen. Er ist sehr zuverlässig und treu.«
Judith war erstaunt über all die Geschichten, die Nicholas ihr anschließend über die Haiducken zu erzählen wusste, jene sagenumwobenen Räuberhelden, die in den finsteren Wäldern des Karpatenbogens ihr Unwesen getrieben haben sollen und es zum Teil wohl noch taten. Die Reise vor zwei Jahren hatte offenbar einen starken Eindruck auf ihren damals fast sechsjährigen Neffen hinterlassen.
Nach einer schier ewig langen Fahrt durch die Donau-Ebene, vorbei an nichts als endlos grünen Steppen, ausgedehnten Weizen- und Maisfeldern und verstreut liegenden Dörfern, näherten sie sich am späten Abend Bukarest. Sie passierten etliche Ansammlungen armseliger Behausungen und dürftiger Bretterbuden, ehe sie unversehens einen von Bäumen gesäumten Boulevard erreichten. In das schummrige Licht der Straßenlaternen getaucht, zogen sich prachtvolle Villen und Stadthäuser zu beiden Seiten entlang.
Die breite Allee führte sie ins Stadtinnere, wo trotz der späten Stunde eine rege Betriebsamkeit auf den Straßen und Plätzen herrschte, als kündigte der dunkle Abendhimmel nicht von einsetzender Ruhe und baldigem Schlaf.
Nachdem sie sich bei einer Karawanserei von den Handel treibenden Mitreisenden und ihrem Führer verabschiedet hatten, fuhr Heinrich sie ohne Eskorte weiter ins Zentrum hinein, wo sie an einem der Hauptplätze vor einem feudalen Hotel hielten.
Judith fühlte sich in diesem – jetzt, da sie die Zivilisation erreicht hatten – zwar wesentlich sicherer, aber völlig fehl am Platze. Die vornehmen Gäste dieses Hotels, denn auch in ihm schien die späte Stunde für seine Bewohner von keinerlei Bedeutung, warfen ihr und den Kindern verstohlene Blicke zu. Erst da wurde Judith sich ihres äußeren Erscheinungsbildes und das der Kinder bewusst. Nicholas und Nataly wirkten keinesfalls wie die Sprösslinge eines altehrwürdigen Adelsgeschlechts, sondern eher wie armselige Bauernkinder, die vor Urzeiten in ihren Sonntagsstaat gepackt und dort belassen worden waren. Nicholas war aus seinem schäbigen Anzug längst herausgewachsen und um seine kleine Schwester stand es nicht viel besser. Die zwei Kleidchen, die sie ihr im Wechsel anlegte, waren ziemlich verschlissen und zudem voller Flecken, die sie allabendlich mühevoll zu beseitigen suchte.
Als der Hotelpage sich ihrer dürftigen Gepäckstücke annahm, straffte Judith die Schultern. Eine Nacht und einen Morgen würden die Gäste und die Bediensteten dieser vornehmen Herberge ihren unangemessenen Aufzug wohl oder übel ertragen müssen.
In ihrer Hotelsuite erwartete sie ein üppiges Nachtmahl, von dem sie nur wenig aßen und dann erschöpft in die weichen Betten fielen.
Zu Judiths Verwunderung setzten sie am nächsten Morgen ihre Reise noch nicht fort. Stattdessen erschien nach dem Frühstück, das sie wiederum auf ihrem Zimmer serviert bekommen hatten, ein Herr nebst Gehilfen, der sich als der erste Schneider der Kapitale vorstellte. Dieser nahm an ihnen allen dreien im Handumdrehen Maß und ließ die Ergebnisse von seinem Assistenten in ein Büchlein eintragen, bevor er sich mit zahlreichen Verbeugungen wieder verabschiedete, nicht ohne einen ungläubigen Blick auf die derzeitige Garderobe seiner neuen Kundschaft geworfen zu haben. Judith schaute ihm noch völlig verblüfft hinterher, als erneut an die Zimmertür geklopft wurde. Der Hoteldiener vermeldete in gebrochenem Englisch, dass ihr Kutscher sie unten zu einer Einkaufsfahrt erwarte.
Wenige Augenblicke später fuhr Heinrich sie in ein belebtes Geschäftsviertel. Sie hielten vor einer Lingerie, wo sie vom Ladendiener in Empfang genommen und vom Inhaber persönlich bedient wurden. Es war ein Wäschegeschäft allerhöchster Güte, und soviel Judith verstand, war der Ladenbesitzer befehligt worden, die Kinder mit allem,was man so brauche, auszustatten. Niemals zuvor hatte sie derart zarte und blütenreine Wäsche erblickt. Selbst bei den reichen Damen in Beacon Hill hatte sie nicht so weiches Flanell, feinfädigen Batist, schimmernden Damast oder exklusiven Brokat zu sehen bekommen. Ein Stapel seidiger Weißwäsche nach dem anderen wurde für sie auf dem Ladentisch zum Begucken und Betasten ausgebreitet; Unterhosen, Unterröcke, Leibchen und Nachtwäsche, die der Ladenbesitzer in Abständen den Kindern anhielt, sich mit fragenden Blicken ihres Wohlgefallens versicherte und sich hierüber Notizen machte. Zu guter Letzt gab er Judith zu verstehen, sich für sich selbst etwas auszusuchen, doch sie wies dies dankend zurück. Ganz zu schweigen davon, dass sie sich in diesem Geschäft noch nicht einmal ein Schnupftuch hätte leisten können, wäre sie sich in einem dieser mit feinen Spitzen besetzten Nachtkleider oder eleganten Morgenmäntel völlig verkehrt vorgekommen.
Etwas benommen verließ Judith mit den Kindern die Lingerie. Als nächstes hatten sie dem Schuhmacher einen Besuch abzustatten, der in seiner Auslage vom Reitstiefel mit und ohne Stulpen über zierliche Trottoir-Stiefelletten für die Dame bis hin zu allerliebsten Spangenschühchen für das Kind alles anbot. Der kleine gebückte Schuster vermaß die Füße der Kinder, legte Leisten an, nahm einen Abdruck, indem er sie barfuß in ein weiches Lehmbett treten ließ, und hielt ihnen im nächsten Moment bereits wieder die Ladentüre auf. Auch beim Hutmacher mussten sie auf Anordnung Heinrichs einkehren, wo Judith, während dieser bei den Kindern Maß nahm und deren Gesichtsform skizzierte, die ausgestellten Hüte bewunderte. Hier fanden sich die neuesten Pariser Modelle neben orientalisch anmutenden Kreationen mit Pelzbesatz und Federschmuck, aber auch schlichte Baretts aus Filz neben bestickten Samtkappen.
Zurück in der Kutsche betrachtete Judith das rege Treiben auf den Straßen und Plätzen, welches sie nur stockend passieren ließ. Um einen Basar hatte sich allerlei Volk versammelt. Neben exotischen Früchten wurden orientalische Gewürze und Räucherwaren angeboten. Bunte Töpfereien und Teppiche fanden ihre Käufer. Es wurde geschaut, geplaudert und gefeilscht. An fast jeder Ecke, um die sie bogen, standen dunkelhäutige Frauen mit einer Vielzahl halb nackter Kinder und verkauften Reisigbesen oder Korbwaren aller Art. Junge Burschen priesen lautstark Tüten mit Sonnenblumenkernen oder Korinthen an und liefen eine Weile neben ihrer Kutsche her, bis Heinrich sie mit einer Drohgebärde verscheuchte. Aus kleinen Kirchen, eingezwängt zwischen Läden, Handwerksstuben und Wohnhäusern, schallten sakrale Gesänge auf die Straße. Alte Frauen standen davor und boten bunte Heiligenbildchen an. An einem Brunnen lehnte ein blinder Bettler und wurde von einem Gendarm unsanft fortgescheucht, während einige modisch gekleidete Damen sich in einem Kaffeehaus von ihren Einkäufen erholten. Diener trugen für ihre Herrschaften große Schachteln aus den Geschäften zu prunkvollen Kaleschen, die neben einfachen Bauernkarren parkten. Schon bald schwirrte Judith der Kopf. Noch nie zuvor hatte sie so viel städtisches Flair neben provinziellem Treiben erlebt.
Die vielen verwinkelten Gassen hinter sich lassend, gelangten sie schließlich auf eine breite Prachtstraße. Die feudalen Gebäude, die diese säumten, waren von teilweise schlichter klassischer Architektur, teils mit üppiger byzantinischer Ornamentik versehen. Judith war froh, als sie am Rande einer grünen Oase anhielten.
Kurz darauf fanden sie sich in einem Park wieder, zu dem sie durch eine Schatten spendende Allee gelangt waren. Das Laub der Bäume zeigte bereits die erste Herbstfärbung, obwohl noch sommerlich hohe Temperaturen herrschten. Judith stellte fest, dass die Menschen dieser Stadt gern auf ihren Straßen, Plätzen und in Parks verweilten. Sie hatten es sichtbar weniger eilig, nach Hause zu kommen oder irgendwelchen Geschäften nachzugehen, als es in London oder Boston üblich war. Ja, sie aßen und spielten sogar im Freien. Unter hohen Bäumen hatte Judith einige ältere Herren entdeckt, die an Parktischen Schach oder Backgammon spielten, rauchten, sich unterhielten oder einfach nur den Vögeln nachschauten, die von kleinen Kindern an der Seite ihrer Mütter oder Gouvernanten mit Brotkrumen gefüttert wurden. Ein Geiger spielte fröhliche Weisen für die Parkbesucher, die es ihm mit ein paar Münzen vergalten. Wenige Schritte weiter bot eine alte Frau große Stücke einer erfrischend aussehenden Frucht an, deren feste grüne Schale nach einer hellen Schicht in rotes Fruchtfleisch überging. Fasziniert wünschten Nicholas und Nataly davon zu kosten. Heinrich hatte Judith glücklicherweise mit ein paar Münzen versorgt.
Auf einer schattigen Parkbank nahe einem Seeufer nahmen sie Platz, lauschten den Violinenklängen und sahen den Enten zu, die begierig zu ihnen herüberäugten. Nicholas biss herzhaft in das rote Fruchtfleisch, sodass etwas Saft auf seine Jacke tropfte. Unbekümmert aß er weiter und spuckte – zu Judiths Entsetzen und Natalys Vergnügen – die großen schwarzen Kerne, die sich darin befanden, vor sich auf den Rasen.
»Was ist denn das für ein Benehmen?«, schalt Judith ihn umgehend. »Seit wann spuckt man in aller Öffentlichkeit in die Gegend? Und schau, wie du dich bekleckert hast!«
»Aber Tante Judith«, erwiderte Nicholas, fast schon belustigt, »die Jacke ist doch eh schmutzig. Und die Kerne sind mir zu groß, als dass ich sie hinunterschlucken möchte. Der alte Mann dort drüben spuckt sie doch auch neben sich.« Genüsslich aß er weiter, ihren missbilligenden Blick ignorierend.
Nataly verlangte schon kurz darauf nach mehr.
Nicholas biss ein weiteres Stück für sie ab und reichte es ihr, nachdem er sorgfältig die Kerne herausgepflückt hatte. Auch sie bekleckerte munter ihr Kleidchen.
Als Judith am Abend die Obstflecken nur schwer aus der Kleidung der Kinder herausgewaschen bekam, ärgerte sie sich, dass sie diese hatte gewähren lassen. Zukünftig würde sie ihnen Gehorsam abverlangen müssen, wenn sie ihre neue Anstellung ordnungsgemäß und zur Zufriedenheit des Grafen ausführen wollte. Sie konnte es sich nicht erlauben, mit der einst von ihr gescholtenen Freizügigkeit ihrer Schwester fortzufahren.
Unweigerlich kehrten ihre Gedanken zu ihrer zukünftigen Rolle als Kindermädchen im Hause des Grafen zurück. Wie so oft fragte sie sich, was genau er wohl von ihr erwartete, was alles zu ihrem Aufgabenbereich gehörte und ob dieser sie ausfüllen würde. Sie hatten nichts Näheres besprochen gehabt. Nach ihrer Entscheidung hatte sich Graf da Laruc umgehend um alle notwendigen Finanzen und Formalitäten gekümmert, hatte sämtliche Reisevorbereitungen getroffen und ihre Schulden in Amerika beglichen, die durch die unvorhergesehene Reise nach England entstanden waren. Er hatte ihr zugesagt, dass sie sich zukünftig finanziell wesentlich besser stehen werde, damit es ihr möglich sei, Rücklagen zu bilden, bei deren Anlage er ihr gern behilflich sein könne. So wolle er gewährleisten, dass sowohl eine Rückpassage nach Amerika als auch eine Wiederaufnahme ihres Studiums jederzeit finanzierbar sei. Über Details würde er mit ihr vor Ort sprechen. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatte sie sich damit zufriedengegeben. Doch je näher sie ihrem unbekannten Ziel kam, desto mehr verlangte es sie nach konkreten Vorstellungen bezüglich ihrer Position im Haus.
Ein weiterer Tag zur allgemeinen Erholung war ihnen vergönnt, bevor sie am darauffolgenden Tag weiterreisten.
Kurz nach Verlassen der Hauptstadt wurde Judith Zeuge der fragwürdigen Schutzmethoden ihrer furchterregenden Begleiter. Obwohl sie von Nicholas inzwischen Näheres über diese erfahren hatte, machte es ihr deren Präsenz keineswegs angenehmer.
Gleich hinter der Stadtgrenze, auf der nördlichen Ausfallstraße, endete die große Prachtallee unvermittelt in einem Armenviertel, so wie sie es bereits auf ihrer Einreise in die Stadt von südlicher Seite her erlebt hatten. Eine Gruppe abgemagerter, völlig zerlumpter Kinder hatte ihre herrschaftliche Kutsche entdeckt und näherte sich ihr hastig und unter scheuen Blicken. Ehe Judith und die heranströmende Kinderschar sich versahen, hatten drei Haiducken in ihre breiten Gürtel gegriffen und hieben unter lauten Flüchen mit Peitschen auf die armen Kinder ein, die winselnd und mit schützend erhobenen Armen zurückwichen. Entsetzt versuchte Judith den dreien Einhalt zu gebieten, doch die Kinder waren längst wieder in einer der finsteren Baracken verschwunden.
Nach diesem Vorfall befand sich Judith in einem Zustand unterdrückter Empörung. Auch Nicholas hatte dem Spektakel mit einiger Bestürzung zugesehen. Judith betete im Stillen, dass ihnen weitere Vorfälle dieser oder ähnlicher Art erspart blieben.
Wieder durchfuhren sie weite Strecken ebenen Gras- und Weidelandes, bis sie schließlich auf eine Ansiedlung stießen, die aus wenigen einfachen Holzhäusern bestand. Dort legten sie eine kurze Rast ein und Heinrich kaufte von den Dorfbewohnern ein wenig Wegzehrung. Nichts als eintönige Weite beherrschte diese Gegend, in der dem Auge nicht der kleinste Reiz geboten wurde.
Dies änderte sich jedoch schlagartig, nachdem sie die Ortschaft hinter sich gelassen hatten. Bald darauf durchfuhren sie ein Flusstal, hinter dem die Landschaft deutlich hügeliger und abwechslungsreicher wurde. Ein kolossales Gebirgsmassiv erhob sich in diesiger Ferne, dessen Anblick Nicholas in seinen Bann zu schlagen schien.
In einem etwas größeren Dorf legten sie eine weitere Pause ein. Heinrich führte sie für ein Mittagessen in eine Schankwirtschaft und versorgte anschließend die Pferde. Als sie sich später ein wenig die Beine vertraten, erblickten sie in einer Scheune einen Maler, dessen ländliche Motive von lichter Leichtigkeit durchdrungen waren. Mit bewegter Miene stand Nicholas vor den ausgestellten Werken. Judith konnte erkennen, wie sehr er sich an die Malerei seiner Mutter erinnert fühlte.
»Ich habe Mummys Bilder alle verkaufen müssen, und trotzdem hat es nicht gereicht«, sprach er unvermittelt, ohne seinen Blick von den Leinwänden zu nehmen. »Wann immer sie mich am Nachmittag am Strand oder im Wäldchen glaubte, bin ich in Wirklichkeit zu den Witherspoons gelaufen, um dort für etwas Milch oder ab und zu ein Stückchen Speck auf den Feldern zu arbeiten. Ich hab’s nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, wie wenig mir Mr. Dexter für ihre Kunst geboten hat. Sogar für das Bild mit der Herzmuschel wollte er mir kaum etwas geben. Es war mein Lieblingsbild. Ihr Letztes. Es hat wehgetan, es wegzugeben.«
Sein Blick verschloss sich. Dann verließ er die Scheune und kehrte forschen Schrittes zur Kutsche zurück.
Judith stand bestürzt. Sein mit äußerer Ruhe und Stärke übertünchtes Leid brach ihr das Herz. Es war das erste Mal, seit sie England verlassen hatten, dass er etwas von der schlimmen Zeit erzählt hatte, der er machtlos ausgesetzt gewesen war. Sie ahnte, dass es nur die Spitze des Eisberges war. Der Schmerz saß deutlich tiefer.
Mächtige Felswände, die aus steil hinaufziehenden Nadelwäldern entwuchsen, schimmerten ihnen im weichen Licht des späten Nachmittages entgegen.
Andächtig schaute Nicholas zu den schroffen Gipfeln empor. Erst nach einiger Zeit bemerkte er den angespannten Gesichtsausdruck seiner Tante, die ihren Blick ebenfalls auf das vor ihnen liegende Gebirge geheftet hielt.
»Ist es nicht kolossal beeindruckend, Tante Judith?« Er konnte seine innere Bewegung kaum verbergen.
»Es sieht fast so aus, als würden wir direkt in dieses monströse Gebirge hineinfahren wollen«, hörte er sie etwas spröde erwidern.
»Gewiss«, entgegnete er verwundert. »Wir fahren sogar ganz weit hinein … und hinauf. Vor allem hinauf! Wir werden doch mitten im Gebirge wohnen.«
Alarmiert schaute seine Tante zu ihm auf.
»Wie meinst du das, Nick, mitten im Gebirge?«
»Na, so wie ich es sage. Mittendrin halt.«
»Du treibst Scherz mit mir, nicht wahr? Ich kann mich deutlich erinnern, dass von einem Schloss die Rede war.«
»Richtig, Tante Judith, nur dass es mitten im Gebirge steht. Es wächst aus einem Felsen heraus … du wirst schon sehen!«
»Du meinst das ernst, was du da sagst, nicht wahr?«
Nicholas starrte seine Tante mit vor Überraschung offen stehendem Mund an. »Hast du das etwa nicht gewusst, Tante Judith? Hatte Mummy das in ihren Briefen an dich nicht erwähnt?«
»Ich muss es wohl überlesen haben. Es standen dort andere Dinge, denen ich weitaus mehr Beachtung schenkte. Ein Fehler, wie ich jetzt zugeben muss.«
»Aber findest du es denn nicht überwältigend schön hier?«, fragte er, enttäuscht über die wenig begeisterte Reaktion seiner Tante.
»Nun«, antwortete sie zögerlich, »ich muss mich erst einmal an die fremde Landschaft hier gewöhnen – und an den für mich neuen Gedanken, demnächst mitten in den Bergen zu wohnen, ebenfalls.« Ein klägliches Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Du musst bedenken, Nick«, fuhr sie sich erklärend fort, »dass ich die meiste Zeit meines Lebens in der Großstadt verbracht habe, auch wenn ich in einem kleinen Küstenort aufgewachsen bin. London und Boston waren zuletzt mein Zuhause.«
»Aber schau doch nur, Tante Judith, das hier ist doch viel schöner als alle Städte der Welt zusammen!«
»Lass mir ein wenig Zeit, Nicholas«, sagte sie und fuhr ihm versöhnlich übers Haupt, »dann werde ich vielleicht auch irgendwann die … Abgeschiedenheit hier zu schätzen wissen.«
Sie schenkte ihm einen zuversichtlichen Blick, bevor sie sich wieder der vorbeiziehenden Landschaft zuwandte. Nicholas konnte jedoch erkennen, dass, je näher sie dem Gebirgsmassiv kamen, ihr umso beklommener ums Herz wurde.
Er zog seine Schwester zu sich auf den Schoß und zeigte ihr die bizarren Bergspitzen, deutete auf hoch am Himmel kreisende Adler und erzählte ihr von den Tieren und Geistern der Wälder, die hier seit Urzeiten lebten. Nataly hörte staunend zu.
Als sie am frühen Abend Sinaia erreichten, stieg dichter Nebel aus den Niederungen empor und hüllte sie ins Nichts.
Die prächtige Klosteranlage fand bei Judith durchaus Anklang, und auch der von allerlei wanderbegeisterten Feriengästen belebte Gebirgsort fand ihren Zuspruch. Nach einer erholsamen Nacht in einem idyllisch gelegenen Berghotel beruhigte sie sich mit dem Gedanken, dass ihr neuer Aufenthaltsort wohl doch nicht so trostlos werden würde, wie sie zunächst befürchtet hatte. Zahlreiche Hotelgäste nahmen nach dem Frühstück, zünftig gewandet, ihre Spaziergänge auf. Der Himmel war von einem tiefen Blau überzogen, wie nur ein Herbstmorgen nach Auflösung des Frühnebels ihn hervorzubringen vermochte. Zwischen dem golden gesprenkelten Blattwerk der Buchen schimmerte bereits das leuchtende Rot des Bergahorns und schuf zusammen mit großen Flächen dunkler Tannenwälder, in deren Spitzen noch vereinzelte Nebelschleier hingen, ein farbenprächtiges Gemälde. Auf dem Vorplatz des Hotels warteten Kutscher darauf, die Herrschaften in die nähere Umgebung zu bringen. So manche Staffelei wurde verladen oder unter den Arm geklemmt. Wehmut erfasste Judith bei diesem Anblick. Sie konnte sich gut vorstellen, wie sehr dieser Naturzauber ihre Schwester entzückt hätte.
Tief atmete sie die würzige Bergluft ein. Heute war sie guten Willens, diesem für Nicholas so denkwürdigen Tag – der Ankunft in seinem neuen Zuhause – positiv entgegenzublicken. Frohgemut bestieg sie mit den Kindern die Kutsche.
Benommen schaute Nicholas aus dem Kutschfenster. All das, wovon er sich so lange verboten hatte zu träumen, endlich wiederzusehen, ergriff ihn bis ins Innerste. Und doch hatte sich ein dumpfer Schleier auf sein freudig aufgesprungenes Herz gelegt.
Es war ihm noch alles deutlich in Erinnerung, als wäre es erst gestern gewesen: Mummys bestürzte Miene am Frühstückstisch, als Onkel Bob ihnen eröffnet hatte, dass er sie nicht zu Graf da Laruc werde begleiten können; sein kindlicher Mut, seinen Patenonkel würdevoll vertreten zu wollen; die Aufregung, die sich ihrer beim Aufbruch bemächtigt hatte. Mummy hatte ungewöhnlich feuchte Hände gehabt.
Während sie seiner Zukunft entgegenfuhren, reiste er gedanklich noch etwas weiter zurück in die Vergangenheit. Die allererste Begegnung mit seinem richtigen Vater im Ballsaal auf Schloss Festetics kam ihm in den Sinn, an dessen Hand er sich sofort geborgen gefühlt hatte; und kurz darauf im Irrgarten des Schlossparks, aus dem der Graf seine Mutter hatte retten müssen, woraufhin sie mit erhitzten Wangen wieder aufgetaucht war. Sein anschließender nächtlicher Traum hatte ihm die Wahrheit bereits verkündet gehabt.
»Mummy hat ihn über alles geliebt«, sagte er gedankenversunken. »Ich hab’s genau gesehen: Amors Pfeil stak in beider Herzen. Sie hat ihn die ganze Zeit über geliebt. Schon immer ...«
Er tauchte aus seinen Gedanken auf und schaute seiner Tante fest in die Augen. »Deshalb hat sie an Vaters Seite so sehr gelitten, deshalb war sie all die Jahre unglücklich. Sie hatte Sehnsucht, Tante Judith, Sehnsucht nach ihrer wahren Liebe! Ich habe es die ganze Zeit über gesehen, und doch war ich blind.« Bekümmert senkte er den Blick. »Ich muss lernen, wieder an sie zu glauben.«
»Was meinst du, Nicholas? An wen zu glauben?«
»An meine Träume. Ich hatte meinen Glauben an sie verloren und damit auch meine Träume selbst. Vielleicht kann ich hier beides wiederfinden.« Mit diesen Worten überließ er sich wieder der vorbeiziehenden Landschaft.
Mit jedem Waldabschnitt, den sie durchfuhren, mit jeder Felsformation, die sich vor ihnen auftat, mit jeder tiefen Schlucht, in die sie blickten, wurde es stiller in der Reisekutsche.
Von István und seinen Kumpanen hatten sie sich, so wie damals, bereits in Sinaia verabschiedet. Nicholas wusste, dass sie fortan niemandes Schutzes mehr bedurften. So war nichts anderes zu vernehmen als das gelegentliche Schnalzen Heinrichs, das Schnauben der Pferde und das Knirschen der Kutschräder, wenn sie über Baumwurzeln und kleine Gesteinsbrocken rumpelten. Ansonsten herrschte andächtige Stille im Inneren des Wagens.
Nataly, durch die Geschichten ihres Bruders vom Vortage noch inspiriert, hielt unermüdlich Ausschau nach den Tieren und Geistern der Wälder, sobald sie einen durchfuhren. Als sie weder das eine noch das andere entdeckte, wandte sie sich enttäuscht ab. Aus Langeweile knabberte sie an einem Zwieback, den ihr Bruder ihr gegeben hatte. Als dieser aufgegessen war, erblickte sie die Tüte mit Weinbeeren, die Heinrich für sie am Vortage erstanden hatte, und naschte diese mit wachsender Begeisterung. Sie waren herrlich süß und saftig! Selbst als sie ihre klebrigen Finger an ihrem Kleidchen abwischte, nahm keiner Notiz von ihr. Mit einem leisen Rascheln holte sie sich einen weiteren Zwieback aus der neben ihr liegenden Tüte, und noch immer erfolgte kein Einwand. Sowohl Nini als auch die Tante schauten gedankenverloren aus dem Fenster. Die Gunst der Stunde nutzend, futterte sie munter drauflos, während sich die Zwiebackkrümel auf ihrem Schoß zu türmen begannen. Waren da nicht irgendwo noch ein paar von den süßen Feigen gewesen?
Unterdessen hielt Nicholas beharrlich den Kopf aus dem Fenster, um ja nicht einen einzigen Augenblick seiner lang ersehnten Wiederkehr zu versäumen. Wie oft hatte er heimlich davon geträumt! Besonders in den finsteren Zeiten, in denen er vor Hunger und Kälte, und vor Sorge um Mutter und Schwester, nicht in den Schlaf gefunden hatte. Er hatte sich vorzustellen versucht, wie es gewesen wäre, wenn sie damals geblieben wären. Doch diese Phantasien hatten jedes Mal ein solches Herzweh nach sich gezogen, dass er sich derlei Gedanken untersagt hatte. Und heute – jetzt! – war es so weit. Sein lang gehegter Wunsch ging endlich in Erfüllung. Auf seiner hellen Freude lag jedoch ein Schatten, denn es war nicht seine Mutter, mit der er zurückkehrte.
Judiths optimistische Stimmung schwand mit jeder Meile mehr, die sie sich in diese unwirtliche Region hineinbegaben. Sie sah sich umschlossen von schroffen Felsen, die kein Mensch zu bezwingen vermochte, abgrundtiefen Schluchten, die unmöglich zu passieren waren und endlosen Wäldern, aus denen es keiner Seele gelänge, je wieder hinauszufinden. Die wenigen verwitterten Scheunen und Hütten, die sie in der Ferne hatten liegen sehen, schienen seit Ewigkeiten verlassen. Je weiter die Kutsche voranrumpelte, desto enger wurde es Judith in der Brust. Sie fuhren mitten hinein in einen steinigen, mit todbringenden Fallen versehenen Irrgarten, dessen Wege allesamt ins Nirgendwo führten. Immer weiter entfernten sie sich von allem, was Zivilisation bedeutete. Sie hatte Mühe, nicht in Panik zu geraten.
Auch Nataly war inzwischen einer gewissen Unruhe verfallen, wenn auch aus völlig anderem Grunde. Sie fühlte ein zunehmendes Zwicken in ihrem Bauch. Leise fing sie an zu klagen, als bereits ein Schwall von Übelkeit in ihr hochstieg.
»Was ist mit dir, Nana?«, fragte Nicholas, aus seinen zwiespältigen Gefühlen gerissen. Alarmiert gewahrte er ihr vor Unwohlsein verzogenes Gesicht. »Ist dir etwa übel?«
»Nana Bauchweh«, jammerte sie, sich auf ihrem Sitz windend.
Erst da fiel sein Blick auf das leere Gerippe des Traubenstiels sowie auf die aufgerissene Tüte Feigenneben ihrem Sitz.
»Hast du die etwa alle aufgegessen?!« Entgeistert starrte er in die fast leere Tüte.
»Ach du lieber Himmel!«, schreckte nun auch Judith auf. »Wir haben nicht aufgepasst!«
»Wir sollten besser eine kurze Rast einlegen, Tante Judith, sonst spuckt uns Nana womöglich noch die ganze …«
Genau in dem Moment erbrach Nataly all die kurz zuvor noch so köstlich schmeckenden Weinbeeren und Feigen, vermischt mit Zwiebackstücken, die sich in ihrem Magen zu einem gärenden Brei gesammelt hatten.
Am Wegesrand beruhigten sie das aufgebrachte Kind, das sich immer wieder übergab, bis ihr kleiner geschundener Magen endlich Erleichterung fand. Notdürftig säuberte Judith ihr Kleidchen, das einen Teil abbekommen hatte. Den Großteil hatte jedoch Heinrich aus dem Wageninneren zu beseitigen, wie Judith beschämt feststellte. Sie entschuldigte sich vielmals für das Ungemach, das sie ihm bereiteten, aber Heinrich sprach begütigend auf sie ein und gab ihnen zu verstehen, sich nicht weiter zu bekümmern. Er führte sie zu einem nahen Gebirgsbach, wo Nataly ihren Mund spülen und Judith ihr die Reste aus Gesicht und Kleidung waschen konnte. Sie warteten ein Weilchen, bis Natalys Unwohlsein nachgelassen hatte.
Die kühle Gebirgsluft legte sich klärend auf Judiths Gemüt. Die Erfordernisse hatten ihr augenblicklich ihre düsteren Empfindungen genommen. Für einen kurzen Moment war sie wieder in ihrem alten Selbst gewesen. Es war gut zu wissen, dass sie noch funktionierte. Sie nahm sich vor, ihre Nerven fortan besser beisammenzuhalten. Es ging nicht an, dass eine Überreizung derselben dazu führte, dass sie ihre Aufsichtspflicht verletzte, wie soeben geschehen.
Als sie sich umblickte, gewahrte sie in einiger Entfernung eine Schafherde. Zwei völlig in Weiß gekleidete Schäfer, behütet mit glockenförmigen schwarzen Mützen, trieben diese über eine Almwiese. Ein zotteliger Hund begleitete sie. Es gab also doch Lebewesen in dieser öden Ausweglosigkeit, stellte sie erleichtert fest.
Zurück in der Kutsche roch es zwar noch etwas säuerlich, aber ansonsten waren fast sämtliche Spuren ihres kleinen Missgeschickes beseitigt. Judith verspritzte einige Tropfen Kölnisch Wasser, das sie stets in ihrem Reisebeutel mit sich führte.
Kurze Zeit später schlief Nataly auf ihrem Sitz ein. Nicholas hielt ihren Kopf auf seinem Schoß gebettet. Nach einer Weile begann er, seine Tante auf die steile Anfahrt vorzubereiten. Mit verhaltener Belustigung erzählte er ihr, wie seiner Mutter damals auf jener Strecke schlecht geworden war.
Es war gewiss nicht nur der Blick in den tiefen Abgrund gewesen, den Judith auf Anraten ihres Neffen tunlichst mied, der bei ihrer Schwester Übelkeit ausgelöst hatte, sondern vielmehr die schwindelerregende Höhe, auf die sie sich auf engen Pfaden stetig hinaufschraubten. Der häufige Richtungswechsel tat das Übrige dazu.
Als sie endlich die Hochebene erreichten, atmete Judith erleichtert auf. Obwohl ihr Vertrauen in den soliden Heinrich und seine Fahrkünste groß war, so hatte sie beim Ächzen der Achsen und Schwanken des Wagens vorsorglich leise gebetet.
Der Anblick des vor ihnen liegenden Bergdorfs ließ Nicholas’ Herz höher schlagen. Sofort fiel ihm das Mädchen mit den blonden Zöpfen und den traurigen grauen Augen wieder ein, das damals bei ihrer Ankunft so bitterlich geweint und ihm bei ihrer Abreise so hoffnungsvoll hinterhergeschaut hatte. Diesmal war keiner der Dorfbewohner auf den Wegen anzutreffen. Sie schienen allesamt, das letzte Tageslicht nutzend, auf den umliegenden Bergwiesen mit dem Einbringen der späten Heuernte beschäftigt. Und obwohl es in etwa die gleiche Stunde sein musste wie damals, senkte sich die Sonne zu dieser Jahreszeit bereits der westlichen Bergkette entgegen.
Vor dem Wirtshaus hielten sie an und Nataly erwachte aus ihrem Schlummer. Darinnen waren diesmal erheblich weniger Bauern versammelt. Zu ihrem Schrecken erhoben sich diese bei ihrem Eintritt und verneigten sich tief vor ihnen. Der Wirt geleitete sie eilfertig zu dem Ehrenplatz in der Abseite. Nachdem sie sich gesetzt hatten, entdeckte Nicholas den alten Mann auf der Ofenbank, der ihnen wie damals auf seinen Knotenstock gestützt fast zahnlos entgegenlachte und Worte zurief.
»Der uralte Petru heißt Euch willkommen, junger Herr«, sagte der Wirt, wie Nicholas meinte, zu verstehen. Augenblicke später kam er mit Brot und je einem Krug Wasser und Wein zurück. Schließlich tischte er drei Gläser Schnaps auf, stellte sich mit Namen vor und stürzte eines davon, ohne auf sie zu warten, mit einem Zug hinunter. Daraufhin ergoss sich ein Redeschwall über sie, der in einer Frage endete. Ratlos blickten sie ihn an. Vasile verneigte sich und verschwand in der Küche, um dort lautstark ihre nicht gemachte Bestellung aufzugeben. Eilig zog Nicholas das kleine Wörterbuch aus seiner Jackentasche.
Als der Wirt ihnen kurz darauf eine Hühnersuppe mit Fettaugen servierte, versuchte Nicholas ihm zu erklären, dass seiner Schwester nicht wohl im Magen sei. Vasile verstand und brachte ihr einen Teller Maisbrei und einen Becher Kräutertee. Er ermutigte sie davon zu trinken, während er sich, um seine Worte zu unterstützen, wohltuend den Bauch rieb. Dienernd entfernte er sich.
Die säuerliche Suppe und der süße Wein, von dem seine Tante vorsichtig nippte, verfehlten ihre Wirkung nicht. Auf ihren Wangen breitete sich eine ungewohnte Röte aus, die ihr gut zu Gesicht stand.
Unterdessen hatte Nicholas seine Schwester in kleinen Schlucken von dem Tee trinken lassen, doch der Maisbrei schien ihr nicht zu schmecken. Stattdessen schaute sie ihm jeden Löffel hinterher. Im stillen Begehren ruhten ihre Augen auf seinem Teller, bis er ein Stück Brot in seine Suppe tunkte und es ihr zu kosten gab. Glücklich verleibte sie sich die durchtränkten Brotstückchen ein.
Der uralte Petru, der ihnen von seiner Ofenbank aus zusah, rief ihnen abermals Worte zu, die er mit einem freudigen Nicken begleitete. Die übrigen Wirtshausbesucher, denen Vasile zwischenzeitlich ebenfalls Schnaps ausgeschenkt hatte, schauten aus wettergegerbten Gesichtern zu ihnen her und erhoben dann wie auf Kommando ihr Glas. »Noroc!«, riefen sie ihnen zu, und auch der Alte erhob sein Gläschen in ihre Richtung. Daraufhin nahm Nicholas das seine auf.
»Untersteh dich!«, hörte er seine Tante mahnen.
»Aber, Tante Judith, wir müssen! Das gebietet die Höflichkeit. Außerdem habe ich schon damals Schnaps probiert. Mummy wollte es zuerst auch nicht zulassen, aber dann sind wir doch nicht darum herum gekommen.«
Ehe sie weiteren Einspruch erheben konnte, prostete er den Leuten zu. Schon stürzten sie den Schnaps in einem großen gemeinsamen Schluck hinunter. Wie damals schoss Nicholas auch diesmal das Wasser in die Augen. Nachdem er tapfer die Tränenflüssigkeit fortgeblinzelt hatte, ohne zu husten, schaute er in sehr zufriedene Gesichter. Vasile kam und klopfte ihm anerkennend die Schulter, während seine Tante ihm einen tadelnden Blick zuwarf. Doch dann setzte auch sie ihr Glas behutsam an die Lippen.
Nicholas wurde leichter ums Herz und die Wangen seiner Tante noch eine Spur rosiger. Derart gewappnet, traten sie den letzten Teil ihrer Reise an.
Auf ihrem Weg wurden sie bereits von Mond und Sternen begleitet, die immer deutlicher am dämmrigen Abendhimmel hervortraten. Nebelschwaden stiegen aus den Niederungen empor und hüllten die Almwiesen in feuchte Schleier. Schon umschlangen diese die dunklen Baumstämme des dichten Tannenwaldes, den sie kurz darauf befuhren.
Gespannt klebte Nataly ihre Nase an das nunmehr geschlossene Kutschfenster, welches die kühle Feuchtigkeit dennoch nicht daran hinderte, zu ihnen ins Wageninnere zu dringen.
»Geister?«, fragte sie mit aufgerissenen Augen und deutete auf einzelne Schwaden, die sich wabernd auf die Kutsche zubewegten.
»Es sind nur Feen, die in ihren weißen Gewändern im Mondlicht tanzen«, beeilte sich Nicholas zu antworten.
Entzückt sah Nataly ihnen nach, froh, nun endlich doch noch Waldgeister gesehen zu haben.
Nicholas zog sie auf seinen Schoß und sie schauten gemeinsam den zauberhaften Erscheinungen nach.
In stiller Bewunderung blickte Judith auf ihren Neffen, der so eifrig bemüht war, seiner Schwester ein Stückchen fabelhafter Kinderwelt aufzubauen, die für ihn längst zusammengestürzt war.
Als sie den dunklen Wald hinter sich gelassen hatten, wies Nicholas Heinrich an, die Kutsche anzuhalten. Dies war genau die Stelle, an der sie das Schloss vor zwei Jahren das erste Mal erblickt hatten. Damals hatte es als Silhouette vor der untergehenden Sonne gelegen. Diesmal tauchte der aufgehende Mond es in ein diffuses Licht und ließ es aus dem Schatten des umliegenden Bergmassivs hervortreten. Beide Kinder schauten wie gebannt zu den Zinnen und Türmen hoch, die sich schwarz gegen den nachtblauen Sternenhimmel absetzten. Von tief unten leckten Nebelzungen am dunklen Felsen empor und umwogten ihr neues Zuhause wie ein Meer aus Watte. Es schien, als ob das Schloss, losgelöst von allem Irdischen, auf einer Wolke schwebte, dem Weltall entgegen, nach denen sich seine Türme und Spitzen sehnsüchtig reckten. Die nächtlichen Himmelskörper erfassten es mit weichem Strahl und nahmen es auf in ihrem Weltenmeer aus Weisheit und Unendlichkeit.
Nur Judith sah von all dem Zauber nichts. Verwundert schaute sie den verzückten Blicken der Kinder nach und erkannte lediglich die dunklen Zacken eines Gebirges, das sich kalt und schroff vor einem mondbeschienenen Abendhimmel abzeichnete. »Was gibt es dort denn so Faszinierendes zu sehen?«, erkundigte sie sich.
»Na, unser Zuhause, Tante Judith«, erwiderte Nicholas, ohne den Blick von der nächtlichen Kulisse abzuwenden. »Wir sind da! Schau nur, sieht es nicht aus wie ein Märchenschloss? Hab ich’s nicht gesagt?«
Als sie keine Antwort gab, sah er verwundert zu ihr auf. »Was ist? Findest du es etwa nicht zauberhaft?«
»Ich kann es nicht einmal sehen«, erwiderte sie, angestrengt in die Dunkelheit starrend.
»Aber Tante Judith, es liegt doch direkt vor uns!«
»Tut mir leid, ich kann beim besten Willen nichts erkennen.«
»Nana sieht es doch auch – nicht wahr, Nana?«
Die Kleine nickte zustimmend und zeigte mit ihrem Finger in die dunkle Nacht hinaus. »Da, Sloss!«, wies sie ihr die Richtung, doch Judith schüttelte nur betreten den Kopf.
»Das nächste Mal kommen wir bei Tag her, Tante Judith.«
Mit diesem Beschluss lehnte sich Nicholas in seinem Sitz zurück und gab Heinrich das Zeichen zur Weiterfahrt.
Die geöffneten Pforten mit den sich windenden Schlangen im schmiedeeisernen Tor und ihren Wache haltenden Wölfen aus Stein zu beiden Seiten ängstigten ihn nicht mehr. Zu viel hatte er inzwischen über ihre Bedeutung erfahren. Er wusste, was sich hinter den Pforten verbarg: sein Zuhause! Sein richtiges Zuhause, aus dem er diesmal nicht wieder in eine ihm fremde und feindlich gesinnte Welt zurückgeschickt werden würde. Diesmal gäbe es keinen so schmerzhaften Abschied, sondern nur Ankunft. Ja, und vielleicht Antworten, wenn er irgendwann wieder bereit dafür war.
Als sie die letzte Pforte hinter sich gelassen hatten, nahm das Kribbeln in seinem Leib deutlich zu und verursachte eine leichte Übelkeit. Der Gedanke, dass sein heimlich gehegter Wunsch in wenigen Sekunden Wirklichkeit werden würde, lähmte ihn.
Wie würde der Graf ihn, seinen Sohn, wohl begrüßen? Vor allem: Wie sollte er den Grafen, seinen Vater, begrüßen? Er war schließlich kein kleiner Junge mehr, und dies war kein Traum!
Sein Herz flatterte, als sie in den Hof einfuhren. Seine Schwester und er waren endlich in Sicherheit.
Kapitel 2
Stocksteif saß er am Fußende des großen Himmelbetts – welches im unteren Teil mit einer glänzenden dunkelblauen Steppdecke bedeckt war –, um das blütenreine Weiß der Damast-Bettwäsche nicht zu beschmutzen. Sein Blick glitt ungläubig im Raum umher.
Die Wand dem Bett gegenüber wurde von einem großen Kamin eingenommen, in dem ein behagliches Feuer vor sich hin tanzte und zusammen mit einigen Wandleuchtern das Zimmer in ein warmes Licht tauchte. Auf dem Sims stand eine Uhr mit gläsernem Sturz, die unablässig ihre blanken Messingpendel kreisen ließ und ihm die verrinnende Zeit vor Augen führte.
Sein Koffer lag noch immer ungeöffnet neben ihm auf dem Bett.
So lange hatte er auf diesen Augenblick gewartet, und jetzt, wo er endlich da war, kam ihm alles furchtbar unwirklich vor – ein wahr gewordener Traum, der irgendwie traumhaft blieb, obwohl er sich gerade in diesen Sekunden erfüllte.
Als Heinrich vor kaum fünfzehn Minuten die Kutsche im Hof zum Halten gebracht hatte, war Nicholas vor Aufregung ganz starr gewesen. Es hatte sich angefühlt, als würde sich sein Inneres auflösen, sodass seine Hülle umso fester hatte werden müssen, damit er nicht gänzlich die Form verlöre. »Steig du zuerst aus, Nicholas!«, hatte Tante Judith ihn mehrmals auffordern müssen. Erst als sich ihm die Hand Graf da Larucs durch den geöffneten Wagenschlag entgegengestreckt hatte, hatten seine Beine gehorcht. Mit einem Schleier vor Augen hatte er des Grafen Gesicht nur verschwommen wahrgenommen.
Willkommen zu Hause, mein Sohn! Diese schlichten und zugleich ergreifenden Worte, weil in der Stimme des Grafen so viel feierliche Freude mitgeschwungen hatte, hallten ihm in den Ohren nach.
Er war nicht in der Lage gewesen, etwas zu erwidern, sein Mund war wie ausgetrocknet gewesen. Nur eine dürftige Verbeugung hatte er hinbekommen und war dann beschämt zur Seite getreten. Ermattet hatte er zugeschaut, wie Nataly neugierig aus der Kutsche gekrabbelt war und sich vom Grafen auf den Arm hatte heben lassen.
»Na, mein Engelchen, hast du die lange Reise gut überstanden?«, hatte er sie gefragt. Von dem bedeutungsvollen Moment völlig unbeeindruckt hatte sie erwidert: »Nana spuckt, ssarfes Brot gessen und Feen sehn!«
Das war der Augenblick gewesen, in dem Tante Judith aus der Kutsche gestiegen war.
»Ich heiße auch Sie herzlich willkommen, Miss Woodward! Hoffentlich hatten Sie nicht allzu viele Unannehmlichkeiten auf Ihrer Reise.« Noch bevor Tante Judith zu einer Entgegnung hätte ansetzen können, hatte er sich wieder Nana zugewandt.
»Ist dir denn jetzt immer noch schlecht, Natalia?« Für einen winzigen Moment hatte Nataly ob dieser ungewohnten Anrede gestutzt, dann hatte sie ihren Vater mit großen Augen angesehen und laut und deutlich erklärt: »Nein. Nana dollen Hunger«, was allseits Belustigung ausgelöst und einen Teil der Spannung genommen hatte. Wie sehr hatte Nicholas seine kleine Schwester um ihre kindliche Unbefangenheit beneidet. Umgehend hatte sie sich den neuen Begebenheiten angepasst und im nächsten Augenblick ihrem Vater ohne jegliche Scheu erzählt, dass sie sein Schloss auf einer Wolke habe schweben sehen, und gefragt, ob es denn morgen früh ganz woanders stünde, wenn die Wolke es mit sich forttrüge.
»Nein, mein Engel«, hatte der Graf ihr ernsthaft geantwortet. »Des Nachts geht es zwar mitunter auf Reisen, doch die Mondgöttin und ihre Kinder, die Sterne, achten gut darauf, dass die Wolke es pünktlich zum Sonnenaufgang, wenn ihr Gemahl, der Sonnengott, erwacht, wieder auf seinen irdischen Platz zurückstellt. Wo kämen wir hin, wenn die Wolken in der Nacht alles verschieben würden? Dann wäre am nächsten Tag ja nichts mehr dort, wo es hingehörte, und die ganze Welt in großer Unordnung! Das würde der strenge Sonnengott nicht dulden und böse mit seiner Frau werden, wenn sie dies zuließe. Sobald jedoch die gütige Mondgöttin herrscht, kann durchaus einiges durcheinandergeraten und das Schloss auf die abenteuerlichste Reise geschickt werden. Aber keine Sorge, Natalia, am nächsten Morgen erwachst du ganz bestimmt an diesem Ort und in deinem Zimmer, das ich dir jetzt zeigen werde.«