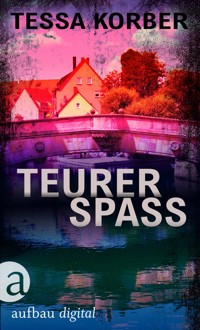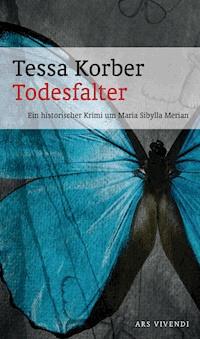Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ex-Kommissar Steinberger hat alles gut geplant: den Umzug in das gepflegte Altenstift, die Jahreskarte für den Tiergarten, die Nachmittage am nahen Valznerweiher, wo auch der Club sein Trainingsgelände hat, seine letzte große Liebe. Doch dann wird ihm klar: Zu seinen neuen Mitbewohnern gehört Peter Quent, der Mörder, den er nie zur Strecke bringen konnte, der dunkle Fleck auf seiner Karriere und seiner Seele. Steinberger begibt sich auf die Jagd, im Visier einen teuflischen Verbrecher. Oder hat er sich all die Jahre in Quent getäuscht? Ein Katz- und Mausspiel beginnt, in dem die Gegner sich nichts schenken ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tessa Korber
Noch einmal sterben vor dem Tod
Kriminalroman
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage November 2020)
© 2020 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg
Motivauswahl: ars vivendi
Coverfoto: © plainpicture/nataliadintrans
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-7472-0185-5
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Die Autorin
1
Was würde er morgen sein? Mauritius Steinberger wusste es nicht. Bis gestern war er ein Jäger gewesen. Einer, dessen Lebensinhalt es war, Verbrecher aufzuspüren. Lange Jahre als Chef der Nürnberger Kripo, danach in einem Sonderermittlungsteam des BKA, nach der Pensionierung als Berater, ein Reisender und Vortragender in Sachen Mord, in Deutschland und weltweit. Bis er beschloss, dass es gut war, ein für alle Mal. Er hatte alle Ämter niedergelegt, alle Termine abgesagt, seine Wohnung verkauft, seinen Hausstand aufgelöst. Seine Frau begraben. Ein paar Krankenhausaufenthalte hinter sich gebracht. Und jetzt stand er hier im Wohnstift, in Nürnberg, seiner Geburtsstadt, seiner alten Wirkungsstätte und dem einzigen Ort, an dem er sich vorstellen konnte – ja, was zu tun?
Morgen würde jedenfalls ein neues Leben beginnen. Für heute befand er sich in einem Übergangszustand, gegen den er wenig unternehmen konnte. Steinberger war ein organisierter Mensch, der unklare Situationen nicht mochte. Aber einen Tag war er bereit, sich das zuzugestehen.
»Fertig«, verkündete der Vorarbeiter der Möbelpacker. Steinberger unterschrieb das Protokoll und drückte dem Mann das vorbereitete Trinkgeld in die Hand. Es war alles an seinem Platz, stellte er fest, als der Trupp sein Einzimmerappartement verlassen hatte: die wenigen Möbel, die ihn über die Jahre begleitet hatten, Bett, Bord, Sessel, Schrank. Zwei, drei Fotografien in altmodischen Rahmen, ein paar Auszeichnungen hinter Glas, die alle schnell entschlossen einen Platz gefunden hatten. Der Schreibtisch, von dem altmodischen PC abgesehen, leer, wie er es mochte. Die Arbeiter hatten den Rahmen mit dem Bild von seiner Frau und ihm links neben dem Bildschirm platziert, dort, wo es stand, als sie alles eingepackt hatten. Steinberger nahm es und betrachtete es einen Moment. Die Aufnahme zeigte Brigitte und ihn in Wanderkluft auf der Terrasse eines Almlokals. Die Sonne schien sehr hell, und im Hintergrund war der Gipfel des Wildkogel zu sehen. Er hatte den Arm um sie gelegt, sie den Kopf an seine Wange. Entspannt blickten sie dem Fotografen entgegen. Seltsam, was das Bild alles nicht zeigte. Steinberger schaute sich um und stellte es schließlich auf das mittlere Brett des Bücherbords.
Er atmete ein. Der Geruch hier drinnen war fremd: Putzmittel, Kunststoff, ein wenig verstaubtes Polsterplüsch. Vorsichtig ließ er ihn in sich ein. Auch die Geräusche waren ihm unvertraut, das Gleiten seiner Schuhe auf dem seltsam federnden Boden, ein Hall, der vom Fehlen von Vorhängen und Kissen herrühren mochte, Stimmen irgendwo auf dem Gang. Ein Knacken in den Rohren, ein dumpfes Rauschen. Und er vernahm das leise Arbeiten des Aufzugs. Erträglich, befand er. Dennoch trieb ihn ein Impuls auf den Balkon.
Ostseite, er würde Frühsonne haben. Gut für einen Frühaufsteher wie ihn. Und hier im achten Stock einen schönen Ausblick über den Reichswald. Ob er es hören würde, wenn im nahen Tiergarten die Löwen brüllten? Der Ruf eines Löwen trug weit. Mauritius Steinberger liebte die Tiere, mehr als die Löwen aber noch die Tiger. Ihre Bewegungen, ihre Kraft. Wäre er romantisch veranlagt gewesen, oder hätte er zur Unbescheidenheit geneigt, hätte er vielleicht von einer inneren Verbundenheit gesprochen. Von Jäger zu Jäger, von einem einsamen, mit den Jahren immer melancholischer werdenden Mann zum anderen. Verborgene Kraft und Traurigkeit, das war es, was er auffing und empfand, wenn er vor dem Gehege an der Sandsteinmauer lehnte und sich dem Strom seiner Gedanken überließ. Nichts davon hätte er jemals einem anderen Menschen gegenüber in Worte gefasst.
Steinberger hatte bereits eine Jahreskarte für den Zoo besorgt. Spaziergänge durch den Tiergarten, das war einer seiner Pläne. An den Montagen und Donnerstagen vielleicht. Mittwochs und freitags dann an den Valznerweiher, im Restaurant speisen, Zeitung lesen, über Fußball sprechen, wenn es sich ergab. Für den Club empfand er nicht unähnlich wie für die Tiger, auch er war eine Konstante in seinem Leben. Und er hatte vor, auf diese Konstanten zu setzen für die Zukunft. Zukunft, seltsames Wort in seinem Alter, leicht adstringierend, mit aufsteigender Säure, und doch – immer noch – mit verheißungsvollem Aroma, wie der Saft von Zitronen.
Dienstags würde er sich Lektüre erlauben, keine Fachbücher mehr, nein: die Klassiker. Er hatte jetzt die Zeit für einen Dickens, einen Tolstoi. Oder für die Reisebetrachtungen Fontanes. Die dicken Bände, die seinem Vater gehört hatten, warteten schon seit Jahrzehnten auf ihn. Bislang hatten sie unbeachtet im kaum gebrauchten Gästezimmer vor sich hin vegetiert, nicht mehr als eine Kulisse, die Bewohntheit vortäuscht. Wenn Steinberger sich einmal vor das Regal verirrt und eines der Bücher in die Hand genommen hatte – warum eigentlich? –, hatte es sich kalt angefühlt, so tot wie der unbeheizte Raum.
Nun hatten diese Bände einen Platz im Herzen seiner Wohnung erhalten. Steinberger würde es endlich mit ihnen versuchen, würde, wie früher sein Vater, im Lehnsessel sitzen, ein Glas Single Malt in der Linken, im Schein einer Lampe mit grünem Schirm; das Bild stand Steinberger noch genau vor Augen. Es hatte ihn seine gesamte Kindheit über begleitet. Jetzt würde er hineinsteigen wie in ein verzaubertes Gemälde. Vielleicht waren zwischen den Buchseiten ja doch Weisheiten über das Leben verborgen, die er besser noch kennenlernen sollte.
Sport stand ebenfalls auf seinem Programm; Kraftsport war für jeden Polizisten Teil des Lebens. Dort, wo andere Menschen ein Sofa platziert hätten, stand seine Trainingsbank mit den Hanteln. Auch Wandern wäre eine Option. Noch war er gut zu Fuß. Herrgott, er war schließlich erst vierundachtzig, ein Silver Surfer, wie seine Kollegen bei der Abschiedsfeier vollmundig erklärt hatten, ein Golden Ager. So viel Edelmetall war ihm allerdings fast verdächtig vorgekommen. Er hatte nichts dazu gesagt, er redete nie viel; jenseits des Mains hatte er als maulfauler Franke gegolten. Seine Frau hatte ganz andere Erklärungen für seine Schweigsamkeit gehabt, aber die waren jetzt hinfällig. So oder so kehrte er zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen zurück. Er war noch kein Greis, er würde in Bewegung bleiben. Aber in Maßen, mit Muße. Er würde …
Es läutete an seiner Tür.
»Herr Steinberger? Einen schönen guten Tag.« Die junge Dame streckte ihm die Hand entgegen. Sie mochte Mitte zwanzig sein, klein, aber nicht ganz schlank, mit einem wippenden, losen Dutt mitten auf dem Kopf, der sie fröhlich und unkonventionell aussehen ließ. Ihr Rock war bodenlang und bunt, die hochgeschlossene weiße Bluse dazu ein bewusster Kontrast. Er sah Farbflecken auf ihren Händen. Keine Gesundheitsschuhe, kein Jackett. Sie war nicht vom Heimpersonal, schloss er, weder Pflege noch Verwaltung.
»Dorothea«, stellte sie sich vor. »Ich leite den Kreativkreis. Wir sind ein aufmüpfiges Grüppchen.« Sie lachte in sein regloses Gesicht. »Und ich dachte, ehe Sie irgendwelche Gerüchte über uns hören ...« Sie ließ den Satz ausklingen und betrachtete ihn. Sie war jemand, der genau hinsah, trotz der etwas fahrig wirkenden Munterkeit, das entdeckte er sofort. Er ließ sie zappeln.
»Jedenfalls: Herzlich willkommen. Und falls Sie mal Lust haben, sich im Malen oder Zeichnen zu versuchen. Oder mit Ton«, sie suchte offenbar nach dem roten Faden. »Jedenfalls: Männer sind bei uns immer herzlich willkommen.« Wieder dieses Lachen. Verlegen war sie nicht. »Es gibt nicht so viele, die sich gern kreativ versuchen. Männer, meine ich.«
»So wie ich.« Machen wir es kurz, dachte er.
»Sagen Sie das nicht.« Sie ließ sich offenbar nicht so leicht abwimmeln. »Ich habe Ihre Akte gesehen, Sie sind ein ganz spannender Mensch. Stimmt es, dass Sie für das BKA gearbeitet haben? Und sogar für Langley?« Sie sprach den Namen des CIA-Sitzes perfekt aus. Er tippte auf eine Vorliebe für Kinofilme über Serienkiller. Ihr Blick wanderte über seine Schulter hinweg in seine Wohnung. »Ist das eine Phantomzeichnung?«, fragte sie.
Er hätte hinterher nicht zu sagen vermocht, wie sie an ihm vorbeigelangt war. Im nächsten Moment schon stand sie vor einem Bild, das sie entdeckt hatte.
»Ein Selbstporträt«, sagte Steinberger. »Der Mann hat es mir aus dem Gefängnis geschickt.« Er machte eine Pause. »In das ich ihn gebracht habe. Er schreibt mir noch manchmal.«
»Haben Sie alle geschnappt?«, fragte sie.
Die Frage behagte ihm nicht. »Keiner schnappt alle.«
»Aber Sie jede Menge, nach allem, was man hört.« Sie beendete ihre Inspektion des Bildes und wandte sich ihm wieder zu. »Vielleicht könnten Sie einmal bei uns über Ihre Arbeit referieren, was meinen Sie?«
»Ich meine, Frau, äh …«
»Dorothea. Dorothea Kranz«, ergänzte sie, als er auffordernd schwieg. Und sie fügte hinzu: »Ich studiere an der Kunstakademie nebenan. Hier im Stift verdiene ich mir was dazu. Wir machen auch Ausstellungen. Wenn Sie sich für Kunst interessieren.«
»Tu ich nicht.«
»Das glauben viele von sich. Aber Sie sind ein Mensch, der sich mit den grundlegenden Dingen des Lebens befasst hat: Sterben, Tod, Verlust, Wut, Gier. Und genau darum geht es in der Kunst.« Für einen Moment verlor sie ihre unverbindliche Heiterkeit. Ihr Blick hing nachdenklich an der Zeichnung. »Sie würden staunen, was passiert, wenn man einen Pinsel in die Hand nimmt und einfach mal die Tür öffnet.«
In ihrem Ton war etwas, das ihn aufhorchen ließ. Steinberger fürchtete sich vor dem Moment, da ihr Blick zu seinem Gesicht wandern würde. »Sie lassen also in Ihren Malstunden Tod, Wut und Gier heraus?« Er versuchte ironisch zu klingen.
Und wieder lachte sie, diese junge Frau, vergessen der seltsame Moment, in dem sie sich zu begegnen drohten. Sie schien einfach und voll Freude über alles und jeden. »Ich sag mal, wir malen nicht nur Blumenbildchen.« Sie zog die Brauen hoch. »Die Heimleitung steht natürlich in gewisser Weise auf Blumenbilder. Sachen, die man in den Gängen aufhängen kann und so.« Sie schlug sich die Hand vor den Mund. »Sie verraten mich doch nicht? Ich brauch den Job hier wirklich.«
Er ließ sich zu einem leichten Nicken herab. Beinahe zu einem Lächeln.
»Und falls Sie doch mal neugierig werden auf das, was in Ihnen steckt: Wir treffen uns immer mittwochs um drei, Raum 007. Ups, das war keine Anspielung. Und anschließend gehen wir ins Café. Bye!«
Er nahm den Flyer, den sie ihm in die Hand drückte, und legte ihn auf die jungfräuliche Schreibtischplatte.
Das nächste Klingeln bescherte ihm eine Frau mittleren Alters mit mütterlichem Gesicht und der Frage, ob er den Wäscheservice in Anspruch nehmen wolle. Sie heiße Irina Staufert. Er habe das in seinem Vertrag noch nicht angekreuzt. Auch sie lächelte. Und dieses Lächeln schien alles über ihn zu wissen. Ein wenig wie das seiner Mutter, die stets lächelte, wenn sie zu ihren Verhören ansetzte, gewiss, dass er ihr nichts würde vorenthalten können. »Ich seh dir bis ins Herz«, pflegte seine Mutter zu drohen und sein armes Herz damit unfehlbar zum Flattern zu bringen. Er hatte diese Technik später manchmal selbst gegenüber Verdächtigen angewandt. Sie wirkte unfehlbar.
»Ich bin immer in der Nähe«, erklärte Irina Staufert. »Falls Sie irgendetwas brauchen.« Steinbergers Herz fand für kurze Zeit zur alten Arrhythmie, ehe er es fest in die Hand nahm und dankte.
Er erhielt einen weiteren Flyer mit allen Serviceleistungen der Etagenbetreuerinnen und warf ihn in den jungfräulichen Mülleimer.
Der darauffolgende Besucher war ein distinguierter Herr, der sich als Doktor Titus Mahltzahn vorstellte und ihn mit ernster Miene auf die Möglichkeit aufmerksam machte, sich dem Kulturkreis anzuschließen und auch als Mäzen für das vielfältige Programm vor allem im Bereich klassischer Musik aufzutreten. »Es gibt einen Konzertsaal mit ausgezeichneter Akustik, in dem ausgezeichnete Ensembles spielen.«
»Ausgezeichnet«, erwiderte Steinberger. Das Wort »Geld« fiel nicht; man verstand sich auch so. Doktor Mahltzahn erwies sich als durchaus informiert darüber, dass Steinberger vom Bundespräsidenten empfangen worden sei. Und einen Orden des Sultanats Brunei sein Eigen nenne, wo er die Umstrukturierung der Polizei als externer Fachmann betreut hatte. Steinberger dagegen behielt für sich, dass er unter einem Klassiker am ehesten das 11:0-Schützenfest des Clubs gegen den VfV 06 Hildesheim im Viertelfinale des DFB-Pokals 1962 verstand. Herr Mahltzahn hinterließ einen Überweisungsauftrag und eine Ausgabe des hauseigenen Kulturmagazins. Beides hinterließ Steinberger an nicht mehr jungfräulicher Stelle.
Schon ein wenig müde öffnete er auf das vierte Klingeln hin, gefasst darauf, dass das Physiotherapeutenteam sich vorstellen würde oder der Leiter der hiesigen Bankfiliale ihn vielleicht persönlich zur Kontoeröffnung beglückwünschte. Es war eine kleine Frau mit Rollator, beinahe im 90-Grad-Winkel über ihr Gefährt geneigt. Ein Buckel dellte ihr ansonsten makelloses Twinset in Puderrosa aus. Eine blonde Perücke, glatt wie ein Helm, zierte ihren Kopf, die Perlenkette schwang frei vor dem faltigen Hals. »Im Park liegt ein Toter«, verkündete sie. »Gleich in den Rosen. Den fressen jetzt die Wildschweine. Die Welt wird verrückt.«
Steinberger räusperte sich, während er nach einer Antwort suchte.
»Ich spinne nicht«, erklärte sie schnell, »ich bin völlig klar. Mörder und Diebe, überall. Aber ich darf ja nichts sagen.« Ihr Blick wanderte schnell von rechts nach links. Ihre linke Hand, bemerkte er jetzt, fleckig und zerknittert, mit starken gelben Nägeln, rieb und zupfte ohne Unterlass am Kunststoffgriff des Rollators. Er schien mehrmals geflickt worden zu sein und war mit Klebeband umwickelt. Ein dickes Goldarmband zeigte, wie sehr sie zitterte, während ihre Finger, wie ferngesteuert, ihr Zerstörungswerk unablässig verrichteten. Jetzt bemerkte Steinberger auch, dass sie rastlos von einem Fuß auf den anderen trat.
»Ich bin sicher ...«, begann er in seinem beruhigendsten Bass.
»Schweinehunde«, durchkreuzte sie seinen Versuch. »Allesamt. Und Sie brauchen sich gar nichts einzubilden. Die besuchen Sie jetzt nur, weil Sie ein Promi sind. Bald sind Sie so einsam wie wir alle.« Abrupt riss sie ihr Gefährt herum und schlurfte davon.
Erleichtert sah Steinberger, dass sie sich keiner der benachbarten Türen näherte, sondern vor dem Aufzug stehen blieb. Sie drückte ungeduldig immer wieder die Knöpfe. Aber als das leise Pling ertönte, mit dem die Tür sich aufschob, blieb sie auf halbem Weg hängen. Irgendetwas verhinderte, dass sie den Aufzug betrat. Steinberger beobachtete eine Weile, wie die Tür sich mehrmals zuzuschieben drohte und immer im letzten Moment wieder aufglitt. Die kleine Dame schimpfte, fuchtelte und trat dagegen. Er seufzte innerlich, dann ging er los, um ihr beizustehen. Die Polizei, dein Freund und Helfer, so schnell wurde man das nicht los.
Als er am Lift stand, erkannte er das Ausmaß ihres Problems. Der ganze weiträumige Aufzug, auf pflegebedürftige und behinderte Menschen eingestellt, war vollgestopft mit Gestalten wie jener, die ihn vergebens zu betreten suchte: Alte Männer und Frauen, in Anzügen und guten Kleidern, mehr oder weniger gebückt über ihre Rollatoren, standen dort dicht aneinandergedrängt und versuchten verzweifelt, die sich ineinander verhakenden Räder und Rollen auseinanderzuhalten. Man schob und zerrte, zupfte und lupfte, blickte argwöhnisch um sich, forderte Platz und verlangte Rücksichtnahme. Steinberger zweifelte daran, dass der ineinander verkeilte Haufen je wieder auseinanderfinden würde.
Der leicht entzündete Blick eines Mannes, der hilflos verrenkt in der Mitte gefangen war, traf den seinen: »Essenszeit«, sagte er resigniert.
»Mahlzeit!« Steinberger schob seine Besucherin mit einem nachdrücklichen Ruck in das Knäuel, sah die Tür vor die danteske Höllenszene gleiten und beschloss gerade, so lange es möglich war, die Treppe zu nehmen, als er, kurz bevor die Gleittür sich ganz geschlossen hatte, ein weiteres Gesicht sah. Eines, das seine Pupillen sich weiten und seinen Mund sich unwillkürlich öffnen ließ. Doch alles, was er hätte sagen können, hätte er dem Metallrücken der Tür sagen müssen.
2
Es dauerte eine Weile, bis Mauritius Steinberger den Abstieg aus dem achten Stock bewältigt hatte. Den größten Teil der Zeit verbrachte er auf einer Toilette neben dem Küchentrakt, wo er bemüht war, seinen Atem wieder zu normalisieren und seinen Knien das Zittern auszutreiben. Auf keinen Fall würde er Peter Quent hyperventilierend gegenübertreten.
Als es so weit war, schlüpfte er unauffällig in den weitläufigen Speisesaal. Er sah geneigte silberhaarige Köpfe, weiße Tischdecken, Blumengestecke, Weinkelche, Kochmützen und Servierschürzen, alles, was es brauchte, um das gepflegte Ambiente eines Hotels zu simulieren. Gestört wurde es nur von den vielen umherstehenden Gehhilfen. Angespannt musterte er die lichten Scheitel und gefurchten Gesichter. Das Gesicht von Peter Quent entdeckte er nicht.
Eine Servicekraft mit gestärkter Schürze wurde auf ihn aufmerksam und führte ihn, sein dringendes Sich-Umschauen missdeutend, an seinen Tisch, wo er aufgefordert wurde, zwischen den drei Tagesmenüs zu wählen. Seine Tischgenossen stellten sich vor und ermunterten ihn, ein wenig Konversation zu treiben. Das Gespräch plätscherte bald dahin, gebändigt durch gute Erziehung und Hinfälligkeit. Der eine oder andere funkelnde Blick traf ihn, doch Steinberger verstand es, ihn nicht zu erwidern. Außerdem war er nicht recht bei der Sache. Noch immer schweifte sein Blick durch den Saal. Es war die alte Gewohnheit des Jägers: Auf der Suche nach dem Wild, hinter dem er her war, musterte er den Rest rasch, sortierte und katalogisierte ihn und schob ihn als irrelevant beiseite. Bei ihm am Tisch saßen: die Spitznasige, der Besserwisser, die »Arme« – nach ihren wiederholten Bekundungen – und ein Mr. Siemens. Keiner von ihnen hatte das Zeug zum Gewalttäter. Keiner war Peter Quent. Doch Steinbergers Suche im weiteren Kreis blieb ebenfalls ergebnislos. Niemand sah Quent auch nur ähnlich. Verdächtig immerhin wirkte ein Mann mit Krücke und Freizeitkleidung, der mit einem prall gefüllten Rucksack zum Essen kam, den er dicht an sein heiles Bein stellte und in Abständen streichelte. Was da wohl drin war?, fragte sich Steinberger. Eine Frage, die ihn bei einer seiner Observationen interessiert hätte. Aber er war nicht beruflich hier. Er war nie mehr beruflich irgendwo.
Als er beim Dessert angelangt war, hatte sich schon die Ahnung Bahn zu brechen begonnen, dass er einer Verwechslung aufgesessen war, dem Aufblitzen einer Erinnerung, einer Freud’schen Fehlleistung. Peter Quent war nicht hier.
Am Fenster saß zwar ein Mann, der Quents Statur hatte, mittelgroß und schlank, von Natur aus elegant, und der eine ähnliche Neigung besaß, den Kopf hocherhoben zu halten. Doch das war auch alles. Am Nachbartisch ertönte ein ganz ähnliches Lachen, laut und raumgreifend, aufmerksamkeitsheischend. Da, dort hinten, nahe der Tür, war ein ungewöhnlich voller weißer Schopf auszumachen, über einer braun gebrannten Stirn. Aber Peter Quent gehörte er nicht.
Die Neigung Quents zu altmodisch-gutbürgerlicher Kleidung war gleich an mehreren der anwesenden Männer zu entdecken. Damals, Anfang der Neunziger, als Steinberger dem Bankraub in Lauf nachgegangen und auf Quent als Verdächtigen gestoßen war, hatte der Freizeitlook begonnen, seinen Siegeszug in der Mittelschicht anzutreten. Die ersten Grünen hatten Selbstgestricktes, Indienkleider und Sandalen für Erwachsene en vogue gemacht. Das Tragen von dandyesken Nadelstreifenjacketts, von Manschettenknöpfen und Hut war da eher ungewöhnlich erschienen. Als Quent ihm das erste Mal gegenüberstand, hatte der Mann Steinberger an eine Figur aus der Kindheit seines Sohnes erinnert, an Pan Tau. Und je länger das Essen dauerte, je ergebnisloser sein Umsehen blieb, umso mehr erschien es Steinberger so, als hätte er im Aufzug eine Märchengestalt gesehen, die nur an ihrem Hutrand zu wischen brauchte, um zu verschwinden. Am Ende hatte er nur einen Blick in seine eigene Vergangenheit getan, in die seltenen, so seltenen Nachmittage, an denen er mit seinem Sohn im Wohnzimmer gesessen und dessen Lieblingsserie geschaut hatte.
Wie auch anders?, sagte sich der alte Kommissar. In diesem Stift wohnten keine Bankräuber und Mörder.
Als er sich schon beinahe entspannt hatte und bereit war, an ein Hirngespinst zu glauben, fing Mauritius Steinberger aus den Augenwinkeln eine rasche Geste auf, ein Winken mit den Fingern, lässig, geringschätzig, beinahe tänzerisch. Wie oft hatte er diese Geste in Verhören bei Quent gesehen, Verhören, in denen sein, Steinbergers, »Ich seh dir bis ins Herz«-Blick nicht das Geringste bewirkt hatte. Ein unbekümmertes, souveränes Wischen war das gewesen, ausgeführt mit der unangezündeten Zigarette zwischen den Fingern, die zu rauchen im Befragungsraum nicht erlaubt war. Die Steinberger nicht zu rauchen erlaubt hatte. Und auch das schien Quent lediglich amüsiert zu haben. Unwillkürlich sprang Steinberger von seinem Stuhl auf. Halb aufgerichtet reckte er den Hals nach dem Urheber dieser Geste. Es war eine Dame mit androgynem Kurzhaarschnitt, großer Brille und einem baumelnden Medaillon vor dem Busen. Ihre langen Finger hielten einen Kugelschreiber, mit dem sie ein Kreuzworträtsel traktierte, unterstützt von ihren Tischgenossinnen. Nicht nur die erstaunten Blicke vom eigenen Tisch trafen Steinberger, der langsam wieder auf seinen Stuhl sank.
»Entschuldigung«, sagte er. »Ich dachte, ich hätte einen Bekannten gesehen.«
»Bekannte gehen ja noch«, meinte die spitznasige Dame links von ihm.
»Genau«, warf der Besserwisser sofort ein. »Schlimm wird es, wenn sie glauben, ihre Eltern zu sehen.«
»Wenn es bei mir so weit ist, hoffe ich, dass ich Claudia Cardinale sehen werde.« Der Siemensianer lachte dröhnend.
Die »Arme« an seiner Seite seufzte, und Mauritius Steinberger begann zu ahnen, dass diese beiden miteinander verheiratet waren. Das Gespräch nahm seinen zögernden Fortgang. Der alte Kommissar entspannte sich. Peter Quent war eine Einbildung.
Ein wenig mehr als das: Er war ein Schreckgespenst. Der einzige Fall, den er nicht gelöst hatte. Der einzige Verbrecher, den er nie hatte verhaften können. Der ihm eine Nase gedreht hatte. Sich aus allem rausgewunden. Ungreifbar. Steinberger würde nie den Moment vergessen, in dem er den tödlichen Unfall an der Bundesstraße bei Lauf und den Bankraub zusammenbrachte. Der Moment, in dem er sich über die Leiche des Jungen gebeugt hatte, von seinem Skateboard gefegt, am Straßenrand liegen gelassen, eine wütende Reifenspur im Grünstreifen, zeugend von der Fahrerflucht. »Wegen Ihrer Gier«, hatte er Quent damals entgegengeschleudert. »Weil Sie die 260.000 in Ihrem Kofferraum nicht aufs Spiel setzen wollten. 260.000 für das Leben eines Kindes.«
»Sie delirieren«, hatte Quent damals gesagt, leicht amüsiert, gelassen. Und irgendwann: »Ich bin nicht Ihr großer, böser Wolf.«
Mauritius Steinberger hatte ihm ins Gesicht gesehen und noch nie in seinem Leben so genau gewusst, dass er eine Lüge hörte. Und nie, nie zuvor hatte ihn der Mensch, der sie erzählte, so sehr abgestoßen. Mauritius Steinberger hasste die Menschen nicht, die er ins Gefängnis brachte. Nicht einmal die Mörder unter ihnen. Warum noch einmal war das bei Quent so anders gewesen? Er müsste in seinen kleinen schwarzen Heften nachschauen, warum er so reagiert hatte. Aber die hatte er nicht mit hierhergenommen. Hier war nur, was er für sein neues Leben brauchte: die Dauerkarte für den Zoo, ein Abonnement des Kicker, eine Wanderkarte für Nürnberg und Umgebung. Seine Hanteln. Seine Klassiker.
»Noch ein Schälchen vom Obstsalat?«
Mauritius Steinberger lehnte ab und ging auf sein Zimmer.
Der Wagen wurde nie gefunden, das Geld ebenso wenig. Peter Quent lebte ein bürgerliches Leben.
Ihn zu vergessen war die einzige Lösung gewesen in all den Jahren. Peter Quent galt als unschuldig vor dem Gesetz. Seine Akte war längst geschlossen. Er ging ihn, Steinberger, nicht mehr das Geringste an. Vielleicht war er schon Jahre tot.
Im achten Stock fand Steinberger seinen Namen am Klingelschild. Hier musste er zu Hause sein. Zum ersten Mal trat er ein, während alles schon an seinem Platz stand und ihn empfing. Das also war nun sein Reich. Hier würde er seine Tage verbringen. Sein neues Leben der Muße. Es war ein Dienstag, daher beschloss er, zu einem Buch zu greifen, um von Anfang an in den richtigen Takt zu kommen. Er hatte nicht auf den Einband geschaut, als er ins Regal langte; der Band war einfach nicht allzu dick gewesen. Steinberger setzte sich zurecht, griff zu seiner Lesebrille, schlug auf, atmete ein und las: »Jemand mußte Josef K. verleumdet haben ...« Der erste Satz berührte ihn unerwartet. Die presseverlautbarungsmäßige Abkürzung des Namens, der juristische Fachbegriff, all das war ihm sehr vertraut. Und gleich im zweiten Satzteil wurde zur Verhaftung des Mannes geschritten. Gut so! Vielleicht war tatsächlich etwas dran an der so viel gelobten Wirkung der Lektüre von Literatur. Andererseits. Steinberger ließ den Band auf die Schenkel sinken. Wie war das damals eigentlich gewesen, als er das erste Mal bei Quent geklingelt hatte? Wohlweislich zu fast noch nachtschlafender Zeit, um den Mann von vornherein in Bedrängnis zu bringen. Keine Köchin. Aber ein Hineinfahren in Hosen. Sehr noble Flanellhosen. Quent besaß keine Jeans; aber das sollte er erst später lernen.
»Das wäre neu.« Hatte Quent nicht etwas ganz ähnlich Ironisches gesagt wie der Held dieses … wie hieß doch das Buch? Er nahm die Lesebrille ab, um den größer gedruckten Namen auf dem Einband entziffern zu können: Der Prozeß. Von einem Franz Kafka. Was war das: ein Gerichtsroman? Die Lebenserinnerungen eines Kriminalers? Er selbst war auch schon aufgefordert worden, seine Memoiren zu schreiben. Es gab Kollegen, die hatten das getan. Nach einigem Nachdenken aber hatte er das Vergessen und das Vergessenwerden vorgezogen. Hatte seine kleinen schwarzen Notizbücher entsorgt. Nicht ganz, musste er zugeben. Sein Blick wanderte hinüber zu der kleinen oberen Schublade in seinem Schreibtisch. Dort lag der Schlüssel zu dem Stauraum, den er angemietet hatte. Für Akten, Papiere. Alles, wovon er sich nicht hatte trennen können, ohne doch damit leben zu wollen. Und warum er beides nicht konnte, darüber wollte er eigentlich nicht nachdenken. Er wusste genau, wie die Kisten aussahen, in dem die Büchlein lagen, nummeriert nach Jahrgängen. Er sah sie alle genau vor sich. Und dabei würde es bleiben. Sechzig Jahre im Dienst der Verbrechensjagd waren genug.
Entschlossen stand Steinberger auf. Er stellte diesen Kafka, der ihm ein Unruhestifter zu sein schien, zurück ins Regal. Griff zu einem Kreuzworträtselheft, zögerte nach einem Blick aus dem Fenster. Noch war sein Übergangstag. Vielleicht war es denkbar, einen Spaziergang durch die örtlichen Grünanlagen zu unternehmen? Im Prospekt waren sie als sehenswert beschrieben worden. Zwar waren Spaziergänge nur für Mittwoch und Freitag vorgesehen. Aber die Orientierung auf dem Gelände mochte als Ausnahme gelten. An einem Übergangstag, beschloss Mauritius Steinberger, waren Unregelmäßigkeiten erlaubt.
Hinunter fuhr er mit dem jetzt leeren Aufzug. Im Erdgeschoss schlenderte er erst eine Weile durch die lange Ladenpassage, die die beiden Wohngebäude miteinander verband. Bank, Supermarkt, Friseur, Reinigung – alles da. Es war eine kleine Welt für sich. Steinberger bewunderte nicht nur das Angebot und die Auslagen, er merkte sich automatisch auch Details wie Öffnungszeiten, Räumlichkeiten, Notausgänge, Fluchtwege. Und er hatte, ohne das ausdrücklich zu wollen, schnell eine ziemlich klare Vorstellung davon, was sich wo in den Kassen befand und wie alles gesichert war. Aus den Augenwinkeln nahm er wahr, wo die Kameras hingen, die Feuerlöscher, die Alarmknöpfe. Sollte hier je ein Verbrechen begangen werden: Er hatte die möglichen Szenarien dafür bereits im Kopf. Einem weniger korrekten Menschen als ihm hätte der Gedanke kommen können, dass er auf seine alten Tage genauso gut die Seiten wechseln und als Gangster agieren könnte. Und ein humorvollerer Mann als er hätte sich die Möglichkeiten dieses Szenarios vielleicht mit Genuss ausgemalt. Steinberger allerdings war ein überaus korrekter Mensch, der nicht dazu neigte, sich gehen zu lassen oder seltsamen Vorstellungen nachzuhängen. So machte er sich im Kopf nur eine Notiz, für die Heimleitung eine Liste mit Sicherheitsmängeln und Verbesserungsvorschlägen aufzustellen. Vielleicht könnte er einen entsprechenden Vortrag dazu halten? Der Konzertsaal hier hatte bekanntlich eine ausgezeichnete Akustik. Mauritius Steinberger verschob das Vorhaben auf unbestimmte Zeit. Er war ein Mann an einem Übergangstag. Was er morgen wäre, war noch ungewiss.
Er schritt ins Freie.
3
Der alte Kommissar mied die üppigen Rosenbeete, von denen manche noch immer blühten, und auch die japanische Bogenbrücke, auf der einige Bewunderer verweilten. Er suchte abgelegenere Wege. Einmal sah er Halbprofil und Schulter eines Mannes, der seinem Vater ähnlich sah, um die Ecke verschwinden und erschrak. Ein andermal leuchtete von Weitem ein rot kariertes Hemd, wie sein erster Chef es gerne getragen hatte. Er wischte den Eindruck weg wie eine Altweiberspinnwebe, doch lästig wie diese blieb er kleben. Was, überlegte Mauritius Steinberger, wenn seine Tischnachbarn recht hatten und er begann, Gespenster zu sehen? Peter Quent war vielleicht nur der Erste gewesen. Was, wenn er umgeben war von Gespenstern seiner Vergangenheit, die ihm nun nach und nach erschienen? All die Verurteilten, die Verfolgten und Verbitterten – wenn sie alle nur darauf gewartet hatten, dass er aufhörte zu arbeiten, zu laufen, blind weiterzumachen, um ihn jetzt einzeln und in Grüppchen aufzusuchen und zur Rede zu stellen? Die Vergessenen, die Rachsüchtigen, die, die seine Beute geworden waren? Was, wenn er um die nächste Baumgruppe herumginge und dort, zierlich und in Gelb, seine Frau mit dem müden Blick stünde und den Mund öffnete, um ihm zu sagen, was sie nie gesagt hatte?
Ich habe mir nichts vorzuwerfen, sagte sich Mauritius Steinberger und öffnete seine Strickweste, denn ihm wurde warm, trotz der mäßigen Temperaturen an diesem schönen Spätsommertag. Es gab keine Gespenster. Er wurde auch nicht dement, wie seine Besucherin mit dem Rollator. Er war einfach nur alt und hatte zu viel gesehen. Da wurde jeder Mensch zu einem Typus, einem aus einer Reihe, deren Merkmale man schon kannte. Es gab einfach nichts Neues mehr.
»Mauritius? Mauritius Steinberger?«
Steinberger fuhr herum und starrte entgeistert in das vertraute Gesicht. Abwehrend hob er die Hand. Doch es wich nicht zurück und verwandelte sich auch nicht. Es handelte sich auch um kein Gespenst, keine Vision, nein, es war unabweislich vorhanden. Alle seine Theorien wurden hinfällig.
Er stand vor seiner früheren Hausärztin. Eigentlich Brigittes Ärztin, korrigierte er sich; er selbst war nie krank gewesen, beinahe nie. Brigittes wegen allerdings hatte er die Praxis oft aufgesucht. Er erinnerte sich gut an die Gespräche, die sie zu dritt geführt hatten, zwischen seinen vielen Auslandsaufenthalten, um zu klären, wie sie mit Brigittes zurückgekehrtem Krebs umgehen sollten, der Chemo, den Diäten, den Jahren des Wartens. Er wusste noch, wie quälend diese Sitzungen gewesen waren, das gedämpfte Licht im Zimmer, die drückende Hoffnungslosigkeit, Brigittes leises Weinen, nichts, was man hätte tun können, um alles zu lösen. Sie, Frau Doktor Hohoff, war der einzige Lichtblick gewesen, der einzige Grund, warum er nicht aufgesprungen und hinausgerannt war.
Gesagt hatte er ihr das nie. Er erinnerte sich nicht, überhaupt je ein privates Wort mit ihr gesprochen zu haben. Er erinnerte sich vage an ihr angenehm beherrschtes Wesen, ihre abwartende Gelassenheit, eine Stimme, die nach Zigaretten und Whisky klang, als gäbe es ein Leben jenseits des weißen Kittels, jenseits dieser Misere hier, in das er aber keinen Einblick erhielt. Irgendwann waren sie dann umgezogen. Brigitte hatte, soweit er wusste, den Kontakt bis zu ihrem Tod gehalten, mit Weihnachtskarten und Urlaubsgrüßen.
Frau Doktor Hohoff war ungewöhnlich groß für eine Frau, eher knochig als schlank; in ihrem Sessel versunken, hatte sie über ihre hohen Knie hinweg zu dem Ehepaar Steinberger hinübergeblickt. Sie hatte damals schon ungefärbtes, jetzt endgültig weißes, langes Haar, das sie in einem Nackenknoten trug. Er konnte sie sich in Gummistiefeln bei der Gartenarbeit vorstellen. Ihre großen Augen dominierten das faltige Gesicht. Das einst scharf leuchtende Blau war milchig geworden, was sie aber insgesamt weicher aussehen ließ. Ja, es schien ihm, als strahle die ganze Frau ein mildes Licht aus. Mauritius Steinberger begann, eine Ahnung davon zu bekommen, was morgen sein könnte.
»Jetzt also auch auf der Insel der Seligen?«, fragte sie nach der Begrüßung.
Er lachte sonor als Bestätigung.
»Oh, entschuldigen Sie, mein Beileid«, fügte sie hinzu, als ihr einfiel, warum er hier war. »Ich habe einen Kranz zur Beerdigung geschickt.«
Er nickte, als erinnere er sich daran. »Ein wunderbarer Park«, stellte er dann fest. »Gehen Sie oft hier spazieren?«
Sie ließ ein, zwei Sekunden verstreichen, ehe sie antwortete. Ihr Blick ruhte dabei auf ihm, wie damals, sanft taxierend. Aber nicht wertend. »Jeden einzelnen Tag«, erwiderte sie dann. »Es ist eine Gnade.«
Gnade, das war kein Wort, das er zu verwenden pflegte. Er lachte erneut, verlegen. »Es ist wohl eher das Resultat guter Gene und Gewohnheiten.«
»Wir sind alle auf ein Stück Gnade angewiesen«, erwiderte sie. Ihr Blick hielt ihn noch immer, doch er spürte, wie sich etwas, was darin gewesen war, leise vor ihm verschloss. Zu seiner Überraschung versetzte ihn das in eine leichte Panik.
»Nun ja, vielleicht erweisen Sie mir ja einmal die Gnade eines gemeinsamen Spaziergangs«, entfuhr es ihm zu seinem eigenen Erstaunen. »Vielleicht zum Valznerweiher, in das Insellokal?«
»Vielleicht«, sagte sie.
Er zog es vor, ihren Ton nicht zu interpretieren. Er wusste nicht, was in ihn gefahren war. Er war ausgebucht, montags bis freitags. Er hatte einen Plan, bei dem er bleiben sollte. »Vielleicht an einem Wochenende«, hörte er jemanden sagen, der er selbst sein musste. Sein Gesicht dabei war gequält; er war es nicht gewohnt, sich als Trottel zu sehen.
»Vielleicht«, echote sie wiederum. Machte sie sich etwa über ihn lustig?
Wie zur Bestätigung ertönte ein Lachen von hinter der Hecke. Es gehörte zu einem Mann, der jetzt auf den Weg und zu ihnen trat. Mauritius Steinberger wurde es mit einem Schlag kalt und hohl zumute. Dann flammte Hitze in ihm auf. Er kannte dieses Lachen: laut, raumgreifend, aufmerksamkeitsheischend.
»Peter Quent«, presste er hervor.
Der Mann stellte sich neben die Ärztin, vertraulich nah, wie Steinberger registrierte. Noch immer war er ausgesucht gepflegt gekleidet, mit einem handgenähten Hemd, Anzughosen und Jackett und, Steinberger ignorierte es, gestreiften Socken im selben dezenten Rosa, das seine Krawatte zierte. Was für eine perfekte, zynische Maskerade. Steinberger dachte an den Jungen mit dem Skateboard und unterdrückte eine leichte Übelkeit.
Quent musterte ihn mit freiem Blick, gelassen, die Hände in den Hosentaschen, wie es seine Art war. Für unbefangene Unschuld hatten die meisten dieses Benehmen gehalten. Steinberger wusste es besser: Es war ungenierter Egoismus, eine Ungeniertheit dämonischen Ausmaßes, die nichts kannte als sich selbst. Die nichts dabei fand, wenn Menschenleben ihr zum Opfer fielen. Er war überzeugt davon, dass Quent sich selbst im Innersten für unschuldig hielt. Weil es in Quents Augen kein Verbrechen war, wenn andere für sein Wohlergehen leiden mussten. Jetzt wusste Steinberger auch wieder, warum er den Mann hasste, der gerade seine Hand zur Begrüßung auf den Arm von Frau Hohoff legte und sie Isolde nannte und, mit amüsiertem Zwinkern in Richtung Steinberger: »Meine Gnädigste.«
Der Kommissar setzte eine steinerne Miene auf.
»Und ich dachte schon«, sagte Peter Quent, »Sie erkennen mich am Ende gar nicht mehr.«
4
»Ich glaube, ich verliere den Verstand. Oder aber die Welt wird verrückt. Neulich sagte der Kaminkehrer aus heiterem Himmel zu mir: ›Zieh dich aus.‹ Ich habe mit dem Gehstock ausgeholt und ihn erschlagen. Es war Notwehr. Was gedenken Sie zu unternehmen?«
Die Pressereferentin des Stifts, Martina Hinterbauer, schaute die zarte alte Frau mit dem goldenen Perückenhelm an, die ihr auf ihren Rollator gestützt diesen Vortrag hielt, und seufzte. Es war wirklich an der Zeit, dass sie für Frau Sörgel einen Platz im Demenzbereich des Stiftes fanden. Sie hatten schon genug mit dem Tod zu tun, auch ohne dass dauernd jemand Leichen dazuerfand. Sie hatte mit diesen Themen im Grunde gar nichts zu tun. Das hier war ein Fall für ihre Kollegen von der Pflege. Noch dazu mitten in der Ladenpassage, wo jeder es hören konnte. Aber sie durfte sich vor den möglichen Zuhörern unter den Passanten keine Blöße geben.
»Meine Liebe«, versuchte sie es, da die Dame nun einmal vor ihr stand, »in den Stifts-Appartements verkehren keine Kaminkehrer. Allerdings gibt es einen Etagenbetreuer, Mikael, Sie kennen ihn«, sagte sie mit mildem Tadel in der Stimme. »Mikael hat ein blaues Auge und eine Aufschürfung an der Schläfe und ist sehr traurig, dass Sie sich nicht von ihm den Blutdruck messen lassen wollten.« Was die Referentin nicht sagte, war, dass Mikael aus Eritrea kam. Rassismus war kein Problem, das es in ihrem Stift gab.
Sie redete weiter, doch es gelang ihr nicht, Frau Sörgel zu beruhigen, das konnte sie an deren Gesicht sehen. Dort zeichneten sich andere Gedanken ab, in ihrem verwirrten Hirn entstand schon eine neue, abwegige Geschichte, vielleicht: Neulich zeigte ich einen Mord bei der Polizei an. Die Kommissarin glaubte mir nicht. Sie sagte nur, es gebe keine Mafia, und lächelte auf eine besondere Weise, die mir klarmachte, dass ich die Nächste wäre. Deshalb musste ich sie leider töten.
Die Hand der alten Dame kratzte und rupfte am Rollatorgriff. Das Zittern wanderte ihren Arm hinauf. Die Referentin griff nach dem Notfallsendegerät in ihrer Tasche, dessen Existenz sie stets leugnen würde.
»Was machen Sie da?«, krähte Frau Sörgel alarmiert. »Was ist da in Ihrer Tasche?«
»Nichts«, erwiderte Frau Hinterbauer und lächelte.
Als zwei Pfleger gekommen und Frau Sörgel mit freundlich ablenkenden Worten in ihr Zimmer zurückgeführt hatten, trat sie an eines der Panoramafenster. Was für eine schöne Anlage, was für ein schönes Haus. Alles war friedlich, alles kultiviert. Es gab Konzerte, Ausstellungen, Tanzabende, Vorträge. Tote Kaminkehrer hingegen nicht. Gestorben wurde zwar genug, vor allem in der stationären Abteilung. Aber das war erwartbar in einem Altenstift und sie gingen professionell damit um. Leise, hygienisch und mit Pietät. Es dauerte keinen Tag, dann war das Zimmer geleert; sie erledigten das unauffällig während der Spätschicht. Niemand, der nicht wollte, brauchte etwas von dem Sterben ringsum mitzubekommen. Für die, die wollten, wurden kleine Gesprächsrunden angeboten, mit Kerzen und Tüchern auf dem Tisch und einer Pastorin, die über Trauer sprach, doch sie waren schlecht besucht. Jeder konzentrierte sich lieber auf das Leben, das ihm selbst noch blieb. Die Pressereferentin wandte sich vom tröstlichen Anblick des Gartens ab. Nein, sie brauchten wirklich keine zusätzlichen Leichen. Sie ging zurück an ihren Tisch und machte sich eine Notiz, dass ihre Kollegin von der Pflege mit Frau Sörgels Ärztin über eine neue Medikation sprechen sollte.
»Entschuldigen Sie, meine Dame.«
Sie betrachtete den Nähertretenden mit höflich kaschiertem Misstrauen, bis sie den Neuzugang erkannte: »Herr Steinberger, wie nett. Haben Sie sich denn schon eingelebt?«
Der alte Herr ihr gegenüber zeigte nur leichte Anzeichen von Schmerzen. Die Knie, diagnostizierte sie in Gedanken, vermutlich ein künstliches Hüftgelenk. Trotzdem noch immer eine imponierende Gestalt. Sie hatte irgendwo gehört, er habe einen schwarzen Gurt. Sein grauer Raubvogelblick war wach, das zerklüftete Gesicht mit den tiefen, fast stehenden Falten von der Nase zu den Mundwinkeln wirkte asketisch. Ohne wie ein Naturbursche auszusehen, hatte er doch die geerdete, ein wenig rohe Ausstrahlung von jemandem, der in seinem Leben viel draußen unterwegs gewesen war. »Haben Sie sich denn schon mit unserem Kulturangebot vertraut gemacht?«
»Ich spreche Sie wegen der Dame an, die Sie eben aufgesucht hat.«
Die Pressereferentin hob die Brauen. »Frau Sörgel? Richtig, sie wohnt auf Ihrem Gang. Sie hat Sie doch nicht belästigt? Frau Sörgel braucht im Moment unser aller Nachsicht und Geduld.«
Der Kommissar beruhigte sie. »Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man ihre Aussagen nicht völlig abtun darf. Gestern beispielsweise erklärte sie mir, dass in dem Blumenbeet unter ihrem Fenster eine Leiche gelegen habe. Ich habe mir daraufhin erlaubt, das besagte Beet in Augenschein zu nehmen.«
»Es tut mir wirklich leid«, fiel die Pressereferentin ihm ins Wort. »Frau Sörgel ist leider bekannt dafür, ein wenig beeinträchtigt zu sein. Wir alle kennen sie schon sehr lange und tragen ihre Launen mit Geduld. Aber es wird in der Tat Zeit, nach adäquateren Betreuungsmöglichkeiten für sie Ausschau zu halten.« Als sie seinen unbewegten Gesichtsausdruck sah, fuhr sie fort: »Ich möchte Ihnen versichern, dass es in unserem Stift natürlich noch nie eine Leiche im Blumenbeet gegeben hat und …« Sie verstummte gequält. Waren denn heute alle Irren verschworen, ihr über den Weg zu laufen? Ihr schweifender Blick fiel auf einen Mann mit Krücke und Rucksack, so prallvoll gepackt, dass er schon fast wie eine Karikatur wirkte. Frau Hinterbauer fühlte sich müde.
»Ich war Polizeibeamter«, erinnerte Steinberger sie, als könnte er ihre Gedanken lesen.
Du bist alt, dachte sie prompt und sagte schnell, ehe er ihr auch diesen Gedanken vom Gesicht ablas: »Wildschweine. Wir hatten schon ein paarmal Probleme mit Wildschweinen auf dem Gelände. Sie kommen aus dem Reichswald und machen sich über die Grünanlagen her. Das ist schwer zu verhindern.«
Er hatte den Kopf schräg geneigt und fragte, ohne auf ihre Worte einzugehen. »Hatten Sie viele Diebstahlsfälle in der letzten Zeit?«
»Diebstahl?«, entgegnete sie entrüstet. »In unserem Stift gab es seit Jahren keinen solchen Fall.« Sie fächerte sich Luft zu. »Wie kommen Sie nur darauf?«
»Kein verschwundener Schmuck? Kein vermisstes Bargeld? Ich könnte mir denken, dass es sehr geschickt angestellt wurde. Von einer Persönlichkeit, die sich darauf versteht, vertrauensselige Menschen auszunutzen.«
»Was wollen Sie damit andeuten?«, fuhr sie auf. Sein Blick ließ sie wieder ein wenig kleiner werden.