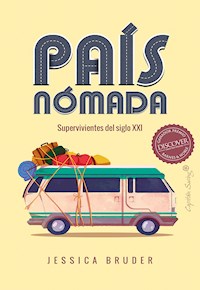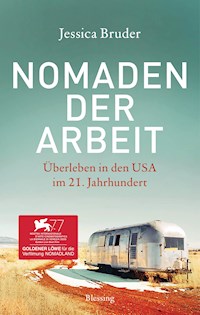
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Verfilmung »Nomadland« von Oscar-Preisträgerin Frances McDormand ausgezeichnet mit dem Goldenen Löwen
Zehntausende Menschen in Amerika sind unterwegs. Sie leben in Wohnmobilen, Vans, Anhängern. Übernachten auf Supermarkt-Parkplätzen, neben den Highways, in der Wüste. Sie schaufeln Zuckerrüben in North Dakota, reinigen Toiletten in den Nationalparks von Kalifornien, arbeiten Zwölf-Stunden-Schichten im Amazon-Versandzentrum im winterlichen Texas. Eines haben sie oft gemeinsam: Sie sind alt. Und im 21. Jahrhundert, erschüttert von der Finanzkrise der Zehnerjahre, ist ihnen der Boden für den sprichwörtlich wohlverdienten Ruhestand weggebrochen. Deshalb ziehen sie als Nomaden der Arbeit von einem saisonalen Tageslohnjob zum nächsten.
Jessica Bruder hat sich ihnen ein Jahr lang angeschlossen und ist diesem Treck durch ganz Amerika gefolgt. Eine nachhallende Reportage über Ausbeutung, Ungerechtigkeit und prekäre Lebensumstände, aber auch über altersweise Beharrlichkeit, Sinn für Gemeinschaft und Abenteuer, wie sie nur ein amerikanischer Highway versprechen kann.
- Ausgezeichnet mit dem Goldenen Löwen auf den Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2020
- »Ein überwältigendes und großartig geschriebenes Buch, das an John Steinbecks Früchte des Zorns denken lässt.« (The New York Times)
- Ein „Buch des Jahres“ der New York Times, ausgezeichnet mit dem Discover Great New Writers Award.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ZUM BUCH
Zehntausende Menschen in Amerika sind unterwegs. Sie leben in Wohnmobilen, Vans, Anhängern. Übernachten auf Supermarkt-Parkplätzen, neben den Highways, in der Wüste. Sie schaufeln Zuckerrüben in North Dakota, reinigen Toiletten in den Nationalparks von Kalifornien, arbeiten Zwölf-Stunden-Schichten im Amazon-Versandzentrum im winterlichen Texas. Und sie haben eines gemeinsam: Sie sind alt. Der American Dream hat für sie Bingo-Spielen und Gartenpflege vorgesehen. Doch im 21. Jahrhundert, erschüttert von der Finanzkrise der Zehnerjahre, ist der Boden für den sprichwörtlich wohlverdienten Ruhestand weggebrochen. Deshalb ziehen sie als Nomaden der Arbeit von einem saisonalen Tageslohnjob zum nächsten.
Eine nachhallende Reportage über Ausbeutung, Ungerechtigkeit und prekäre Lebensumstände, aber auch über altersweise Beharrlichkeit, Sinn für Gemeinschaft und Abenteuer, wie sie nur ein amerikanischer Highway versprechen kann.
ZUR AUTORIN
Jessica Bruder war als Professorin an der Columbia Graduate Journalism School tätig, Schwerpunkte ihrer journalistischen Arbeit sind subkulturelle und wirtschaftlich-soziale Phänomene. Ihr Leitartikel »The End of Retirement« im Harper’s Magazine, Basis dieses Buches, wurde mit dem Aronson Award for Social Justice Journalism ausgezeichnet, sie veröffentlicht darüber hinaus u.a. in The New York Times Magazine,The Washington Post und The International Herald Tribune. Ihr preisgekröntes Buch Nomaden der Arbeit erregte landesweites und internationales Aufsehen. Bruder lebt in Brooklyn, New York City.
Jessica Bruder
NOMADEN
DER
ARBEIT
Überleben in den USA
im 21. Jahrhundert
Aus dem Amerikanischen von
Teja Schwaner und Iris Hansen
Blessing
Originaltitel: Nomadland – Surviving America in the Twenty-First Century
Originalverlag: W.W. Norton & Company, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Jessica Bruder
Copyright © 2019 by Karl Blessing Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin,
nach einem Entwurf von Pete Garceau
unter Verwendung eines Bildes von
© Eugenia Maximova/Anzenberger/Redux
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-22768-5V002
www.blessing-verlag.de
Für Dale
»Alles hat irgendwo einen Riss.
So fällt das Licht herein.«
Leonard Cohen
»Die Kapitalisten wollen nicht,
dass irgendjemand außerhalb ihres
wirtschaftlichen Versorgungsnetzes lebt.«
Anonymer Kommentar,
azdailysun.com
INHALT
VORWORT
TEIL EINS
1 DER SQUEEZE INN
2 DAS ENDE
3 AMERIKA ÜBERLEBEN
4 FLUCHTPLAN
TEIL ZWEI
5 AMAZON TOWN
6 THE GATHERING PLACE
7 DAS RUBBER TRAMP RENDEZVOUS
8 HALEN
9 EIN PAAR R-ÜBERRAGENDE ERLEBNISSE
TEIL DREI
10 DAS O-WORT
11 NACH HAUSE
CODA – DER OKTOPUS IN DER KOKOSNUSS
DANKSAGUNG
ANMERKUNGEN
VORWORT
Während ich schreibe, sind sie im ganzen Land unterwegs.
IN DRAYTON, NORTH DAKOTA, verdingt sich ein siebenundsechzig Jahre alter ehemaliger Taxifahrer aus San Francisco als Helfer bei der alljährlichen Zuckerrübenernte. Von Sonnenauf- bis nach Sonnenuntergang arbeitet er bei Temperaturen, die unter den Gefrierpunkt fallen. Er hilft den Trucks, die laufend von den Feldern angerollt kommen, ihre Ladung von mehreren Tonnen Zuckerrüben abzuwerfen. Nachts schläft er in dem Van, der sein Zuhause wurde, als Uber ihn aus der Taxibranche drängte und er sich die Miete für seine Wohnung nicht mehr leisten konnte.
In Campbellsville, Kentucky, verstaut eine sechsundsechzig Jahre alte ehemalige Bauleiterin Waren während der Nachtschicht in einem Amazon-Lager und schiebt dabei einen Rollwagen meilenweit über den Betonboden. Die Arbeit ist todlangweilig, und sie bemüht sich verzweifelt, jedes Teil korrekt einzuscannen, um ja nicht gefeuert zu werden. Morgens kehrt sie in ihren winzigen Trailer zurück, mit dem sie in einem von mehreren Wohnmobil-Parks steht, die Amazon für Nomadenarbeiter wie sie angemietet hat.
In New Bern, North Carolina, nutzt eine Frau, die ansonsten in einem Teardrop-Trailer wohnt, der so klein ist, dass er von einem Motorrad gezogen werden kann, das Couchsurfing-Angebot eines Freundes, während sie auf Arbeitssuche ist. Trotz ihres Master-Abschlusses findet die aus Nebraska stammende Achtunddreißigjährige keinen Job. Sie weiß, dass für die Zuckerrübenernte noch Leute gesucht werden, aber durchs halbe Land zu reisen, würde mehr Bargeld erfordern, als sie besitzt. In den Trailer ist sie unter anderem umgezogen, weil sie vier Jahre zuvor ihren Arbeitsplatz verloren hat. Nachdem ihre Stelle bei einer gemeinnützigen Organisation gestrichen wurde, konnte sie neben den Raten für die Rückzahlung des Studentendarlehens nicht auch noch die Miete bezahlen.
In San Marcos, Kalifornien, betreibt ein Paar in seinen Dreißigern, das in einem GMC-Wohnmobil, Baujahr 1975, lebt, am Straßenrand einen Kürbisstand mit Kinderkarneval und Streichelzoo, den sie auf einem unbefestigten Platz innerhalb von fünf Tagen aus dem Nichts aufbauen mussten. In wenigen Wochen werden sie auf den Verkauf von Weihnachtsbäumen umsteigen.
In Colorado Springs, Colorado, erholt sich ein zweiundsiebzig Jahre alter vandweller – die Bezeichnung für Leute, die in ihrem »Van« (einem ausgebauten Lieferwagen) wohnen – bei Verwandten von einem dreifachen Rippenbruch, den er sich bei einem Instandsetzungsjob auf einem Campingplatz zugezogen hat.
Wanderarbeiter, Landstreicher, Vagabunden, rastlose Seelen hat es immer gegeben. Heute jedoch, im dritten Jahrtausend, entsteht eine neue Art umherziehendes Volk. Leute, die sich nie haben vorstellen können, Nomaden zu sein, machen sich auf den Weg. Sie geben ihre traditionellen Häuser und Wohnungen auf, um in etwas zu leben, das in Anspielung auf real estate, den englischsprachigen Ausdruck für Immobilie, auch scherzhaft als wheel estate bezeichnet wird – Vans, gebrauchte Wohnmobile, Schulbusse, Pick-ups mit Campingaufbauten, Trailer und einfache alte Limousinen. Hinter sich lassen sie Situationen, die sie als Angehörige einer einst als Mittelschicht bezeichneten Bevölkerungsgruppe vor unmögliche Entscheidungen stellen. Entscheidungen wie zum Beispiel:
Möchten Sie lieber etwas zu essen oder Zahnersatz? Ihre Hypothek abzahlen oder die Stromrechnung begleichen? Ein Auto finanzieren oder Medikamente kaufen? Die Miete oder die Rate fürs Studentendarlehen bezahlen? Warme Kleidung anschaffen oder tanken, damit Sie zur Arbeit pendeln können?
Die Antwort erschien vielen zunächst radikal.
Da man sich nicht selbst eine Gehaltserhöhung geben kann, drängt sich der Gedanke auf, die größte aller Ausgaben zu reduzieren. Warum nicht das bürgerliche Domizil gegen ein Leben auf Rädern eintauschen?
Manche nennen sie »homeless«. Aber die modernen Nomaden lehnen diese Titulierung ab. Ausgestattet mit Obdach und Transportmittel, wie sie sind, ziehen sie eine andere Wortschöpfung vor: Sie bezeichnen sich schlicht und einfach als »houseless«.
Aus der Ferne betrachtet, könnten viele von ihnen irrtümlich für Rentner gehalten werden, die sorglos im Wohnmobil umherreisen. Wann immer sie sich einen Kinobesuch oder ein Essen im Restaurant gönnen, fallen sie in der Menge nicht weiter auf. Was Geisteshaltung und Erscheinung betrifft, gehören sie weitgehend zur Mittelschicht. Sie waschen ihre Kleidung in Waschsalons, werden Mitglieder in Fitnessstudios, um dort duschen zu können. Viele verließen ihre festen Wohnungen, nachdem die »Great Recession«, die Weltwirtschaftskrise, ihre Ersparnisse verschlungen hatte. Um Benzintanks und Bäuche zu füllen, verrichten sie in langen Schichten harte körperliche Arbeit. In Zeiten von Niedriglöhnen und steigenden Wohnkosten haben sie sich von Mieten und Hypotheken befreit, um über die Runden zu kommen. Sie überleben in den USA.
Aber genau wie jeder andere wollen sie mehr als nur überleben. Was als letzter Ausweg begann, ist zu einem Kampf um etwas Größeres geworden. Menschsein bedeutet, nach mehr zu streben als nur dem Auskommen. Ebenso dringend wie Nahrung und Obdach braucht der Mensch Hoffnung.
Und auf der Straße gibt es immer Hoffnung. Sie ist eine Art Nebenprodukt der Vorwärtsbewegung. Solange man unterwegs ist, erscheinen die Möglichkeiten so unbegrenzt wie das Land weit. Man bewahrt sich die feste Überzeugung, dass etwas Besseres kommen wird. Es liegt direkt vor uns: die nächste Stadt, der nächste Job, die nächste Begegnung mit einem Fremden wird es mit sich bringen.
Natürlich sind einige dieser Fremden ebenfalls Nomaden. Wenn sie sich treffen – online, bei einem Job oder beim Campen weit entfernt vom öffentlichen Versorgungsnetz –, formieren sich allmählich »Sippen«. Es herrscht gegenseitiges Verständnis, wie in einer Art Verwandtschaft. Geht ein Van kaputt, wird für den Besitzer gesammelt. Sie lassen sich von einem Gefühl anstecken: Hier findet etwas Großes statt. Das Land verändert sich schnell, alte Strukturen brechen weg, und sie befinden sich im Epizentrum von etwas Neuem. Mitten in der Nacht und ums Lagerfeuer versammelt, kann sich das anfühlen wie ein flüchtiger Blick ins Utopia.
Während ich diese Zeilen schreibe, ist Herbst. Der Winter lässt nicht mehr lange auf sich warten. Bald stehen in der Saisonarbeit die alljährlichen Entlassungen an. Die Nomaden werden ihre Lager abbrechen und zu ihrem eigentlichen Zuhause zurückkehren, auf die Straße. Werden sich wie Blutkörperchen durch die Venen des Landes fortbewegen. Sich auf die Suche nach Freunden oder Angehörigen machen oder auch nur nach einem Ort, an dem es warm ist. Manche werden quer durch den Kontinent reisen. Alle werden die Meilen zählen, die sich abspulen wie ein Filmstreifen mit Eindrücken von Amerika: Fast-Food-Läden und Einkaufszentren. Unter Frost schlummernde Felder. Autohändler, Megakirchen und 24-Stunden-Restaurants. Konturlose Weiten. Viehmastanlagen, stillgelegte Fabriken, Trabantenstädte und Kaufhäuser. Schneebedeckte Gipfel. Die Landschaft fliegt vorbei, den ganzen Tag, bis in die Dunkelheit hinein, bis die Müdigkeit einsetzt. Mit schläfrigem Blick suchen sie sich einen Ort, wo sie sich abseits der Route erholen können. Auf Walmart-Parkplätzen. In ruhigen Straßen von Vororten. Auf Raststätten, wo leerlaufende Motoren ihr Wiegenlied singen. In den Morgenstunden dann, bevor irgendjemand etwas bemerkt, sind sie schon wieder auf dem Highway. Fahren weiter und sind sich einer Sache sicher:
Das letzte Stückchen Freiheit in Amerika ist ein Parkplatz.
TEIL EINS
1 DER SQUEEZE INN
Auf dem Foothill Freeway, etwa eine Stunde landeinwärts von Los Angeles, taucht über dem Verkehr in Richtung Norden eine Bergkette auf, die den ausgedehnten Vorstädten jenseits der Stadt ein abruptes Ende setzt. Dieses Stück Wildnis ist der südliche Rand der San Bernardino Mountains, den Worten des United States Geological Survey zufolge ein »hoher Steilhang«.1 Er ist Teil einer Formation, die sich vor elf Millionen Jahren entlang des San Andreas Fault zu erheben begann und wegen der pazifischen und nordamerikanischen Kontinentalplatten, die sich eng aneinander vorbeischieben, auch heute noch an Höhe gewinnt.2 Fährt man direkt darauf zu, scheint der Bergkamm sogar abrupt in die Höhe zu schießen. Bei seinem Anblick richtet man sich automatisch im Sitz auf, und eine Empfindung im Brustkorb wird zunehmend intensiver, ein Gefühl, als würde sich dort Helium ansammeln, so viel vielleicht, dass es einen davontragen könnte.
Linda May umklammert ihr Lenkrad und betrachtet durch die Gleitsichtgläser ihrer rosafarbenen Brille die näher kommenden Berge.3 Das silbergraue, mehr als schulterlange Haar ist mit einer Plastikspange nach hinten gebunden. Sie biegt vom Foothill Freeway auf den Highway 330 ab, der auch unter dem Namen City Creek Road bekannt ist. Ein paar Meilen noch verläuft die Straße flach und breit. Dann verjüngt sie sich zu einer steilen Serpentine mit nur einer Fahrbahn in jeder Richtung und macht sich daran, den San Bernardino National Forest zu erklimmen.
Die fünfundsechzig Jahre alte Großmutter fährt einen Jeep Grand Cherokee Laredo, der sein Dasein mit Totalschaden und ausgeschlachtet auf einem Autoschrottplatz gefristet hatte, bevor sie ihn kaufte. Die Motorkontrollleuchte zickt – sie hat die Angewohnheit aufzuleuchten, obwohl es kein Problem gibt –, und bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass die Lackierung der Motorhaube, die eingedrückt war und ersetzt werden musste, vom Rest der Karosserie um einen halben Farbton abweicht. Aber nach Reparaturarbeiten, die sich über Monate hingezogen haben, ist das Auto schließlich straßentauglich. Ein Mechaniker hat eine neue Nockenwelle samt Stößel eingebaut. Linda hat ihn so gut wie möglich aufpoliert, die trüben Scheinwerfergläser mit einem alten T-Shirt und Insektenabwehrmittel gereinigt – ein Do-it-yourself-Trick. Jetzt zieht der Jeep zum ersten Mal ihr Heim: einen winzigen, blassgelben Trailer, den sie »Squeeze Inn« nennt. (Gästen, die diese Anspielung auf den begrenzten Platz nicht auf Anhieb verstehen, hilft sie auf die Sprünge: »Ja, es gibt genügend Platz, squeeze in, quetsch dich rein.« Dabei schmunzelt sie und zeigt ihre tiefen Lachfalten.) Der Trailer ist ein Relikt aus Glasfaserguss, ein Hunter Compact II, Baujahr 1974, der seinerzeit als »die Krönung des Reisevergnügens« beworben wurde: »Folgt auf freier Straße treu wie ein Kätzchen, bewegt sich, wenn es hart auf hart kommt, flink wie ein Tiger.«4 Vier Jahrzehnte später wirkt der Squeeze Inn wie eine Überlebenskapsel in charmantem Retro-Look: ein Kasten mit gerundeten Ecken und schrägen Seitenwänden, dessen Form an Styroporbehälter zum Aufklappen erinnert, wie sie einst in Hamburgerläden verwendet wurden. Der Innenraum entspricht mit einer Länge von etwa drei Metern in seinen Abmessungen ungefähr denen des Planwagens, mit dem Lindas Ur-Ur-Urgroßmutter mehr als hundert Jahre zuvor durchs Land gereist ist. Er besitzt einige typische Merkmale aus den Siebzigerjahren: Wände und Decke sind mit gestepptem cremefarbenem Kunstleder verkleidet, der Boden ist mit senfgelb und avocadogrün gemustertem Linoleum ausgelegt. Das Dach reicht gerade so hoch, dass Linda aufrecht stehen kann. Nachdem sie den Trailer bei einer Auktion für 1 400 Dollar erstanden hatte, beschrieb sie ihn auf Facebook: »Der Innenraum ist 1,60 Meter hoch, ich bin 1,50«, schrieb sie. »Passt perfekt.«
Linda schleppt den Squeeze Inn hinauf zum Hanna Flat, einem Campingplatz im Kiefernwald nordwestlich des Big Bear Lake. Es ist Mai, und sie will bis September dort bleiben. Aber im Gegensatz zu den Schönwetterbesuchern, die im San Bernardino National Forest – einem wilden Landstrich, der größer ist als Rhode Island – alljährlich zu Tausenden ihre Freizeit verbringen, pilgert Linda hierher, um zu arbeiten.
Es ist bereits ihr dritter Sommer als Campingplatz-Host: ein Saisonjob, der sie zu Hausmeisterin, Kassiererin, Platzwartin, Wachfrau und Begrüßungskomitee in einer Person macht. Linda freut sich, dass der Job bald beginnt. Und sie freut sich über die alljährliche Lohnerhöhung um 50 Cent, die sie als Angestellte im dritten Jahr bekommt und die sie auf einen Stundenlohn von 9,35 Dollar hochstuft. (Zu der Zeit lag der Mindestlohn in Kalifornien bei 9 Dollar die Stunde.) Zwar wird sie genau wie andere Campingplatz-Hosts »auf unbestimmte Zeit« eingestellt – sodass ihr jederzeit fristlos gekündigt werden kann, ohne Begründung –, aber man hat ihr eine volle 40-Stunden-Woche in Aussicht gestellt.
Leute, die den Job als Campingplatz-Host zum ersten Mal ausüben, träumen von bezahlten Ferien im Paradies. Wer könnte es ihnen verdenken? Schließlich sind die Stellenanzeigen für diese Jobs gespickt mit Fotos von glitzernden Flussläufen und wildblumenübersäten Wiesen. Eine Broschüre des California Land Management, so heißt der private Konzessionär, bei dem Linda angestellt ist, zeigt freudig lächelnde grauhaarige Frauen an einem sonnigen Seeufer, Arm in Arm, wie beste Freundinnen im Sommercamp. »Camping gegen Bezahlung!« Diese Worte verwendet American Land & Leisure, ein weiteres Unternehmen, das Campingplatz-Hosts einstellt, auf einem Spruchband, mit dem es für den Job wirbt. Unter der Überschrift sind Referenzen zu lesen: »Unsere Mitarbeiter sagen: ›Noch nie hat das Rentnerleben so viel Spaß gemacht!‹ oder ›Wir haben Freunde fürs Leben gefunden‹ oder ›So gesund wie jetzt waren wir schon seit Jahren nicht mehr‹.«5
Von Anfängern heißt es, sie seien oft sperrig, und einige würden kündigen, sobald man sie mit den weniger angenehmen Seiten des Jobs konfrontiere: betrunkene, lärmende Camper babysitten, haufenweise Asche und Scherben aus Feuerstellen schaufeln (ungehobelte Besucher lieben es, Flaschen in die Flammen zu werfen, um sie explodieren zu lassen) und das dreimal täglich anstehende Ritual des Reinigens der Klohäuschen. Während das Putzen der Toiletten für die meisten Campingplatz-Hosts die unangenehmste ihrer Pflichten ist, zeigt Linda sich davon gänzlich unbeeindruckt, wirkt sogar ein wenig stolz darauf, diese Aufgabe gut zu machen. »Ich will sie sauber haben, weil meine Camper sie benutzen«, sagt sie. »Ich leide nicht unter Bakterienphobie – man zieht sich Gummihandschuhe an und bringt es einfach hinter sich.«
Als Linda die San Bernardino Mountains erreicht, ist die Aussicht atemberaubend, lenkt jedoch auch vom Fahren ab. Der Straßenrand ist so schmal, dass er kaum die Bezeichnung Seitenstreifen verdient. Auf einigen Abschnitten endet der Asphalt direkt am Abhang, lauert jenseits des Asphalts nichts als Leere. Schilder weisen Autofahrer auf Gefahren hin: »Steinschlag« und »Überhitzung vermeiden: Auf den nächsten 14 Meilen Klimaanlage ausschalten«. Linda scheint nichts davon aus der Ruhe zu bringen. Seit ihrer Zeit als Fernfahrerin, die fast zwei Jahrzehnte zurückliegt, lässt sie sich von schwierigen Straßen nicht mehr beeindrucken.
Ich fahre direkt vor Linda in einem Van. Als Journalistin verbringe ich seit mehr als einem Jahr immer wieder Zeit mit ihr, und während der Unterbrechungen telefonieren wir sehr häufig. Bei jedem Anruf habe ich die vertraute Begrüßung schon im Ohr, bevor Linda abnimmt. Ein melodisches »Hallooo-ooo«, das sie in demselben Drei-Noten-Singsang spricht, in dem man beim Guck-guck-Spiel mit einem Kleinkind »Ich seh dich« ruft.
Kennengelernt hatte ich Linda anderthalb Jahre zuvor bei meiner Recherche für einen Artikel über die wachsende Subkultur amerikanischer Nomaden, über Leute also, die immer unterwegs sind, in Vollzeit.* Genau wie Linda versuchten viele dieser umherschweifenden Seelen, einem wirtschaftlichen Paradoxon zu entkommen: steigende Mieten, die auf Niedriglöhne treffen, eine unaufhaltsame Kraft, die auf einen unbeweglichen Gegenstand prallt. Sie fühlten sich wie in einem Schraubstock gefangen, steckten all ihre Kraft in anstrengende, Nerven raubende Arbeit, deren Lohn kaum für die Miete oder eine Hypothek reichte, lebten ohne eine Möglichkeit, ihr Schicksal langfristig zu verbessern, und ohne Aussicht, jemals in Rente gehen zu können.
Ihre Gefühle waren in einem Fundament aus unumstößlichen Fakten verankert: Löhne und Wohnkosten sind so stark auseinandergedriftet, dass der Traum eines bürgerlichen Lebens für eine wachsende Zahl von Amerikanern mittlerweile nicht schwer, sondern gar nicht zu erreichen ist. Während ich diese Zeilen schreibe, gibt es in Amerika nur ein Dutzend Counties und nur eine Metropolregion, wo ein in Vollzeit zum Mindestlohn arbeitender Einwohner die marktübliche Miete für eine Einzimmerwohnung aufbringen kann. Um ein solches Apartment zu mieten, ohne dabei mehr als die empfohlenen 30 Prozent des Einkommens fürs Wohnen auszugeben, müsste man mindestens 16,35 $ pro Stunde verdienen – der staatliche Mindestlohn beträgt die Hälfte.6 Die Konsequenzen sind furchtbar, besonders für den einen von sechs amerikanischen Haushalten, der mittlerweile mehr als die Hälfte seines Einkommens fürs Wohnen ausgibt.7 Für viele Familien mit geringem Einkommen bedeutet das, nur wenig oder gar nichts für Lebensmittel, Medikamente und andere grundlegende Dinge übrig zu haben.
Viele der Leute, die ich kennengelernt habe, hegten schon viel zu lange den Verdacht, Verlierer in einem abgekarteten Spiel zu sein. Und daher haben sie einen Weg gefunden, das System auszutricksen. Sie gaben ihre bürgerliche Art zu wohnen auf und sprengten auf diese Weise die Fesseln, die ihnen durch Mieten oder Hypotheken angelegt worden waren. Sie zogen in Campingbusse, Wohnmobile und Trailer, reisten dem guten Wetter hinterher von Ort zu Ort und füllten mithilfe von Saisonarbeit ihre Benzintanks. Auch Linda gehört dieser Sippe an. Sie zieht im Westen Amerikas umher, ich folge ihr seit einiger Zeit.
Als der steile Anstieg in die San Bernardino Mountains beginnt, ist es mit meiner Glückseligkeit über den Anblick der Gipfel in der Ferne vorbei. Plötzlich fühle ich mich beklommen. Die Vorstellung, mit meinem klobigen Campingbus Serpentinen zu fahren, ängstigt mich ein wenig. Zu sehen, wie Linda den Squeeze Inn mit ihrem klapprigen Jeep zieht, ängstigt mich sogar sehr. Sie bat mich, vor ihr zu fahren. Sie wollte hinter mir bleiben, mir folgen. Aber warum? Befürchtete sie, ihr Trailer könnte sich losmachen und bergab rollen? Eine Antwort darauf bekam ich nie.
Nachdem ich das Schild des San Bernardino National Forest passiert habe, nähert sich dem Squeeze Inn von hinten ein glänzender Tankwagen. Als beide Fahrzeuge in eine Serie von S-Kurven einfahren, die meinen Blick auf Linda im Rückspiegel versperren, wirkt der Fahrer ungeduldig, fährt ein wenig zu dicht auf. Ich halte weiter Ausschau nach ihrem Jeep. Auch als die Straße wieder gerade verläuft, taucht sie nicht auf. Stattdessen sehe ich auf der geraden Steigung erneut den Tanklastwagen. Von Linda keine Spur.
Ich parke in einer Haltebucht, wähle ihre Mobilnummer und hoffe auf das vertraute »Hall-ooo-ooo«. Das Telefon klingelt und klingelt, dann schaltet sich die Mailbox ein. Ich parke den Van, springe hinaus und gehe auf der Fahrerseite nervös auf und ab. Ich versuche es noch einmal. Keine Antwort. Mittlerweile haben weitere Autos, etwa ein halbes Dutzend, die Kurven hinter sich gelassen und fahren auf der geraden Strecke an meiner Haltebucht vorbei. Ich bemühe mich, ein mulmiges Gefühl zu unterdrücken, doch während die Minuten verstreichen, verwandelt sich meine Erregung in Panik. Der Squeeze Inn ist verschwunden.
Monatelang sehnte Linda den Moment herbei, in dem sie sich wieder auf den Weg machen und ihre Arbeit als Campingplatz-Host aufnehmen konnte. In Mission Viejo, fünfzig Meilen südöstlich von Los Angeles, hatte sie in der Mietwohnung ihrer Tochter Audra und ihres Schwiegersohns Collin festgesessen, zusammen mit ihren drei Enkelkindern, allesamt Teenager. Weil es nicht genügend Schlafzimmer gab, war ihr Enkelsohn Julian in der Essecke bei der Küche untergebracht. (Diese Lösung war komfortabler als die Situation in der vorherigen Wohnung der Familie, wo ein begehbarer Kleiderschrank einer ihrer Enkeltöchter gleichzeitig als Schlafzimmer dienen musste.)
Linda bekam das, was noch übrig war: das Sofa neben der Eingangstür. Es war eine Insel. Sie fühlte sich dort wie im Exil, besonders, weil ihr Jeep in der Werkstatt festsaß. Wann immer die Familie einen Ausflug machen wollte, an dem sie nicht teilnahm, musste jeder auf dem Weg zur Tür an Lindas Sofa vorbeigehen. Das wurde irgendwann unangenehm. Linda machte sich langsam Sorgen: Hatte die Familie etwa ein schlechtes Gewissen, wenn sie Zeit ohne sie verbrachte? Außerdem vermisste sie ihre Selbstständigkeit. »Ich wäre lieber die Königin in meinen eigenen vier Wänden, als unter einer anderen Königin zu leben, auch wenn sie meine Tochter ist«, sagte sie zu mir.
Zusätzlich war die Familie in dieser Zeit von gesundheitlichen Problemen geplagt, die sie sowohl emotional als auch finanziell so sehr belasteten, dass es Linda noch schwerer fiel, ihre Hilfe anzunehmen. Enkeltochter Gabbi war seit mehr als drei Jahren aufgrund einer mysteriösen Fehlfunktion des Nervensystems körperlich geschwächt und mit Unterbrechungen immer wieder bettlägerig; später wurde bei ihr rheumatische Arthritis festgestellt und darüber hinaus das Sjögren-Syndrom, eine Autoimmunkrankheit. Und zu allem Überfluss litt Collin, der Ernährer der Familie, seit Kurzem unter schwerer Migräne und Schwindel, sodass er seinen Bürojob aufgeben musste.
Irgendwann hatte Linda in Betracht gezogen, sich über CamperForce, ein von Amazon ins Leben gerufenes Programm zur Einstellung von Wanderarbeitern, für einen saisonabhängigen Job in einem Warenlager des Online-Händlers zu bewerben. Doch bei genau dieser Arbeit hatte sie im Jahr zuvor durch die ständige Nutzung des Barcode-Scanners ihr rechtes Handgelenk so stark belastet, dass sich eine weintraubengroße Beule gebildet hatte. Noch schlimmer war das, was man nicht sehen konnte: der reißende Schmerz, der über die gesamte Länge des rechten Arms ausstrahlte, vom Daumen bis zum Handgelenk, über Ellbogen und Schulter bis in den Nacken. Das Heben eines Kaffeebechers oder einer Pfanne reichte aus, um den unerträglichen Schmerz auszulösen. Sie glaubte, dass es sich um eine schwere Sehnenscheidenentzündung handelte, aber durch diese Erkenntnis verschwand die Krankheit nicht. Und ohne Heilung konnte sie diese Arbeit nicht wieder ausüben.
Total pleite und auf ihrer Sofainsel gestrandet, versuchte Linda, sich auf ihre Zukunft als Eigentümerin – und einzige Bewohnerin – des Squeeze Inn zu konzentrieren. Bevor sie bei ihrer Familie unterkroch, war sie in einem achteinhalb Meter langen El-Dorado-Wohnmobil, Baujahr 1994, von Job zu Job gereist, doch das Fahrzeug fing irgendwann an, viel zu viel Benzin zu schlucken und auseinanderzufallen. Sich auf einen winzigen Trailer zu reduzieren, fühlte sich gut an, auch wenn am Squeeze Inn noch einiges gemacht werden musste. Bei den Vorbesitzern hatte er in der salzhaltigen Luft an der Küste von Oregon gestanden, sodass einige Metallteile Rost angesetzt hatten; den Rumpf aus Glasfaser entstellte ein orangefarbener Roststreifen. Linda beschloss, ihre Auszeit für Schöner-mobil-wohnen-Projekte zu nutzen. Ihre erste Aufgabe bestand darin, ein Scheuermittel zusammenzubrauen – der geheime Inhaltsstoff waren im Mixer zerkleinerte Eierschalen –, mit dem sie die Rostflecken entfernte. Außerdem musste sie für ein gemütliches Bett sorgen. An der hinteren Wand des Trailers befand sich eine kleine Essecke. Linda entfernte den Tisch und schnitt eine Pappschablone so zurecht, dass sie auf die Bänke passte. Im Sperrmüll des Nachbarn tauchte eine Queen-Size-Matratze mit gepolsterter Oberfläche auf, die sie sich schnappte. So wie ein Fischhändler einen großen Fang entgrätet, schlitzte sie die Matratze auf, um die Federn zu entfernen und zu entsorgen. Als Nächstes zog sie die Polsterlagen heraus und schnitt sie mit einem Teppichmesser so zurecht, dass sie der Schablone entsprachen. Nachdem sie die äußere Hülle auf dieselbe Größe angepasst hatte, nähte sie die Stoffteile wieder sorgfältig zusammen, legte die Füllung wieder ein und schuf so eine perfekte Minimatratze von 182 x 91 Zentimeter. »Ein noch schmaleres Bett wäre mit meinem Kumpel hier etwas unbequem geworden«, erzählte sie mir und zeigte auf Coco, ihren Cavalier King Charles Spaniel. »Also habe ich mich für 91 Zentimeter Breite entschieden, damit wir beide hineinpassen.«
Am Tag bevor Linda nach Hanna Flat aufbrach, fragte ich sie, ob sie aufgeregt sei. »Oh, ja!«, antwortete sie. »Ich habe kein Auto. Kein Geld. Sitze auf dieser Sofainsel fest.« Mit ihren Social-Security-Schecks – 524 Dollar, den monatlichen Beitrag für Medicare schon abgezogen – würde sie es bis zum ersten Zahltag in ihrem neuen Job schaffen. Nachdem ihr Leben auf die Größe eines Sofas reduziert worden war, konnte sie es kaum abwarten, dass die Welt sich wieder vor ihr ausbreitete. Zu lange hatte sie ohne die gewohnte Freiheit auskommen müssen, den schnellen Rausch des immer wieder Neuen, der Möglichkeiten, die sich auftun, sobald man unterwegs ist. Es war Zeit zu gehen.
Am Morgen des 6. Mai war es mild und bewölkt. Linda und ihre Familienmitglieder umarmten einander zum Abschied. »Ich melde mich, wenn ich angekommen bin«, versprach sie. Sie verfrachtete Coco in den Jeep und fuhr los. Ihr erstes Ziel war eine Autowerkstatt, in der sie die Luft ihrer brüchigen und abgefahrenen Reifen, die nicht zueinanderpassten, auffüllte. Einen Ersatzreifen hatte der Jeep nicht. Als Nächstes fuhr sie zu einer Shell-Tankstelle. Sie tankte voll und ging nach drinnen, um den Beleg zu holen und ein Päckchen Marlboro Red 100 zu kaufen. Der junge Kassierer nickte, während sie sich laut daran erinnerte, als Teenager für eine Gallone nur einen Quarter bezahlt zu haben, kein Vergleich zum aktuellen Preis von 3,79 Dollar. »Man konnte einen Dollar in den Tank pumpen und damit den ganzen Tag herumfahren«, erzählte sie ihm und schüttelte lächelnd den Kopf.
Linda schien sich durch nichts die Laune verderben zu lassen. Nicht mal, als sie feststellen musste, dass die Türen ihres Jeeps abgeschlossen waren und der Schlüssel im Wageninneren lag, verschlechterte sich ihre Stimmung. Coco stand mit wedelndem Schwanz auf den Hinterbeinen, die Pfoten auf der Fahrertür. Der Hund war auf die Verriegelung getreten, vermutete Linda. Die Scheibe war jedoch einen Spalt geöffnet. Ich holte ein Stabfeuerzeug aus dem Van, quetschte meine Hand durch die Öffnung und löste die Verriegelung. Die Reise konnte weitergehen.
Der Squeeze Inn wartete auf einem Stellplatz am Stadtrand von Perris, einer Stadt auf der anderen Seite der Santa Ana Mountains, einer Bergkette, die Kaliforniens Halbinselküste von der harscheren Wüstenregion im Landesinneren trennt. Um dorthin zu gelangen, musste man über den Ortega Highway fahren, eine der gefährlichsten Straßen im ganzen Bundesstaat, wo den Worten eines Reporters der Los Angeles Times zufolge »Ballungsraum, schlechtes Fahrverhalten und veraltete Straßenbautechniken frontal aufeinanderprallen«.8 Auf dieser kurvenreichen Straße zwischen Orange County und dem Inland Empire stauen sich häufig die Pendler, aber jetzt um die Mittagszeit floss der Verkehr angenehm ruhig. Schon bald war Linda auf der anderen Seite angelangt, fuhr vorbei an dem etwa halben Dutzend Wohnwagensiedlungen, die sich wie Muscheln ans westliche Ufer des Lake Elsinore klammern. Drei Jahre zuvor hatte sie im Shore Acres Mobile Home Park an einer rissigen Asphaltstraße, die vom Highway zum See führte, in einem für 600 Dollar gemieteten Trailer gelebt.
In einem Target-Laden kaufte Linda Lebensmittel, die reichen sollten, bis eine Woche später der nächste Social-Security-Scheck eintreffen würde: einen großen Karton Frühstücksflocken von Quaker Oats, anderthalb Dutzend Eier, Rinderhackfleisch, Fleischwurst, Hamburgerbrötchen, Goldfisch-Cracker, Nutter-Butter-Kekse, Tomaten, Senf und zwei Liter Milch. Obwohl sie ihren Job erst in ein paar Tagen antreten würde, rief sie ihren zukünftigen Chef vom Parkplatz aus an. Er sollte wissen, dass sie zuverlässig war und den Job ernst nahm. Sie sei auf dem Weg, sagte sie ihm, und plane vor Einbruch der Dunkelheit Hanna Flat zu erreichen.
Der Squeeze Inn wartete unter ausgeblichenen US-Flaggen auf einem Stellplatz auf der Nordseite des Highway 74 hinter einem Maschendrahtzaun, der oben zusätzlich durch Stacheldraht gesichert war. Linda fuhr durchs Tor. Der Kalfaktor vor Ort, ein dünner Kerl namens Rudy mit Van-Dyke-Bart, kam nach draußen, um sie zu begrüßen. Sie scherzten miteinander, während Linda den Trailer startklar machte und versuchte, keinen Punkt ihrer To-do-Liste zu übersehen. »Mein Gehirn ist wie dicht geschweißt: Nichts kommt rein, nichts kommt raus«, witzelte Rudy. Irgendwann im Laufe der Plauderei stieg Linda zu schnell aus dem Trailer und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Der Squeeze Inn wippte auf seiner einzigen Achse, dann landete sein hinteres Ende unsanft auf dem Boden. »Hättest wohl heute Morgen auf die Zimtschnecke verzichten sollen, was?«, flachste Rudy. Linda fing sich wieder. »Da war ich wohl zu hektisch!«, sagte sie. Glücklicherweise hatten weder sie noch der Squeeze Inn Schaden genommen.
Linda verzurrte eine Halterung für die beiden knapp zwanzig Pfund schweren Propangasbehälter an der Vorderseite des Trailers, mit denen sie ihren Kühlschrank, die Herdplatten und einen kleinen Ofen betrieb. Schließlich half Rudy ihr, den Squeeze Inn an den Jeep zu koppeln. Sie startete den Motor und fuhr, zunächst etwas zögerlich, los. Winkend rollte sie durchs Tor vom Platz. Genau wie in der alten Werbebroschüre versprochen, folgte der Wohnwagen dem Jeep »wie ein Kätzchen«.
Als Linda nach der ersten Reihe von Kurven in den San Bernardino Mountains nicht wieder auftauchte, blätterte mein Hirn sich durch einen Stapel diverser Katastrophen. Vielleicht hatte sie den Motor abgewürgt, und er sprang nicht wieder an. Vielleicht hatte sie einen Platten – ungünstig, wenn man ohne Ersatzreifen unterwegs ist – oder, noch schlimmer, einen geplatzten Reifen. Die Befürchtungen wurden düsterer. Was, wenn sie den Squeeze Inn verloren hatte und der Trailer bergabraste? Was, wenn der Jeep in einer weiten Kurve von der Straße abgekommen und in den Canyon gestürzt war, wie in einem Remake der dramatischen Szene in Thelma und Louise?
Als ich den Motor anließ, um zurückzufahren und nach ihr zu sehen, klingelte das Telefon. »Ich bin gleich da«, sagte Linda. Als sie die Haltebucht erreichte, war ich unglaublich erleichtert, doch dieses Gefühl hielt nicht lange an. Linda kam zum Stehen und deutete mit Gesten an, dass an ihrem Trailer etwas nicht stimmte: Die Halterung für die Propanflaschen war leer. In den engen Biegungen hatten sich beide gelöst. Eine hing noch an ihrem Schlauch und war dem Squeeze Inn hinterhergepoltert, wobei sie ein faustgroßes Loch in den Fiberglasrumpf geschlagen hatte. Die andere Flasche hatte sich komplett losgemacht und war wie ein explosionsgefährdetes Tumbleweed quer über den Highway gerollt. Der Tankwagen, Linda noch immer dicht auf den Fersen, war mit einem Schlenker ausgewichen und an Linda vorbeigerast. Sie konnte von Glück sagen, dass es an diesem Straßenabschnitt eine Haltebucht gab, in der sie mit ihrem Gespann Platz fand. Die desertierte Flasche kam auf der anderen Seite des Highways zum Liegen. Linda schätzte kurz ihre Situation ein – an den äußeren Rand einer engen Kurve gequetscht, war sie für andere Fahrzeuge nicht zu sehen – und widerstand der Versuchung hinüberzuflitzen, um den Ausreißer zu retten. »Die Flasche kostet 20 Dollar, ich dagegen bin unbezahlbar!«, erinnert sie sich, in diesem Moment gedacht zu haben. Sie löste die verbliebene Flasche vom Schlauch und verstaute sie im Trailer.
Nachdem das Beinah-Unglück abgewendet war, fuhr Linda weiter, immer bergauf. Der Highway führte sie durch die Orte Arrowbear Lake und Running Springs, deren alpine Hänge im Winter Skifahrer und Snowboarder anlockten, um diese Jahreszeit jedoch für Mountainbiker und Wanderer attraktiv waren. Sie passierte den hundert Jahre alten Damm am Big Bear Lake, einem von Schnee gespeisten Reservoir, und folgte dem Verlauf seines nördlichen Ufers durch den Lebensraum der Weißkopfseeadler. Als Nächstes folgten die Grout Bay und der winzige Ort Fawnskin. Der heutige Name geht auf Städteplaner des frühen 20. Jahrhunderts zurück, die sich nicht vorstellen konnten, dass ein Ort, der »Grout« (Mörtel) hieß, Urlauber anziehen würde.9 Im dortigen Gemischtwarenladen gab es alles zu kaufen, was Abenteurer in der Wildnis so brauchen: Angelgeschirr, Bierkühler, Schlitten, Schneeketten, Schlafsäcke, Sonnenschirme und Souvenir-Schnapsflaschen in Gewehrform. (»Tequila-Shots«, erklärte der Kassierer.) Im nahe gelegenen Park wurde mit Fiberglasdenkmälern aller möglichen uniformierten Männer gedacht. Es gab einen Baseballspieler, einen Indianerhäuptling, einen Cowboy, einen Feuerwehrmann, einen Kampfpiloten, einen Piraten und einen Highway-Streifenpolizisten. Sie sahen aus, als würden sie gleich »Y.M.C.A.« singen. »All diese Statuen!«, rief Linda. »Warum nicht eine einzige Frau?« Dann bemerkte sie andere Skulpturen: zwei Rindviecher, die vor einen Planwagen gespannt waren. Die waren bestimmt weiblich, meinte Linda, weil sie keine erkennbaren Genitalien aufwiesen und die Einzigen waren, die Arbeit verrichteten. Von dem Zeitpunkt an rief sie ihnen, wann immer sie am Park vorbeikam, zu: »Heeeeeyyy, Girls!«
Auf dem Rim of the World Drive cruiste Linda an einem Privatgrundstück vorbei, wo sich hinter schweren verschlossenen Toren und Schildern mit der Aufschrift »Betreten verboten« der übertrieben gepflegte Rasen erahnen ließ. Als sie in den Coxey Truck Trail einbog, wählte Linda das Schritttempo. Hier brachte der bröckelnde Straßenbelag einen holprigen Feldweg zum Vorschein. Links und rechts lugten zwischen den Asphaltstücken und den üppig rot blühenden Beerentraubenbüschen gelbe Schöterichsprösslinge hervor. Auch Überreste des »Butler II«-Großfeuers vom Jahr 2007 waren zu erkennen: verkohlte Baumstämme, die wie riesige Stachelschweinborsten aus ihrer grünen Umgebung herausragten. Die Feuersbrunst hatte damals mehr als fünfeinhalbtausend Hektar verschlungen, auch Hanna Flat, sodass der Campingplatz bis 2009 wegen Reparaturarbeiten geschlossen blieb.10 Als Hanna Flat näher kam, fuhr Linda noch langsamer und konzentrierte sich voll auf die unebene Straße, um tiefen Rillen auszuweichen, die im festgefahrenen Boden lauerten. Hinter ihr hüpfte und polterte der Squeeze Inn.
Gegen sechs Uhr abends, es war noch hell, erreichte sie die Einfahrt zum Campingplatz. Mit mehr als zweitausendeinhundert Metern über dem Meeresspiegel lag Hanna Flat über eintausendfünfhundert Meter höher als Mission Viejo, wo ihre Reise am Morgen desselben Tages begonnen hatte. Die Luft war kälter und dünner. Sie entdeckte ein Anschlagbrett und stieg aus dem Jeep, um die Informationen zu lesen. Hinweise warnten Besucher vor Schlangen und instruierten sie, ihre Lagerfeuer bis auf den letzten Funken zu löschen (»EVERYSPARKDEAD-OUT«). Auch das Mitbringen von Feuerholz mit invasiven blinden Passagieren sollte vermieden werden: Insekten wie zum Beispiel ein bestimmter Eichenkäfer mit der wissenschaftlichen Bezeichnung Agrilus coaxalis und niederträchtige Krankheitserreger mit Namen wie »Kieferfäule« und »plötzlicher Eichentod«. Auf einer großen Karte war ein Weg eingezeichnet, der sich durch das Gelände mit achtundachtzig nummerierten Zeltplätzen schlängelte, die für 26 Dollar pro Nacht zu mieten waren. Außerdem gab es einen Bereich ohne Nummern, der sich so nah am Eingang befand, dass Linda ihn von dort, wo sie stand, sehen konnte. Dort wurden ein paar zusätzliche Ausstattungsmerkmale geboten: ein asphaltierter Fahrzeugstellplatz, Anschlüsse für Wasser und Strom sowie eine Picknick-Ecke mit einem Tisch und einer Feuerstelle. Davor, neben einem verrottenden Baumstumpf, den Feuerameisen kolonisiert hatten, war auf einem Schild »CAMPHOST« zu lesen.
Hier würde Linda für die nächsten sechs Monate zu Hause sein.
Dass Linda die Tage zählte, lag daran, dass sie endlich ihre Arbeit aufnehmen wollte, aber es gab auch noch einen anderen Grund: Sie erwartete eine Freundin, die mit ihr zusammenarbeiten würde. Die sechzig Jahre alte Silvianne Delmars hatte noch nie als Campingplatz-Host gearbeitet, freute sich aber darauf, es auszuprobieren. »Mit Linda May an meiner Seite könnte ich es auch mit einer Armee aufnehmen!«, hatte sie ein paar Monate zuvor erklärt. Silvianne wohnte in einem Ford E350 Econoline Super Club Wagon, Baujahr 1990, der als Transportbus für Senioren und Arbeitsfahrzeug für Sträflingsarbeitsteams gedient hatte, bevor sie ihn über die Anzeigenwebsite Craigslist kaufte, inklusive defekter Kopfdichtungen, abgefahrener Bremsen, brüchiger Servolenkungsschläuche, abgefahrener Reifen und eines Anlassers, der beim Starten ominöse Mahlgeräusche von sich gab. Wenn das Sonnenlicht in einem bestimmten Winkel auf die Fahrerseite traf, wurden die Umrisse eines vor langer Zeit überlackierten Schriftzugs sichtbar: »Hoolbrook Senior Citizens Assoc.«
Zwei von Silviannes Kumpels schlugen Namen für den Wagen vor: »Queen Mary« und »Esmeralda«. Da sie ungern einem den Vorzug geben wollte, taufte sie ihn Queen María Esmeralda. Den Innenraum gestaltete sie mit glänzenden Schals, bestickten Kissen, Weihnachtsbeleuchtung und einem Altar, auf dem eine Jungfrau-von-Guadalupe-Opferkerze und eine Statuette von Sekhmet, der löwenköpfigen ägyptischen Göttin, standen. Silvianne hatte sich in ihrem Bus auf den Weg gemacht, nachdem sie mit einer Serie von Herausforderungen konfrontiert worden war: Auto gestohlen, Handgelenk gebrochen (keine Versicherung) und ein Haus in New Mexico, das sie nicht verkaufen konnte. »Wenn man zum ersten Mal in der Innenstadt im Auto übernachtet, fühlt man sich wie eine schreckliche Versagerin oder eine Obdachlose«, erklärte sie. »Aber der Mensch hat eine großartige Eigenschaft: Er gewöhnt sich an alles.«
Silvianne hatte Linda anderthalb Jahre zuvor kennengelernt, als beide in dem Amazon-Warenlager, wo Linda sich das Handgelenk verletzte, als befristete Angestellte in der Nachtschicht arbeiteten. Silvianne war Tarotkartenleserin – sie hatte außerdem in der Gesundheitsabteilung eines Konzerns gearbeitet, als Kellnerin, im Einzelhandel, als Akupunkteurin sowie im Cateringbereich –, und daher gelang es ihr, die Folge von Ereignissen, die sie zu einer Busbewohnerin gemacht hatten, als eine Vorsehung zu betrachten, mit der die Göttin sie auf den Pfad der Gypsies führte. (In ihrem Blog, Silvianne Wanders, schilderte sie den Wandel so: »Eine Babyboomerin, die das Rentenalter noch nicht ganz erreicht hat, gibt ihre bürgerliche Bleibe auf, ein ehemaliges Minenarbeiterhäuschen, ihre drei Teilzeitjobs sowie jegliche Illusionen der Sicherheit, die dieser ramponierte Überrest des American Dream ihrer gequälten Seele möglicherweise noch bescherte. Das Ziel: aufzubrechen in ein Nomadenabenteuer und das zu werden, wozu sie als Tarotkartenleserin – Schamanische Astrologin – Cosmic Change Agent schon immer bestimmt war.«
Silvianne hat einen Song geschrieben, ihre »Vandweller-Hymne«. Als sie ihn das erste Mal für mich sang, parkte die Queen María Esmeralda auf einem Burger-King-Parkplatz in Arizona, und ich hatte Silvianne im Lokal interviewt. Wir schabten die Panade von unseren Chicken-Nuggets und verfütterten das Fleisch an die grünäugige Katze Layla, die diese Leckerbissen nur »nackt« fraß. Die ersten Zeilen des Songs, den sie nach der Melodie von »King of the Road« dichtete, schrieb Silvianne auf einem einsamen Abschnitt des Highway 95 in Arizona. Seitdem hat sie den Text mehrmals verbessert – die neueste Version liest sich wie folgt:
Alter verbeulter High Top Van,
Wie in einer großen Blechdose.
Keine Miete, keine Regeln, kein Mann,
Ich bin nicht an ein Stück Land gebunden.
Bin im Sommer in kühlen Wäldern,
Im Winter in der Wüstensonne.
Bin eine alte Zigeunerseele mit neuen Zielen,
Königin der Straße!
Meine Freunde denken, ich bin verrückt,
Aber für mich ist ihr Leben viel zu zahm.
Wenn ich manchmal den Blues singe,
Kleiner Preis für das Leben, das ich wähle.
Ich weiß nun, dass aller Raum geheiligter Boden ist,
Wenn wir uns nur nie umsehen
Bei unserer heiligen Suche nach der neuen Erde.
Königinnen der Straße!
Ich kenne jede Straße in fünf westlichen Bundesstaaten.
Wenn es eine blaue Autobahn ist, zögere ich nicht.
Ich erfahre jede seltsame Geschichte jeder kleinen Stadt.
Ich komme vielleicht langsam hin, aber ich komme herum, in meinem …
Benzin saufenden High-Top-Ford
Ich habe manchmal Angst, aber nie Langeweile,
Weil ich endlich die Leine durchgeschnitten habe
Im Gegensatz zu den Konsumentenhorden der Gesellschaft.
Ich habe eine große Katze, um mich gesund zu halten,
Lovely Layla ist ihr Name,
Nicht wirklich wild, aber nicht zu zahm
Königinnen der Straße!11
Als Linda in Hanna Flat ankam, hielt Silvianne sich noch immer zwei Stunden weiter südlich auf, wo sie ihre Queen María Esmeralda vor einem Apartmenthaus in Escondido geparkt hatte, in dem eine Freundin eine Wohnung besaß. Sie genoss den Vorzug, Wäsche waschen und heiße Bäder nehmen zu können. (Im Vandweller-Slang nannte man das, was sie tat, »Einfahrt-Surfen«.) Mit nur noch 40 Dollar in der Tasche wartete sie auf die Zusendung einer Kreditkarte, der ersten, die sie nach zehn Jahren besitzen würde.
Die ersten Tage, die Linda auf dem Campingplatz verbrachte, verliefen ruhig. Es gab ein paar Kojotensichtungen und Gerüchte über einen Puma. Es fielen ein paar Zentimeter Schnee, aber mithilfe eines Heizgerätes konnte sie im Squeeze Inn für ein wenig Wärme sorgen. Sie kaufte eine neue Gasflasche. Sie dekorierte ihren Kühlschrank mit einem Magneten, auf dem »Lebe jeden Tag, als würde Aunt Bee dich beobachten« zu lesen und ein Foto der Haushälterin aus der Andy Griffith Show zu sehen waren. Auf einem weiteren Magneten war eine Ode ans Nomadenleben mit dem Titel »A Full Set of Stuff« abgedruckt, deren Verfasser Randy Vining hieß, sich jedoch auch als Mobile Kodger bezeichnete. Sie begann so: »Ich reise von morgens bis abends mit einer ganzen Reihe von Sachen/Nicht weniger, als ich brauche, und nicht mehr als genug.« Sie las Bücher. Eine Vandweller-Freundin hatte ihr Woodswoman: Living Alone in the Adirondack Wilderness empfohlen, und Linda verschlang es geradezu, staunte darüber, wie unabhängig und genügsam die Autorin lebte, die sich, inspiriert von Walden oder Leben in den Wäldern, aus Baumstämmen im Wert von 600 Dollar ihre eigene Hütte gebaut hatte. Als Nächstes begann sie mit Making Ideas Happen: Overcoming the Obstacles Between Vision and Reality, einer Selbsthilfeschwarte für Unternehmer, die sie nach wertvollen Hinweisen für die Schaffung einer Zukunft durchforstete.12 Und sie kuschelte mit Coco, der sich auf ihrer gemeinsam genutzten Matratze an ihre Seite schmiegte und hin und wieder hyperaktiv nach oben schoss, um ihr das Gesicht abzulecken. »Oh, Küsse, Küsse!«, sagte sie zu dem Hund. »Bald hast du dir die Zunge ganz zerschlissen! Und dann brauchst du eine Zungensanierung, und was glaubst du wohl, wer dafür bezahlen darf?«
An dem Sonntag, an dem sie Silvianne erwartete, beschloss Linda, die nächstgelegenen Duschen aufzusuchen, um sich frisch zu machen. Sie befanden sich auf dem fünf Meilen entfernten Serrano Campground am Ufer des Big Bear Lake in zugigen Kabinen, die man aus einfachen Betonziegeln gebaut hatte. Um Wasser zu sparen, wurden die Hähne immer nur für kurze Intervalle geöffnet, und beim Duschen musste man daher immer wieder einen verchromten Drücker betätigen. Anschließend bürstete Linda auf dem Parkplatz ihre Haare in der Sonne und posierte wie für einen Shampoo-Werbespot. »Glänzt mein Haar schon?«, fragte sie.
Silvianne traf an jenem Nachmittag ein. Bekleidet war sie mit einem senfgelben Frida-Kahlo-T-Shirt, einem wallenden Patchwork-Rock, rosa Leggings und Wildledermokassins. Sie umarmte Linda und inspizierte anschließend das Innere des Squeeze Inn. »Auf den Bildern sah er größer aus!«, sagte sie. Silvianne ist groß und schlank, ihr ergrauender brauner Schopf gelockt. In die Stirn fiel ihr ein Pony, und das restliche Haar hatte sie nach hinten gebunden, wobei sich ein paar Strähnen aus der Bananenspange befreit hatten. Als sie den Trailer betrat, musste sie den Kopf einziehen. Linda erzählte ihr, wie sehr sie es genoss, darin zu leben. Der einzige Komfort, den sie aus ihrem alten Wohnmobil vermisste, seien Dusche und Toilette. Letztere hatte sie durch einen Eimer ersetzt, und bislang schien diese Lösung gut zu funktionieren.
Die Einweisung der Campingplatz-Hosts begann am Montag um 8:30 Uhr morgens im Big Bear Discovery Center, einer vom U.S. Forest Service betriebenen Ausbildungsstätte. Als Belohnung für alle, die teilnahmen, warfen die Vorgesetzten vom California Land Management ihnen abgepackte Kekse zu. Am meisten jedoch freuten sich die zukünftigen Hosts auf das kostenlose Mittagessen: Hotdogs am ersten Tag, Fast-Food-Hühnchen am zweiten. Zusätzlich zum Essen erhielt jeder Teilnehmer einen rotbraunen Dreiringordner mit dem 350 Seiten dicken Handbuch des California Land Management, außerdem hörten sie einen ausführlichen Vortrag über die bevorstehende Arbeit. Sie wurden ermuntert, ihren jeweiligen Campingplatz auf »Mikromüll« zu durchforsten – Zellophanfolienschnipsel, Alufolie, Zigarettenstummel und sonstiges Zeug – und die einzelnen Zeltplätze frei von »Stolperfallen« zu halten, etwa Zapfen in Pampelmusengröße, die von den turmhohen Jeffrey-Kiefern des Waldes fielen. Sie hörten auch abschreckende Beispiele, Geschichten über Fehler, die sie vermeiden sollten. Einmal vergaß ein unglückseliger Arbeiter, als er Feuerstellen mit einer Schaufel von Asche befreite, diese auf Glutreste zu prüfen, und steckte so sein Golfmobil in Brand. Seid schlauer als dieser Typ! In einem anderen Fall brach sich ein weiblicher Host eine Rippe, als sie sich auf einen Abfallcontainer schwang, um eine Bärensicherungskette zu befestigen, die sich gelöst hatte. »Das war ich!«, rief Linda, sehr zur Überraschung ihrer Chefs, die die Geschichte erzählten, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass das Opfer anwesend war. (Der Unfall hatte sich im vorigen Sommer ereignet, als Linda in Mammoth Lakes, Kalifornien, gearbeitet hatte. Wegen der Verletzung war eine Zeit lang jede Bewegung schmerzhaft: Atmen, Fegen, mit dem Golfmobil über Unebenheiten fahren, Bücken und sogar mit ihren Campinggästen zusammen lachen. Familie und Freunde bestanden darauf, dass sie zum Arzt ging. Dieser bestätigte, dass eine Rippe gebrochen war, und ermahnte sie, während der Abheilungsphase ja nichts anzuheben, was mehr als zehn Pfund wog.)
Am Mittwoch um 8:00 Uhr morgens begannen Linda und Silvianne den ersten Arbeitstag in ihren identischen Uniformen: braunen Hosen und kakifarbenen Windjacken, die auf der linken Brust mit einem Berggipfel-Logo bestickt waren. In diesen Farben konnten sie leicht mit den staatlichen Forstaufsehern verwechselt werden; diese Irreführung, so hatte man ihnen gesagt, sei sehr hilfreich, wenn man mit unfolgsamen Campern fertigwerden musste. Silvianne war bereits seit Stunden auf den Beinen, um ihr allmorgendliches Gesundheitsprogramm auszuführen – entgiftende Kräuter einnehmen, anschließend meditieren, dann ein Frühstück genießen, das wie der Rest ihres Speiseplans weder Zucker noch Fleisch, Milchprodukte oder verarbeitetes Getreide enthielt – Maßnahmen, mit denen sie die Heilung eines Basalzellenkarzinoms unter dem rechten Auge zu unterstützen hoffte. Ihr Golfmobil war voll beladen mit Werkzeug und Hilfsmitteln: zwei Harken, zwei Besen, einem Spaten, einem Metallbehälter für Asche und Plastikeimern mit jeder Menge Putzzeug. Außerdem hatten sie Broschüren dabei, in denen teure Wildnistouren per Gleitschirm, Hubschrauber, Segway, Seilrutsche, Allradgeländewagen und in einem Schaufelradboot namens Miss Liberty beworben wurden. Silvianne hatte gerade erst gelernt, das Golfmobil zu fahren, und freute sich darauf, das Steuer zu übernehmen. Es war ein kühler, aber heller Morgen, ein paar Sonnenstrahlen fanden den Weg durch die Kiefern. Raben krächzten in den Ästen, und Gambelmeisen sangen eine Melodie aus drei Noten, die an ein Kinderlied erinnerte. Zu den Füßen der Bäume streckten die ersten Sprösslinge der Schneeblume – spargelförmig wachsende Pflanzen, die im späten Frühling blühen und sich eines Pilzes bedienen, um den Wurzeln der Nadelbäume Nährstoffe zu entziehen – ihre Köpfe durch den Kiefernnadelteppich. Blaubäuchige Eidechsen huschten über asphaltierte Flächen. Erdhörnchen tauchten in ihre Höhlen ab, sobald das Golfmobil sich näherte.
An den vielen Tricks, die Linda auf Lager hatte, erkannte man, dass sie diese Arbeit nicht zum ersten Mal verrichtete. Wenn sie die Klohäuschen desinfizierte, legte sie ein Einmalhandtuch um die Toilettenpapierrollen, damit sie vor den Chemikalien geschützt waren. Sie sprach darüber, sich Pam-Kochspray zu besorgen – oder WD-40, aber Pam war billiger –, denn wenn man die Wände der Toilettenschüsseln damit besprühte, konnte Schmutz nicht so gut daran haften. Nach dem Ausleeren eines Abfalleimers demonstrierte sie, wie man mit einem Knoten einen neuen Müllsack schnell so befestigte, dass er nicht über die Lippe rutschen konnte. Als sie den Unrat um die Picknicktische herum entfernte, machte sie am Ende eines jeden Harkenstrichs mit dem Handgelenk einen kleinen Schlenker. »So kann man nicht erkennen, wo ich aufgehört habe«, erklärte sie. »Sieht natürlicher aus.«
An einem besonders verdreckten Zeltplatz – ein unverpackter Schlafsack und eine Rolle Toilettenpapier waren zusammen mit leeren Instantnudelpackungen achtlos auf den Boden geworfen worden – hatten die Gäste das zum Kochen genutzte Feuer nicht gelöscht. Linda und Silvianne gossen abwechselnd aus Krügen Wasser hinein und mussten von dem aufsteigenden Rauch und der zischenden Glut husten. Mit einer Schaufel rührten sie in der heißen Pampe, um letzte Funken zu ertränken, die das Feuer wieder hätten entzünden können. Später kehrten die Camper – ein paar Kerle in ihren Zwanzigern – von einer Wanderung zu ihrer durchtränkten Feuerstelle zurück. Sie froren. Trotz des vorhergesagten Schneefalls trug einer von ihnen kurze Ärmel und hatte keine Jacke mitgenommen, ein anderer war in den einzigen Schuhen gewandert, die er dabeihatte: Pantoffeln. Linda stieß zu ihnen, als die Unglückseligen versuchten, das Feuer wieder zu entfachen. »Wenn ihr weggeht, müsst ihr eine Hand ins Feuer legen können«, sagte sie geduldig. »Ihr habt Glück, dass wir es entdeckt haben und nicht die Forstaufseher.« Die Ranger hätten ihnen eine Strafe verpasst. Die jungen Männer gaben überschwängliche Entschuldigungen von sich. »Sorry, Ma’am!«, sagten sie. »Tut uns leid.«
Zweimal in der Woche waren Linda und Silvianne alleine für Hanna Flat verantwortlich. An den anderen drei Tagen teilten sie sich das Gebiet mit einem weiteren Campingplatz-Host, der sich auf dem Gelände auskannte. (Die Frau erzählte gerne eine Geschichte, die sich im Vorjahr zugetragen hatte, als sie im selben Wald gearbeitet hatte und ein Exhibitionist, nur in eine Amerikaflagge gehüllt – sonst nichts –, umhergerannt war und sich immer wieder entblößt hatte, bis die Polizei kam und ihn mitnahm.) Den größten Teil ihrer Arbeitszeit verbrachten sie damit, die achtzehn Toiletten und achtundachtzig Zeltplätze von Hanna Flat sauber zu halten. Sie übernahmen Hausmeisteraufgaben, checkten neue Camper ein, kassierten Gebühren, stellten Reserviert-Schilder auf, gaben Wandertipps, schlichteten belanglose Streitigkeiten, schaufelten Feuerstellen leer und erledigten Papierkram. Gäste kamen zu ihnen, um Holz zu kaufen, das in einem Käfig auf dem Stellplatz des Hosts lagerte und acht Dollar das Bündel kostete. Oft gingen sie wieder davon, ohne etwas gekauft zu haben, weil sie Lindas und Silviannes Rat folgten und den Wald nach Brennmaterial durchkämmten, das drei Kriterien erfüllte: bereits tot, liegt am Boden, ist lose. Es kam vor, dass Linda am Ende der Arbeitsrunden so erschöpft war, dass sie ein Nickerchen brauchte.
Neben einem Schild zu leben, auf dem »CAMPHOST« steht, ist nicht leicht. Es bedeutet, jederzeit den Bedürfnissen der Campinggäste verpflichtet zu sein. Aber wann hatten sie dann eigentlich Feierabend? Wann immer ein Host vor Ort war und es Arbeit gab, wurde von ihm erwartet, dass er diese erledigte. Als eines Nachts um halb zwölf zwei Trucks mit Campern eintrafen, begaben die sich direkt zur Queen María Esmeralda, weckten Silvianne auf und ließen sich von ihr einchecken. Zu den Aufgaben der Hosts gehörte es außerdem, die »nächtlichen Ruhezeiten« durchzusetzen und Beschwerden wegen Lärmbelästigung nachzugehen. Linda versuchte, Problemen auf freundliche Weise vorzugreifen. Wenn eine Gruppe von Leuten ankam, die wie Partytypen aussahen, gab sie ihnen folgenden Hinweis: »Wir möchten, dass ihr Spaß habt, aber nach zehn Uhr abends wünschen wir, dass ihr sehr leise Spaß habt.« Wenn sie sah, dass auf einem Zeltplatz Bierflaschen herumlagen, machte sie, anstatt die Gäste zum Aufräumen aufzufordern, ein hilfreiches Angebot: »Ich könnte euch ein paar große Müllsäcke bringen.«
Linda und Silvianne waren für eine volle Vierzig-Stunden-Woche eingestellt worden, aber eine Garantie dafür gab es nicht. Als sie einen halben Monat hinter sich hatten, teilte der Vorgesetzte ihnen plötzlich mit, dass die Campingplatz-Reservierungen rückläufig waren und das Unternehmen Kosten einsparen musste. Daher würden Linda und Silvianne in den nächsten beiden Wochen nur drei Viertel der normalen Stundenzahl arbeiten. Damit fiel Lindas Wochenlohn auf unter 290 Dollar. (Der von Silvianne war noch niedriger, weil ihr als »Neuling«, anders als Linda, noch keine Erhöhung zustand.)
Linda und Silvianne beschwerten sich nicht darüber, dass die schlecht bezahlte Arbeit überdies noch nicht einmal zuverlässig verfügbar war oder bisweilen grenzenlos ausufern konnte. Andere »Workamper« taten es aber. Häufig sind Campingplatz-Hosts frustriert, weil die Arbeit, die von ihnen erwartet wird, sich nicht innerhalb der festen Stundenzahl verrichten lässt, die sie berechnen dürfen. Ein Arbeiter in den Sechzigern, der 2016 zum ersten Mal vom California Land Management eingestellt wurde, berichtete mir von seinem Posten aus per E-Mail über seine Erfahrungen. »Als Campingplatz-Host zu arbeiten ist ein Trip«, schrieb er. »Viele widersprüchliche Botschaften vom ›Management‹. Ich habe eine Dreißig-Stunden-Stelle, aber in so mancher Woche kam ich auf fünfundvierzig Stunden und mehr. Ich habe mich dagegen gewehrt, und daraufhin wurde der Umfang der verlangten Arbeit reduziert.« Für die bereits geleisteten Überstunden entschädigten seine Manager ihn leider nicht.
Diese Geschichte passt zu dem, was Greg und Cathy Villalobos, die Mitte sechzig waren und als Ehepaar den Job der Campingplatz-Hosts verrichtet hatten, im Jahr 2014 auf einer Website für Neuigkeiten im Rechtswesen schilderten. Sie berichteten, dass bei ihrer Arbeit für das California Land Management und einen weiteren Konzessionär, Thousand Trails, von ihnen erwartet wurde, mehr Stunden abzuleisten, als sie auf ihren Zeitkarten notieren durften. »Ich erzähle diese Geschichte in erster Linie, um anderen Senioren zu helfen und dazu beizutragen, dass diese Praktik gestoppt wird. Das Ganze ist ziemlich empörend, insbesondere weil es auf die Regierung zurückfällt, denn von der werden diese Unternehmen unter Vertrag genommen«, teilte Greg Villalobos dem Reporter mit.13
Eine andere Workamperin, die im Jahr 2015 für das California Land Management arbeitete, gab dem Unternehmen auf Yelp eine Bewertung mit nur einem Sternchen und behauptete, dass sie und ihr Mann oft zwölf Stunden und mehr am Tag arbeiten mussten, jedoch nicht mehr als acht aufschreiben durften. »Dass sie so mit Seniorenehepaaren umgehen, die auf das Einkommen angewiesen sind, ist falsch. Diese Umstände müssen dringend untersucht werden«, schrieb sie.14