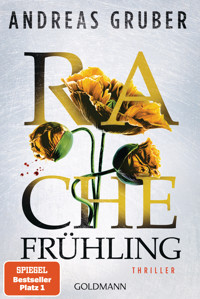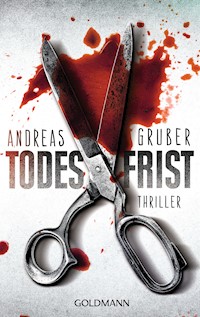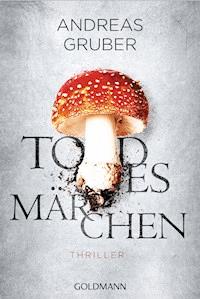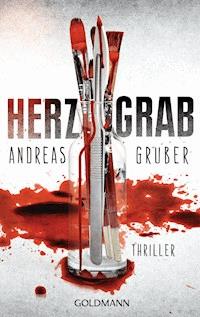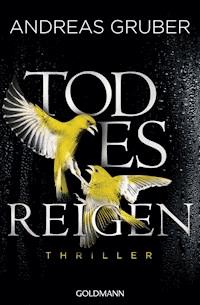Inhalte
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Woher Schriftsteller ihre Ideen nehmen
Schießerei am O.K. Corral
Wirklich böse Sachen
Seit wann trinken Katzen Whisky?
Glauben Sie mir, mein Name ist Dr. Watson!
Bruegels Turmbau zu Babel
Klinik
Ristorante Mystico
Das Bahnwärterhaus
Die Schatten von Norgarth
Wie ein Lichtschein unter der Tür
Rue de la Tonnellerie
Die scharfe Kante des Geodreiecks
Northern Gothic
Nachwort
Der Autor
Unser Leseprobenbuch
Der LUZIFER Verlag
Quellenverzeichnis
Impressum
Copyright © 2015 by Andreas Gruber
Copyright Deutsche Erstausgabe © 2015LUZIFER Verlag
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert
Lektorat: Heike Müller
ISBN E-Book: 978-3-95835-078-6
Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf
FacebookTwitterGoogle+Pinterest
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen und senden Ihnen kostenlos einen korrigierten Titel.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
für Hansi, Robert, Thomas und Petra,
meine teuflischen Nachbarn,
danke, dass es euch gibt
»Wenn's donnert, wachen die Gebetbücher auf.«
Sprichwort
WOHER SCHRIFTSTELLER IHRE IDEEN NEHMEN
Vorwort von Anna Gram
Grillenberg liegt etwa dreißig Kilometer südlich von Wien. Am Ende des kleinen Orts befindet sich der so genannte Mandlingweg. Dieser verläuft an einem Bach, vorbei an einigen Gewächshäusern und einer stillgelegten Mühle. Bevor diese Gasse in einen Forstweg übergeht und sich im Wald verliert, liegt ein einstöckiges gelbes Einfamilienhaus mit Balkon, Carport und Wintergarten. Was gleich auffällt: Eine Brücke führt über den Bach auf das Grundstück, und über die nicht eingezäunte Wiese jagen fünf Katzen.
Es ist eine Gegend nach seinem Geschmack. Hier fühlt er sich zu Hause und genießt die Ruhe in seinem Arbeitszimmer. Die Rede ist von Andreas Gruber.
Es ist Ende August, die Sonne steht tief, und es ist bereits fünf Uhr abends. Ich bin eine Viertelstunde zu spät dran und parke vor dem Grundstück. Gruber kommt mir schon entgegen. In brauner Khakihose bis zu den Waden, barfuß in ausgelatschten Sandalen und einem ausgewaschenenTom WaitsT-Shirt. Er ist braun gebrannt, hat ausgebleichtes blondes Haar, einen Dreitagesbart, trägt keine Armbanduhr, dafür aber jede Menge geflochtener Freundschaftsbänder.
Nach einer kurzen Begrüßung bittet er mich auf die Terrasse unter die Sonnenmarkise. Wir kennen uns bereits von zahlreichen E-Mails und Telefonaten, doch persönlich bin ich ihm noch nie begegnet. Für einen Moment verschwindet er im Haus, dann kommt er mit zwei Caipirinhas wieder, mit reichlich Eiswürfeln und jeder Menge in Achtel geschnittenen Limetten. In der Zwischenzeit ist mir auch schon eine Katze auf den Schoß gesprungen.
»Anna – ich darf Sie doch Anna nennen, oder?«, meint er mit seinem Wiener Dialekt. »Auf unser Wohl.«
Wir trinken.
Als freie Mitarbeiterin desLiteraTour Crash Magazinsin München, verschlägt es mich öfter nach Österreich, daher ist mir der Wiener Dialekt geläufig. Für die 25. Jubiläumsausgabe des Magazins wollte ich ein Interview mit Gruber bringen, das sich rasch zu einer Story entwickelt hatte. Der Redaktion gefiel die Idee, und so wurde ein Künstlerportrait mit Buchbesprechungen daraus. Der Aufmacher trug den TitelDer Stephen King der deutschen Horrorliteratur.Kurz vor der Jubiläumsausgabe wurde das Magazin jedoch eingestellt. Die Nummer mit der Coverstory ist nie erschienen.
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich bereits, dass Gruber einen neuen Erzählband plante, und bei einem Telefonat bot er mir an, das Vorwort zu seinem neuen Buch zu schreiben. Ich willigte ein, jedoch nur unter der Bedingung, ihn persönlich kennenlernen zu dürfen, und so kam es zu diesem Termin.
Mit dem Glas Caipirinha in der Hand lehnt er sich im Korbstuhl zurück und schließt für einen Moment die Augen. Auf dem Tisch liegt ein Manuskript. Es wird von einem Laptop beschwert. Die Seiten flattern im Wind.
Ich habe mir vorgenommen, das Interview nicht mit den üblichen banalen Fragen zu beginnen.Woher nehmen Sie Ihre Ideen? Wie wird man eigentlich Schriftsteller?Von verschiedenen Interviews weiß ich, dass er allergisch darauf reagiert.
Ich will gerade meine erste Frage stellen, als er plötzlich selbst das Wort ergreift. »Bleiben Sie sitzen, ich möchte Ihnen etwas zeigen.« Er steht auf, geht kurz ins Haus und kommt mit einer schweren Schreibmaschine wieder, die er stolz vor mir auf den Tisch stellt.
»William S. Burroughs hat früher auf dieser Schreibmaschine gearbeitet. Angeblich hat er daraufNaked Lunchgeschrieben, allerdings bezweifle ich das.«
Ich bewundere das Gerät. Es hat eine Tastaturreihe mehr als andere Maschinen. Aber auch die Walze und die Typenhebel sehen merkwürdig aus – nicht mechanisch, sondern irgendwie biologisch, als lebe das Gerät wie ein fettes, dunkles Insekt.
Gruber erklärt, dass er diese Schreibmaschine vor fünfzehn Jahren während eines Urlaubs in Los Angeles bei einer Versteigerung in den Paramount Studios erworben hat. Sie wurde als Requisit in der Cronenberg Verfilmung vonNaked Lunchverwendet. Gruber hat eine Schwäche für die Beat-Poeten der 60er-Jahre. Er erzählt, dass er die Storys von Kerouac, Ginsberg und Bukowski liebt und von Burroughs sogar eine persönlich gewidmete Autogrammkarte besitzt.
Erst jetzt bemerke ich, dass aus dem Haus die Musik von Tom Waits dringt.Swordfishtrombones, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls passt der exzentrische Sound des Albums zur augenblicklichen Situation.
»Mit der Verfilmung vonNaked Lunchist Burroughs unsterblich geworden«, sagt Gruber.
Ich frage ihn, ob es ihn stört, wenn mein Diktafon mitläuft. Er schüttelt den Kopf, und ich drücke die Aufnahmetaste. »Beschäftigt Sie der Gedanke von Unsterblichkeit?«, frage ich ihn.
Er denkt eine Weile nach und erzählt mir dann folgende Geschichte: Er wurde vor Jahren von einem Schriftstellerkollegen darauf aufmerksam gemacht, dass ein Wikipedia-Eintrag über ihn existiere. Er wollte wissen, wer diesen Eintrag erstellt hatte, und so warf er einen Blick in den Quellencode. Aber dort stand kein Verfasser. Bis heute hat er nicht herausgefunden, wer diesen Artikel angelegt hat. Doch im Quellencode stieß er auf eine interessante Zeile. Unter dem Geburtsdatum stand ein freies Feld mit der Bezeichnung »Todesdatum«. Eines Tages würde es jemand ausfüllen, und da wurde ihm zum ersten Mal schmerzlich bewusst, dass das Leben endlich ist.
Er stellt das Glas weg und wird nachdenklich. »George Orwell nannte vier Gründe, warum Autoren schreiben: Aus politischem Engagement, weil man die Welt verändern möchte, aus Sinn für Geschichte, weil man etwas für die Nachwelt aufzeichnen möchte, aus ästhetischem Enthusiasmus, weil man Freude an guter Prosa hat, oder aus reinem Egoismus, weil man auch nach seinem Tod nicht in Vergessenheit geraten möchte.«
»Der letzte Grund hat etwas«, sage ich.
»Sehe ich auch so. Man schreibt, um Spuren zu hinterlassen. Weil man etwas schaffen möchte, das es nicht gäbe, würde man es nicht schreiben. Damit verewigt man sich in der Geschichte, wenn auch nur mit einer winzigen Fußnote.«
»Ähnlich denken und fühlen wir Journalisten auch«, gebe ich zu, »aber unsere Arbeit ist nicht von Dauer.«
Gruber lächelt. »Naja, es sei denn, man erhält den Pulitzer-Preis.«
Stimmt. Und schon reden wir über Philosophie, Schriftstellerei und das Leben. Jeder Kunstschaffende bringt seine eigene Welt hervor, entweder mit der Atmosphäre, die er mit seinen Werken vermittelt, oder den Themen, die er verarbeitet. Damit es funktioniert, ist eigentlich nur eine Sache wichtig: Dass man sich selbst und seiner Arbeit treu bleibt. Und schon sind wir bei den Dingen angelangt, die uns geprägt haben.
Gruber ist in der sogenannten Wickie, Slime & Paiper-Zeit aufgewachsen, wie die Österreicher die 70er Jahre nennen. Mit Fernsehserien wieRaumschiff Enterprise, Munsters, Columbo, Kobra übernehmen Sieund später dannMagnumoderMike Hammer. Er hat in den SommerferienYpsundClever & Smart-Comics gelesen, und späterMAD, als er mit der Straßenbahn zur Schule fuhr. Im Fernsehen liefen dieTarzan-Filme, und im Kino die japanischenGodzilla-Streifen. In den Tauschzentralen hat er John Sinclair- und Larry Brent-Heftromane gekauft und die Anfänge eines Stephen King und später eines Clive Barker miterlebt. Ich bin zwar einige Jahre jünger als Gruber, aber vieles habe ich in München ähnlich empfunden. Über eine Sache sind wir uns besonders einig: Was waren das noch für Zeiten, als man im Zug sitzen konnte, ohne dass Dutzende Handys klingelten!
Geprägt von all diesen Erlebnissen in seiner Jugend beschloss er, selbst zu schreiben. Vor allem auch deshalb, weil er besonders im Winter, wenn es in der Wiener Innenstadt bereits um 16.00 Uhr dunkel wurde, allein in der Wohnung eines Altbaus auf die Heimkehr seiner berufstätigen Eltern wartete. Dabei spielte seine Fantasie oft verrückt, und in seinem Kopf schwirrten unzählige beklemmende Gedanken herum. Allerdings noch unstrukturiert, denn wie er selbst sagt, fehlte ihm das Werkzeug, sie professionell zu Papier zu bringen. Später zermürbten ihn die regelmäßigen Absagen von Verlagen. Nach einigen kaum erwähnenswerten Story-Veröffentlichungen in Fanzines und Magazinen stellte sich der erste kleine Erfolg im Jahr 2000 ein, als er seinen ersten Schreibworkshop bei Andreas Eschbach besuchte und während eines Urlaubs in London die englische Creative Writing-Literatur entdeckte. Kurze Zeit später erschien sein erster ErzählbandDer fünfte Erzengelin einem Kleinverlag mit einer Auflage von 200 Stück und erzielte prompt den 4. Platz beim Deutschen Phantastik-Preis. Der nächste große Erfolg kam 2005 mit der Veröffentlichung des RomansDer Judas-Schrein, der den ersten Platz beim Deutschen Phantastik-Preis erreichte. Von da an war es nur noch eine Frage der Zeit, bis seine Romane in Großverlagen veröffentlicht wurden.
Seine stilistische Bandbreite ist groß. Mal schreibt er erfrischend witzig, kaltschnäuzig, herrlich zynisch, augenzwinkernd frech, oder setzt einfach nur eine irre Idee, ein wunderbares Bild, eine köstliche Metapher genial in Szene. Darüber hinaus schreibt er pointiert und scharfzüngig, hat schwarzhumorigen Wortwitz ohne Ende, blendende Einfälle, ist manchmal pulpig unterwegs, manchmal trashig oder schnodderig, aber trotzdem stets mit Niveau. Er weiß, worüber er schreibt, ist immer konkret, nie schwammig.
Um ihn jedoch ein wenig zu provozieren, erinnere ich ihn daran, dass er schon einige kontroverse Statements von sich gegeben hat. Ich zitiere einen Satz aus dem Grußwort seines ThrillersRachesommer, das er an die CLUB-Leser gerichtet hat.Ich zweifle an dem Geisteszustand der Menschen, wenn sie freie Schriftsteller werden wollen.
»Warum sind Sie Schriftsteller geworden?«, frage ich ihn.
Es folgt nur Achselzucken. Er will sich um die Antwort drücken. Anscheinend habe ich einen wunden Punkt berührt. Ich wäre eine schlechte Journalistin, würde ich nicht sofort nachhaken.
»In der Danksagung des RomansDas Eulentorschreiben SieJeder Thrillerautor ist ein Mörder, der für seine Taten nicht ins Gefängnis kommt«, zitiere ich ihn erneut. »Ist das einer der Gründe, weshalb Sie schreiben?«
Im Internet habe ich ein weiteres Zitat von ihm entdeckt:Schriftstellerei bedeutet für mich, dass ich interessante Figuren erfinden darf, ohne in der Psychiatrie zu landen – und Menschen auf originelle Weise ermorden kann, ohne im Gefängnis zu landen.»Schreiben Sie deshalb?«, hake ich nach.
Er lehnt sich zurück und betrachtet die untergehende Sonne, die hinter einer dunklen Wolkendecke am Horizont verschwindet. Wind kommt auf, es wird kühler.
»Warum setzt man sich stundenlang an den PC?«, fragt er mich. »Warum riskiert man eine Sehnenscheidenentzündung im Handgelenk, eine Thrombose in den Beinen, eine Ozonvergiftung vom Laserdrucker, Migräne vom Bildschirmflimmern, oder einen Herzinfarkt, weil das verfluchteWordwieder mal abgestürzt ist? Warum kämpft man verzweifelt mit HTML-Codes, weil sich die dämliche Webseite nicht updaten lässt, bekommt das Honorar für Lesungen nicht überwiesen, kommt zu Lesungsterminen, um festzustellen, dass das Mikro nicht funktioniert und die nette Buchhändlerin vergessen hat, die eigenen Bücher zu bestellen, obwohl man ihr bereits dreimal alle Titel und ISBN-Nummern gemailt hat? Warum reißt man sich täglich den Arsch auf, um die Texte wiederholt zu überarbeiten, bis sie einem wie ausgelutschte Spaghetti aus dem Hals hängen, obwohl man mittags lieber ins Freibad, nachmittags auf ein Grillfest oder abends mit Freunden ins Kino gehen möchte? Warum leiert man sich jede Woche von neuem ein interessantes Posting für Facebook aus den Gehirnwindungen? Warum hängt man stundenlang mit Kopfhörern im Skype, um sich von seinem Literatur-Agenten volllabern zu lassen, weil das neue Manuskript ein Crossover-Projekt ist, das sich in keine Schublade einordnen lässt, aber der Folgeentwurf, der sich zwar schubladisieren lässt, zu wenig erfrischend und originell ist?«
Ich bin von diesem emotionalen Ausbruch ein wenig vor den Kopf gestoßen, aber Gruber starrt nach wie vor zum dunklen Horizont und redet weiter, als führe er Selbstgespräche. »Wie oft habe ich den Satz bereits gehört?Ihr Manuskript ist gut und originell. Nur sind die guten Teile nicht originell, und die originellen nicht gut.«
Er sieht mich an. »Laut Studie wissen wir, dass achtzig Prozent aller Leser Frauen sind. Also brauchen wir starke weibliche Helden. Wir brauchen eine sexy Location und Charaktere mit Ecken und Kanten, aber frei von jedem Klischee.«
»Sie haben den Dreh doch herausgefunden«, widerspreche ich ihm. »Immerhin leben Sie mittlerweile von der Schriftstellerei.«
»Ja, schon.« Er zuckt mit den Achseln.
Gruber ist, nach seiner eigenen Einschätzung, heute auf seinem absoluten Höhepunkt. Er schreibt zwar weniger als früher, dafür aber besser und intensiver. Die Antwort, warum er das tut, ist er mir aber immer noch schuldig geblieben.
Mittlerweile wird es dunkel und die schwarzen Regenwolken schieben sich über das Grundstück. Es beginnt zu nieseln. Ich habe noch etwa eine Stunde Zeit, bevor ich mit dem Auto wieder nach München fahren möchte. Wir schleppen also die Korbstühle in die Hütte neben dem Carport, raffen Manuskript, Laptop und Schreibmaschine von William S. Burroughs zusammen und flüchten ins Haus. Drinnen riecht es nach kaltem Kaffee. Gruber bemerkt meinen Blick und bietet mir Kaffee aus seiner neuen Nespressomaschine an. Auf dem Weg in die Küche kommen wir an einer Holzkommode vorbei, auf der eine altertümliche Schreibmaschine unter einem Glassturz steht.
Angeblich hat H. G. Wells 1893 auf diesem Gerät in London die Rohfassung des ManuskriptsDie Zeitmaschinegetippt. Ich wage nicht zu fragen, wie viel diese Schreibmaschine gekostet hat, denn womöglich ist es eine Fälschung.
Wir gehen ins Wohnzimmer, mit Kaffeetassen und einem Stück Kuchen, den Grubers Ehefrau gebacken hat, wie er mir erklärt. Sie verbringt ein Wellness-Wochenende in der Therme, während Gruber an einem Manuskript arbeitet.
Wir setzen uns, Gruber in einen großen Fauteuil mit Armlehnen, ich auf die Couch. Das Diktafon liegt auf dem Tisch.
»Apropos H. G. Wells«, greife ich das Thema wieder auf. »Sie schreiben doch auch Science-Fiction-Storys …«
Er winkt sogleich ab. »Ja, es erweckt den Anschein. Richtig ist jedoch, dass ichHorror-Storys oder – wenn Sie so wollen – unheimliche phantastische Storys schreibe, in die ich mitunter Science-Fiction-Elemente einbaue. Ich vermische die Genres gern, um den Leser aufs Glatteis zu führen. Manchmal ist es auch notwendig, um einzelne Storys in Science-Fiction-Magazinen unterzubringen. Aber lieber höre ich, dass ich Phantastik-Erzählungen schreibe.«
»Und Ihr neuer ErzählbandNorthern Gothicenthält Phantastik-Storys?«
Er nickt. »Dreizehn Stück, aber nur eine davon ist eine Erstveröffentlichung. Sonst lauter überarbeiteter alter Kram.« Er denkt kurz nach. »Anna, Sie sagten doch vorhin, Sie wollten ebenso wie manche Autoren unsterblich sein.«
Ich streite es nicht ab.
»Wollen Sie mal Teil einer meiner Geschichten werden?«, fragt er.
»Wie? Ich als Person?«
Gruber nickt. »Ich baue Sie in eine meiner Storys ein.«
Ich werde neugierig. »Wie soll das funktionieren?«
»Ganz einfach.« Er rückt näher zu mir. »Ich arbeite gern in jenem Graubereich, wo Realität und Fiktion ineinander verschwimmen. Ich führe den Leser gern ins Ungewisse, und kaum bemerkt er, dass etwas faul ist, findet er sich schon mitten in einer phantastischen Story wieder.«
Ich weiß zwar nicht ganz, worauf er hinaus will, aber der Gedanke ist reizvoll.
Er lehnt sich zurück. Sein Gesicht verschwindet im Schatten der Stehlampe. »Vielleicht sind Sie – so, wie Sie hier sitzen – gar nicht mehr real, sondern bereits Teil einer meiner Geschichten.«
Ich hebe die Schultern. »Ja, vielleicht.« Wäre er kein Autor, hätte er vermutlich nicht solche Ideen. Ich nippe an meinem Kaffee. »Ich würde gern das Thema wechseln und über etwas anderes reden.«
Gönnerhaft hebt er die Hand. »Wie Sie wollen – ist Ihr Vorwort.«
Plötzlich läutet das Telefon auf der Kommode neben dem Lehnstuhl.
»Entschuldigen Sie bitte.« Er hebt ab und lauscht eine Weile. Es folgt eine Reihe vonJasundNeinsundVielleichtsundWarums, dann erst entwickelt sich ein Gespräch. Offensichtlich spricht er entweder mit seinem Literatur-Agenten oder mit einem Filmproduzenten. Es geht um die Verfilmung seiner beiden ThrillerTodesfristundTodesurteil. Die beiden Bücher haben sich in Summe über 300.000 Mal verkauft, wie ich dem Gespräch entnehme. Eine deutsch-französische Filmproduktion ist auf den Stoff aufmerksam geworden. Übersetzungen in den italienischen und französischen Sprachraum mit einer Startauflage von je 50.000 Exemplaren sind angedacht. Gruber fühlt sich wohl in dieser Rolle. Seine Stimme klingt anders. Ein wenig selbstverliebt, eine Spur selbstgefällig. Während der ganzen Zeit läuft mein Diktafon mit. Manchmal schielt er zu mir, ob ich zuhöre und wie ich reagiere. Ich frage mich, ob er diesen Ton ebenfalls angeschlagen hätte, wenn er allein im Zimmer gewesen wäre?
Endlich legt er auf. Zufrieden lässt er die Fingerknöchel knacken. Im Wohnzimmer leuchtet bloß die Stehlampe hinter ihm und formt seine im Fauteuil sitzende Gestalt zu einer düsteren Silhouette. Draußen herrscht bereits tiefschwarze Nacht. Eigentlich wollte ich schon längst losfahren, aber die Zeit ist wie im Flug vergangen.
»Worüber wollten Sie sprechen?«
»Ja, also …« Ich starre auf das Telefon, und da verschlägt es mir die Sprache, als ich bemerke, dass das Kabel gar nicht in der Buchse an der Wand steckt, sondern lose auf dem Teppich liegt. »Ich würde gern mit Ihnen über die Ursache Ihres Erfolgs sprechen«, sage ich und versuche, mir nichts anmerken zu lassen. »Über die Creative Writing-Workshops, die Sie besucht haben und die Techniken und stilistischen Tricks, die Sie verwenden.«
Zum ersten Mal an diesem Tag erlebe ich ihn unsicher. Ich merke, dass er nicht über dieses Thema sprechen will. Ich bleibe jedoch hartnäckig und frage ihn, woran er erkennt, dass ein bestimmter Text funktioniert. Meiner Meinung nach ist das genauso wichtig, wie die Frage, warum ein gewisser Textnichtfunktioniert. Was sind die Dreh- und Angelpunkte einer Geschichte? Wie erkennt man Widersprüche im Text? Mit welchen Tricks fesselt man seine Leser? Woran merkt man, dass zu viel erklärt wurde? Wann braucht eine Geschichte mehr Details, und wann ist es besser, weniger zu zeigen?
Gruber blickt mich ratlos an. Die Situation erscheint mir ein wenig surreal. Warum täuscht er auf einmal diese Unwissenheit vor? Ich frage ihn weiter. Wie werden Plot-Points, emotionaler Wendepunkt, Cliffhanger und Showdown effektvoll inszeniert? Wie vermeidet man Füllwörter, Floskeln und Klischees? Stärkt eine Metapher den Text oder schwächt sie ihn? Wie werden Charaktere anschaulich in die Geschichte eingeführt, und woran merkt man, dass Dialoge packend geschrieben sind? Wie funktioniert es, dass der Leser nicht den Autor vor sich sieht, der die Geschichte erzählt, sondern selbst in die Erzählperspektive der Geschichte eintaucht?
Ich habe mich in Rage geredet. Indessen blickt Gruber mich aus dunklen Augen an. Sogar seine Iris ist schwarz, wie bei einer Katze, die zornig wird, weil man sie am Schweif gezogen hat. Womöglich habe ich es mit meinen Fragen übertrieben, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass er über kreative Schreibtechniken nichts weiß. Falls ich Recht haben sollte, frage ich mich, wie er mit seinen Büchern erfolgreich werden konnte?
»Wollen Sie die Wahrheit hören?«, fragt er mich plötzlich.
»Natürlich, deswegen bin ich hier. Schließlich soll es ein ehrliches Vorwort für Ihr Buch werden.«
»Ich habe keine Creative Writing-Bücher gelesen.«
»Tatsächlich?«
»Kein einziges.« Er muss meinen entsetzten Blick bemerkt haben, denn rasch fügt er hinzu: »Ich schreibe intuitiv.«
»Aber in der Danksagung zuRachesommerhaben Sie geschrieben …« Ich blättere in meinen Unterlagen und dann zitiere ich ihn aus seinem eigenen Buch.Last but not least gilt mein Dank Dr. Uwe Neumahr von der AVA-International, der mich knapp zwei Jahre lang unermüdlich betreut und mit mir die unterschiedlichsten Exposé-Entwürfe durchgekaut hat, bis wir diesen Stoff fanden. Während dieser Zeit gab er mir zahlreiche Tipps und Ratschläge, unterbreitete mir Verbesserungsvorschläge und versorgte mich mit Material und Buchempfehlungen, sodass ich an manchen Tagen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sah.
»Stimmt, das habe ich geschrieben, aber es war eine Lüge. Die Leser wollen so etwas hören, also gebe ich es ihnen. In Wahrheit war es anders, und ich habe nichts davon gelesen.«
Ich schiele zum Diktafon. »Wollen Sie, dass ich das so veröffentliche?«
Er hebt die Schulter. »Weiß nicht, darüber reden wir später noch, einverstanden?«
Schlagartig herrscht eine merkwürdige Stimmung zwischen uns. Offensichtlich ist es ihm unangenehm, dass ich seine Aussagen der letzte Jahre als Lüge entlarvt habe.
»Wie kann man erfolgreich sein, wenn man nicht weiß,wieman schreibt?«, frage ich ihn. Schließlich komme ich als Journalistin aus einem ähnlichen Fach und weiß, worüber ich rede.
»Für den Erfolg muss man sich eben dahinterklemmen«, sagt er.
»Ich kenne Schriftsteller, die in jedem Forum mit gefakten E-Mail-Adressen Werbung für ihre eigenen Bücher machen. Sie nominieren sich selbst für Literaturpreise und bieten im Gegenzug zu positiven Besprechungen ihrer Werke positive Kritiken anderer Werke an. So jemand sind Sie doch nicht!«
Er reagiert nicht.
»Ich beobachte Ihre schriftstellerische Tätigkeit nun schon seit fast zehn Jahren. Soweit ich Sie einschätze, scheren Sie sich einen Dreck um Werbung, Rezensionen, Literaturpreise und Verkaufsränge.« So ähnlich hatte ich es in meinem ArtikelDer Stephen King der deutschen Horrorliteraturformuliert.Gruber schreibt das, was ihm durch den Kopf geht, was ihn beschäftigt und bewegt, egal welcher Trend gerade vorherrscht, ehrlich und direkt, ohne sich davon beeinflussen zu lassen, ob es dafür überhaupt einen Markt gibt.
»Wie naiv sind Sie eigentlich?“, fragt er mich. »Glauben Sie allen Ernstes, man hat Erfolg, wenn man nicht selbst etwas nachhilft?«
»Ja, das glaube ich.«
»Sie tun mir leid.«
»Aber Ihre Bücherhabensich doch sensationell verkauft«, widerspreche ich ihm. »Todesfristhielt sich bei Amazon über zwei Jahre lang unter Verkaufsrang 100.«
»Nachher können Sie einen Blick in den Carport werfen, dort lagern einige Tausend Exemplare.«
Mir bleibt die Luft weg. »Aber die vielen guten Rezensionen?«
»Habe ich alle selbst geschrieben.«
»Aber Sie haben zweimal den renommiertenDeutschen Thriller-Preisgewonnen.«
»Hat mich etwa fünfhundert Euro gekostet – pro Juror. In der Jury saßen sieben davon. Einer weigerte sich, das Geld zu nehmen, drei verlangten das Doppelte. Ich musste wieder einmal meinen Kreditrahmen überziehen.«
Plötzlich ist es unerträglich schwül im Haus. Draußen donnert und regnet es, und ich wische mir den Schweiß von der Stirn. »Aber warum das alles?«
Er breitet die Arme aus. »Sehen Sie sich um. Die Vitrinen, die Gemälde, der Kristallleuchter. Meine Frau geht nicht gerade zimperlich mit Geld um. Das alles muss irgendwie bezahlt werden! Beantwortet das Ihre Frage?«
»Aber Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie müssen nicht vom Schreiben leben können. Diesen zusätzlichen Druck brauchen Sie nicht.«
»So etwas hören die Leser immer gern. Es klingt nicht so verkrampft wie die Wahrheit.«
Ich blättere in meinen Unterlagen nach einem weiteren Zitat. »In der Danksagung Ihres ThrillersTodesfristschreiben Sie unter anderem …Ich bin davon überzeugt, frei nach William Faulkner, dass es bei der Schriftstellerei nicht um Ruhm und schon gar nicht um Gewinn geht, sondern darum, aus dem Material des menschlichen Geistes etwas zu schaffen, das vorher nicht existiert hat.« Ich mache eine Pause. »Ist das etwa auch gelogen?«
»Macht nicht jeder Autor gern Karriere?«
»Aber um welchen Preis?«, stelle ich die Gegenfrage. »Zu Beginn unseres Gespräches behaupteten Sie noch, man müsse sich selbst treu bleiben.«
»Hören Sie, Anna. In einer Gesellschaft wie der unsrigen wird jeder, der sich selbst treu bleibt, elend verhungern.Dasist die Wahrheit!«
Ich schalte das Diktafon aus. »So, wie Sie das alles formulieren, kann ich es unmöglich in dem Vorwort bringen.«
»Wahrscheinlich nicht. Trotzdem ist es die Wahrheit.« Er nippt an seinem Glas Caipirinha. Die Eiswürfel klicken aneinander.
Ich blicke mich um. »Sie hatten doch einen Kaffee.«
»Welchen Kaffee?«, fragt er.
Ich schaue auf den Tisch. Statt des Kuchentellers steht dort eine Flasche Zuckerrohrschnaps.
»Wohin ist die Kaffeetasse verschwunden?«, möchte ich wissen.
»Welche Tasse?« Er schüttelt den Kopf. »Wollen Sie wirklich mal Teil einer meiner Geschichten werden?«, wiederholt er seine Frage von vorhin.
»Ja, sicherlich.« Tatsächlich bin ich mir aber nicht mehr sicher.
»Sie wirken verwirrt.«
Ich bleibe ihm die Antwort schuldig.
»Sie haben vorhin den emotionalen Wendepunkt einer Story erwähnt.« Er lehnt sich zurück und denkt nach. »In der Mitte einer Geschichte ändert sich die Situation dramatisch. Ist doch richtig so, oder? Der Jäger wird zum Gejagten, ehemalige Freunde beginnen sich zu hassen. Langsam beginnt der Protagonist zu ahnen, worum es wirklich geht. Lose Enden fügen sich zusammen und ergeben eine neue Richtung.«
Unwillkürlich blicke ich zum Telefonkabel, das ausgesteckt auf dem Teppich liegt.
»Wenn ich die Zeit betrachte, wie lange das Interview bereits gedauert hat«, fährt er fort, »dann hätten wir jetzt – würden wir uns in einer Story befinden – den emotionalen Wendepunkt erreicht. Stimmen Sie mir zu?«
»Ja«, krächze ich.
»Sie sehen blass aus«, stellt er fest. »Kommen Sie mit, vertreten wir uns die Beine. Ich zeige Ihnen etwas.«
Ich bin nicht sicher, ob ich das sehen will. Als er sich aus dem Fauteuil erhebt, bemerke ich eine kleine schwarze Box mit einem roten Knopf neben der Armlehne. Ein Kabel verläuft entlang des Lehnstuhls und endet im Telefon. Würde ich auf diesen Knopf drücken, würde das Telefon dann läuten? Falls ja, wozu hat er mir das Telefonat vorgegaukelt? Wollte er mich mit dieser Prahlerei nur beeindrucken?
»Kommen Sie!«
Auf dem Weg durchs Wohnzimmer kommen wir an einer Kommode vorbei, auf der eine weitere Schreibmaschine unter einem Glassturz steht. Es ist ein französisches Modell, das aussieht, als stamme es aus einem Steampunk-Universum. Gruber bemerkt mein Interesse.
»Auch eine Antiquität, auf die ich stolz bin«, gesteht er. »Darauf hat Jules Verne 1863 in ParisDie Reise zum Mittelpunkt der Erdegeschrieben. Aber das schönste Stück meiner Sammlung befindet sich im Keller.« Er öffnet eine Tapetentür in der Wand und legt einen Kippschalter um. Eine Neonröhre flackert auf und wirft ihr Licht auf eine enge Betontreppe, die in den Keller führt.
Er geht voraus. Seine Schritte hallen gedämpft an den Wänden wider. Ich bleibe verunsichert am Treppenabsatz stehen.
»Kommen Sie schon«, fordert er mich auf. »Sie wollten doch wissen, wie man erfolgreiche Bücher schreibt, ohne etwas über das Handwerk des Schreibens zu wissen. Ich zeig es Ihnen.«
Langsam folge ich ihm. Auf halbem Weg fällt mir ein, dass ich das Diktafon im Wohnzimmer liegen gelassen habe. Als ich mich umdrehe, sehe ich, wie die Kellertür langsam ins Schloss fällt. Das Geräusch hört sich an, als schnappe ein Riegel zu. Da fällt mir ein, was Gruber einmal in einem Interview über die dunkelste Stunde des Helden gesagt hat.Im letzten Drittel einer Geschichte darf nichts mehr zufällig sein, wie zu Beginn, wo sich alles vielleicht sogar durch einen dummen Zufall entwickelt hat. Die weitere Handlung muss von den zuvor eingeführten Details logisch ableitbar sein. Kurz vor dem Showdown schlittert der Protagonist in die schrecklichste aller Lagen. Obwohl sich das Schicksal ohnehin gegen ihn verschworen hat, verpasst es ihm am Schluss noch einen weiteren schweren Schlag, der seinen letzten Hoffnungsschimmer auf Nimmerwiedersehen zu Nichte macht. Alles scheint verloren.
»Ein dummer Zufall, dass ausgerechnet Ihr Literaturmagazin eingestellt wurde«, sagt Gruber. »Andernfalls wären Sie jetzt nicht hier.«
»Gibt es in Ihren Geschichten oft ein Happy End?«
Er lacht amüsiert auf. »Ein Happy End?«
Was für eine blöde Frage. Ich kenne seine Storys. Da kommt fast niemand heil davon.
Am Ende der Treppe liegt ein enger Raum. Es stinkt nach Öl, Kordit und Schwefel. Bleigrauer Dampf liegt in der Luft. Ticken, Hämmern und Saug- und Pumpgeräusche erfüllen das Zimmer. Auf einem Tisch steht ein mit Dampf betriebener Schreibapparat. Die Typen hämmern unermüdlich aufs Papier. Die Endlosrolle wird automatisch über die Walze gezogen. Kleine Amplituden springen auf und ab. All das hängt an einem mächtigen schwarzen gerippten Kunststoffschlauch.
»Was zum Teufel ist das?«, entfährt es mir.
»Der automatische Schreibapparat von William Gibson. Darauf hat erNeuromancergeschrieben. Ich habe die Maschine im Jahr 2000 bei einer Auktion in London erworben.«
»In jenem Jahr, als Sie erfolgreich wurden.«
Er zwinkert mir zu. »Gut recherchiert.«
»Danke.« Doch anscheinend nicht gut genug, andernfalls wäre ich nicht nach Grillenberg gefahren, um einen Autor zu besuchen, der Horror-Storys schreibt. »Womit wird dieser Apparat angetrieben?«
»Mit Literaturkritikern, Journalisten und Rezensenten.«
»Sie machen Scherze?«
Gruber bleibt ernst. Er tritt zur Seite und öffnet einen Metallschrank mit länglichen Belüftungsschlitzen. In der Dunkelheit sehe ich fünf ausgemergelte Körper, die wie Jacken in einem Kleiderschrank an Dioden und Drähten hängen.
Der Showdown kann kommen … aber ohne mich! Ich drehe mich um und laufe zur Treppe.
»Halt, nicht so rasch«, ruft Gruber mir nach. »Sie wollten doch Teil einer meiner Storys werden.«
Ich laufe weiter und bin bereits auf den ersten Stufen. Da drehe ich mich noch einmal kurz um, voller Panik, da ich jede Sekunde damit rechne, dass er mich einholt und an der Hand packt. Doch Gruber steht gelassen neben dem Metallschrank und lächelt. Warum schaut er so zufrieden? Fast schon besessen. Irre!
»Nein, ich habe es mir anders überlegt.«
»Zu spät. Sie hätten den Kaffee nicht trinken sollen …« Er greift nach mir. Seine Hand und die Finger werden unendlich lang und es scheint, als würden sie mich zurück in den Raum ziehen.
Schießerei am O.K. Corral
SeitZombielandundThe Walking Deadhaben Romane, Filme und Comics über Zombies wieder Hochkonjunktur. Gut so! Ich bin ein Fan dieser lebenden Toten, und als mir der Wiener Autorenkollege Stefan Cernohuby erzählte, dass er eine Horror-Western-Anthologie in einem Kleinverlag herausgeben wolle und mich um einen Beitrag bat, war ich sofort Feuer und Flamme. Und noch etwas war mir im selben Augenblick klar: Ich würde eine Westernstory mit Zombies schreiben. Als alter Tombstone- und Wyatt Earp Fan war mir auch sofort klar, wo und wann diese Geschichte spielen würde.
Mehr möchte ich Ihnen nicht verraten. Bewaffnen Sie sich mit Sporen, Colt und Patronengurt und reiten Sie gemeinsam mit mir in den Sonnenuntergang …
DIE EINWOHNER VON TOMBSTONE warfen uns vor, unsere Vormachtstellung auszunutzen. Die Croupiers würden das Glücksspiel in den Saloons manipulieren und mehr als bloß ein Auge zudrücken, wo es uns in den Kram passte. Manche nannten unsDienstmarken tragende Zuhälter. Nun, vielleicht lagen sie damit nicht einmal falsch.
Ich habe mich als Bergmann, Glücksspieler und Saloonbesitzer durchs Leben geschlagen, als junger Bursche in der Unionsarmee im Bürgerkrieg gekämpft, später Alkohol geschmuggelt, Schulden gemacht und Steuern hinterzogen – Letzteres nicht zu knapp! Ich habe Maisfelder bewirtschaftet, während eines Viehtrecks nach Fort Laramie gegen Indianer gekämpft und dabei bis zu den Hüften in Blut und Scheiße gestanden. Ich bin mit Wild Bill Hickok in Kansas auf Büffeljagd gewesen und habe als Postkutschenfahrer gearbeitet, wurde dreimal angeschossen, habe Versorgungsgüter für den Bau derUnion Pacific Railroadtransportiert und bin Ringrichter bei Boxkämpfen gewesen. Yessir! All das habe ich gemacht! Was erwarteten Leute, die so jemanden zum Deputy Sheriff wählten? Einen bibelfesten Samariter? Natürlich war ich kein Heiliger – und meine Brüder schon gar nicht.
Mein Name ist Wyatt Earp, ich wurde in Illinois geboren und war ein wilder Hund. Yessir! Aber eine Sache veränderte mich: Ich heiratete meine große Liebe Urilla Sutherland. Mit meiner Hochzeit schwor ich dem üblen Leben ab. Ich kaufte ein Haus und wurde sesshaft. Doch schon bald darauf starb Urilla an Typhus. Es ist die Hölle, so zu krepieren. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen und denke heute noch oft an sie. Seitdem hasse ich Ärzte – bis auf einen, aber davon erzähle ich Ihnen später. Nach Urillas Tod arbeitete ich als Polizist in Lamar, stellvertretender Marshal in Dodge City und Deputy Sheriff in Pima County. Mein Bruder Virgil, der alte Hundesohn, wurde U.S. Marshal in Tombstone, und damit begann der ganze Ärger.
Meine Brüder und ich hatten einige Claims für Silberminen abgesteckt. So wurden Virgil, Morgan und ich reich, aber das passte einigen Leuten in Tombstone nicht – vor allem den Clantons und McLaurys, üble Burschen, die uns schon lange im Visier hatten.
Die McLaurys hatten der U.S. Army aus Camp Rucker eine Herde Maultiere gestohlen und Virgil hatte die Mistkerle dabei überrascht, als sie dasUS-Brandzeichen in einD8ändern wollten. Kurz darauf waren die Clantons, die eine Ranch in der Nähe von Charleston besaßen, durch die Stadt geritten und hatten einen kräftigen, schönen Rappen dabei. Meinen! Er war mir ein Jahr zuvor gestohlen worden. Einem Mann einen Gaul zu klauen ist wirklich das Letzte! Ab da begannen die Feindseligkeiten zwischen unseren Familien, und die Spannung wuchs bis zum heutigen Tag.
Vor einigen Stunden, am Morgen dieses 26. Oktobers 1881, verhaftete Virgil den verfluchten Hurensohn Ike Clanton, weil er wieder einmal im Saloon randaliert hatte, nahm ihm seine Knarre ab und verdonnerte ihn zu einer Geldstrafe von 25 Dollar. Eine Kleinigkeit für Ike, da er sich als Viehdieb ständig einen Batzen Geld ergaunerte. Als Ike das Gerichtsgebäude verließ, schwor er Rache an U.S. Marshal Virgil Earp, seinen Brüdern und Freunden. Er drohte damit, uns alle zu töten. Das schloss natürlich mich und sogar den Doc mit ein.
Gegen Mittag erhielt ich ein Telegramm von Sam Carpenter aus Yuma. Der alte Sam schrieb, dass die beiden Spießgesellen Tom und Frank McLaury sowie Ike Clantons Bruder Bill vom nördlich gelegenen Grand Lake den Colorado River runter geritten waren. Eine üble Gegend, aus der man nichts Gutes hört, wenn man den Ute-Indianern Glauben schenkt. Sam Carpenter hatte zudem erfahren, dass die Geächteten den alten Indianerfriedhof geplündert hatten. Vor ein paar Tagen hatten sie den Grand Canyon verlassen und befanden sich seitdem über Tucson auf dem Weg nach Tombstone. Angeblich sahen sie furchterregend aus. Vermutlich würden sie am Nachmittag hier eintreffen.
Ich wusste nicht, ob die beiden Familien weitere Mörder, Viehdiebe oder Gesetzlose um sich scharen konnten, aber ich rechnete mit mindestens fünf bis sechs Mann … und heute würde der langjährige Familienstreit endlich ein Ende finden.
Um halb drei Uhr nachmittags füllte ich die Trommel meinerBuntline Specialund steckte sie ins Holster. Der ColtSingle Actionmit den hölzernen Griffschalen hatte einen besonders langen Lauf und eine dementsprechend große Reichweite. Die würde ich heute garantiert brauchen. Ich zog den Hut ins Gesicht, schlüpfte in den schwarzen Mantel und betrat die Fremont Street. In Tombstone, Arizona, war es kühl an diesem Tag. Wenn sie mich heute abknallten, konnten sie mich mit den frisch polierten Stiefeln, der schwarzen Hose, der goldenen Uhrkette und dem gestärkten weißen Seidenhemd gleich so in die Holzkiste legen. Sie brauchten mich nicht einmal zu rasieren oder mir die Nägel zu schneiden. Ich war bereit, Urilla im gottverdammten Himmel zu treffen.
Auf dem unbebauten Grundstück im Block 17 lag ein Mietstall, der O.K. Corral. Von hier hatte man eine gute Sicht nach Norden. Dort traf ich auf Morgan und Virgil. Meine Brüder hatten sich ebenso fein rausgeputzt. Vermutlich rechneten auch sie damit, nicht mehr aufzustehen, wenn die Kugeln flogen und unsere Körper in den trockenen Sand fielen. Virgils Marshal-Stern funkelte in der Nachmittagssonne. Er sprach kein Wort.
Morgan spuckte auf den Boden. Er trug den Hut tiefer als sonst. Seine Gesichtszüge lagen im Schatten. »Die sind überfällig«, sagte er.
»Die rotten sich zusammen«, antwortete Virgil. Seine Stimme klang trocken. »Heute bringen wir es zu Ende.«
In weiter Ferne hörte ich ein Pferd wiehern. Aus dem Dunkel der Scheune trat ein Mann. Ein hoch gewachsener, dürrer, aschblonder Kerl. Der Doc zog ein steifes Bein hinter sich her und war mehr tot als lebendig, schwer durch Tuberkulose gezeichnet und abgefüllt mit Alkohol, damit seine Hände nicht zitterten. Er sagte nichts, als er neben mich trat. Ich merkte nur, wie Virgil erleichtert die Schultern sinken ließ und Morgan tief durchatmete. Offenbar schickten sie soeben einen Dank an den Himmelvater, der ihre Stoßgebete erhört hatte.
Der Doc war der kühnste, schnellste und tödlichste Mann mit einer Waffe, den ich jemals gesehen hatte. Und er war mein Freund. Yessir!
John Henry Holliday aus Georgia, dessen Ma, Gott hab sie selig, ebenfalls elend an Tuberkulose krepiert war, hatte mir schon zweimal das Leben gerettet. Im September ´78 hatte er mich in Dodge City aus einem Hinterhalt freigeschossen, und mir ein zweites Mal während einer Schießerei mit Bat Masterson in einem Varieté die Haut gerettet.
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er sich heute zu uns gesellen würde, aber er tat es, denn irgendwie steckte er in der Sache mit drin. Als wir nach Tombstone gekommen waren, hatte er sich an unserem Silberminengeschäft beteiligt und wurde dadurch in den Krieg gegen die McLaurys und Clantons hineingezogen. Wahrscheinlich bereitete ihm aber auch die Vorstellung Freude, die verfluchten Hurensöhne abzuknallen. Dabei war der Doc kein schießwütiger Kojote. Er hatte das Valdosta Institute besucht, Mathematik, Geschichte, Latein, Französisch und Griechisch studiert, später in Philadelphia sogar noch den Doktortitel gemacht. Tatsache! Eine Zeit lang hatte er als Zahnarzt in Atlanta praktiziert. Erst als auch er an Tuberkulose erkrankt war, zog er in ein trockeneres Klima. Dort begann er zu trinken und professionell Poker zu spielen. Der alte Hundesohn war gut darin und finanzierte sich so seinen Lebensunterhalt. In Dodge City lernten wir uns dann kennen – und dank ihm war ich noch am Leben.
Fragte sich nur noch, wie lange …
Kurz nach drei Uhr knirschten Schritte hinter uns. Wir fuhren herum und sahen eine Staubwolke. Die Schatten mehrerer Männer kamen langsam hinter der Scheune hervor. Im nächsten Moment erkannten wir sie. Sie waren zu fünft, schwer bewaffnet, mit zwei Colts an jedem Gürtel.
Frank McLaury, Tom McLaury, Ike Clanton, Bill Clanton und Billy Claiborne. Sie waren um einen mehr als wir und hatten die Nachmittagssonne im Rücken. Doch wir hatten den Doc an unserer Seite.
Niemand sagte ein Wort – es gab auch nichts zu reden. Jeder wusste, dass er den anderen tot sehen wollte. Frank McLaury zog als Erster. Noch bevor er den Hahn gespannt hatte, lagen schon beide Colts schussbereit in Docs Hand. Wir zogen wie die Teufel.
Ich hörte das Krachen. Die Kugeln zischten vorbei, schlugen hinter mir ins Holz und fuhren neben mir dumpf in die Körper von Virgil, Morgan und den Doc. Niemand taumelte zurück, niemand gab einen Laut von sich. Jeder drückte den Abzug seiner Colts. Das Krachen nahm kein Ende. Schon nach wenigen Augenblicken waren wir in eine stinkende und beißende Rauchwolke eingehüllt. Der Doc trat durch den Nebel nach vorne. Ich folgte ihm. Auf meiner anderen Seite gingen Virgil und Morgan zu Boden. Trotzdem schossen sie weiter.
Schon bald konnte ich nichts mehr sehen, aber ich war sicher, Frank McLaury in die Brust, Bill Clanton in die Schulter und Ike Clanton mehrmals in den Bauch getroffen zu haben. Es kam mir vor wie Stunden, doch das Ganze hatte sich in höchstens einer halben Minute zugetragen. Schnell waren die ersten Trommeln leer. Es klickte. Gut an die fünfzig Schuss waren gefallen.
Der Doc und ich standen noch. Meine Brüder lagen verletzt im Sand. Billy Claiborne suchte das Weite. Er lief geradewegs in den Sonnenuntergang auf die freie Prärie zu. Der Doc zielte und schoss, verfehlte ihn jedoch. Und dann hatte auch er keine Patrone mehr. Virgil erhob sich als Erster. Er hatte eine Kugel im Bein und eine in der Schulter. Morgan blutete am Handgelenk. So viel ich durch den Rauch sehen konnte, fehlten ihm zwei Finger. Auch er humpelte, nachdem er sich erhoben hatte. Außerdem blutete er übel aus einer Wunde am Hals.
Als sich die Pulverwolke verzog, sahen wir die McLaury- und Clanton-Brüder im Staub liegen. Keiner rührte sich. Der Doc ging zu ihnen. Während er mit dem Stiefel Frank McLaury in die Seite stieß, füllte er die Trommel seines Colts mit Patronen aus seinem Gürtel.
Er grinste. »Gute Arbeit, meine Herren. Wir haben die Scheißkerle er…«
Da schoss Frank McLaurys Oberkörper in die Höhe. Sein Schädel fuhr herum und biss den Doc durch den Stiefel ins Bein. Der Doc schrie auf und ließ die Waffe fallen. Die Patronen tanzten über McLaurys Kopf und fielen in den Sand. Der Doc wollte weghumpeln, doch Frank hatte sich so in seine Wade verbissen, dass der Doc den Körper hinter sich her schleifte.
Ich hatte bereits nachgeladen und verpasste Frank zwei Kugeln in den Kopf. Er zuckte, und sein Kiefer flog davon. Sein Körper bäumte sich auf. Auch die Arme und Beine der anderen Kerle fuhren durch den Sand, als wären sie an eine galvanische Zelle angeschlossen. Virgil und Morgan hatten ebenfalls nachgeladen und eröffneten das Feuer auf die Hurensöhne. Sie pumpten jede Menge Blei in ihr Fleisch. Bald gab keiner auch nur einen Mucks von sich.
Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn. Noch nie zuvor hatte ich so hartnäckige Mistkerle gesehen.
»Heilige Scheiße, Jesus und Maria«, fluchte der Doc, als er seinen Stiefel begutachtete. Franks Zähne steckten noch im Leder. Sie hatten ein faustgroßes Loch hineingerissen. Die Finger des Docs waren blutig, nachdem er sie auf die Wunde gelegt und dabei das Gesicht verzogen hatte.
Virgil und Morgan humpelten näher, um unser Werk zu betrachten. Wir waren nicht stolz auf das, was wir angerichtet hatten. Die Leichen waren mehr zerfetzt als nötig. Aber wir hatten diesen Krieg nie gewollt. Ich starrte in Bill Clantons tote Augen. Die Pupillen waren nur stecknadelkopfgroß und so rot wie die untergehende Sonne. Ich hatte schon vielen Leichen die Augen geschlossen, aber noch nie so etwas Grauenvolles gesehen.
Der Doc ging zu Boden, um seinen Colt und die Patronen aufzuheben. Dabei hielt er einen respektablen Abstand zu den Toten.
»Mögen ihre Seelen in Frieden ruhen«, sagte Virgil. »Doc Holliday, schließ ihnen die Augen!«
»Du kannst mich mal!«, fluchte der Doc. »Ich fasse garantiert keinen von denen an. Sieh dir bloß die Augen dieser kranken Scheißkerle an!«
Ich konnte es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, der Doc hatte das gleiche Telegramm von Sam Carpenter erhalten wie ich und seine Aussage bezog sich auf den indianischen Friedhof beim Grand Lake.
Der Doc erhob sich und drehte sich zu uns. Die Sonne blendete uns, daher bemerkte ich nicht sofort, dass sich Bill Clanton aus dem Staub erhob. Ich sah ihn erst, als er hinter dem Doc stand und seine verfaulten Zähne in dessen Hals schlug.
Der Doc ging sogleich zu Boden. Virgil, Morgan und ich schossen auf den verfluchten Hurensohn, der sich in Docs Nacken verbissen hatte. Wir ballerten jeder eine volle Trommel in Bill Clanton. Doch erst als Virgil mit dem Stiefel gegen Bills Kopf trat, ließ er los und fiel offensichtlich tot um.
»Verdammte Kacke, Jesus und Maria, so ein Bullshit!«
Der Doc kroch auf allen Vieren fluchend durch den Sand. Blut lief ihm in langen Fäden vom Hals. Es sah zu komisch aus, aber uns war nicht zum Lachen.
Ich sage die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Durch die Rauchwolke sah ich, wie sich die Körper der anderen drei Leichen erhoben. Ich packte den Doc am Kragen seines Ledermantels und zerrte ihn weg. Virgil lud seinen Revolver und eröffnete erneut das Feuer. Eine Minute später hatten wir keine Patronen mehr in unseren Gürteln.
Zu jenem Zeitpunkt kamen die ersten Bewohner Tombstones zum O.K. Corral gelaufen. Sie waren mit Flinten bewaffnet und schoben sich neugierig um die Scheune.
Virgil übernahm als U. S. Marshal sogleich das Reden. Während sich der örtliche Arzt um Morgans Wunden kümmerte, packte mich der Doc und raunte mir zu: »Dort rüber in den Schatten!«
Hinter der letzten Scheune stand sein gesattelter Gaul. Die Satteltaschen waren prall gefüllt mit Wasser, Dörrfleisch und vermutlich Geldscheinen. Im Holster steckte eine langläufige Schrotflinte. Für den Fall einer Niederlage hatte Holliday alles für eine hastige Flucht vorbereitet. So war er nun mal, der Doc!
Ich stützte ihn. Als wir seinen Gaul erreichten, wischte ich dem Doc den Schweiß von der Stirn. Er war eiskalt. Seine Zähne klapperten. Der Mistkerl hatte gewiss Fieber.
»Bullshit!«, fluchte er erneut und spuckte auf den Boden.
Die Wunde an seinem Hals sah schrecklich aus. Das Fleisch hatte sich binnen weniger Minuten zu einem roten aufgequollenen Wulst entzündet.
»Es geht mit mir zu Ende«, keuchte er.
Ich ahnte, dass er nicht die Tuberkulose meinte.
»Red‘ keinen Scheiß!«, widersprach ich, war mir aber nicht sicher, ob der Doc nicht vielleicht doch Recht hatte.
»Du weißt doch, was man über den Grand Lake am Colorado River erzählt.«
»Nein«, log ich.
»Ach, Wyatt«, murmelte er. »Du hast das Telegramm von Sam Carpenter auch erhalten, und ich weiß verdammt gut, dass du die Geschichten der Ute-Indianer kennst. Außerdem hast du mit eigenen Augen gesehen, was gerade passiert ist.«
Es hatte keinen Zweck, dem Doc und mir etwas vorzulügen.
Der Doc zog sich in den Sattel. »Es geht schneller als ich dachte.«
Ich zuckte zusammen, als ich hinter mir weitere Schüsse hörte – das typische Geräusch kurzläufiger Schrotflinten – und das dumpfe Platzen von Fleisch. Offensichtlich war unser Kampf gegen die McLaurys und Clantons noch nicht zu Ende. Gott sei Dank hatten sich die Bewohner Tombstones auf unsere Seite geschlagen.
Wie zur Bestätigung seiner Worte blickte der Doc kurz auf. Er saß gezeichnet im Sattel. »Besser, du bringst es hier und jetzt gleich zu Ende, bevor noch mehr Unheil passiert.«
Meine Hand lag auf den hölzernen Griffschalen derBuntline Special. Der Doc hatte zweifelsohne Recht. Immerhin war er der Doc – er musste es wissen! Es jetzt zu beenden wäre die beste Lösung für ihn und alle anderen gewesen, die ihm begegneten, trotzdem haderte ich mit mir. Solange ein Funke Menschlichkeit in seinem Blick loderte, würde ich es nicht übers Herz bringen, ihn wie einen räudigen Köter abzuknallen.
»Ich gebe dir zwei Tage Vorsprung«, sagte ich schließlich.
Der Doc lachte hohl. »Und dann?«
»Werde ich dich finden.«
»Vermutlich bin ich dann ein anderer und werde mir nicht so leicht eine Kugel in den Kopf jagen lassen.«
»Wir werden sehen – und jetzt mach, dass du wegkommst.«
Schüsse knallten.
Der Doc nickte zum Abschied. »Versprich mir, wenn du mich findest … mach es kurz.« Er nahm meine Hand und presste meinen Zeigefinger auf seine Stirn. »Hierhin. Versprich mir das.«
Ich löste mich aus seinem Griff und drückte seine Hand.
»Versprich mir das!«, wiederholte er.
»Ja.«
Er lächelte müde. Im Moment war die Tuberkulose sein geringstes Problem. Für einen Augenblick glaubte ich seine Pupillen rot funkeln zu sehen, aber das lag möglicherweise nur am Staub der Prärie oder an der untergehenden Sonne.
Der Doc gab seinem Pferd die Sporen und ritt davon. Ich sah ihm lange nach, bis er in der Staubwolke nicht mehr zu erkennen war. Wahrscheinlich war es ein Fehler gewesen, ihn gehen zu lassen, aber der Doc hatte mir zweimal das Leben gerettet – heute vermutlich zum dritten Mal. Gott war mein Zeuge, ich war ihm das schuldig.
Er konnte mit dem Colt umgehen wie kein Zweiter. Außerdem war er nicht nur ein Zahnarzt, den die Notwendigkeit zu einem Spieler gemacht hatte, sondern auch ein Gentleman, den die Krankheit zu einem Vagabunden gemacht, und ein Philosoph, den das Leben zu einem bissigen Zyniker gemacht hatte – und darüber hinaus mein bester Freund.
Wirklich böse Sachen
Ich liebe die Filme jenes Regisseurs mit dem unaussprechlichen Namen. Die Rede ist von Night M. Shyamalan.The Sixth Sensehat eine Welle von Plot-Twist-Filmen losgetreten, die bis jetzt in den Kinos anhält. ShyamalansUnbreakablehat meines Erachtens eine noch bessere Pointe als sein Vorgängerfilm.Signswar etwas schwach, aber die Pointe vonThe Villagehat mir wieder den Glauben an Shyamalan zurückgegeben.
Zu jener Zeit, als die Kinofilme mit der großen berühmten Wendung am Schluss in aller Munde waren, wollte ich mitWirklich böse Sachenetwas ähnliches zu diesem Thema schreiben. Ich hatte die Story damals Boris Koch geschickt, von dem ich wusste, dass er ein versierter und Kino-erfahrener Autor ist, um zu testen, ob er den Schluss vorhersehen würde. »Ich habe die Pointe ab der Hälfte erraten«, schrieb er mir kurz nach der Lektüre zurück. Ich war entsetzt.