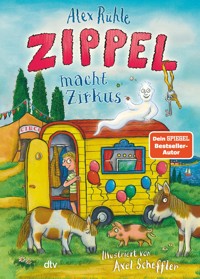6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Früher hat Alex Rühle abends sein Blackberry auf dem Schuhschrank deponiert, damit er vor dem Zubettgehen schnell noch heimlich E-Mails checken konnte. Jetzt bleibt ihm nichts übrig, als live im eigenen Gehirn zu googeln, denn er ist für ein halbes Jahr offline und schreibt darüber ein Buch. Begleiten Sie ihn auf seine Abenteuerreise in die analoge Welt! »War ein eher ruhiger Tag: 68 Mails im Eingang, 45 geschrieben. Ich mach den Rechner aus, zieh meine Jacke an, stell mich in den Aufzug und denke: "Harakiri. Gute Nacht, du schöne Welt."« Alex Rühle ist ein erfolgreicher Journalist, er kommt ganz schön rum, ist glücklich verheiratet und hat zwei Kinder und er ist süchtig. Er ist ein Internet-Junkie. Kein Extremfall, nicht mal die Ausnahme. Er ist gerade so abhängig wie Sie und ich es sind, nur dass wir es nicht immer wissen. Doch Alex Rühle weiß es und macht Ernst: Ein halbes Jahr wird digital gefastet, und das Leben als Journalist und Vater muss offline weitergehen. Dabei ist das Porträt einer Zeit entstanden, in der alles immer schneller geht und man doch keine Zeit hat, und in der das Allein-Sein zur Tortur geworden ist. »Alles abschalten! Dieses kluge und lustige Buch lesen! Danach weiß man, welches Netz man im Leben wirklich braucht.« Doris Dörrie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta
© 2010 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Abbildung: © Nikolai Golovanoff / Corbis
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse GmbH, Leck
Printausgabe: ISBN 978-3-608-94617-8
E-Book: ISBN 978-3-608-10132-4
Für Bib,
mit Dank für 18 analoge Jahre
DER TAG DAVOR
Der Proband bereitet sich vor Zeugen auf sein Experiment vor, verabschiedet sich von all seinen Freunden und hat im Aufzug Angst, so zu enden wie ein sibirischer Einsiedler. Alles beginnt aber mit einem stummen Duell und der Frage, ob das denn überhaupt erlaubt sei.
30. NOVEMBER
Mittags, auf dem Weg in die Kantine, bitte ich Christopher und Bernd, mit mir einen kurzen Umweg zu machen, bei den Jungs von der IT, im zweiten Stock, vorbei. Ich will die beiden als Zeugen dabeihaben. Der Sachbearbeiter, der mir das Gerät vor etwa einem Jahr ausgehändigt hat, fragt zuerst, ob das ein Scherz sei.
»Nein, ich will nur, dass Sie das Ding in Verwahrung nehmen. Am 31. Mai komme ich und hol’s mir wieder ab.«
»Aber warum denn nur?«
»Ich gehe ein halbes Jahr offline.«
»Da können Sie den Blackberry doch auch zu Hause in eine Schublade stecken.«
Ebenso gut könnte ein Dealer seinem Kunden sagen, um clean zu werden, reiche es, das Crack auf den Schrank zu legen, außer Sichtweite, vielleicht noch in einer Kaufhof-Tüte verstecken, dann werde das schon klappen mit ein bisschen gutem Willen. Ich halte dem Mann stumm meinen Blackberry hin. Er sieht mich regungslos an und verschränkt die Arme. Mittlerweile schauen uns alle Mitarbeiter in dem Büro zu, Christopher und Bernd stehen feixend in der Tür, Bernd sagt: »Der meint’s erst.« In dem Moment kehren sich die Fragen ins Sorgenvolle: Ob mit mir alles in Ordnung sei, ob ich Probleme mit dem Ding hätte. »Ja, hab ich, deswegen sollen Sie’s ja zurücknehmen.« Da steckt er den Blackberry achselzuckend in die oberste Schublade seines Schreibtischs und sagt: »Sie kommen doch eh nachher ohne Ihre Freunde zurück und holen ihn sich heimlich wieder.«
Als ich nach dem Kantinenbesuch beim IT-Support anrufe, versteht die Sachbearbeiterin erst mal gar nicht, was ich will. Ob denn irgendwas nicht stimme mit meinem Internet.
»Nein, alles wunderbar und makellos, ich will’s bloß ein halbes Jahr los sein.«
Stille in der Leitung.
»Hallo? Sind Sie noch dran?«
»Ja. Schon. Ich weiß bloß gar nicht – ... Ist das denn erlaubt?«
Erst als ich der Frau mehrfach versichere, dass das wirklich abgesprochen sei, mit der Chefredaktion und mit der Ressortleitung, verspricht sie mir, um 22.30 Uhr Mozilla Firefox, Skype, Lotus Notes und den Internet Explorer von meinem Rechner zu schmeißen.
Nach diesem Anruf werde ich unsagbar nervös, ich schreibe wie besessen E-Mails und ziehe mir panisch Zeug aus dem Netz, für die Zeitungsthemen der nächsten Wochen, aber auch für dieses Tagebuch. Wer weiß, vielleicht finde ich ja noch gute Texte über digitale Sucht, Beschleunigung, Überforderung. Oder einen weiteren geistreichen Lobgesang auf die Allzeitvernetzung und Intelligenz des Internets. Noch vor einer halben Stunde fühlte sich das Ganze an, als würde ich heimlich auf Abenteuerurlaub fahren. Jetzt ist es, als würde ich für eine gnadenlose Arktisexpedition packen, auf der ich ein halbes Jahr keinen Menschen sehe, ein Fehler, Greenhorn, und du erfrierst elendig zwischen Eisschollen.
Kurz vor Dienstschluss stelle ich mit Erstaunen fest, wie dumm der sogenannte Abwesenheitsagent ist. Gibt man zwei Daten ein, formuliert er daraus den kategorischen Satz: »Ich werde vom 1. Dezember bis zum 31. Mai nicht im Büro sein.« Ich werde aber die meiste Zeit im Büro sein, du bescheuerte Kiste. Genauer gesagt die halbe Zeit: Ich werde das kommende halbe Jahr im monatlichen Wechsel zu Hause und in der SZ verbringen, um besser unterscheiden zu können zwischen den Auswirkungen, die das Offlinesein auf mein Arbeits- und auf mein Privatleben hat. Man kann den Satz nicht umformulieren, nur was drunterschreiben: »Halt! Stimmt nicht! Ich bin die meiste Zeit da. Aber ich habe für sechs Monate meine Mail abgestellt. Über postalische Zuschriften, Faxe oder gar persönliche Besuche freue ich mich in dieser Zeit des digitalen Fastens noch mehr als sonst schon.« Danach noch eine Sammel-Mail an gute Freunde, in der ich mich verabschiede und sie bitte, mich nicht zu vergessen. Friedmann verspricht in seiner prompten Antwort, er werde »nachher mal auf den Dachboden steigen – Hausstaubmilben, ich komme! – und Postkarten raussuchen«. Dann fragt er noch, wie viele Mails ich heute bekommen hätte, »am letzten Tag vor deinem Harakiri«. War ein ganz normaler Tag: 68 Mails im Eingang, 45 geschrieben. Ich mache den Rechner aus, ziehe meine Jacke an, stelle mich in den Aufzug und denke: »Harakiri. Gute Nacht, du schöne Welt.«
Und jetzt? Magert mein Leben ab zur analogen Mangelexistenz? Verkomme ich zu einem dieser bärtigen Sonderlinge, die einem in den Fußgängerzonen aus speckigen Jutebeuteln eng bedruckte Zettel über den nahenden Weltuntergang zustecken? Werde ich so einsam wie der sibirische Einsiedler, den sie in den Neunzigerjahren in einer Blockhütte unterm Polarkreis fanden und der nicht mal wusste, dass Stalin tot ist? Oder weitet sich mein Alltag? Erlebe ich stille, epiphanische Beglückungen, weil ich mehr im Moment weile als andere? Wär natürlich wunderbar. Ein halbes Jahr Rundumerfüllung und reine Aufmerksamkeit, ganz’n’gar im Hier’n’Jetzt.
Auf dem Heimweg, am Gasteig, radle ich gedankenverloren auf der falschen Straßenseite den Berg runter und sehe nicht, dass unten eine Polizeistreife steht. Strafzettel, 15 Euro.
DEZEMBER
Erster Monat, in dem der Proband zunächst schwere Entzugserscheinungen durchlebt. Er wird gehänselt, will sich einen buschigen Bart wachsen lassen, träumt von den Great Plains des Netzes und wird im Büro verhaltensauffällig. An Erfreulichem sind die dramatische Befreiung eines Erpels, ein Einladungsbrief aus einem bayerischen Hochsicherheitsgefängnis und ein stiller Silvesterabend zu vermelden.
1. DEZEMBER
All die Monate werde ich früh schlafen gehen, soviel steht schon mal fest. Wenn ich jeden Morgen um fünf Uhr am Schreibtisch sitzen will, muss ich ab sofort mit den Kindern ins Bett. Als B., meine Frau, gestern Abend sah, wie ich den Wecker stellte, sagte sie: »Bist du sicher? Ich hab dich öfter aufwachen sehen als du dich selber. Ist doch schon um sieben ein schwerer Kampf für dich.« Das stimmt, die härteste Nebenwirkung am Kinderhaben ist für mich das frühe Aufstehen. Ich bin eine Morgenmemme.
Es ist kurz vor fünf, ich sitze mit einer Kanne Grüntee im fahlen Blaulichtbezirk meines Rechners, nur der Bildschirm glimmt. Eigentlich sollte das Tagebuch entstehen in einer Zeit, in der ich entspannt durchs Leben flaniere. Ich wollte dafür ein Sabbatical nehmen, was leider nicht geklappt hat. Also stattdessen in Nachtschichten, mit zusammengekratztem Urlaub. Die Entspanntheit muss ich irgendwie hinter dem Rücken meines Alltags in den Text hineinschmuggeln, schließlich gleicht ebendieser Alltag mittlerweile eher einem gramgebeugten Kohlekumpel als einem Flaneur: Schwarz von Staub fährt er jeden Tag erneut ein in den klaftertiefen Schacht namens Arbeit. Hätte ich jetzt das Internet offen, würde ich sofort schauen, wie tief ein Klafter ist. So kann ich nur entweder in eine Bibliothek fahren, was ich wahrscheinlich nicht mehr getan habe seit meinem Studium, was ungefähr gleichbedeutend ist mit: seit Google (ich habe 1996 meinen Magister gemacht), oder meinen Vater anrufen, der noch beeindruckend viele solcher Fachwissenspartikel wohlverwahrt in sich herumträgt, aber der schläft um die Uhrzeit hoffentlich noch. Ne, Moment, in ein Lexikon könnte ich schauen. Ich hatte früher einen dreibändigen, weinroten Universal-Meyer. Aber der steht längst im Keller, irgendwo weit hinter den Koffern.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!