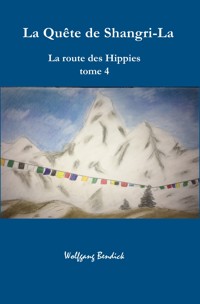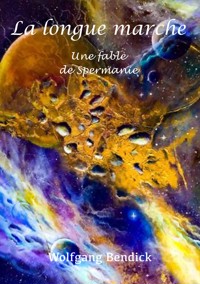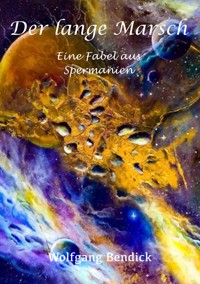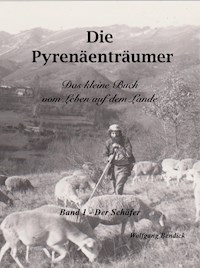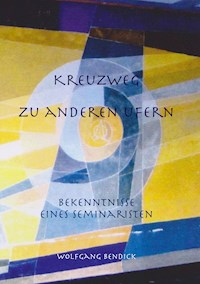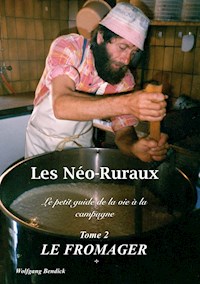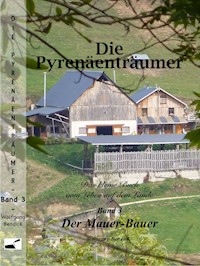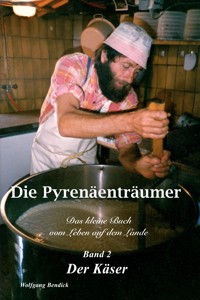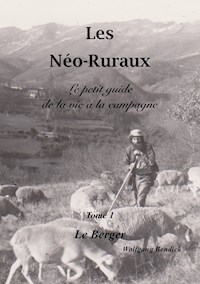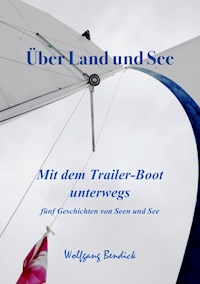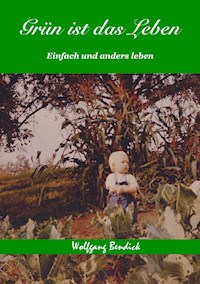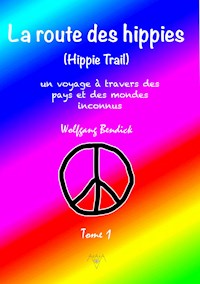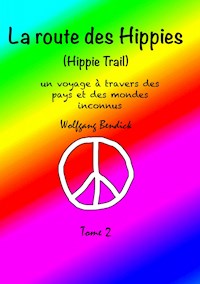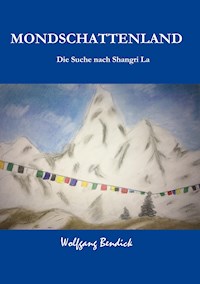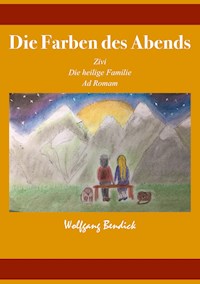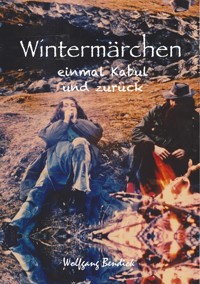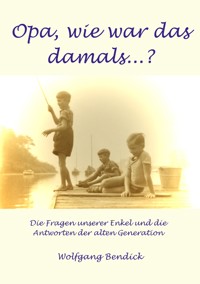
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: über Land und See
- Sprache: Deutsch
Was damals hochmodern war, finden wir jetzt in Museen, wenn es nicht auf Müllhalden gelandet ist. Die Menschen heute tun die alte Generation als altmodisch, als zeitfremd ab. Doch um das Heute zu verstehen, muss man das Gestern kennen. Eigentlich ist heute alles anders. Doch die Grundprobleme sind geblieben, wenn sich nicht sogar ein paar neue dazugesellt haben. Auch die Werte haben sich nicht geändert, selbst wenn jetzt anscheinend der Konsum der Maßstab aller Dinge ist. Dieses Buch, ein Dialog, soll sowohl der jüngeren Generation einen Einblick in unsere Welt, wie sie damals war, vermitteln, als auch den Älteren ihr eigene Kindheit wieder in Erinnerung brin-gen. Denn aus der Symbiose von Vergangenheit und Gegenwart wird unsere Zukunft entstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Wolfgang Bendick
Opa, wie war das damals
Die Fragen unserer Enkel und die Antworten der alten Generation
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Das Buch
Kommunikation
Schule
Religion
Kinderspiele
Mode
Fernsehen
Fahrbarer Untersatz
Beten
Technik
Ökologie
Ernährung
Freiheit
Drogen
Arbeit
Umbruch
Diskriminierung
Geburt und Tod
Nachwort
Weitere Werke des Autors:
Impressum neobooks
Das Buch
Die Fragen unserer Enkel
Und die Antworten der alten Generation
Ein Dialog
Wolfgang Bendick
Text: © Copyright 2023 Wolfgang Bendick
Umschlag: Lucia Bendick
Fotos: Wolfi, Franz
Verantwortlich
Für den Inhalt: Wolfgang Bendick
Las Piasseres
F 09800 Augirein
Frankreich
Für diejenigen, die keine Zeit mehr haben
„Die Ruhe sei dem Menschen heilig, denn nur Verrückte haben’s eilig“, sagt ein altes Sprichwort…
Um den langen Tag eines Bauern durchzustehen, machte ich es mir zur Gewohnheit, mich nachmittags etwas hinzulegen. Waren die Enkel bei uns, so kamen sie zu mir auf das Kanapee und ich erzählte ihnen Geschichten, bis sie eingeschlafen waren. Dann fielen auch mir die Augen zu.
Später erzählte ich ihnen Geschichten und schlief vor ihnen ein. Wenn ich aufwachte, waren sie alle weg.
Inzwischen gehen sie mehr und mehr ihre Wege und haben keine Zeit mehr, zuzuhören. Damit aber auch die ‚Spätgeborenen‘ es erfahren können, fasse ich alles in diesem Büchlein zusammen.
Erstmals erschienen im Sommer 2023
Ein Dankeschön an meine Freunde, die durch ihre Lesefreude mich motivierten, nicht die Feder aus der Hand zu legen und vor allem an Peter und Franz, die diesem Text den letzten Schliff gaben.
Kommunikation
„Opa, als du so alt warst wie ich, war da wirklich alles besser als heute?“
„Nein, es war anders. Man sollte nicht vergleichen oder aburteilen. Denn man ist geneigt, etwas Negatives von heute mit einer Erinnerung von damals zu vergleichen. Nur, Erinnerungen sind meistens positiv, da unser Gedächtnis lieber die schönen Sachen behält“.
„Was war es denn, das damals so anders war?“
„Das Auffälligste ist wohl, dass es damals keine Handys gab. Niemand hatte so ein Ding in der Hand oder am Ohr.“
„Wie habt ihr euch denn benachrichtigt?“
„Wenn es eilig war, benutzte man das Telefon oder schickte ein Telegramm. Für letzteres musste man aber zur Post gehen, und die war in der Stadt. Sonst schrieb man einen Brief. Nicht jeder Haushalt besaß ein Telefon, denn es kostete Geld. Hatte man keines, ging man zu dem Nachbarn, der eines besaß, oder ging zu einer Telefonzelle, so gelbe, verglaste Häuschen. Oft standen Leute davor und warteten, dass es frei wurde. War man dran, ging man hinein und nahm einen ziemlich schweren, schwarzen Hörer, der eher wie ein dicker Knochen aussah, von der Gabel seitlich eines großen, schwarzen Kastens. Dann warf man ein paar Münzen in einen Schlitz, wo sie sich hinter einer Scheibe aneinanderreihten.
Man wählte mit einer drehbaren, gelochten Scheibe die Nummer, indem man den Finger in das Loch vor der entsprechenden Zahl steckte und die Scheibe soweit drehte, bis der Finger an einen Anschlag kam. Dann nahm man den Finger heraus und die Scheibe ging langsam wieder zurück in ihre Ausgangsstellung. Manchmal zu langsam, und man versuchte, sie mit Fingerdruck zu beschleunigen. Nun wählte man die nächste Ziffer, eine nach der anderen. Später gab es auch Telefone mit Tasten, die die einzelnen Ziffern trugen. Mitunter gab es Apparate, an denen zusätzlich an einem Kabel eine Ohrmuschel daran hing, die man sich an das andere Ohr hielt, wenn der Verkehrslärm zu laut war oder man schlecht die Stimme des anderen verstand. Manchmal hörten wir Kinder mit dieser Muschel die Gespräche der Erwachsenen mit. Wollte man ein Ferngespräch führen, musste man zuerst das ‚Fräulein vom Amt‘ anrufen und ihr den Wohnort und die Nummer des Gesuchten sagen. Diese stellte nun den Kontakt her, indem sie Kabel in die dem Ort entsprechende Verbindung umsteckte. Später gab es die ‚Vorwahlnummern‘, mit deren Hilfe man Ferngespräche auch selbst machen konnte.
In den Zellen war die Luft oft stickig, es roch nach Zigarettenrauch oder billigem Parfüm. Man fasste sich so kurz wie möglich, denn gerade bei Ferngesprächen verschwanden die Münzen schnell. War der Ausspruch ‚Time is Money!‘ in einer Telefonzelle entstanden?
In den letzten Jahren wurden diese Telefonautomaten mit vorausbezahlten Plastikkarten, einem Vorläufer der heutigen Kreditkarten bedient, um so zu verhindern, dass Diebe die Kasse aufbrachen und das Geld stahlen. Das Gute an den Dingern war, dass sie auch bei Stromausfall funktionierten, da die Telefonzellen ein eigenes Stromsystem besaßen. Das geht bei Handys heute nicht mehr, da bei Stromausfall auch die Sendemasten außer Betrieb sind.“
„Das klingt ja kompliziert. Da finde ich die Handys schon praktischer!“
„Ja, auf den ersten Blick sind sie das auch. Aber man weiß nicht, oder will es nicht wissen, wie schädlich die Strahlung der Apparate und der Antennen ist.“
„Da konntet ihr euch ja gar nicht amüsieren. Keine Spiele, keine Musik oder Filme… Das muss ja langweilig gewesen sein!“
„Langeweile hatten wir schon manchmal. Wir Kinder aus dem Dorfviertel saßen oft irgendwo zusammen auf einem Zaun, dem Randstein oder dem Bänkle, wo die Bauern morgens ihre Milchkannen abstellten, damit das Molkereiauto sie besser laden konnte. Wir erzählten uns lustige Geschichten, oder machten Pläne, was wir anstellen könnten. Die Großen machten sich über die Kleinen lustig und bisweilen ärgerte man sich untereinander. Die Mädchen waren meistens für sich und machten ihre Hüpfspiele, während die Buben durch den Wald strolchten, Indianer spielten, bis zu den Knien im Wasser stehend mit den Händen Forellen fischten (natürlich schwarz, d.h. ohne Erlaubnis) oder auf einer Wiese Fußball oder Fangen spielten.
Ihr wisst gar nicht mehr, wie es ist, Zeit zu haben, sich zu langweilen, bis dann einer plötzlich DIE Idee hat, wo alle mitmachen.“
Schule
„Wovor hattest du damals am meisten Angst?“
„Was ich fürchtete, das waren die Lehrer, da viele von ihnen uns für schlechtes Verhalten oder nicht ausreichende Leistungen ohrfeigten oder mit einem Stock schlugen. Brach der Stock ab, musste der Schüler, auf dem er zu Bruch gegangen war, einen neuen mitbringen. Meist waren das dieselben Schüler, die sich schier einen Spaß daraus zu machen schienen, den Lehrer zur Weißglut und zum Ausrasten zu bringen. Wenn sie der Lehrer übers Knie legte und ihnen das Hinterteil verdrosch, dann schrien sie wie am Spieß, machten aber dabei Grimassen oder streckten, zu uns schauend, ihre Zunge heraus. So viel Mut oder Frechheit besaßen nicht viele von uns.
Einmal hatte Helmut, der Ober-Rabauke eine Schachtel mit Schiessplättchen, das waren so rote Papierkonfetti mit Pulver drin, die man in einer kleinen Pistole zum Knallen bringen konnte, in der hinteren Tasche seiner Hose. Als der Lehrer sein Hinterteil mit dem Rohrstock bearbeitete, explodierten diese plötzlich und eine Flamme schoss in die Höhe. Völlig perplex ließ der Lehrer seinen Stock und den Jungen los. Dieser schlug sich mit der Hand auf die brennende Hose und raste laut schreiend aus dem Klassenzimmer aufs Klo, wo er schnell mit der Hand Wasser aus dem Becken schöpfte und sein Hinterteil kühlte. Stöhnend kam er nach einer Weile zurück und setzte sich an seinen Platz. Er verbarg seinen Kopf auf seinen Armen und heulte wie ein Schlosshund, wobei er von Zuckungen geschüttelt wurde. Uns tat der Kerl richtig leid. Die Klasse war stumm, man hörte nur das Jammern des Schülers. Der Lehrer wusste nicht, was er sagen oder tun sollte und setzte sich hinter sein Pult. Einer seiner Freunde ging hin, legte ihm den Arm um die Schulter und sprach ihm gut zu. Doch sein Stöhnen wurde nur noch lauter. Da bemerkten wir plötzlich, dass er lachte und vor Freude über den gelungenen Streich schier hüpfte. Durch das Loch in der Hose sahen wir, dass er eine Lage Zeitungen in der Hose trug. Nur der Lehrer merkte nichts, verschonte ihn aber für ein paar Wochen. An der ganzen Schule wurde er als Held gefeiert. Erziehung glich damals eher einer Dressur.
Natürlich gab es auch liebe Lehrer, doch waren die in der Minderzahl. Wir hatten ja damals in der Volksschule den ganzen Vormittag lang und auch jeden Tag denselben Lehrer. Und wenn der einen nicht leiden konnte, aus welchen Gründen auch immer, dann hatte man es schwer! Das Tröstliche war, dass wir den Nachmittag frei hatten.“
„Was, jeden Nachmittag? Das ist ja toll! Sag, bist du auch mal verprügelt worden?“
„Schon, aber nicht oft. Manchmal eine Ohrfeige, weil ich angeblich gegrinst oder eine freche Antwort gegeben hatte. Ich war eher einer der Feiglinge in der Klasse. Deshalb wurde ich wohl besonders viel von den Schulkameraden geärgert. Da war ein anderer Klassenkamerad, Kurt Michalsky, der Sohn des Fischhändlers, der noch mehr getrietzt wurde als ich. Ich nenne hier seinen Namen, denn er verdient es. Gäbe es eine Liste von kindlichen Märtyrern an der Marienschule, wohin wir gingen, so würde der einen der ersten Plätze einnehmen!
Oft kam Kurt morgens zu spät, da er im Laden hatte helfen müssen, Fische auszunehmen. Das brachte ihm den Zorn des Lehrers ein und den Spott der Anderen, weil er so nach Fisch stank und manchmal noch eine Schuppe in seinen krausen Haaren kleben hatte. Stoisch steckte er alle Hänseleien ein. Was hätte er auch anderes machen können, war er doch noch dünner und schwächer als ich! Ich litt mit ihm jedes Mal, wenn er ungerecht behandelt wurde und versuchte, ihm ein guter Freund zu sein. Die Anderen nannten ihn Kaulquappe, wegen seines großen Kopfes und seiner krummen Gestalt. Mich nannten sie Frosch, wegen meiner großen Augen. Wie er, gab auch ich lieber klein bei, um meinen Frieden zu haben, sei es von den Lehrern oder den Klassenkameraden. Doch ist das nicht immer die beste Lösung. Denn manche aus der Klasse nutzten das aus, um einen erst recht zu triezen, zu hänseln.“
„Wie denn das?“
„Wir verstauten alle unsere Schulsachen in einem ‚Schulranzen‘ oder ‚Tornister‘, einem kleinen ledernen Koffer, den wir auf dem Rücken trugen. Das sollte uns zugleich eine gerade Körperhaltung geben. Die ‚Bösen‘ versteckten oft meinen Schulranzen oder leerten ihn in der Pause aus. Sie beklecksten meine Schönschriftübungen oder beschossen mich heimlich mit ‚Spickus‘, geknickten Papierröllchen, die sie mit einem zwischen Daumen und Zeigefinger gespannten Gummiband abschossen.“
„Das klingt ja ziemlich grausam. Aber wie beklecksten die denn deine Hefte?“
„Wir schrieben ab der zweiten Klasse mit ‚Federhaltern‘. Das waren bunt angemalte, bleistiftähnliche Gebilde aus Holz, die oben spitz zuliefen. Diese Spitze steckten wir meist in den Mund und kauten darauf herum. Das verkürzte die Zeit und hatte so einen schönen bitteren Geschmack, der wohl von der Farbe kam, die dabei zerbröselte. Am unteren Ende war der Federhalter verdickt und besaß innen drin eine blecherne Hülse, in die man eine leicht gerundete, spitz zulaufende metallene Klinge, die ‚Feder‘, schob. Diese tauchte man in das sich in einer Vertiefung des Schreibpultes befindliche Tintenfässchen, streifte den Tropfen ab und schrieb dann solange, bis keine Tinte mehr an der ‚Feder‘ war. Das war meist nicht mal eine halbe Zeile. Wenn der Lehrer den Schülern den Rücken zeigte, schleuderten die Frechen oft mit ihren Federhaltern die Tinte in alle Richtungen. In den höheren Klassen schrieb man dann mit einem ‚Füll-Federhalter‘, oder kurz ‚Füller‘ genannt, einem Schreiber, der eine Tintenreserve in einem kleinen Tank besaß. Durch Drehen am oberen Ende konnte man einen Kolben bewegen, mit dem man durch die in das Tintenfass getauchte Feder Tinte in den Tank sog.
Den ersten ‚Kugelschreiber‘ brachte ein Klassenkamerad mit, als ich schon in der dritten Klasse war, also 1956. Er wollte wohl vor den anderen damit angeben. Gab das einen Ärger mit dem Lehrer! Der ‚Kuli‘ wurde konfisziert, ähnlich den anderen verbotenen Sachen, die wir mit in den Unterricht brachten und mit denen wir erwischt wurden. Erst am Schuljahrsende bekamen wir diese zurück. Daraufhin wurde von der Schulleitung verboten, Kugelschreiber zu benutzen. Füllfederhalter (später mit Tintenpatronen, welche einfacher zu wechseln waren) blieben Vorschrift. Erst in den achtziger Jahren wurde der Kugelschreiber für Klassenarbeiten erlaubt und der ‚Füller‘ verschwand mehr und mehr.“
„Und wie habt in der ersten Klasse geschrieben?“
„Mit Griffeln. Das waren Stäbchen aus Schiefer, demselben Material, mit dem man Dächer deckt. Meist waren sie mit buntbedrucktem Papier umwickelt, damit sie nicht so leicht zerbrachen. Deshalb auch lagerte man sie in einem ‚Griffelkästchen‘, einer länglichen, hölzernen Schachtel mit Schiebedeckel. War ein Schüler mal faul oder frech gewesen, ließen manche Lehrer sich von dem Schüler diesen Deckel geben und forderten ihn auf, die Hände auszustrecken, mit dem Handrücken nach oben. Dann schlugen sie ihm mit dem flachen Deckel darauf. Wehe, der Schüler zog die Hand zurück! Dann waren die folgenden Schläge noch heftiger oder geschahen mit der Kante des Deckels!
In dem Kästchen befand sich auch ein Griffelspitzer, ähnlich einem Bleistiftspitzer heute. Oder ein mit kleinen Löchern versehenes, leicht konkav gebogenes Blechstück, das als Raspel diente und womit wir die Schreibgriffel anspitzten. Manche hatten auch Griffel, die einem Bleistift glichen und wo sich anstatt Graphit Schiefer in der Mitte befand. Doch waren diese teurer. Ich hatte immer nur die einfachen. Zum Beantworten einer Frage des Lehrers musste man immer aufstehen. Wehe, man vergaß beim sich wieder Hinsetzen, auf den Sitz zu schauen! Denn oft hielt der Banknachbar seinen Griffel mit der Spitze nach oben dort fest. Das tat weh! Nur eine Lederhose gewährte einem etwas Schutz.“
„Aber mit so einem steinernen Stift kann man doch nicht auf Papier schreiben!?“
„Da hast du recht. Geschrieben wurde im ersten Jahr auf einer Schiefertafel, ungefähr 20 x 30 cm groß, vorne mit Linien, hinten mit Kästchen bedruckt zum Rechnen. Die Schiefertafel war mit einem Holzrähmchen versehen, worauf auf der Vorderseite die Buchstaben in klein und groß aufgedruckt waren, hinten die Zahlen. Ein Eck des Rahmens war durchbohrt. Darin band man das ‚Tafelläppchen‘ fest, ein meist von der Mutter oder Oma gehäkeltes, topflappenartiges Gebilde, was zum Abtrocknen der Tafel diente. Denn war eine Seite vollgeschrieben und wollte man alles ‚löschen‘, so geschah das mit einem runden Gummischwamm. Dieser befand sich in einer runden Dose, meist aus Bakelit, eine der ersten Plastikarten, und wurde mit einem Schraubdeckel verschlossen. Oft war auf den Deckel ein buntes Bild geklebt. Dieser Schwamm musste öfters am Tag gespült werden, sonst bekam die Tafel einen grauen Film. Dazu befand sich im Klassenzimmer ein besonderes Waschbecken. Außerdem begann das nasse Schwämmchen bald zu stinken, vor allem, wenn es ein paar Tage nicht benutzt worden war. Dieser saure Mief, der sich verbreitete, wenn man seine Tafel abwischte, machte uns Spaß und manche Schüler versuchten, mit irgendwelchen Zugaben den Geruch zu verstärken, um vor den anderen anzugeben, vor allem aber um den Lehrer zu ärgern.
Wurde die Tafel nicht benutzt, steckte sie in einem ‚Tafelschoner‘, einer Hülle aus Pappe oder Sperrholz, die einem Bucheinband glich. Das Tafelläppchen hing immer außen vom ‚Tornister‘, damit es trocknen konnte. Natürlich war dieses Läppchen oft Ursache für Spott, vor allem, wenn es sehr bunt und schön gehäkelt war.
Auch unsere Namen waren ein Anlass um uns gegenseitig zu ärgern. Meist dienten als Vorlage Geschichten aus Kinderbüchern, wie dem ‚Struwwelpeter‘ oder aus Zeitschriften. Hieß einer Philipp, bekam er den Spitznamen ‚Zappel-Philipp‘. Ein Hans wurde ‚Hans-guck-in-die-Luft‘, einer, der mager war zum ‚Suppen-Kasper‘. Ein Reinhold wurde zum ‚Nashorn‘ umgetauft, nach einem Comic-Strip. Eine Berta hatte gleich den Spitznamen ‚dicke Berta‘ weg, benannt nach einer Kanone aus dem Krieg. Aber eigentlich wurde alles mit Spott überzogen, wenn man ein Schwächling war. Hatte hingegen einer der Stärkeren etwas Besonderes, gab er damit an und wurde von den Anderen bewundert.“
„Ja, heute gibt es sie immer noch, die ‚Angeber‘!“
„Leider nicht nur an der Schule. Du findest sie überall. Mich kotzen sie an, doch scheinen viele sich von denen beeindrucken zu lassen. Wie schon gesagt, schrieben wir mit schiefernen Griffeln. Anfangs drückten wir zu fest auf, und die Spitze brach ab. Oder sie brachen in der Mitte durch. Je nach Winkel, in dem man den Griffel hielt, konnte der ein quietschendes, kreischendes Geräusch verursachen, was einem die Haare zu Berge stehen ließ. Auch der Lehrer schien dieses Geräusch zu hassen, vielleicht, weil es ihn an seine eigene Schulzeit und deren Qualen erinnerte. Jedenfalls gaben sich die Meisten größte Mühe, leise zu schreiben. Dazu befeuchteten wir manchmal die Griffelspitze mit der Zunge. Später dann war es meist Absicht, wenn einer mal quietschte, nur um den Lehrer zu ärgern oder die Anderen zum Lachen zu bringen.“
„Mit wieviel Jahren kamt ihr damals in die Schule?“
„Mit sechs Jahren. Uns Erstklässler nannten die Größeren ‚I-Männchen‘, denn das i war der erste Buchstabe, den alle Schüler lernen mussten: ‚Rauf, runter, rauf, Pünktchen drauf‘. Am ersten Schultag brachten uns die Mütter zur Schule. Außer dem Schulranzen auf dem Rücken, trugen wir jeder eine ‚Zuckertüte‘ in den Armen. Das war eine aus bunter Pappe gefertigte, nach unten spitz zulaufende Tüte, angefüllt mit Bonbons, Schokolade und anderen Süßigkeiten, um uns den Schulanfang ‚schmackhaft‘ zu machen. Viele von uns hatten richtig Angst vor dem ersten Schultag, hatten die älteren Geschwister uns doch schon Horrorgeschichten darüber erzählt. Ich freute mich darauf, konnte ihn kaum erwarten.“
„Warum das?“
„Weil nur die Großen in die Schule gingen. Ich wollte auch endlich groß sein, um nicht mehr zu den ‚Säuglingen‘, wie die Größeren uns nannten, zu gehören. Wir mussten im Schulhof antreten, in Zweierreihen, die Mütter mit uns. Das gab natürlich Spott. ‚Muttersöhnchen!‘, ‚Säugling!‘, scholl es aus den Reihen der Zweit- und Drittklässler. Diese konnten sich nicht zurückhalten und stimmten ein Spottlied an, das noch während Wochen über den Schulhof hallte, sei es gesungen oder gepfiffen: ‚I–Männchen, Kaffeekännchen, lass dein Püppchen tanzen! Wenn es nicht mehr tanzen kann, dann steck es in die Kaffeekann! Fällt Kaffeekanne um, ist I-Männchen dumm!‘
Wir hatten ziemliche Angst und klammerten uns an die Hand der Mutter und an die Zuckertüte. Der Lehrer Schmid - später von uns Nussknacker genannt, wegen seines langen Kinns - nahm sich unserer an. Er fragte nach unseren Namen und führte uns, als eine schrille Glocke anfing zu läuten, in das Klassenzimmer. Dort hatte er mit bunter Kreide ein riesiges Bild mit Osterhasen, Eiern und Blumen an die aufgeklappte Wandtafel gemalt (damals wurde man nach den Osterferien eigeschult). So ein großes Bild hatten wir noch nie gesehen! Wir waren weg vor Staunen und rannten zur Tafel um das genauer zu sehen. Die meisten Mütter nutzten diesen Moment, um sich aus dem Staub zu machen. Manchem Kleinen flossen die Tränen, als er plötzlich bemerkte, dass die Mutter sich entfernt hatte. Viele Kinder aber ließen deren Hand nicht los und etliche Mütter verbrachten die ersten Schulstunden im Klassenzimmer.“
„Da hat sich ja vieles geändert seitdem! Aber geärgert wird heute auch noch. Nur heißt das jetzt ‚Mobben‘!“
„Ja, leider. Das ist ein großes Drama. Kinder können grausam sein. Und dazu sind sie auch noch viel empfindsamer. Vielleicht waren wir damals abgehärteter als ihr heute, wenn man es so nennen kann. Da Bestrafen durch Schläge, Anschreien, Einsperren und Drohungen in jeder Familie üblich war, gab uns das ein ‚dickeres Fell‘. Wir als Kinder hatten trotzdem viel Leid zu ertragen. Tadel und Strafe waren an der Tagesordnung, man gab uns Hausarrest oder man sperrte uns in einem dunklen Raum ein. Auch musste oft der Teppichklopfer herhalten, um eine Strafe zu bekräftigen. Das war die damalige Erziehungsmethode. ‚Was einen nicht umbringt, das macht einen nur härter!‘, war ein häufig gebrauchter Spruch, der wohl noch aus Kriegszeiten stammte.
Das Schwerste für einen war, wenn man ungerecht bestraft worden war. Wurde das mal offensichtlich, dann gab es keine Entschuldigung von Seiten der Eltern oder Lehrer, sondern es hieß nur: ‚Dann zählt das halt für ein Mal, wo du nicht erwischt worden bist!‘ War man mal hingefallen und blutete, so versteckten wir die Wunde vor den Erwachsenen, um nicht zusätzlich noch getadelt zu werden: ‚Hättste aufgepasst, wäre das nicht passiert!‘ und: ‚Die guten Hosen!‘ oder: ‚Das war die Strafe Gottes für deine begangenen Untaten!‘ Nur bei den Klassenkameraden gab man mit Wunden und Blut an. Dadurch stieg man im Rang.