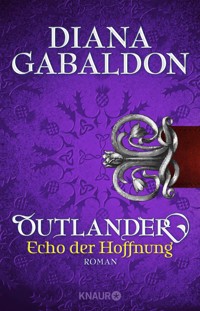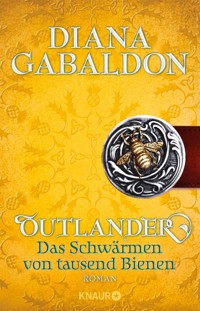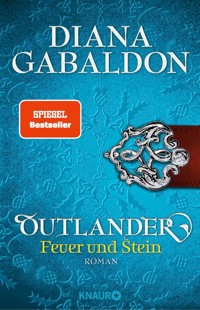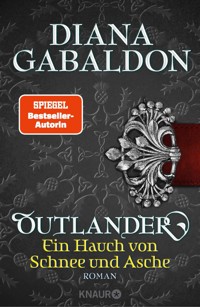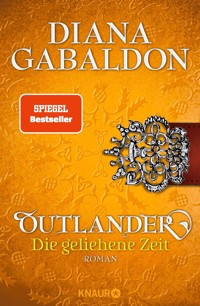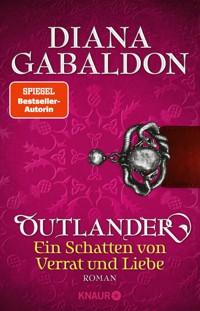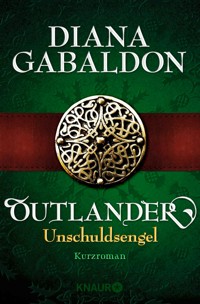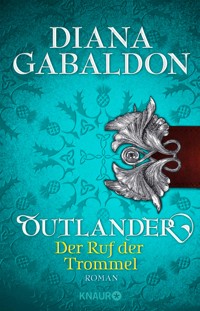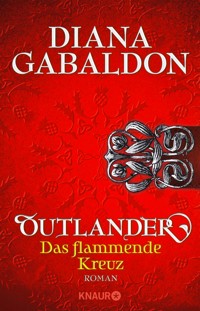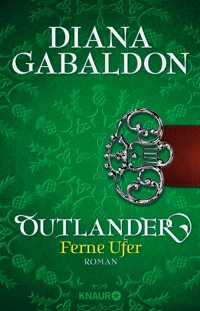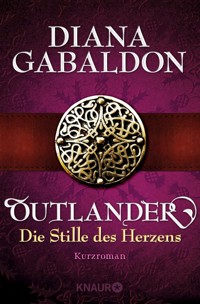
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein trauernder Witwer, eine zukünftige Nonne und ein Graf, der tief in den dunklen Künsten steckt: Entdecken Sie »Die Stille des Herzens«, einen spannenden Kurzroman von Bestseller-Autorin Diana Gabaldon. Paris 1778. Michael Murray hat seine geliebte schwangere Frau verloren und ist voller Trauer. Nun soll er die junge Joan MacKimmie, die Nonne werden will, auf ihrer Reise zum Kloster begleiten. Doch bald finden sich die ungleichen Gefährten mitten in einem gefährlichen Abenteuer wieder: Der Comte St. Germain, der sich den dunklen Künsten verschrieben hat, glaubt in Joan die Tochter der geheimnisvollen Dame Blanche wiederzuerkennen. Um sie in seine Gewalt zu bringen, schreckt er vor nichts zurück … Der Kurzroman »Die Stille des Herzens« ist mit Diana Gabaldons epischer »Outlander«-Saga verbunden, die 1946 in Schottland beginnt, als Claire Randall in den magischen Steinkreis tritt und im Jahre 1743 erwacht. Er spielt nach dem siebten »Outlander«-Band »Echo der Hoffnung«; Sie können ihn aber auch unabhängig davon lesen. »Die Stille des Herzens« und noch sechs weitere Kurzromane von Bestseller-Autorin Diana Gabaldon finden Sie auch im Sammelband »Outlander – Im Bann der Steine«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Diana Gabaldon
Outlander – Die Stille des Herzens
Kurzroman
Aus dem Englischen von Barbara Schnell
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Paris 1778. Michael Murray hat seine geliebte schwangere Frau verloren und ist voller Trauer. Nun soll er die junge Joan MacKimmie, die Nonne werden will, auf ihrer Reise zum Kloster begleiten. Doch bald finden sich die ungleichen Gefährten mitten in einem gefährlichen Abenteuer wieder: Der Comte St. Germain, der sich den dunklen Künsten verschrieben hat, glaubt in Joan die Tochter der geheimnisvollen Dame Blanche wiederzuerkennen. Um sie in seine Gewalt zu bringen, schreckt er vor nichts zurück …
Der Kurzroman »Die Stille des Herzens« ist mit Diana Gabaldons epischer Outlander-Saga verbunden, die 1946 in Schottland beginnt, als Claire Randall in den magischen Steinkreis tritt und im Jahre 1743 erwacht. Er spielt nach dem siebten Outlander-Band »Echo der Hoffnung«; Sie können ihn aber auch unabhängig davon lesen.
Inhaltsübersicht
Die Stille des Herzens
Danksagung
Dieses Buch widme ich Karen Henry, Rita Meistrell, Vicki Pack, Sandy Parker und Mandy Tidwell (die ich mit allem Respekt und der größten Dankbarkeit auch meine persönliche Erbsenzählertruppe nenne) für ihre unschätzbare Hilfe beim Aufspüren von Irrtümern, Anschlussfehlern und Kleinkram aller Art.
(Für etwaige verbleibende Fehler ist allein die Autorin verantwortlich, die nicht nur hin und wieder fröhlich die Chronologie ignoriert, sondern sich bisweilen auch ganz bewusst auf Abwege begibt.)
Die Stille des Herzens
DAS IST EINE MERKWÜRDIGE GESCHICHTE. Aus den letzten Kapiteln von Echo der Hoffnung, in denen Michael Murray frisch verwitwet aus Frankreich eintrifft, um beim Tod seines Vaters da zu sein, wissen wir, dass er ein sehr verletzlicher Mann ist, der den Stürmen des Schicksals nicht viel entgegenzusetzen hat. Doch Echo war nicht seine Geschichte.
Es war auch nicht Joans Geschichte, obwohl auch sie eindeutig auf ein Abenteuer zusteuert, als sie in den Highlands ihren Weggang aus dem Haus ihrer Mutter einfädelt, um ins Kloster zu gehen und Nonne zu werden – obwohl sie im Leben noch kein Kloster und keine Nonne gesehen hat.
Wenn nun ein Witwer und eine Postulantin gemeinsam nach Paris reisen, darf man davon ausgehen, dass es interessant wird – und das wird es auch, doch dies ist nicht nur Michaels und Joans Geschichte.
Haben Sie sich je gefragt, was geschehen ist, nachdem der Graf von St. Germain in Die geliehene Zeit im Sternengemach des Königs zusammenbrach? Treten Sie ein, und finden Sie es heraus.
ER WUSSTE BIS HEUTE NICHT, warum ihn der Frosch nicht umgebracht hatte. Paul Rakoczy, Graf St. Germain, ergriff das Glasfläschchen, zog den Korken heraus und roch zum dritten Mal vorsichtig daran, verkorkte es dann aber wieder, immer noch unzufrieden. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Dem Duft des dunkelgrauen Pulvers in dem Fläschchen haftete zwar der Geist einer vertrauten Substanz an – doch es war dreißig Jahre her.
Einen Moment lang saß er da und blickte stirnrunzelnd auf die Ansammlung von Gläsern, Glas- und Zinnflaschen und Pelikangefäßen auf seiner Werkbank. Es war später Nachmittag, und die Pariser Frühjahrssonne war wie Honig, warm und klebrig in seinem Gesicht. Doch in den Rundungen der Gläser leuchtete sie sanft, sodass die darin enthaltenen Flüssigkeiten rote, braune und grüne Flecken auf das Holz warfen. Der einzige Misston in dieser friedlichen Symphonie aus Licht war eine große Ratte, die mitten auf der Werkbank reglos auf dem Rücken lag, und daneben eine geöffnete Taschenuhr.
Vorsichtig legte der Graf dem Tier zwei Finger auf die Brust und wartete geduldig. Diesmal dauerte es nicht so lange; er war die Kälte schon gewohnt, unter der sich sein Verstand in den Tierkörper vortastete. Nichts. Keine Spur von Licht vor seinem inneren Auge, kein warmes Rot eines pulsierenden Herzens. Er blickte auf die Uhr: eine halbe Stunde.
Er zog seine Finger fort und schüttelte den Kopf.
»Mélisande, du gemeines Weibsbild«, murmelte er nicht ohne Zuneigung. »Du hast doch nicht geglaubt, dass ich etwas, das von dir kommt, an mir selbst ausprobiere, oder?«
Dennoch … Er selbst war sehr viel länger als eine halbe Stunde tot gewesen, als ihm der Frosch das Drachenblut verabreicht hatte. Es war früher Nachmittag gewesen, als er vor dreißig Jahren das königliche Sternengemach betreten hatte, mit Herzklopfen angesichts der bevorstehenden Konfrontation – ein Duell der Zauberer, bei dem es um die Gunst des Königs ging – und von dem er geglaubt hatte, es gewinnen zu können. Er erinnerte sich an die Klarheit des Himmels, die Schönheit der aufgehenden Sterne, die leuchtende Venus am Horizont und das Glück, das ihn durchströmte. Die Dinge besaßen immer eine größere Intensität, wenn man wusste, dass das Leben innerhalb der nächsten Minuten zu Ende sein konnte.
Und eine Stunde später dachte er, sein Leben sei zu Ende, als ihm der Becher aus der tauben Hand fiel, ihm die Kälte mit erstaunlicher Geschwindigkeit durch die Glieder raste und sich die Worte Ich habe verloren als eisiger Kern aus Unglauben mitten in sein Hirn froren. Sein Blick war nicht auf den Frosch gerichtet gewesen; das Letzte, was seine Augen in der zunehmenden Dunkelheit gesehen hatten, war die Frau – La Dame Blanche –, deren Gesicht ihn über den Becher hinweg anblickte, den sie ihm gereicht hatte, angewidert und so weiß wie Gebein. Was ihm jedoch zusätzlich im Gedächtnis geblieben war und woran er sich auch jetzt wieder mit demselben Gefühl des Erstaunens und derselben Wissbegier erinnerte, war die große blaue Flamme, so intensiv wie die Farbe des Abendhimmels jenseits der Venus, die aus ihrem Kopf und ihren Schultern geschlagen war, als er starb.
An Gefühle wie Bedauern oder Angst erinnerte er sich nicht, nur an Erstaunen. Dies war allerdings gar nichts im Vergleich zu dem Erstaunen, das er empfunden hatte, als er wieder zu sich kam, nackt auf einer Steinplatte in einer widerwärtigen unterirdischen Kammer, Seite an Seite mit einer Wasserleiche. Glücklicherweise hatte sich keine lebende Seele in dieser ekelhaften Grotte aufgehalten, und er war – taumelnd und halb blind, bekleidet mit dem nassen, stinkenden Hemd des Ertrunkenen – in die Morgenröte hinausgestiegen, die schöner war, als es jedes Zwielicht sein konnte. Also – zehn bis zwölf Stunden vom Moment des scheinbaren Todes bis zur Wiederbelebung.
Er betrachtete die Ratte, streckte dann den Finger aus und hob eine der kleinen, zierlichen Pfoten an. Fast zwölf Stunden. Schlaff, die Totenstarre war bereits vorüber; es war warm so weit oben im Haus. Schließlich wandte er sich der Arbeitsplatte zu, die an der anderen Wand des Labors entlanglief und auf der eine ganze Reihe von Ratten lag, vielleicht besinnungslos, vielleicht tot. Er schritt langsam an der Reihe entlang und stieß die Tiere einzeln an. Schlaff, schlaff, steif. Steif. Steif. Alle tot, ohne Zweifel. Jedes Tier hatte eine kleinere Dosis bekommen als das vorige, doch alle waren gestorben – obwohl er sich bei der letzten noch nicht sicher sein konnte. Also noch etwas warten, um ganz sicher zu sein.
Er musste es wissen. Denn am Hof der Wunder wurde gemunkelt. Und es hieß, der Frosch sei wieder da.
MAN SAGTE, ROTES HAAR SEI ein Zeichen des Teufels. Nachdenklich betrachtete Joan die feurigen Locken ihres Begleiters. Der Wind an Deck war so heftig, dass ihr die Augen tränten, und er riss Michael Murray kleine Haarsträhnen aus dem Haarband, sodass sie seinen Kopf wie Flammen umtanzten. Wenn er des Teufels war, hätte man allerdings erwartet, dass sein Gesicht so hässlich war wie die Nacht, und das war es nicht.
Zu seinem Glück sah er seiner Mutter ähnlich, dachte sie. Sein jüngerer Bruder Ian war weniger gesegnet, und das sogar ohne die heidnischen Tätowierungen. Michael hatte einfach ein angenehmes Gesicht, auch wenn es jetzt vom Wind und von den Spuren der Trauer gezeichnet war – was wahrhaftig kein Wunder war, hatte er doch gerade seinen Vater verloren und keinen Monat zuvor seine Frau in Frankreich.
Doch sie trotzte diesem Sturm nicht, um Michael Murray zu beobachten, selbst wenn es noch so sehr möglich war, dass er in Tränen ausbrach oder sich vor ihren Augen in den Gehörnten verwandelte. Sie berührte vorsichtshalber ihr Kruzifix. Der Priester hatte es gesegnet, und ihre Mutter hatte es den ganzen Weg zur St.-Ninians-Quelle getragen und dort ins Wasser getaucht, um den Heiligen um seinen Schutz zu bitten. Und es war ihre Mutter, die sie sehen wollte, solange sie konnte.
Sie löste ihr Halstuch, umklammerte es fest, damit es der Wind nicht fortwehte, und winkte damit. Ihre Mutter, die auf dem Kai immer kleiner wurde, winkte ebenfalls heftig, Joey hinter ihr mit dem Arm um ihre Taille, damit sie nicht ins Wasser fiel.
Joan schnaubte leise beim Anblick ihres frischgebackenen Stiefvaters, besann sich dann aber und berührte erneut das Kruzifix, während sie ein rasches Reuegebet sprach. Schließlich hatte sie selbst dafür gesorgt, dass diese Ehe zustande kam, und das war auch gut so. Wenn nicht, säße sie jetzt noch daheim in Balriggan fest und wäre nicht endlich unterwegs nach Frankreich, um eine Braut Christi zu werden.
Jemand stieß ihren Ellbogen an, und als sie zur Seite blickte, sah sie, dass Michael ihr ein Taschentuch anbot. Es war wirklich kein Wunder, wenn ihr die Augen liefen – aye, und die Nase –, bei diesem Wind. Sie nahm das Stückchen Stoff mit einem knappen Kopfnicken entgegen, wischte sich kurz über die Wangen und schwenkte ihr Halstuch noch heftiger.
Aus Michaels Familie war niemand da, um ihm zum Abschied zuzuwinken, nicht einmal seine Zwillingsschwester Janet. Aber sie waren halt alle mit dem beschäftigt, was nach dem Tod des alten Ian Murray zu tun war, kein Wunder also. Und es war sowieso nicht dringend nötig, Michael zum Schiff zu begleiten – Michael Murray war Weinhändler in Paris und ein wunderbar weit gereister Herr. Sie tröstete sich mit der Gewissheit, dass er wusste, was zu tun war und wohin sie gehen mussten. Er hatte gesagt, er würde sie unbehelligt im Konvent der Engel abliefern, denn der Gedanke, sich allein ihren Weg durch Paris zu suchen, wo die Straßen voller Menschen waren, die alle Französisch sprachen … obwohl sie natürlich gut Französisch konnte. Sie hatte es den ganzen Winter über gelernt, und Michaels Mutter hatte ihr geholfen. Allerdings würde sie der Äbtissin besser nichts von den französischen Romanen erzählen, die Jenny Murray in ihrem Bücherregal hatte.
»Voulez-vous descendre, mademoiselle?«
»Häh?« Sie sah Michael an, der auf die Treppe zeigte, die nach unten führte. Blinzelnd wandte sie sich zurück – doch das Kai war verschwunden und mit ihm ihre Mutter.
»Nein«, sagte sie. »Noch nicht. Ich möchte noch …« Sie wollte das Land sehen, solange sie konnte. Es würde das Letzte sein, was sie je von Schottland sah – ein Gedanke, bei dem sich ihr Magen zu einer kleinen festen Kugel zusammenballte. Sie wies mit einer vagen Geste auf die Leiter. »Geht nur. Ich komme schon allein zurecht.«
Doch er ging nicht, sondern stellte sich neben sie und umklammerte die Reling. Sie wandte sich ein wenig von ihm ab, damit er sie nicht weinen sah, doch eigentlich tat es ihr nicht leid, dass er geblieben war.
Keiner von ihnen sagte etwas, und langsam versank das Land, als ob die See es verschlang, und jetzt war ringsum nichts mehr als das offene Meer, das glasig grau unter den dahinrasenden Wolken wogte. Ihr wurde schwindelig von diesem Anblick, und sie schloss die Augen und schluckte.
Lieber Herr Jesus, gib, dass ich mich nicht übergeben muss!
Sie hörte ein leises Geräusch neben sich, und als sie die Augen öffnete, sah sie, dass Michael Murray sie besorgt betrachtete.
»Ist Euch nicht gut, Ms Joan?« Er lächelte schwach. »Oder sollte ich Euch Schwester nennen?«
»Nein«, sagte sie, bezwang ihre Nerven und ihren Magen und richtete sich auf. »Noch bin ich ja keine Nonne, oder?«
Er betrachtete sie von oben bis unten mit der unverblümten Art der Highlandmänner, und wieder lächelte er, diesmal breiter.
»Habt Ihr denn schon einmal eine Nonne gesehen?«, fragte er.
»Nein«, sagte sie, so steif sie konnte. »Gott und die Heilige Jungfrau habe ich auch noch nie gesehen, aber an sie glaube ich ebenfalls.«
Sehr zu ihrem Ärger brach er in Gelächter aus. Doch als er den Ärger in ihrem Gesicht sah, hörte er sofort auf, auch wenn sie es hinter seinem aufgesetzten Ernst immer noch beben sehen konnte.
»Ich bitte um Verzeihung, Ms MacKimmie«, sagte er. »Ich hatte nicht vor, die Existenz von Nonnen in Zweifel zu ziehen. Ich habe schon viele dieser Kreaturen mit meinen eigenen Augen gesehen.« Seine Lippen zuckten, und sie funkelte ihn an.
»Kreaturen, wie?«
»Eine Redensart, mehr nicht, das schwöre ich! Vergebt mir, Schwester, denn ich weiß nicht, was ich tue!« Er hob die Hand und zog in gespieltem Schrecken den Kopf ein. Das Bedürfnis, ihrerseits zu lachen, verschlechterte ihre Laune weiter, aber sie begnügte sich mit einem schlichten, missbilligenden Mmpfm.
Doch ihre Neugier gewann die Oberhand, und nachdem sie ein paar Momente das schäumende Kielwasser des Schiffes betrachtet hatte, fragte sie, ohne ihn anzusehen: »Als Ihr die Nonnen gesehen habt – was haben sie denn da getan?«
Er hatte sich jetzt wieder im Griff und antwortete ihr ernst.
»Nun, ich sehe zum Beispiel die Schwestern von Notre-Dame, die sich ständig um die Armen auf der Straße kümmern. Sie sind immer zu zweit unterwegs, und beide Nonnen haben große Körbe dabei, mit Essbarem, nehme ich an – vielleicht dazu Arzneien? Aber sie sind zugedeckt – die Körbe –, deshalb kann ich nicht mit Gewissheit sagen, was darin ist. Vielleicht schmuggeln sie ja auch Brandy und Spitze zu den Docks hinunter …« Er wich ihrer erhobenen Hand aus und lachte.
»Oh, Ihr werdet eine fabelhafte Nonne abgeben, Schwester Joan. Terror daemonium, solatium miserorum …«
Sie kniff die Lippen fest zusammen, um nicht zu lachen. Schrecken der Dämonen, was für eine Dreistigkeit!
»Nicht Schwester Joan«, sagte sie. »Sie werden mir wohl im Konvent einen neuen Namen geben.«
»Oh, aye?«, sagte er neugierig und strich sich das Haar aus den Augen. »Dürft Ihr Euch den Namen selbst aussuchen?«
»Ich weiß es nicht«, räumte sie ein.
»Nun, aber – welchen Namen würdet Ihr denn nehmen, wenn Ihr die Wahl hättet?«
»Äh … nun ja …« Sie hatte niemandem davon erzählt, doch was konnte es schon schaden? Sie würde Michael Murray ja nie wiedersehen, wenn sie erst in Paris waren. »Schwester Gregory«, platzte sie heraus.
Zu ihrer großen Erleichterung lachte er nicht.
»Oh, das ist ein guter Name«, sagte er. »Nach dem heiligen Gregor, dem Großen?«
»Nun … aye. Ihr findet ihn nicht anmaßend?«, fragte sie ein wenig nervös.
»Oh nein!«, sagte er überrascht. »Ich meine, wie viele Nonnen heißen denn Maria? Wenn es nicht anmaßend ist, sich nach der Mutter Gottes zu nennen, wie kann es dann vermessen sein, sich nur den Namen eines Papstes zu geben?« Dabei lächelte er so fröhlich, dass sie das Lächeln erwiderte.
»Wie viele Nonnen heißen denn Maria?«, fragte sie neugierig. »Es ist ein häufiger Name, oder?«
»Oh, aye, Ihr sagt ja, Ihr habt noch nie eine Nonne gesehen.« Doch er machte sich jetzt nicht mehr über sie lustig. »Ungefähr die Hälfte der Nonnen, denen ich je begegnet bin, scheinen Schwester Maria Irgendwie zu heißen – Ihr wisst schon, Schwester Maria Polycarp, Schwester Maria Joseph … in der Art.«
»Ihr begegnet also sehr vielen Nonnen, während Ihr Euren Geschäften nachgeht, ja?« Michael Murray war der jüngere Teilhaber von Fraser et Cie, einem der größten Wein- und Spirituosenhändler in Paris – und dem Schnitt seiner Kleider nach ging es ihm dabei nicht schlecht.
Sein Mund zuckte, doch er antwortete ernst.
»Nun, das tue ich, in der Tat. Nicht jeden Tag, aber die Schwestern kommen oft in mein Geschäft – oder ich gehe zu ihnen. Fraser et Cie beliefert die meisten Klöster und Konvente in Paris mit Wein, und manchmal schicken sie zwei Nonnen vorbei, um eine Bestellung aufzugeben oder etwas Besonderes mitzunehmen – ansonsten liefern wir natürlich. Und selbst die Orden, die keinen Wein zum Essen trinken – und die meisten Häuser in Paris trinken Wein; es sind schließlich Franzosen, aye? –, brauchen Messwein für ihre Kapellen. Und die Bettelorden klopfen mit schönster Regelmäßigkeit an und bitten um Almosen.«
»Tatsächlich?« Sie war so fasziniert, dass sie nicht länger versuchte, ihre Unwissenheit zu verbergen. »Ich wusste gar nicht … ich meine … die verschiedenen Orden haben also verschiedene Aufgaben, ist es das, was Ihr sagen wollt? Was für Orden gibt es denn sonst noch?«
Er warf ihr einen kurzen Blick zu, wandte sich dann aber wieder um und kniff die Augen zum Schutz gegen den Wind zusammen, während er überlegte.
»Nun … es gibt Nonnen, die die ganze Zeit beten – kontemplative Orden nennt man sie, glaube ich. Man sieht sie zu jeder Tages- und Nachtzeit in der Kathedrale. Es gibt aber mehr als nur einen solchen Orden; einer trägt graue Kutten und betet in der Josephskapelle, und ein anderer trägt Schwarz; man sieht sie vor allem in der Kapelle Unserer Lieben Frau der Meere.« Er warf ihr einen neugierigen Blick zu. »Wollt Ihr eine solche Nonne werden?«
Sie schüttelte den Kopf, froh, dass der beißende Wind ihr Erröten verbarg.
»Nein«, sagte sie nicht ohne Bedauern. »Das sind vielleicht die Heiligsten unter den Nonnen, aber ich habe einen Großteil meines Lebens damit verbracht, im Hochmoor vor mich hin zu sinnieren, und es lag mir nicht besonders. Ich glaube, ich habe nicht die richtige Seele dafür, selbst wenn ich es in einer Kapelle täte.«
»Aye«, sagte er und wischte sich die wehenden Haarsträhnen aus dem Gesicht. »Ich weiß, wie es im Hochmoor ist. Nach einer Weile geht einem der Wind nicht mehr aus dem Kopf.« Er zögerte einen Moment. »Als mein Onkel Jamie – Euer Pa, meine ich –, Ihr wisst doch, dass er sich nach der Schlacht von Culloden in einer Höhle versteckt hat?«
»Sieben Jahre lang«, sagte sie ein wenig ungeduldig. »Aye, jeder kennt diese Geschichte. Warum?«
Er zuckte mit den Achseln.
»Nur so ein Gedanke. Ich war damals noch ein kleines Kind, aber hin und wieder bin ich mit meiner Mutter zu ihm gegangen, um ihm etwas zu essen zu bringen. Er hat sich zwar gefreut, uns zu sehen, aber er hat nicht viel geredet. Und seine Augen haben mir Angst gemacht.«
Joan spürte, wie ihr ein kleiner Schauder über den Rücken lief, der nicht von der steifen Brise herrührte. Sie sah – sah es plötzlich, in ihrem Kopf – einen hageren, schmutzigen Mann, dessen Gesicht nur Haut und Knochen war und der in den feuchten, kalten Schatten der Höhle hockte.
»Pa?«, sagte sie spöttisch, um zu überspielen, dass ihr eine Gänsehaut über die Arme lief. »Wie kann man denn vor ihm Angst haben? Er ist doch so ein freundlicher, gütiger Mann.«
Michaels breiter Mund zuckte.
»Das kommt wahrscheinlich ganz darauf an, ob man ihn schon einmal kämpfen gesehen hat. Aber …«
»Habt Ihr das denn?«, unterbrach sie ihn neugierig. »Ihn einmal kämpfen gesehen?«
»Das habe ich, aye. Aber«, sagte er, denn er wollte sich nicht vom Thema abbringen lassen, »ich habe ja auch nicht gemeint, dass er mir Angst gemacht hat. Ich hatte nur das Gefühl, dass er nicht ganz von dieser Welt war. Dass er die Stimmen im Wind hörte.«
Das ließ ihr den Speichel im Mund eintrocknen, und sie bewegte ihre Zunge ein wenig und hoffte, dass man es ihr nicht ansah. Sie hätte sich keine Sorgen zu machen brauchen; er sah sie gar nicht an.
»Mein eigener Pa hat gesagt, es läge daran, dass Jamie so viel Zeit allein verbrachte, dass ihm die Stimmen in den Kopf krochen und er sie nicht aussperren konnte. Wenn er sich sicher genug fühlte, um ins Haus zu kommen, hat es manchmal Stunden gedauert, bis er wieder anfing, uns zu hören – wir durften ihn erst ansprechen, wenn er etwas gegessen und sich aufgewärmt hatte.« Er lächelte ein wenig bedauernd. »Mama meinte, vorher wäre er kein Mensch – und rückblickend glaube ich, dass sie das ganz wörtlich gemeint hat.«
»Nun«, sagte sie, hielt dann aber inne, weil sie nicht wusste, wie sie fortfahren sollte. Sie wünschte von ganzem Herzen, sie hätte das eher gewusst. Ihr Pa und seine Schwester würden später auch nach Frankreich kommen, doch es war möglich, dass sie sie nicht sehen würde. Vielleicht hätte sie mit Pa sprechen können, ihn fragen können, wie sich die Stimmen in seinem Kopf anhörten – was sie sagten. Ob sie Ähnlichkeit mit den Stimmen hatten, die sie hörte.
DIE DÄMMERUNG NAHTE, und die Ratten waren immer noch tot. Der Graf hörte, wie die Glocken von Notre-Dame zur Sext schlugen, und blickte auf seine Taschenuhr. Die Glocken schlugen zwei Minuten zu früh, und er runzelte die Stirn. Er hasste Nachlässigkeit. Er stand auf, reckte sich und stöhnte, als sein Rückgrat knackte wie die abgehackte Salve eines Exekutionskommandos. Kein Zweifel, er wurde älter – ein Gedanke, bei dem ihn ein Schauder durchlief.
Wenn. Wenn er den Weg vorwärts finden konnte, dann würde vielleicht … Aber man wusste es nie, das war der teuflische Haken daran. Kurze Zeit lang hatte er gedacht – gehofft –, dass der Alterungsprozess zum Halten kam, wenn man in der Zeit zurückreiste. Das erschien ihm anfangs logisch, wie wenn man eine Uhr zurückdrehte. Andererseits aber war es nicht logisch, denn er war immer in die Zeit vor seiner Geburt gereist. Nur einmal hatte er versucht, nur ein paar Jahre zurückzugehen, in die Zeit, als er Anfang zwanzig war. Das war ein Fehler gewesen, und er erschauerte heute noch bei der Erinnerung daran.
Er trat an das große Giebelfenster, das auf die Seine hinausblickte.
Dieser Ausblick auf den Fluss hatte sich in den letzten zweihundert Jahren kaum verändert; er hatte ihn zu diversen Zeiten gesehen. Das Haus hatte ihm zwar nicht immer gehört, aber es stand schon seit 1620, und jedes Mal war es ihm zumindest gelungen, sich kurz Zutritt zu verschaffen, wenn auch nur, um sich nach einer Passage wieder in der Wirklichkeit zurechtzufinden.
Nur die Bäume veränderten sich in seinem Bild des Flusses, und manchmal kam ein seltsam aussehendes Boot. Doch der Rest war immer gleich und würde zweifellos auch immer so bleiben: die alten Angler, die auf dem Landesteg stur vor sich hin schwiegen, während sie ihr Abendessen fingen und ihren Stammplatz mit ausgestreckten Ellbogen verteidigten, die jüngeren Fischer, die barfuß und mit vor Erschöpfung hängenden Schultern ihre Netze zum Trocknen ausbreiteten, die nackten kleinen Jungen, die vom Kai ins Wasser sprangen. Er empfand ein beruhigendes Gefühl von Ewigkeit, wenn er den Fluss beobachtete. Vielleicht spielte es ja gar keine so große Rolle, wenn er eines Tages sterben musste?
»Natürlich tut es das«, murmelte er vor sich hin und hob den Blick zum Abendhimmel. Die Venus leuchtete hell. Zeit zu gehen.
Gewissenhaft blieb er nacheinander vor den aufgereihten Ratten stehen, um sie zu betasten und sich zu vergewissern, dass jeder Lebensfunke erloschen war, dann fegte er sie alle in einen Jutesack. Wenn er zum Hof der Wunder ging, würde er zumindest nicht mit leeren Händen kommen.
JOAN WOLLTE EIGENTLICH immer noch nicht nach unten gehen, doch das Licht ließ jetzt nach, der Wind nahm rücksichtslos zu, und eine besonders hinterlistige Bö, die ihr die Röcke um die Taille wehte und ihr mit kalter Hand an den Hintern packte, entlockte ihr einen wenig würdevollen Aufschrei. Hastig strich sie ihre Röcke wieder glatt und steuerte dann auf die Leiter zu, gefolgt von Michael Murray.
Es tat ihr leid, als sie ihn am Fuß der Leiter husten und sich die Hände reiben sah; sie hatte ihn frierend an Deck festgehalten, weil er zu höflich war, nach unten zu gehen und sie sich selbst zu überlassen – und sie zu egoistisch, um zu sehen, dass er fror, der Arme. Sie machte sich eilig einen Knoten ins Taschentuch, der sie daran erinnern sollte, dass sie als Buße eine zusätzliche Rosenkranzdekade beten würde, sobald sie dazu kam.
Er begleitete sie zu einer Bank und sagte ein paar Worte auf Französisch zu der Frau, die neben ihr saß. Offenbar stellte er sie vor, so viel verstand sie noch – doch als die Frau dann nickte und antwortete, konnte sie nur noch mit offenem Mund dasitzen. Sie verstand kein Wort. Nicht ein einziges Wort.
Michael begriff ihre Lage offensichtlich, denn er sagte etwas zu dem Ehemann der Frau, das sie von Joan ablenkte, und verwickelte beide in ein Gespräch, das es Joan ermöglichte, sich lautlos an die hölzerne Wand des Schiffes zurücksinken zu lassen. Sie schwitzte vor Verlegenheit.
Nun, sie würde sich schon noch daran gewöhnen, beruhigte sie sich selbst. Sie musste es einfach. Entschlossen konzentrierte sie sich aufs Zuhören und machte sogar hier und dort ein Wort in dem Gespräch aus. Michael war einfacher zu verstehen; er sprach langsamer und schluckte nicht die zweite Hälfte jedes Wortes herunter.
Gerade versuchte sie zu erraten, wie man wohl ein Wort buchstabierte, das sich wie »pfagwiemiarniähr« anhörte,