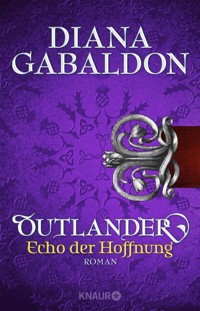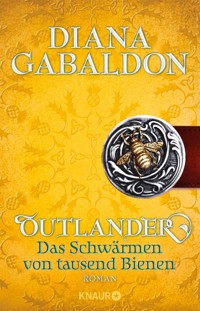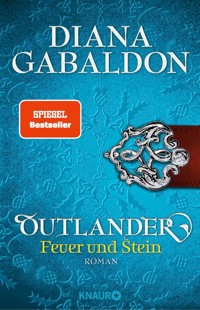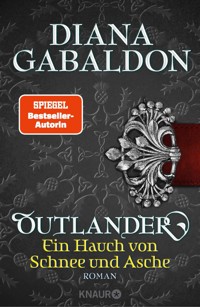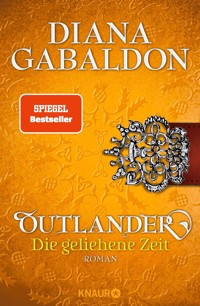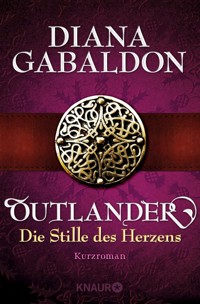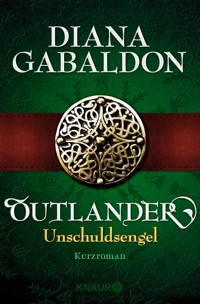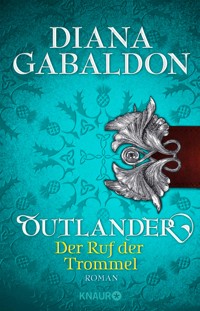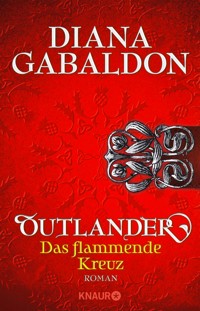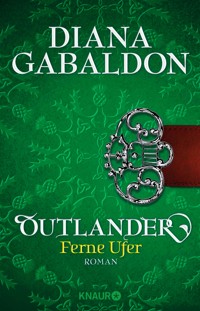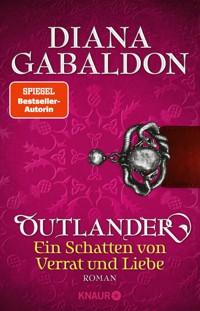
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Outlander-Saga
- Sprache: Deutsch
Jamie Fraser kehrt von den Toten zurück – doch seine große Liebe Claire hat seinen besten Freund geheiratet … »Outlander – Ein Schatten von Verrat und Liebe« ist der dramatische 8. Teil der Welt-Bestseller-Saga von Diana Gabaldon: ein hochspannender, gefühlvoll erzählter und exakt recherchierter Mix aus historischem Roman, Zeitreise-Abenteuer und Familiensaga. 1778 ist ein dramatisches Jahr für die Frasers: Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg steuert auf seinen blutigen Höhepunkt zu; William, der junge Graf von Ellesmere, findet zu seinem Entsetzen heraus, dass er Jamies unehelicher Sohn ist und damit von einem Rebellen und verurteilten Verbrecher abstammt; und die verwitwete Claire hat in die Ehe mit Lord John Grey eingewilligt, Jamies bestem Freund. Ihr Herz droht zum zweiten Mal zu brechen, als etwas geschieht, das sie in ihren kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt hätte: Eines Tages steht der totgeglaubte Jamie quicklebendig vor ihr. Zumindest wissen Claire und Jamie ihre Tochter Brianna im 20. Jahrhundert in Sicherheit – oder? Niemand mischt so gekonnt eine ganz große, romantische Liebesgeschichte mit spannenden historischen Fakten und dramatischen Abenteuern: Diana Gabaldons Highland-Saga ist ein Jahrhundertwerk. Die historischen Romane der Outlander-Saga von Bestseller-Autorin Diana Gabaldon sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Outlander – Feuer und Stein - Outlander – Die geliehene Zeit - Outlander – Ferne Ufer - Outlander – Der Ruf der Trommel - Outlander – Das flammende Kreuz - Outlander – Ein Hauch von Schnee und Asche - Outlander – Echo der Hoffnung - Outlander – Ein Schatten von Verrat und Liebe - Outlander – Das Schwärmen von tausend Bienen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2061
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Diana Gabaldon
Outlander
Ein Schatten von Verrat und Liebe
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Barbara Schnell
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
1778 ist ein dramatisches Jahr für die Frasers: Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg steuert auf seinen blutigen Höhepunkt zu; William, der junge Graf von Ellesmere, findet zu seinem Entsetzen heraus, dass er Jamies unehelicher Sohn ist und damit von einem Rebellen und verurteilten Verbrecher abstammt; und die verwitwete Claire hat in die Ehe mit Lord John Grey eingewilligt, Jamies bestem Freund. Ihr Herz droht zum zweiten Mal zu brechen, als etwas geschieht, das sie in ihren kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt hätte: Eines Tages steht der totgeglaubte Jamie quicklebendig vor ihr …
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
ERSTER TEIL
Zentnerweise Steine
Dreckiger Bastard
In welchem die Frauen wie immer die Scherben aufsammeln
Frag lieber nicht, wenn du die Antwort doch nicht hören willst
Die Leiden der jungen Herren
Elfreths Gasse
Unter meinem Schutz
Die unbeabsichtigten Folgen unüberlegten Tuns
Der Mensch braucht Luft zum Atmen
Die Gezeiten wenden sich
Chestnut Street Nr. 17
In welchem der Heilige Geist über einen zögernden Jünger kommt
Vergesst Paoli nicht!
Eine kleine Nachtmusik
Chestnut Street Nr. 17
Morgenlüfte voller Engel
Chestnut Street Nr. 17
Donnerdrohen
Eine Armee im Aufbruch
Raum für Geheimnisse
Freiheit!
Namenlos, heimatlos, trostlos und wirklich sehr betrunken
Harte Maßnahmen
Von Kohlköpfen und Königen
Im Wald außerhalb von Philadelphia
Männer …
Sturm zieht auf
In welchem Mrs Figg eingreift
Selige Kühle in der Glut, Trost inmitten all der Trauer
Schenkt mir Freiheit, sonst …
ZWEITER TEIL
Ein Schritt ins Dunkle
30. Oktober 1980 Ein hydroelektrischer Tunnel unter dem Damm von Loch Errochty
30. Oktober 1980 Das Studierzimmer des Gutsherrn, Lallybroch
Wer sucht, der findet
Wärmer, kälter
Rückkehr nach Lallybroch
Lichter und Sirenen
Der Schimmer in den Augen eines Schaukelpferds
»Denn manchen, welcher an der Schwelle stolpert, verwarnt dies, drinnen laure die Gefahr!«
»It’s Best to Sleep in a Hale Skin«
Zuflucht
An Gearasdan
Die Witterung eines Fremden
Cognosco te
Die Zahl der Bestie
Der Geist eines Gehängten
Ohne ihr Wissen Engel
In welchem alles zusammenkommt
In Liebe …
Geisterstunde
Amphisbaena
Wie man eine Seele heilt
Gütiger Jesus, sag mir ja …
DRITTER TEIL
Etwas Passendes für einen Krieg
Nur, wenn wir auch Spaß daran haben
Unschärferelation
Der gute Hirte
Der kleine Schurke
Morphiaträume
Ungünstig erwischt
In dem ich die Bekanntschaft einer Rübe mache
Vestalische Jungfrauen
Stinkender Papist
Geh nicht gelassen in die gute Nacht
Kastrametation
Eine Entdeckung in den eigenen Reihen
Quäker und Kundschafter
Zähflüssiger Dreier
Das Maultier kann dich nicht leiden
Eine alternative Verwendungsmöglichkeit für eine Penisspritze
Dreihunderteins
Moskitos
Kriegsbemalung
Nach Dingen greifen, die nicht da sind
VIERTER TEIL
Aufbruch in Dunkelheit
Ante-Emm
Die eine Laus
Folie à Trois
Irrungen und Wirrungen
Das seltsame Gebaren eines Zeltes
Was einen Mann in Schweiß ausbrechen und erbeben lässt …
Der Apfelgarten
Wer sich ergibt, begibt sich in Gefahr
So rot wie Blut, so weiß wie Schnee …
Zur falschen Zeit am falschen Ort
High Noon
Pater Noster
Bei den Grabsteinen
FÜNFTER TEIL
Auch Leute, die in den Himmel wollen, möchten nicht sterben, um dorthin zu kommen.
Sonnenuntergang
Dunkle Nacht
Der lange Rückweg
In welchem die rosenfingrige Morgenröte auf Streit aus ist
Mondaufgang
Ein Hauch von Roquefort
Den einen Tag ein stolzer Hahn – am Tag darauf ein Staubwedel
Es ist ein kluges Kind, das seinen Vater kennt
Drei zu null für Fraser
Ich lasse dich nicht damit allein
Das Haus an der Chestnut Street
Der Geist der Zusammenkunft
Eine Coda im 3/2 Takt
Ian und Rachel
Jamie und Claire
SECHSTER TEIL
The Body Electric
5. Dezember 1739
Kein Mangel an Haaren in Schottland
Männerarbeit
Der Wall
Radar
Sind dies deine Tier’?
Die einzige Chance
Postpartum
Sonnenwende
Der Sukkubus von Cranesmuir
Kein besonders guter Mensch
Ein Logenbruder
Der Friedhof
Die Realität ist das, was auch dann nicht verschwindet, wenn man nicht mehr daran glaubt
Frottage
Die Geräusche, aus denen die Stille besteht
SIEBTER TEIL
Ein Massaker in der Ferne
Gespenster bei Tageslicht
Und danke für den Fisch
Wer glaubt, kann nur gewinnen
Schlaf, der des Grams verworrn Gespinst entwirrt
Auf, auf zum fröhlichen Jagen
Difficilia quae pulchra
Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik
»Ah, armer Yorick!«
Das Krachen der Dornen
Über Kohlen gehen
Geweihter Boden
ACHTER TEIL
Quod scripsi, scripsi
Wozu die Buchstaben Q, E und D sonst noch gut sind
Calamari am Abend, erquickend und labend
Oglethorpes großer Wurf
Klempnerei
Auf der Froschjagd
Invasion
Ein überlegenes Heilmittel
Die geborene Spielerin
Irrlicht
Letzter Ausweg
Letzte Riten
Amaranthus
Was zu sagen bleibt
NEUNTER TEIL
Eine Herberge in der Wildnis
Fannys Frenulum
Ein Ausflug zum Handelsposten
Liebste, legst du dich zu mir?
Die tiefsten Gefühle äußern sich im Schweigen
Etwas kommt zum Vorschein
Interruptus
Ein Besuch im Geistergarten
Und das weißt du auch
Danksagung
Anmerkungen der Autorin
Dämme und Tunnel
Banastre Tarleton und die Britische Legion
Die Schlacht von Monmouth
Das Kriegsgerichtsverfahren gegen General Charles Lee
Dieses Buch ist ALLEN gewidmet, die (neben mir)
wie die Wilden daran gearbeitet haben, es für Sie fertigzustellen.
Vor allem
Jennifer Hershey (Lektorin, US)
Bill Massey (Lektor, UK)
Kathleen Lord (alias »Hercules« – Redakteurin)
Barbara Schnell (Übersetzerin und tapfere Mitstreiterin, Deutschland)
Catherine MacGregor, Catherine-Ann MacPhee und Adhamh O Broi
(Gaelisch-Experten)
Virginia Norey (alias »Büchergöttin« – Gestalterin)
und
Kelly Chian und dem Produktionsteam bei Random House
sowie
Beatrice Lampe und Petra Zimmermann in München.
Prolog
Im Licht der Ewigkeit wirft die Zeit keine Schatten.
»Eure Ältesten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen.« Doch was ist es, das die alten Frauen sehen?
Wir sehen die Notwendigkeit, und wir tun die Dinge, die getan werden müssen.
Junge Frauen sehen nicht – sie sind, und die Quelle des Lebens fließt in ihnen.
Wir sind die Hüter der Quelle, Beschützer des Lichts, das wir erweckt haben, der Flamme, die wir sind.
Was habe ich gesehen? Du bist das Gesicht meiner Jugend, der Traum all meiner Lebensalter. Funke, der mich entzündet.
Hier stehe ich nun wieder an der Schwelle des Krieges, meine Heimat ist kein Ort und keine Zeit; kein Land außer mir selbst … und dies ein Land, dessen einziges Meer das Blut ist, dessen einzige Grenze der Verlauf des Gesichtes, das ich liebe.
ERSTER TEIL
Nexus
1
Zentnerweise Steine
16. Juni 1778Im Wald zwischen Philadelphia und Valley Forge
Ian Murray stand da, einen Stein in der Hand, und betrachtete die Stelle, die er ausgewählt hatte. Eine kleine, abgelegene Lichtung zwischen ein paar mit Flechten überzogenen Felsbrocken, überschattet von Fichten am Fuß einer hohen Zeder; ein Ort, den kein Wanderer zufällig aufsuchen würde, der aber dennoch nicht unzugänglich war. Er hatte vor, sie hierherzubringen – die Familie.
Zuerst Fergus. Vielleicht nur Fergus allein. Mama hatte Fergus großgezogen, seit er zehn war; vorher hatte er keine Mutter gehabt. Ian war ungefähr zur gleichen Zeit zur Welt gekommen, also hatte Fergus Mama genauso lange gekannt wie er selbst und sie genauso geliebt. Vielleicht sogar mehr, dachte er, und Schuldgefühle vergrößerten seinen Schmerz. Fergus war bei ihr in Lallybroch geblieben und hatte sich mit um sie und den Hof gekümmert; er nicht. Er schluckte krampfhaft, trat auf die kleine freie Stelle hinaus und legte seinen Stein in die Mitte. Dann trat er einen Schritt zurück.
Und ertappte sich dabei, dass er den Kopf schüttelte. Nein, es mussten zwei Grabhügel sein. Seine Mama und Onkel Jamie waren Bruder und Schwester, und die Familie konnte sie hier gemeinsam betrauern – doch vielleicht würde er auch andere hierherführen, damit sie sie nicht vergaßen und ihnen die letzte Ehre erwiesen. Und das waren Menschen, die zwar Jamie Fraser gekannt und geliebt hatten, die aber keine Ahnung hatten, wer Jenny Murray war.
Das Bild seiner Mutter in einem Grab durchbohrte ihn wie eine Forke, verblasste, als ihm einfiel, dass sie ja gar nicht in einem Grab lag, und stieß dann noch einmal umso brutaler zu. Er konnte es nicht ertragen, sich vorzustellen, wie sie ertranken, sich vielleicht aneinanderklammerten, während sie versuchten, sich über …
»A Dhia!«, stieß er aus, ließ den Stein fallen und machte auf dem Absatz kehrt, um mehr zu suchen. Er hatte selbst schon Menschen ertrinken sehen.
Mit dem Schweiß des Sommertags rannen ihm die Tränen über das Gesicht; er achtete nicht darauf und hielt nur hin und wieder inne, um sich die Nase am Ärmel abzuwischen. Er hatte sich ein zusammengerolltes Halstuch um den Kopf gebunden, um sich die Haare und den beißenden Schweiß aus den Augen zu halten; es war triefend nass, bevor er auch nur zwanzig Steine auf jeden der Grabhügel gelegt hatte.
Seine Brüder hatten gewiss auf dem Friedhof von Lallybroch einen Grabhügel für seinen Vater errichtet. Und dann war die ganze Familie gekommen, gefolgt von den Pächtern und danach den Dienstboten, und jeder hatte dem Gewicht der Erinnerung seinen eigenen Stein hinzugefügt.
Fergus also. Oder … nein, was dachte er da nur. Tante Claire musste die Erste sein, die er hierherbrachte. Sie war zwar keine Schottin, aber sie wusste genau, was ein solcher Grabhügel bedeutete, und vielleicht würde es sie ja ein wenig trösten, einen für Onkel Jamie zu sehen. Aye, gut. Tante Claire, dann Fergus. Onkel Jamie hatte Fergus an Sohnes statt angenommen; es war Fergus’ gutes Recht. Und dann vielleicht Marsali und die Kinder. Doch möglicherweise war Germain ja alt genug, um mit Fergus zu kommen? Er war jetzt fast elf, beinahe Mann genug, um zu verstehen und wie ein Mann behandelt zu werden. Onkel Jamie war schließlich sein Großvater; es war nur recht und billig so.
Wieder trat er zurück und wischte sich keuchend über das Gesicht. Insekten summten ihm um die Ohren und umschwärmten ihn, gierig nach seinem Blut, doch er hatte sich bis auf einen Lendenschurz ausgezogen und sich nach Art der Mohawk mit Bärenschmalz und Minze eingerieben; sie rührten ihn nicht an.
»Wache über sie, oh Geist der roten Zeder«, sagte er leise auf Mohawk und blickte in das duftende Geäst des Baumes auf. »Hüte ihre Seelen und lasse sie hier verweilen, so frisch wie deine Zweige.«
Er bekreuzigte sich und bückte sich, um im verrottenden Laub zu graben. Ein paar Steine noch, dachte er. Für den Fall, dass ein Tier sie verstreute. Verstreut wie seine Gedanken, die rastlos unter den Gesichtern seiner Familie umherstreiften, den Bewohnern von Fraser’s Ridge – Gott, ob er je dorthin zurückkehren würde? Brianna. Oh Himmel, Brianna …
Er biss sich auf die Unterlippe und schmeckte Salz, leckte es ab und grub weiter. Sie war in Sicherheit bei Roger Mac und den Kindern. Doch, Gott, er hätte ihren Rat brauchen können – Roger Macs allerdings sogar noch mehr.
Wen konnte er jetzt noch fragen, wenn er Hilfe brauchte, sich um sie alle zu kümmern?
Rachel kam ihm in den Sinn, und ihm wurde ein wenig leichter ums Herz. Aye, wenn er Rachel hätte … Sie war jünger als er, nicht älter als neunzehn, und da sie Quäkerin war, hatte sie sehr seltsame Vorstellungen davon, wie die Dinge sein sollten, doch wenn er sie hätte, hätte er massiven Fels unter den Füßen. Er hoffte, dass er sie bekommen würde, aber es gab immer noch Dinge, die er ihr sagen musste, und bei dem Gedanken an dieses Gespräch kehrte die Enge in seine Brust zurück.
Das Bild seiner Cousine Brianna kehrte jedoch ebenfalls zurück und blieb vor seinem inneren Auge stehen: hochgewachsen mit der langen Nase und dem kräftigen Knochenbau ihres Vaters … und damit erhob sich gleichzeitig das Bild seines Vetters. Briannas Halbbruder. Großer Gott, William! Was fing er nur mit William an? Er bezweifelte, dass der Mann die Wahrheit kannte, wusste, dass er Jamie Frasers Sohn war – war es Ians Aufgabe, es ihm zu sagen? Ihn hierherzubringen und ihm zu erklären, was er verloren hatte?
Er musste bei diesem Gedanken aufgestöhnt haben, denn sein Hund Rollo hob den kräftigen Kopf und sah ihn besorgt an.
»Nein, das weiß ich auch nicht«, sagte Ian zu ihm. »Lassen wir es einfach dabei, aye?« Rollo legte den Kopf wieder auf die Pfoten, schüttelte sich die Fliegen aus dem Zottelpelz und sank erneut in seinen seligen Frieden.
Ian arbeitete noch eine Weile weiter und ließ seine Gedanken mit dem Schweiß und den Tränen verrinnen. Er hielt schließlich inne, als die sinkende Sonne die Spitzen seiner Grabhügel berührte, müde, aber friedvoller als zuvor. Die Hügelchen waren kniehoch, Seite an Seite, klein, aber solide.
Eine Weile stand er still, ganz ohne zu denken, und lauschte dem Zirpen der Vögel und dem Atem des Windes in den Bäumen. Dann seufzte er tief auf, hockte sich hin und berührte den einen der Hügel.
»Mo ghràdh, a mhathair«, sagte er leise. Meine Liebe ist mit dir, Mutter. Schloss die Augen und legte die aufgeschürfte Hand auf den anderen Steinhaufen. Unter dem Schmutz, den er sich in die Haut gerieben hatte, fühlten sich seine Finger seltsam an, als könnte er geradewegs durch die Erde greifen und das berühren, was er so sehr brauchte.
Er verharrte reglos und atmete, dann öffnete er die Augen.
»Hilf mir dabei, Onkel Jamie«, sagte er. »Ich glaube, das schaffe ich nicht allein.«
2
Dreckiger Bastard
William Ransom, der neunte Graf von Ellesmere, Vicomte Ashness, schob sich durch das Gedränge auf der Broad Street, ohne den Protest der Fußgänger zu beachten, die er unwirsch beiseitestieß.
Er wusste nicht, wohin er ging oder was er tun würde, wenn er dort anlangte. Alles, was er wusste, war, dass er platzen würde, wenn er stehen blieb.
Sein Kopf pochte wie ein entzündeter Abszess. Alles pochte. Seine Hand! Wahrscheinlich hatte er sich etwas gebrochen, doch das kümmerte ihn jetzt nicht. Sein Herz, das wund in seiner Brust hämmerte. Sein Fuß, zum Kuckuck, was denn, hatte er etwa auch noch zugetreten? Er holte aus und traf einen losen Pflasterstein, der mitten durch eine Schar von Gänsen flog, die lauthals zu gackern begannen und sich zischend auf ihn stürzten, während sie ihm die Flügel um die Schienbeine schlugen.
Es regnete Federn und Gänsekot, und die Leute stoben in alle Himmelsrichtungen auseinander.
»Bastard!«, kreischte die Gänsemagd und schlug mit ihrem Hirtenstab auf ihn ein, bis sie ihn übel am Ohr erwischte. »Der Teufel soll dich holen, du dreckiger Bastard!«
Eine ganze Reihe anderer wütender Stimmen schloss sich dieser Verwünschung an, und er bog in eine kleine Gasse ein, gefolgt von aufgeregtem Gackern und Rufen.
Er rieb sich das dröhnende Ohr und taumelte im Vorübergehen gegen die Häuserwände, doch er nahm nichts anderes wahr als dieses eine Wort, das ihm nur noch lauter durch den Kopf dröhnte. Bastard!
»Bastard!«, sagte er laut und schrie dann »Bastard, Bastard, Bastard!«, so laut er konnte, während er mit der Faust auf die nächste Ziegelmauer einhämmerte.
»Wer ist ein Bastard?«, fragte eine amüsierte Stimme hinter ihm. Er fuhr herum und sah eine junge Frau, die ihn neugierig betrachtete. Ihr Blick wanderte langsam über seine Gestalt hinweg und registrierte seine keuchende Brust, die Blutflecken an den Besätzen seines Uniformrockes und den grünen Gänsemist auf seiner Hose, langte an den Silberschnallen seiner Schuhe an und kehrte noch neugieriger zu seinem Gesicht zurück.
»Ich«, sagte er leise und verbittert.
»Oh, wirklich?« Sie trat aus dem schützenden Hauseingang, in dem sie gestanden hatte, und überquerte die Gasse, um sich vor ihn hinzustellen. Sie war hochgewachsen und schlank und hatte zwei hübsche feste Brüste – die unter ihrem dünnen Musselinhemd deutlich zu sehen waren, denn sie trug zwar einen seidenen Unterrock, jedoch weder Korsett noch Mieder. Und auch kein Häubchen – das Haar fiel ihr lose über die Schulter. Eine Hure.
»Ich habe eine Vorliebe für Bastarde«, sagte sie und berührte ihn sacht am Arm. »Was für ein Bastard seid Ihr denn? Ein übler? Ein durchtriebener?«
»Ein trauriger«, sagte er und musterte sie finster, als sie lachte. Sie bemerkte seine finstere Miene zwar, wich aber nicht zurück.
»Kommt doch herein«, sagte sie und ergriff seine Hand. »Ihr seht so aus, als könntet Ihr etwas zu trinken gebrauchen.« Er sah, wie sie seine aufgeplatzten, blutenden Fingerknöchel betrachtete und sich mit ihren kleinen weißen Zähnen auf die Unterlippe biss. Doch sie schien keine Angst zu haben, und er ließ sich widerstandslos von ihr in den dunklen Eingang ziehen.
Was für eine Rolle spielte es auch?, dachte er plötzlich zu Tode erschöpft. Was für eine Rolle spielte überhaupt irgendetwas?
3
In welchem die Frauen wie immer die Scherben aufsammeln
Chestnut Street Nr. 17, PhiladelphiaWohnsitz von Lord und Lady John Grey
William hatte das Haus wie ein Donnerschlag verlassen, und es sah so aus, als sei vorher der Blitz eingeschlagen. Ich fühlte mich jedenfalls tatsächlich so, als hätte ich ein furchtbares Gewitter überlebt; Haare und Nerven standen mir gleichermaßen zu Berge und bebten vor Aufregung.
Jenny Murray hatte das Haus gleich nach Williams Aufbruch betreten, und auch wenn ihr Anblick kein ganz so großer Schock war wie der Rest, so verschlug er mir doch die Sprache. Ich starrte meine ehemalige Schwägerin mit großen Augen an – wobei sie ja bei Licht betrachtet immer noch meine Schwägerin war, weil Jamie noch lebte. Er lebte.
Es war keine zehn Minuten her, dass er in meinen Armen gelegen hatte, und die Erinnerung an seine Berührung durchzuckte mich flackernd wie elektrische Funken in einer Leidener Flasche. Mir war dumpf bewusst, dass ich lächelte wie eine Idiotin, trotz der Zerstörungen, der erschütternden Szenen, trotz Williams verstörter Reaktion – wenn man eine solche Explosion denn als »Verstörung« bezeichnen konnte –, trotz der Gefahr, in der sich Jamie befand, und trotz der vagen Neugier, was Jenny oder aber auch Mrs Figg, Lord Johns Köchin und Haushälterin, wohl im nächsten Moment sagen würden.
Mrs Figg war glatt, rund und glänzend schwarz, und sie hatte die Angewohnheit, sich lautlos gleitend von hinten anzuschleichen wie eine Stahlkugel.
»Was ist denn hier los?«, knurrte sie, während sie plötzlich hinter Jenny auftauchte.
»Heilige Mutter Gottes!« Jenny wirbelte mit großen Augen herum und fuhr sich mit der Hand an die Brust. »Wer in Gottes Namen seid Ihr?«
»Das ist Mrs Figg«, sagte ich und verspürte ein surreales Bedürfnis zu lachen, trotz – oder vielleicht auch wegen – der Ereignisse, die sich just abgespielt hatten. »Lord John Greys Köchin. Und Mrs Figg, dies ist Mrs Murray. Meine, äh, meine …«
»Schwägerin«, sagte Jenny entschlossen. Sie zog ihre schwarze Augenbraue hoch. »Wenn du mich noch nimmst, Claire?« Ihr Blick war unverwandt und offen, und das Bedürfnis zu lachen verwandelte sich abrupt in ein nicht minder heftiges Bedürfnis, in Tränen auszubrechen. Von allen Quellen des Beistandes, die ich mir ausgemalt hätte … Ich holte tief Luft und streckte die Hand aus.
»Oh ja.«
Ihre kleinen festen Finger verwoben sich mit den meinen, und so einfach war es besiegelt. Es waren weder Entschuldigungen nötig noch Worte der Verzeihung. Die Maske, die Jamie trug, hatte sie nie gebraucht. Was sie dachte und fühlte, sah man ihren Augen an, diesen schrägen blauen Katzenaugen, die sie mit ihrem Bruder gemeinsam hatte. Sie wusste jetzt, wer und was ich war – und wusste, dass ich ihren Bruder mit Herz und Seele liebte, ihn immer geliebt hatte, trotz der geringfügigen Komplikation, dass ich gegenwärtig mit jemand anderem verheiratet war. Und dieses Wissen löschte Jahre des Misstrauens, des Argwohns und der Verletzungen aus.
»Das ist ja wirklich wunderbar«, sagte Mrs Figg in dem Moment knapp. Sie kniff die Augen zusammen und drehte sich geschmeidig um die eigene Achse, um das Panorama der Zerstörung zu betrachten. Das Treppengeländer war oben abgerissen. Zerborstene Geländerteile, löcherige Wände und blutige Flecken markierten den Weg, den William nach unten genommen hatte. Kristallsplitter des Lüsters übersäten den Boden und glitzerten festlich im Licht, das durch die offene Tür hereinströmte, die wie trunken an einer Angel hing.
»Merde auf Toast«, murmelte Mrs Figg. Abrupt wandte sie sich mir zu, die schwarzen Johannisbeeraugen immer noch zusammengekniffen. »Wo ist Seine Lordschaft?«
»Ah«, sagte ich. Ich merkte, dass dies eine zähe Angelegenheit werden würde. Mrs Figg empfand zwar für die meisten Leute nur tiefe Missbilligung, doch John war sie treu ergeben. Sie würde alles andere als angetan sein zu hören, dass Seine Lordschaft entführt worden war, und zwar von …
»Da wir gerade dabei sind, wo ist mein Bruder?«, erkundigte sich Jenny und sah sich um, als erwartete sie, dass Jamie plötzlich unter der Sitzbank hervorkriechen würde.
»Oh«, sagte ich. »Hm. Nun ja …« Möglicherweise sogar mehr als zäh. Denn …
»Und wo ist mein lieber William?«, wollte Mrs Figg wissen und zog die Nase kraus. »Er ist hier gewesen; ich rieche das stinkende Toilettenwasser, das er für seine Wäsche benutzt.« Missbilligend stieß sie mit der Schuhspitze gegen ein Stück Putz, das sich gelöst hatte.
Ich holte noch einmal tief Luft und klammerte mich fest an die Reste meines Verstandes.
»Mrs Figg«, sagte ich, »vielleicht wärt Ihr ja so freundlich und würdet uns allen eine Tasse Tee machen?«
Wir SAßEN IM SALON,während Mrs Figg sich von den Verwüstungen weiterhin murmelnd und kopfschüttelnd einen Überblick verschafft hatte. Nach vollendeter Inspektion war sie zum Küchenhaus geeilt, um neben der Teezubereitung auch ihre Schildkrötensuppe im Auge zu behalten.
»Schildkrötensuppe lässt man besser nicht verschmoren, oh nein«, sagte sie streng zu uns, als sie bei ihrer Rückkehr die Teekanne mit dem gepolsterten gelben Teewärmer abstellte. »Nicht, wenn sie so viel Sherry enthält, wie Seine Lordschaft es gerne hat. Fast eine ganze Flasche – das wäre eine schlimme Verschwendung guten Alkohols.«
Mein Inneres kehrte sich prompt nach außen. Schildkrötensuppe – mit viel Sherry – war für mich mit einer lebhaften und sehr intimen Erinnerung verbunden, die sich um Jamie und ein Fieberdelirium drehte und darum, wie das Auf und Ab eines Schiffes dem Beischlaf förderlich ist. Ein Gedanke, der dem bevorstehenden Gespräch wiederum nicht im Mindesten förderlich sein würde. Ich massierte mir die Stelle zwischen den Augenbrauen, um die summende Wolke der Verwirrung zu zerstreuen, die sich dort sammelte. Die Luft im Haus fühlte sich immer noch elektrisiert an.
»Apropos Sherry«, sagte ich. »Oder was Ihr sonst an Hochprozentigem greifbar hättet, Mrs Figg …«
Sie sah mich nachdenklich an, nickte und griff nach der Karaffe auf der Anrichte.
»Brandy ist stärker«, entschied sie und stellte sie vor mich hin.
Jenny betrachtete mich mit der gleichen Nachdenklichkeit. Sie streckte die Hand aus, goss einen ordentlichen Schluck Brandy in meine Tasse und verfuhr ähnlich mit der ihren.
»Nur für alle Fälle«, sagte sie mit hochgezogener Augenbraue, und wir tranken erst einmal. Ich glaubte zwar, dass ich etwas Kräftigeres brauchen würde als Tee mit Brandy, um die Wirkung der jüngsten Ereignisse auf meine Nerven zu lindern – Laudanum zum Beispiel oder einen ordentlichen schottischen Whisky –, doch der Tee half sicher fürs Erste auch ein bisschen. Er war heiß und aromatisch und ließ sich als sanftes Wärmerinnsal in meiner Mitte nieder.
»Nun denn. Besser, ja?« Jenny stellte ihre Tasse ab und sah mich erwartungsvoll an.
»Es ist zumindest ein Anfang.« Ich holte tief Luft und lieferte ihr eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse des Morgens.
Jennys Augen waren denen ihres Bruders verstörend ähnlich. Sie sah mich an, kniff sie zu, dann noch einmal, schüttelte den Kopf, wie um ihn zu klären … und akzeptierte, was ich ihr gerade erzählt hatte.
»Jamie ist also mit deinem Lord John auf und davon, die britische Armee ist hinter ihnen her, der hochgewachsene, aufgebrachte Junge, dem ich auf der Eingangstreppe begegnet bin, ist Jamies Sohn – nun, natürlich ist er das; das könnte selbst ein Blinder sehen –, und in der Stadt wimmelt es von britischen Soldaten. Und das ist alles?«
»Eigentlich ist er gar nicht mein Lord John«, widersprach ich. »Ansonsten, ja, das ist im Wesentlichen die Lage. Dann hat dir Jamie also von William erzählt?«
»Aye, das hat er.« Sie grinste mich über den Rand ihrer Teetasse hinweg an. »Ich freue mich so für ihn. Aber was hat der Junge denn dann? Er sah eher danach aus, als würde er nicht einmal einem Bären aus dem Weg gehen.«
»Was habt Ihr gesagt?«, unterbrach uns Mrs Figgs Stimme abrupt. Sie stellte das Tablett hin, das sie mitgebracht hatte, und der silberne Milchkrug und das Zuckerschälchen klapperten wie Kastagnetten. »William ist wessen Sohn?«
Ich kräftigte mich mit einem Schluck Tee. Mrs Figg wusste, dass ich mit einem gewissen James Fraser verheiratet gewesen und theoretisch seine Witwe war. Doch das war alles, was sie wusste.
»Nun«, sagte ich und hielt inne, um mich zu räuspern. »Der, äh, hochgewachsene Herr mit dem roten Haar, der gerade hier war – Ihr habt ihn doch gesehen?«
»Ja.« Mrs Figg sah mich mit zusammengekniffenen Augen an.
»Habt Ihr ihn Euch genau angesehen?«
»Habe nicht besonders auf sein Gesicht geachtet, als er an die Tür kam und nach Euch gefragt hat, aber von hinten habe ich ihn gut gesehen, als er mich aus dem Weg geschoben hat und die Treppe hochgelaufen ist.«
»Aus diesem Blickwinkel ist die Ähnlichkeit möglicherweise nicht ganz so ausgeprägt.« Ich trank noch einen Schluck Tee. »Äh … dieser Herr ist James Fraser, mein … äh … mein …« »Erster Ehemann« war nicht korrekt, genauso wenig wie »letzter Ehemann« oder auch – unglücklicherweise – »jüngster Ehemann«. Ich entschied mich für die einfachste Alternative. »Mein Ehemann. Und, äh … Williams Vater.«
Mrs Figgs Mund öffnete sich, erst einmal tonlos. Sie ging langsam rückwärts und setzte sich mit einem Pfmpf auf eine bestickte Ottomane.
»Weiß William das?«, fragte sie, nachdem sie einen Moment überlegt hatte.
»Jetzt ja«, sagte ich und wies mit einer knappen Geste auf die Verwüstung im Treppenhaus, die durch die offene Tür des Salons, in dem wir saßen, gut zu sehen war.
»Merde auf … ich meine, heiliges Lamm Gottes, behüte uns.« Mrs Figgs zweiter Ehemann war Methodistenprediger, und sie war stets bemüht, sich seiner würdig zu erweisen, doch ihr erster Mann war ein französischer Glücksspieler gewesen. Ihre Augen richteten sich auf mich wie zielende Kanonenrohre.
»Und Ihr seid seine Mutter?«
Ich verschluckte mich an meinem Tee.
»Nein«, sagte ich und wischte mir das Kinn mit einer Leinenserviette ab. »Ganz so kompliziert ist es dann doch nicht.« Eigentlich war es sogar noch komplizierter, aber ich hatte nicht vor zu erklären, wie William gezeugt worden war, weder Mrs Figg noch Jenny. Jamie musste ihr zwar erzählt haben, wer Williams Mutter war, aber ich bezweifelte, dass er seiner Schwester erzählt hatte, dass Williams Mutter, Geneva Dunsany, ihn mit Drohungen gegenüber Jennys Familie in ihr Bett gezwungen hatte. Welcher echte Kerl gibt schon gerne zu, dass er sich von einer Achtzehnjährigen hat erpressen lassen?
»Lord John ist Williams Vormund geworden, als Williams Großvater gestorben ist, und zu diesem Zeitpunkt hat Lord John auch Lady Isobel Dunsany geheiratet, die Schwester von Willies Mutter. Sie hatte sich um Willie gekümmert, seit seine Mutter bei seiner Geburt gestorben war, und sie und Lord John sind eigentlich von Kindesbeinen an Willies Eltern gewesen. Isobel ist dann gestorben, als er ungefähr elf war.«
Mrs Figg folgte dieser Erklärung aufmerksam, ließ sich aber nicht von der Hauptsache ablenken.
»James Fraser«, sagte sie mit einem vorwurfsvollen Blick auf Jenny und tippte sich mit ihren breiten Fingern auf das Knie. »Wie kommt es, dass er nicht tot ist? Es hieß doch, er ist ertrunken.« Sie richtete den Blick auf mich. »Ich dachte, Seine Lordschaft würde sich ebenfalls in den Hafen stürzen, als er es gehört hat.«
Ich erschauerte plötzlich und schloss die Augen, während das salzig-kalte Grauen dieser Nachricht mich mit einer Woge der Erinnerung überspülte. Obwohl ich das Glück von Jamies Berührung noch auf meiner Haut spürte und das Wissen, dass er da war, mir das Herz wärmte, durchlebte ich erneut den überwältigenden Schmerz zu hören, dass er tot war.
»Nun, zumindest was das angeht, kann ich Euch aufklären.«
Ich öffnete die Augen und sah, wie Jenny einen Zuckerklumpen in ihren frischen Tee fallen ließ und Mrs Figg zunickte. »Wir – mein Bruder und ich – sollten von Brest aus mit einem Schiff namens Euterpe fahren. Aber der durchtriebene Dieb von einem Kapitän ist ohne uns losgesegelt. Hat sich ja sehr für ihn ausgezahlt«, fügte sie stirnrunzelnd hinzu.
So konnte man es ausdrücken. Die Euterpe war bei einem Sturm im Atlantik gesunken und mit Mann und Maus verloren gegangen. Wie man mir – und John Grey – gesagt hatte.
»Jamie hat uns ein anderes Schiff gesucht, aber es ist in Virginia gelandet, und wir mussten an der Küste entlang nach Norden fahren, zum Teil mit der Kutsche, zum Teil mit dem Paketboot, um den Soldaten aus dem Weg zu gehen. Diese Nädelchen, die du Jamie gegen die Seekrankheit gegeben hast, wirken Wunder«, fügte sie beifällig an mich gewandt hinzu. »Er hat mir gezeigt, wohin ich sie stecken muss. Aber als wir gestern nach Philadelphia gekommen sind«, fuhr sie mit ihrer Erzählung fort, »haben wir uns bei Nacht in die Stadt gestohlen wie zwei Diebe und uns den Weg zu Fergus’ Druckerei gesucht. Himmel, ich dachte ein Dutzend Mal, mir würde das Herz stehen bleiben!«
Sie lächelte, als sie daran dachte, und mir fiel auf, wie sehr sie sich verändert hatte. Ihr Gesicht war immer noch von Trauer überschattet, und sie war dünn und von der Reise mitgenommen, aber die schreckliche Last des langen Sterbens ihres Mannes Ian hatte sich von ihr gehoben. Ihre Wangen hatten wieder Farbe, und ihre Augen leuchteten so, wie ich es zuletzt bei unserer ersten Begegnung vor dreißig Jahren gesehen hatte. Sie hat ihren Frieden gefunden, dachte ich und empfand eine Dankbarkeit, bei der es auch mir leichter ums Herz wurde.
»Jamie klopft also an die Hintertür, und es kommt keine Antwort, obwohl wir ein Feuer durch die Fensterläden leuchten sehen können. Er klopft noch einmal, diesmal ein kleines Liedchen …« Sie pochte sacht mit den Fingerknöcheln auf den Tisch, pom-pe-di-pom-pe-di-pomp-pomp-pomp, und mein Herz tat einen Satz, als ich die Titelmelodie der »Texas Rangers« erkannte, die Brianna ihm beigebracht hatte.
»Und kurz darauf«, fuhr Jenny fort, »ruft eine Frauenstimme heftig, ›Wer ist da?‹. Und Jamie sagt auf Gaidhlig: ›Es ist dein Vater, meine Tochter, und er ist durchgefroren, nass und hungrig.‹ Es hat nämlich in Strömen geregnet, und wir waren beide nass bis auf die Haut.«
Sie lehnte sich ein wenig zurück und erzählte genüsslich weiter.
»Es öffnet sich die Tür, aber nur einen Spalt, und da steht Marsali mit einer Pistole in der Hand und ihre beiden kleinen Mädchen hinter ihr, kämpferisch wie die Erzengel, jede mit einem Holzscheit, um es dem Dieb vor das Schienbein zu schlagen. Dann sehen sie den Feuerschein auf Jamies Gesicht fallen, und alle drei schreien los, als wollten sie die Toten wecken, und stürzen sich auf ihn und zerren ihn hinein und reden alle gleichzeitig und fragen, ob er ein Gespenst ist und warum er nicht ertrunken ist, und da haben wir zum ersten Mal davon gehört, dass die Euterpe gesunken war.« Sie bekreuzigte sich. »Gott sei ihren armen Seelen gnädig«, sagte sie und schüttelte den Kopf.
Ich bekreuzigte mich ebenfalls und sah, wie mir Mrs Figg einen Seitenblick zuwarf; ihr war nicht klar gewesen, dass ich Papistin war.
»Ich bin natürlich auch hineingegangen«, fuhr Jenny fort, »aber alle reden gleichzeitig und hasten hin und her, um trockene Kleider und heiße Getränke zu holen, und ich sehe mich einfach nur um, weil ich noch nie zuvor in einer Druckerei gewesen bin. Der Geruch nach Tinte, Papier und Blei ist ein Wunder für mich, und plötzlich zupft es an meinem Rock, und dieser Kleine mit dem süßen Gesicht sagt zu mir: ›Und wer seid Ihr, Madame? Möchtet Ihr etwas Cidre?‹«
»Henri-Christian«, murmelte ich und lächelte bei dem Gedanken an Marsalis Jüngsten, und Jenny nickte.
»›Nun, ich bin deine Oma Janet, mein Sohn‹, sage ich, und er bekommt große Augen, und er kreischt los und umarmt meine Beine so fest, dass ich aus dem Gleichgewicht gerate und auf die Kaminbank falle. Ich habe einen blauen Fleck am Hintern, der so groß ist wie deine Hand«, fügte sie aus dem Mundwinkel an mich gerichtet hinzu.
Ich spürte, wie sich ein kleiner Knoten der Anspannung löste, den ich gar nicht bemerkt hatte. Jenny wusste natürlich, dass Henri-Christian von Geburt an zwergenwüchsig war – aber etwas zu wissen und es zu sehen, sind manchmal zwei sehr verschiedene Dinge. Für Jenny war es eindeutig nicht so gewesen.
Mrs Figg hatte diesen Bericht interessiert verfolgt, ohne jedoch ihre Zurückhaltung aufzugeben. Bei der Erwähnung der Druckerei nahm diese Zurückhaltung nun noch ein wenig zu.
»Diese Leute – dann ist Marsali Eure Tochter, Ma’am?« Ich wusste, was sie dachte. Die ganze Stadt Philadelphia wusste, dass Jamie ein Rebell war – und ich damit eine Rebellin. Es war die Tatsache, dass mir die Verhaftung drohte, die Lord John dazu bewegt hatte, darauf zu beharren, dass ich ihn in den Wirren des Tumults heiratete, der auf die Nachricht von Jamies Tod gefolgt war. Die Erwähnung einer Druckerei im britisch besetzten Philadelphia führte unweigerlich zu weiteren Fragen, was genau dort gedruckt wurde und von wem.
»Nein, ihr Mann ist der Adoptivsohn meines Bruders«, erklärte Jenny. »Aber ich habe Fergus selbst großgezogen, seit er ein kleiner Junge war, also ist er nach der Sitte der Highlands auch mein angenommenes Kind.«
Mrs Figg kniff die Augen zu. Bis jetzt hatte sie tapfer versucht, die Figuren der Handlung auseinanderzuhalten, doch nun gab sie es auf und schüttelte so heftig den Kopf, dass die rosa Bändchen ihrer Haube wie Fühler hin und her wackelten.
»Also, wo zum Teufel … ich meine, wo in aller Welt ist Euer Bruder mit Seiner Lordschaft hin?«, wollte sie wissen. »Glaubt Ihr, sie sind zu dieser Druckerei?«
Jenny und ich wechselten einen Blick.
»Das bezweifle ich«, sagte ich. »Vermutlich hat er eher die Stadt verlassen und John – äh, Seine Lordschaft – als Geisel benutzt, um an den Wachtposten vorbeizukommen, falls notwendig. Wahrscheinlich lässt er ihn laufen, sobald sie weit genug entfernt sind.«
Mrs Figg stieß ein missbilligendes Brummen aus.
»Vielleicht geht er aber auch nach Valley Forge und liefert ihn den Rebellen aus.«
»Oh, das glaube ich nicht«, sagte Jenny beruhigend. »Was sollten sie schon mit ihm wollen?«
Mrs Figg blinzelte, verblüfft über die Vorstellung, dass irgendjemand Seiner Lordschaft nicht dieselbe Wertschätzung entgegenbringen könnte wie sie selbst, doch nachdem sie kurz die Nase gerümpft hatte, fand sie sich mit dieser Möglichkeit ab.
»Er war aber nicht in Uniform, oder, Ma’am?«, fragte sie mich mit gerunzelter Stirn. Ich schüttelte den Kopf. John besaß zurzeit kein Offizierspatent. Er war Diplomat, wenn auch theoretisch immer noch Oberstleutnant im Regiment seines Bruders, und legte seine Uniform daher zu feierlichen Anlässen an oder wenn es jemanden einzuschüchtern galt. Doch offiziell befand er sich im Ruhestand und würde in normaler Kleidung als Zivilist gelten, nicht als Soldat – und daher für General Washingtons Soldaten in Valley Forge kaum von besonderem Interesse sein.
Ich glaubte aber ohnehin nicht, dass Jamie nach Valley Forge wollte. Ich wusste mit absoluter Gewissheit, dass er zurückkommen würde. Hierher. Zu mir.
Dieser Gedanke entfaltete sich tief in meinem Inneren und stieg als Welle der Wärme in mir auf, sodass ich die Nase in meiner Teetasse vergrub, damit man nicht sah, wie ich rot wurde.
Er lebte. Ich liebkoste diese Worte, wiegte sie in meinem Herzen. Jamie lebte. So glücklich ich darüber war, Jenny zu sehen – und noch glücklicher darüber, dass sie mir einen Olivenzweig anbot –, am liebsten wäre ich hinauf in mein Zimmer gegangen, hätte die Tür geschlossen und mich mit fest geschlossenen Augen an die Wand gelehnt, um erneut die Sekunden nach seinem Eintreten zu durchleben, als er mich in die Arme genommen, mich an die Wand gedrückt und geküsst hatte, als mich die schlichte, greifbare, warme Tatsache seiner Gegenwart so überwältigt hatte, dass ich ohne die stützende Wand möglicherweise zu Boden gegangen wäre.
Er lebt, wiederholte ich lautlos zu mir selbst, er lebt.
Alles andere war gleichgültig. Obwohl ich mich doch flüchtig fragte, was er mit John angestellt hatte.
4
Frag lieber nicht, wenn du die Antwort doch nicht hören willst
Im Wald, eine Stunde außerhalb von Philadelphia
Eigentlich war er voll und ganz darauf gefasst gewesen zu sterben; rechnete mit nichts anderem, seit ihm dieser Satz entfahren war: »Ich habe deiner Frau beigewohnt.« Die einzige Frage, die ihm noch durch den Kopf ging, war die, ob ihn Jamie Fraser wohl erschießen oder erstechen würde oder ob er ihm mit bloßen Händen die Eingeweide herausreißen würde.
Dass ihn der gehörnte Ehemann in aller Ruhe betrachtete und einfach nur »Oh? Warum?« fragte, kam nicht nur unerwartet, sondern es war auch … unerhört. Absolut unerhört.
»Warum?«, wiederholte John Grey ungläubig. »Hast du warum gesagt?«
»Ja. Und ich würde eine Antwort sehr zu schätzen wissen.«
Jetzt hatte Grey beide Augen offen; er konnte sehen, dass Frasers äußerliche Ruhe längst nicht so unerschütterlich war, wie er zunächst vermutet hatte. Eine Ader pochte in Frasers Schläfe, und er hatte das Gewicht ein wenig verlagert, so wie es ein Mann im Umfeld einer Wirtshausschlägerei tun mochte, nicht unbedingt, um von sich aus gewalttätig zu werden, sondern um darauf gefasst zu sein, dass andere es wurden. Perverserweise fand Grey diesen Anblick beruhigend.
»Wie zum Henker meinst du das, ›Warum‹?«, fragte er plötzlich gereizt. »Und warum zum Kuckuck bist du nicht tot?«
»Das frage ich mich auch oft«, erwiderte Fraser höflich. »Dann hast du also gedacht, ich wäre es?«
»Ja, und deine Frau ebenso! Hast du die geringste Vorstellung davon, was ihr dieses Bewusstsein angetan hat?«
Die dunkelblauen Augen verengten sich kaum merklich.
»Willst du damit andeuten, dass ihr die Nachricht von meinem Tod derart den Verstand geraubt hat, dass sie jede Vernunft verloren hat und dich in ihr Bett gezwungen hat? Denn«, fuhr er fort und schnitt Grey das erhitzte Wort ab, »wenn ich in Bezug auf deine Natur nicht ernsthaft in die Irre geführt wurde, würde es doch beachtlicher Gewaltanwendung bedürfen, dich zu einem solchen Schritt zu zwingen? Oder sehe ich das falsch?«
Die Augen waren immer noch schmal. Grey erwiderte Frasers Blick. Dann schloss er kurz die Augen und rieb sich mit beiden Händen das Gesicht, als erwachte er aus einem Albtraum. Er ließ die Hände sinken und öffnete die Augen wieder.
»Du wurdest nicht in die Irre geführt«, brachte er zwischen zusammengebissenen Zähnen heraus. »Und du siehst es falsch.«
Frasers rote Augenbrauen fuhren in die Höhe – aufrichtig erstaunt, dachte er.
»Du hast es getan, weil – aus Verlangen?« Auch er erhob jetzt die Stimme. »Und sie hat das zugelassen? Das glaube ich nicht.«
Die Farbe kroch Fraser über den sonnengebräunten Hals, leuchtend wie eine Kletterrose. Grey sah das nicht zum ersten Mal, und tollkühn beschloss er, dass die beste – die einzig mögliche – Verteidigung darin bestand, die Beherrschung als Erster zu verlieren. Es war so erleichternd.
»Wir dachten, du wärst tot, du altes Arschloch!«, schrie er außer sich. »Alle beide! Tot! Und wir … wir … haben eines Abends zu viel getrunken … viel zu viel … wir haben von dir gesprochen … und … Verdammt, keiner von uns hat den anderen geliebt – wir haben es beide mit dir getrieben!«
Frasers Gesicht verlor abrupt jeden Ausdruck, und sein Mund klappte auf. Grey erfreute sich den Bruchteil einer Sekunde an diesem Anblick, bevor ihm eine kräftige Faust mit voller Wucht unter die Rippen fuhr, sodass er rückwärtsgeschleudert wurde, noch ein paar Schritte weiterstolperte und dann zu Boden fiel. Vollkommen atemlos lag er im Laub, und sein Mund öffnete und schloss sich wie der eines gestrandeten Fisches.
Also schön, dachte er. Dann also mit bloßen Händen.
Die Hände krallten sich in sein Hemd und zerrten ihn wieder hoch. Es gelang ihm, sich hinzustellen, und eine Spur von Luft sickerte ihm in die Lunge. Frasers Gesicht war keine drei Zentimeter von dem seinen entfernt. Fraser war ihm sogar so nah, dass er die Miene des Mannes nicht sehen konnte – nur zwei blutunterlaufene, irre Augen aus nächster Nähe. Das reichte ihm. Er fühlte sich jetzt völlig ruhig. Es würde nicht lange dauern.
»Du erzählst mir jetzt haarklein, was passiert ist, du dreckiger kleiner Perverser«, flüsterte Fraser, und sein Atem, der nach Ale roch, strömte heiß über Greys Gesicht. Er schüttelte Grey sacht. »Jedes Wort. Jede Geste. Alles.«
Grey bekam gerade eben genug Luft, um zu antworten.
»Nein«, sagte er entschlossen. »Dann bring mich lieber um.«
FRASER SCHÜTTELTE IHN SO HEFTIG, dass seine Zähne schmerzhaft aufeinanderschlugen und er sich auf die Zunge biss. Er stieß einen erstickten Laut aus, und ein Fausthieb, den er nicht hatte kommen sehen, traf sein rechtes Auge. Er fiel wieder zu Boden, während sein Kopf in bunte Fragmente und schwarze Punkte zersprang, und es roch durchdringend nach verrottendem Laub. Fraser zerrte ihn hoch und stellte ihn wieder hin, hielt dann aber inne, wahrscheinlich, um zu entscheiden, wie er seine Vivisektion am besten fortsetzte.
Da ihm das Blut in den Ohren hämmerte und Fraser keuchend atmete, hatte er nichts gehört, doch als er jetzt vorsichtig sein gesundes Auge öffnete, um zu sehen, woher der nächste Hieb kommen würde, entdeckte er den Mann. Ein verwahrlost aussehender, schmutziger Strolch mit einem Fransenjagdhemd, der stupide unter einem Baum hervorglotzte.
»Jethro!«, bellte der Mann und nahm sein Gewehr fester in die Hand.
Eine Anzahl Männer kam aus den Büschen. Ein oder zwei trugen die Reste einer Uniform, doch die meisten waren in grobes Leinen gekleidet, allerdings ergänzt durch die bizarren Rebellenmützen, enge Strickmützen aus Wolle, die ihnen bis über die Ohren gingen, sodass die Männer in Johns tränenden Augen aussahen wie lebende Bombenhülsen.
Die Ehefrauen, die ihnen diese Kleidungsstücke wahrscheinlich gestrickt hatten, hatten ihnen Mottos wie »Unabhängigkeit« oder »Freiheit« in die Bündchen gestrickt, aber eine besonders blutrünstige Handarbeiterin hatte ihrem Mann die Worte »Töte sie!« in die Mütze eingearbeitet. Der Mann selbst war, wie Grey bemerkte, ein kleines, schmächtiges Exemplar mit einer Brille, deren eines Glas zersprungen war.
Fraser hatte innegehalten, als er die Männer kommen hörte, und baute sich jetzt vor ihnen auf wie ein von Hunden gestellter Bär. Die Hunde blieben abrupt in sicherem Abstand stehen.
Grey presste die Hand auf seine Leber, die vermutlich einen Riss hatte, und keuchte. Er würde jeden Atemhauch brauchen.
»Wer seid Ihr?«, wollte einer der Männer wissen und stocherte kampflustig mit einem langen Stock auf Jamie ein.
»Oberst James Fraser, Morgans Scharfschützen«, erwiderte Fraser kalt, ohne den Stock zu beachten. »Und Ihr?«
Das schien den Mann ein wenig aus der Fassung zu bringen, doch er überspielte es mit großen Worten.
»Korporal Jethro Woodbine, Dunnings Waldläufer«, sagte er schroff. Er wies mit einer abrupten Kopfbewegung auf seine Begleiter, die sich augenblicklich in aller Seelenruhe auf der Lichtung verteilten. »Und wer ist Euer Gefangener?«
Grey spürte, wie sich sein Magen zusammenballte, was angesichts des Zustandes seiner Leber schmerzhaft war. Doch er antwortete mit zusammengebissenen Zähnen, ohne auf Jamie zu warten.
»Ich bin Lord John Grey. Falls Euch das etwas angeht.« Seine Gedanken hüpften umher wie Flöhe, während er versuchte, sich auszurechnen, ob seine Überlebenschancen bei Jamie Fraser oder bei dieser Bande von Rüpeln besser standen. Noch vor wenigen Augenblicken hatte er sich in die Idee gefügt gehabt, durch Jamies Hand zu sterben, doch wie so viele Ideen war auch diese in der Vorstellung reizvoller als in der Durchführung.
Die Enthüllung seiner Identität schien die Männer zu verwirren, die ihn unter skeptischem Gemurmel anblinzelten.
»Hat keine Uniform an«, bemerkte einer von ihnen sotto voce an einen anderen gerichtet. »Ob er überhaupt Soldat ist? Sonst haben wir doch nichts mit ihm zu schaffen, oder?«
»Doch, das haben wir«, verkündete Woodbine, der jetzt ein wenig von seinem Selbstbewusstsein zurückerlangte. »Und wenn Oberst Fraser ihn gefangen genommen hat, wird er doch wohl einen Grund haben?« Seine Stimme hob sich fragend, wenn auch zögernd. Jamie gab keine Antwort, und sein Blick war fest auf Grey gerichtet.
»Er ist Soldat.« Köpfe verdrehten sich, um zu sehen, wer das gesagt hatte. Es war der schmächtige Mann mit der zersprungenen Brille, die er jetzt mit einer Hand zurechtgerückt hatte, um Grey durch das verbleibende Glas besser betrachten zu können. Ein feuchtes graues Auge inspizierte ihn, dann nickte der Mann, der sich seiner Sache jetzt sicherer war.
»Er ist Soldat«, wiederholte der Mann. »Ich habe ihn in Philadelphia mit seiner Uniform auf der Veranda vor einem Haus an der Chestnut Street sitzen gesehen, wie er leibt und lebt. Er ist Offizier«, fügte er unnötigerweise hinzu.
»Er ist kein Soldat«, sagte Fraser und wandte den Kopf, um den Brillenträger scharf zu mustern.
»Hab’s gesehen«, knurrte der Mann. »Klar und deutlich. Mit Goldlitze«, murmelte er beinahe unhörbar und senkte den Blick.
»Aha.« Jethro Woodbine trat auf Grey zu und betrachtete ihn sorgfältig. »Nun, habt Ihr etwas zu Eurer Verteidigung zu sagen, Lord Grey?«
»Lord John«, sagte Grey gereizt und strich sich ein zerdrücktes Laubstückchen von der Zunge. »Ich bin nicht der Titelträger, sondern mein älterer Bruder ist es. Grey ist mein Nachname. Was die Uniform betrifft; ich bin Soldat gewesen. Ich besitze zwar noch einen Dienstrang innerhalb meines Regiments, aber kein gültiges Patent. Reicht Euch das, oder wollt Ihr auch noch wissen, was ich heute gefrühstückt habe?«
Er war dabei, sie absichtlich gegen sich aufzubringen, denn ein Teil von ihm hatte beschlossen, dass er lieber mit Woodbine gehen und sich von den Kontinentalen inspizieren lassen würde, statt hierzubleiben und weiterer Inspektion durch Jamie Fraser entgegenzusehen. Fraser musterte ihn mit zusammengekniffenen Augen. Er kämpfte gegen das Bedürfnis an, den Blick abzuwenden.
Es ist die Wahrheit, dachte er trotzig. Was ich dir gesagt habe, ist die Wahrheit. Und jetzt weißt du es.
Ja, sagte Frasers schwarzer Blick. Und du glaubst, ich werde still damit leben?
»Er ist kein Soldat«, wiederholte Fraser und wandte Grey betont den Rücken zu, um sich ganz auf Woodbine zu konzentrieren. »Er ist mein Gefangener, weil ich ihn verhören wollte.«
»Worüber denn?«
»Das geht Euch nichts an, Mr Woodbine«, sagte Jamie, und seine tiefe Stimme klang zwar sanft, hatte aber einen stählernen Unterton. Jethro Woodbine ließ sich jedoch von niemandem etwas vormachen, und daran wollte er absolut keinen Zweifel lassen.
»Was mich etwas angeht, entscheide ich selbst, Sir«, fügte er also nach einer merklichen Pause hinzu. »Woher wissen wir denn, dass Ihr seid, wer Ihr sagt, wie? Ihr tragt keine Uniform. Kennt einer von euch Kameraden diesen Mann?«
Die derart angesprochenen Kameraden zogen überraschte Mienen. Sie blickten einander unsicher an; ein oder zwei Köpfe schüttelten sich verneinend.
»Nun denn«, sagte Woodbine ermutigt. »Wenn Ihr nicht beweisen könnt, wer Ihr seid, dann werden wir diesen Mann wohl mit ins Lager nehmen, um ihn zu verhören.« Er lächelte unangenehm, da ihm anscheinend noch ein anderer Gedanke gekommen war. »Ob wir Euch auch mitnehmen sollen?«
Im ersten Moment stand Fraser völlig reglos da und betrachtete Woodbine so, wie ein Tiger wohl einen Igel betrachten würde: Ja, er konnte ihn fressen, aber würde es die Unannehmlichkeit wert sein, ihn hinunterzuschlucken?
»Dann nehmt ihn eben mit«, entschied er abrupt und entfernte sich von Grey. »Ich habe anderswo zu tun.«
Woodbine hatte Widerspruch erwartet; er blinzelte verblüfft und hob zwar seinen Stock, blieb aber stumm, als Fraser auf die andere Seite der Lichtung zustapfte. Als er die Bäume erreichte, drehte er sich um und warf Grey einen ausdruckslosen, finsteren Blick zu.
»Wir sind noch nicht fertig, Sir«, sagte er.
Grey richtete sich zu voller Größe auf, ohne seine schmerzende Leber und die Tränen zu beachten, die ihm aus dem verletzten Auge liefen.
»Stets zu Diensten, Sir«, gab er knapp zurück. Fraser funkelte ihn an und tauchte in den wogenden grünen Schatten ein, ohne Woodbine und seine Männer noch eines Blickes zu würdigen. Ein oder zwei von ihnen blickten den Korporal an, dem man seine Unentschlossenheit ansehen konnte. Grey jedoch empfand nichts dergleichen. Just bevor Frasers hochgewachsene Silhouette endgültig verschwand, formte er mit den Händen einen Trichter vor seinem Mund.
»Und es tut mir nicht leid, verdammt!«, rief er laut.
5
Die Leiden der jungen Herren
Jenny war zwar fasziniert von Williams Geschichte und den dramatischen Umständen, unter denen er gerade von seiner wahren Vaterschaft erfahren hatte, doch ihre eigentliche Sorge galt einem anderen jungen Mann.
»Weißt du, wo Ian ist?«, fragte sie wissbegierig. »Und hat er seine junge Frau gefunden, das Quäkermädchen, von dem er seinem Pa erzählt hat?«
Bei dieser Frage entspannte ich mich ein wenig; Ian und Rachel Hunter standen – Gott sei Dank – nicht auf der Liste der problematischen Verwicklungen. Zumindest im Moment nicht.
»Ja, das hat er«, sagte ich und lächelte. »Aber wo er ist …? Ich habe ihn seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen, aber oft ist er noch länger fort. Er arbeitet hin und wieder als Kundschafter für die Kontinentalarmee, aber da sie sich schon so lange in ihrem Winterquartier in Valley Forge befindet, wurden seine Dienste in letzter Zeit weniger gebraucht. Trotzdem ist er häufig dort, weil Rachel es auch ist.«
Jenny blinzelte erstaunt.
»Ach ja? Warum denn? Haben die Quäker nicht etwas gegen den Krieg?«
»Mehr oder weniger. Aber ihr Bruder Denzell ist Militärarzt – aber ein richtiger Arzt, keiner von den Pferdedoktoren und Quacksalbern, die man sonst in der Armee findet –, und er ist seit Dezember in Valley Forge. Rachel kommt immer wieder nach Philadelphia – sie darf die Wachtposten passieren und bringt ihm Essen und medizinischen Nachschub –, aber sie arbeitet an Dennys Seite und hält sich öfter dort auf als hier, um ihm bei seinen Patienten zu helfen.«
»Erzähle mir von ihr«, bat Jenny und beugte sich gebannt vor. »Ist sie ein liebes Mädchen? Und meinst du, dass sie Ian liebt? Nach allem, was sein Vater mir erzählt hat, liebt der Junge sie sehr, hatte aber noch nichts zu ihr gesagt, weil er nicht wusste, wie sie es aufnehmen würde. Er war sich nicht sicher, dass sie damit zurechtkommen würde, dass er … ist, wer er ist.« Ihre rasche Geste umfasste Ians Persönlichkeit und seine Entwicklung vom Highlandjungen zum Mohawk-Krieger. »Er würde ja weiß Gott niemals einen anständigen Quäker abgeben, und ich gehe davon aus, dass ihm das ebenso klar ist.«
Ich lachte bei diesem Gedanken, obwohl es gut möglich war, dass das Thema tatsächlich eine ernste Rolle spielen würde; ich wusste nicht, was eine Quäkerzusammenkunft von einem solchen Paar halten würde, hatte aber das dumpfe Gefühl, dass man alarmiert darauf reagieren würde. Ich wusste allerdings nicht das Geringste über die Ehe unter den Quäkern.
»Sie ist ein sehr liebes Mädchen«, versicherte ich Jenny. »Extrem vernünftig, sehr kompetent – und jeder sieht, dass sie Ian liebt, obwohl ich glaube, dass sie es ihm auch noch nicht gesagt hat.«
»Ah. Kennst du ihre Eltern?«
»Nein, sie sind beide gestorben, als Rachel noch ein Kind war. Sie ist mehr oder weniger von einer Quäkerwitwe großgezogen worden und dann mit sechzehn zu ihrem Bruder gezogen, um ihm den Haushalt zu führen.«
»Sprecht Ihr von der kleinen Quäkerin?« Mrs Figg war mit einer Vase Rosen ins Zimmer gekommen, die nach Myrrhe und Zucker dufteten. Jenny atmete den Duft tief ein und richtete sich auf. »Mercy Woodcock ist ganz begeistert von ihr. Sie schaut jedes Mal, wenn sie in der Stadt ist, bei Mercy vorbei, um diesen jungen Mann zu besuchen.«
»Jungen Mann?«, fragte Jenny und runzelte die Stirn.
»Williams Vetter Henry«, erklärte ich hastig. »Denzell und ich haben im Winter eine sehr ernste Operation an ihm durchgeführt. Rachel kennt William und Henry, und sie ist so gütig, regelmäßig nach Henry zu sehen. Mrs Woodcock ist seine Quartierswirtin.«
Mir fiel ein, dass ich selbst vorgehabt hatte, heute Vormittag nach Henry zu sehen. Es gab Gerüchte von einem Rückzug der Briten aus der Stadt, und ich musste mir einen Eindruck davon verschaffen, ob er schon reisefähig war. Letzte Woche war es ihm zwar schon recht gut gegangen, doch er hatte nicht mehr als ein paar Schritte gehen können und sich dabei auf Mercy Woodcocks Arm gestützt.
Und was ist mit Mercy Woodcock?, fragte ich mich mit einem kleinen Stich in der Magengrube. Mir und auch John war klar, dass es eine ernste – und wachsende – Zuneigung zwischen der freien Schwarzen und ihrem aristokratischen jungen Untermieter gab. Ich war Mercys Ehemann ein Jahr zuvor während des Rückzugs aus Fort Ticonderoga begegnet. Er war schwer verletzt gewesen, und da es seitdem kein Lebenszeichen von ihm gegeben hatte, hielt ich es für sehr wahrscheinlich, dass er nach seiner Gefangennahme durch die Briten gestorben war.
Doch die Möglichkeit, dass John Woodcock wundersam von den Toten zurückkehrte – es kam schließlich vor, dachte ich, und wieder stieg bei diesem Gedanken die Freude in mir auf –, war das geringste Problem. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Johns Bruder, der gestrenge Herzog von Pardloe, entzückt sein würde zu hören, dass sein jüngster Sohn vorhatte, eine Zimmermannswitwe zu heiraten, ganz gleich welcher Hautfarbe.
Und dann war da noch seine Tochter Dottie, wo wir gerade bei Quäkern waren … Sie war mit Denzell Hunter verlobt, und ich fragte mich, was der Herzog wohl davon halten würde. John, der gern wettete, hatte fünfzig zu fünfzig auf Dottie und ihren Vater gesetzt.
Ich schüttelte den Kopf und verwarf das Dutzend Dinge, an denen ich nichts ändern konnte. Während meines kleinen Gedankenausflugs schienen Jenny und Mrs Figg über William und seinen abrupten Aufbruch von der Szene gesprochen zu haben.
»Wohin kann er nur gegangen sein, frage ich mich?« Mrs Figg blickte sorgenvoll auf die Wand des Treppenhauses, in der Williams blutverschmierte Faust lauter Löcher hinterlassen hatte.
»Entweder sucht er Streit oder eine Flasche oder eine Frau«, sagte Jenny mit der Autorität einer Ehefrau, einer Schwester und einer Mutter mehrerer Söhne. »Vielleicht auch alles gleichzeitig.«
Elfreths Gasse
ES WAR NOCH NICHT MITTAG, und die einzigen Stimmen, die in dem Haus zu hören waren, waren die einer Gruppe plaudernder Frauen. Im Salon war niemand zu sehen, als sie vorübergingen, und es zeigte sich auch niemand, als sie ihn über eine abgenutzte Treppe in ihr Zimmer führte. Das löste ein seltsames Gefühl in ihm aus, als wäre er unsichtbar. Er fand diese Vorstellung tröstlich; er konnte sich selbst nicht ertragen.
Sie trat vor ihm ein und öffnete die Fensterläden. Er hätte sie gern gebeten, sie wieder zu schließen; in der Flut des Sonnenlichts fühlte er sich furchtbar entblößt. Doch es war Sommer; es war heiß und stickig im Zimmer, und er schwitzte bereits heftig. Die Luft, die hereinwirbelte, duftete nach Harz, und die Sonne spiegelte sich flüchtig auf ihrem glatten Scheitel wie der Glanz einer frischen Kastanie. Sie drehte sich um und lächelte ihn an.
»Eins nach dem anderen«, verkündete sie ruhig. »Zieht Euren Rock und Eure Weste aus, bevor Ihr noch erstickt.« Ohne abzuwarten, ob er diesem Vorschlag Folge leistete, wandte sie sich wieder um und griff nach Wasserkrug und Schüssel. Sie füllte die Schüssel, trat zurück und winkte ihn zum Waschtisch, auf dessen abgenutztem Holz ein Handtuch und ein viel benutztes Stück Seife lagen.
»Ich hole uns etwas zu trinken, ja?« Und mit diesen Worten war sie fort, und ihre nackten Füße trippelten geschäftig die Treppe hinunter.
Er begann mechanisch, sich zu entkleiden. Er blinzelte die Waschschüssel verständnislos an, doch dann fiel ihm ein, dass in den besseren Häusern manchmal von einem Mann verlangt wurde, sich erst zu waschen. Diese Sitte war ihm bereits einmal untergekommen, doch bei dieser Gelegenheit hatte die Hure die Waschung für ihn vorgenommen – und ihn mit der Seife so wirkungsvoll geknetet, dass das erste Aufeinandertreffen bereits in der Schüssel geendet hatte.
Bei dieser Erinnerung stieg ihm erneut die Röte ins Gesicht, und er riss so heftig an seinem Hosenlatz, dass ihm ein Knopf abplatzte. Sein gesamter Körper pulsierte immer noch schmerzhaft, doch das Gefühl begann jetzt, sich an einer Stelle zu konzentrieren.
Er konnte die Hände nicht ruhig halten und fluchte leise, denn seine aufgeschürfte Haut erinnerte ihn erneut an seinen überstürzten Aufbruch aus dem Haus seines Vaters. Nein, verdammt, nicht dem Haus seines Vaters. Lord Johns Haus.
»Du verdammter Bastard!«, murmelte er. »Du hast es gewusst. Du hast es die ganze Zeit gewusst!« Das versetzte ihn beinahe noch mehr in Wut als die erschütternde Enthüllung, wer sein Vater war – dass sein Stiefvater, den er geliebt hatte, dem er mehr als jedem anderen Menschen vertraut hatte … dass ihn der verdammte Lord John Grey sein Leben lang angelogen hatte!
Alle hatten ihn angelogen.
Alle.
Er fühlte sich plötzlich, als sei er in eine Kruste aus gefrorenem Schnee eingebrochen und darunter geradewegs in einen unvermuteten Fluss gestürzt. Als sei er unter dem Eis in die schwarze Atemlosigkeit gerissen worden, hilflos und stumm, während die ungezügelte Kälte sein Herz umklammerte.
Hinter ihm ertönte ein leises Geräusch, und er fuhr instinktiv herum, doch erst beim Anblick der erschütterten Hure begriff er, dass er hemmungslos weinte. Die Tränen liefen ihm über das Gesicht, und sein feuchter, halb versteifter Schwanz hing ihm aus der Hose.
»Verschwindet«, krächzte er, während er hektisch versuchte, seine Kleider wieder zu ordnen.
Statt zu verschwinden, kam sie auf ihn zu, eine Karaffe in der einen und zwei Zinnbecher in der anderen Hand.
»Fehlt Euch etwas?«, fragte sie und sah ihn von der Seite an. »Kommt, ich schenke Euch etwas ein. Ihr könnt es mir doch erzählen.«
»Nein!«
Sie kam auf ihn zu, jedoch langsamer. Durch seine tränennassen Augen sah er ihren Mund zucken, als sie seinen Schwanz sah.
»Das Wasser war für Eure armen Hände gedacht«, sagte sie und gab sich sichtlich Mühe, nicht zu lachen. »Ich muss aber zugeben, dass Ihr ein echter Gentleman seid.«
»Das bin ich nicht!«
Sie blinzelte.
»Ist es etwa eine Beleidigung, Euch so zu nennen?«
Überwältigt vor Wut, hieb er blind um sich und schlug ihr die Karaffe aus der Hand. Sie zerbarst in tausend Scherben, und es regnete billigen Wein. Sie schrie auf, als das Rot ihren Unterrock durchtränkte.
»Bastard!«, kreischte sie, dann holte sie aus und warf ihm die Becher an den Kopf. Sie traf jedoch nicht, und die Zinngefäße fielen scheppernd zu Boden und rollten davon. Sie war im Begriff, sich der Tür zuzuwenden, und rief »Ned! Ned!«, als er auf sie zustürmte und sie abfing.
Er wollte doch nur, dass sie aufhörte zu kreischen, wollte doch nur verhindern, dass sie die männliche Aufsicht des Hauses herbeirief. Er legte ihr die Hand auf den Mund, riss sie von der Tür zurück und versuchte mit der anderen Hand, ihre rudernden Arme unter Kontrolle zu bringen.
»Tut mir leid, tut mir leid«, sagte er immer wieder. »Ich wollte nicht … ich will nicht … oh, verdammt!« Sie hatte ihn abrupt mit dem Ellbogen an der Nase erwischt, und er ließ sie fahren und hob die Hand an sein Gesicht. Das Blut tropfte ihm zwischen den Fingern hindurch.
Ihr Gesicht hatte dort, wo er sie festgehalten hatte, einen roten Abdruck, und ihr Blick war wild. Sie wich zurück und rieb sich mit dem Handrücken über den Mund.
»Fort … mit Euch!«, keuchte sie.
Das ließ er sich nicht zweimal sagen. Er rauschte an ihr vorbei, schob sich an einem kräftigen Kerl vorbei, der die Treppe hinaufgerannt kam, und lief auf die Gasse hinaus. Erst als er die Straße erreichte, begriff er, dass er in Hemdsärmeln war, weil er Rock und Weste zurückgelassen hatte, und dass sein Hosenlatz offen stand.
»Ellesmere!«, sagte eine entsetzte Stimme. Er blickte entgeistert auf und stellte fest, dass er den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit einer Gruppe von englischen Offizieren bildete, unter ihnen Alexander Lindsay, der Graf von Balcarres.
»Guter Gott, Ellesmere, was ist denn passiert?« Sandy war sein Freund, und er war bereits dabei, sich ein großes, schneeweißes Taschentuch aus dem Ärmel zu ziehen. Das drückte er William vor die Nase, kniff ihm die Nasenlöcher zu und bestand darauf, dass er den Kopf in den Nacken legte.
»Hat man Euch etwa aufgelauert und Euch ausgeraubt?«, wollte einer der anderen wissen. »Gott! Diese grässliche Stadt!«