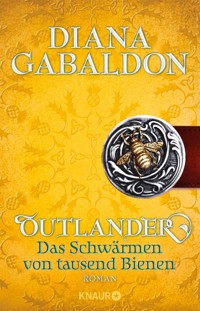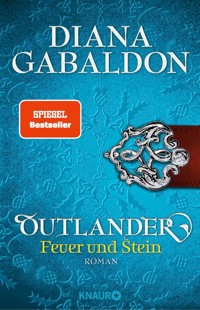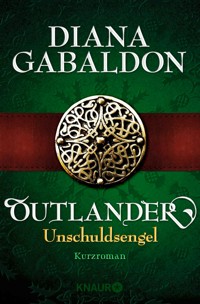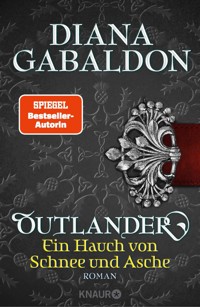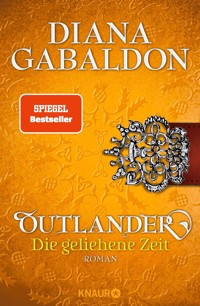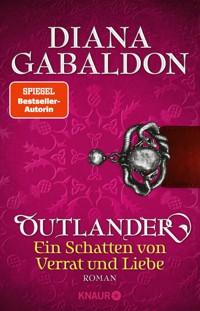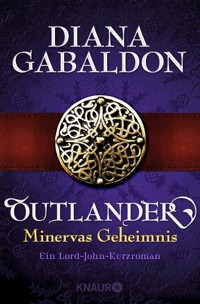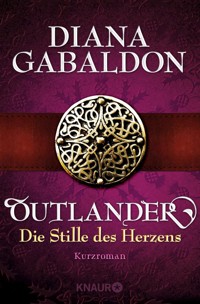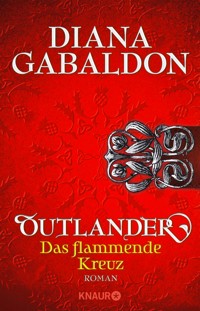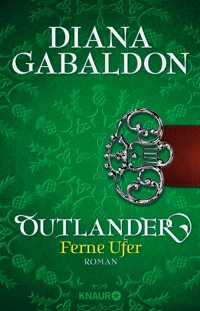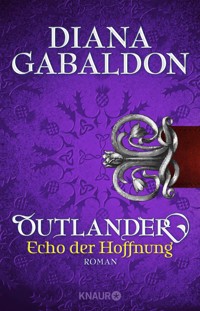
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Outlander-Saga
- Sprache: Deutsch
In Band 7 der erfolgreichen "Outlander"-Serie von Welt-Bestseller-Autorin Diana Gabaldon erwartet die Fans der großen Historien- und Zeitreise-Saga erneut ein opulentes Epos voller Leidenschaft und Liebe, Kampf und Rebellion. Dabei führt der Weg von Diana Gabaldons großem Liebespaar, Claire und Jamie, diesmal zurück nach Schottland, wo erneut Abenteuer, Leidenschaft, Romantik und Spannung auf die Liebenden warten. Inmitten der Wirren des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges beschließt Jamie Fraser 1777, mit seiner geliebten Claire nach Schottland zu reisen. Er will seine Druckerpresse aus Edinburgh holen, um die Rebellen zu unterstützen. Heißt es nicht, die Feder sei mächtiger als das Schwert? Die Reise birgt so manche Gefahr für die Liebenden, während ihre Freunde sich in den zunehmend blutigeren Gefechten auf verfeindeten Seiten wiederfinden. "Es kann nur eine geben – Diana Gabaldon ist die Mutter aller Highlander!" Brigitte Die historischen Romane der Outlander-Saga von Bestseller-Autorin Diana Gabaldon sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Outlander – Feuer und Stein - Outlander – Die geliehene Zeit - Outlander – Ferne Ufer - Outlander – Der Ruf der Trommel - Outlander – Das flammende Kreuz - Outlander – Ein Hauch von Schnee und Asche - Outlander – Echo der Hoffnung - Outlander – Ein Schatten von Verrat und Liebe - Outlander – Das Schwärmen von tausend Bienen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2110
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Diana Gabaldon
Outlander – Echo der Hoffnung
Roman
Aus dem Amerikanischen von Barbara Schnell
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In Band 7 der erfolgreichen »Outlander«-Serie von Weltbestsellerautorin Diana Gabaldon erwartet die Fans der großen Historien- und Zeitreise-Saga erneut ein opulentes Epos voller Leidenschaft und Liebe, Kampf und Rebellion. Dabei führt der Weg von Diana Gabaldons großem Liebespaar, Claire und Jamie, diesmal zurück nach Schottland, wo erneut Abenteuer, Leidenschaft, Romantik und Spannung auf die Liebenden warten.
Inmitten der Wirren des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges beschließt Jamie Fraser 1777, mit seiner geliebten Claire nach Schottland zu reisen. Er will seine Druckerpresse aus Edinburgh holen, um die Rebellen zu unterstützen. Heißt es nicht, die Feder sei mächtiger als das Schwert? Die Reise birgt so manche Gefahr für die Liebenden, während ihre Freunde sich in den zunehmend blutigeren Gefechten auf verfeindeten Seiten wiederfinden.
Der siebte Band der Outlander-Saga (Band 1: Feuer und Stein; Band 2: Die geliehene Zeit; Band 3: Ferne Ufer; Band 4: Der Ruf der Trommel; Band 5: Das flammende Kreuz; Band 6: Ein Hauch von Schnee und Asche) wieder in exklusiver Premiumausstattung!
»Es kann nur eine geben – Diana Gabaldon ist die Mutter aller Highlander!« Brigitte
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Erster Teil
Manchmal sind sie wirklich tot
Und manchmal sind sie’s nicht
Leben um Leben
Vorerst noch nicht
Kleine Moralkunde für Zeitreisende
Zweiter Teil
Long Island
Eine ungewisse Zukunft
Tauwetter
Abschied nehmen
Brander
Schräglage
Genug
Unrast
Heikle Angelegenheiten
Das schwarze Kabinett
In der Halle des Bergkönigs
Zwergdämonen
Zähneziehen
Ein Kuss in Liebe
Ich bedaure …
Pastors Katze
Schmetterling
Dritter Teil
Korrespondenz von der Front
Joyeux Noël
Am Busen der Tiefe
In der Klemme
Tunneltiger
Auf den Gipfeln der Hügel
Gespräch mit einem Schuldirektor
Schiffe ziehen in der Nacht vorüber
Eine kleine Führung durch die Kammern des Herzens
Vierter Teil
Verdachtsmomente
Die Ereignisse spitzen sich zu
Buch der Psalmen 30
Ticonderoga
Der Great Dismal
Fegefeuer I
Klare Worte
Eine Frage des Gewissens
Der Segen der heiligen Bride und des heiligen Michael
Zuflucht vor dem Sturm
Fünfter Teil
Scheideweg
Countdown
Freunde
Drei Pfeile
Energielinien
Höhenlagen
Henry
Bedenken
Exodus
Die Briten kommen
Feuer! Feuer!
Mount Independence
Die Rückkehr des Wilden
Rückzug
Bei lebendigem Leib
Das Deserteursspiel
Unabhängigkeitstag I
Die Schlacht von Bennington
Deserteursspiel, Runde II
… Keinen besseren Begleiter als die Büchse …
Ein einziger Gerechter
Für immer getrennt von Freunden und Familie
Herrenbesuch
Mein Hut, der hat drei Ecken
Sterbebett
Wenn es trieft vor Schmalz
Störenfried
Kapitulationsbedingungen
Schutzrecht
Sechster Teil
Dilemma
Das Fest aller Heiligen
Ein verlorenes Schäfchen kehrt zurück
Ich seh etwas, was du nicht siehst
Sic transit gloria mundi
Wenn der Wind weht
Memorarae
Alte Schulden
Die Höhle
In vino veritas
Fegefeuer II
Vorkehrungen
Schäfchenzählen
Zu meiner Rechten
Siebter Teil
Sohn einer Hexe
Valley Forge
Trennung und Wiedersehen
Ziemlich unschön
Der tintenbefleckte Krüppel
Gewappnet mit Diamanten und mit Stahl
Schritte
Unabhängigkeitstag II
Erdstöße
Die Pfade des Todes
Betäubung
Glühwürmchen
Nexus
Mischianza
Schmetterling auf dem Schlachthof
Warte, warte nur ein Weilchen …
Redivivus
Back to the roots
Die Stunde des Wolfs
Danksagung
Anmerkungen der Autorin
Über die Lord-John-Romane
Brigadier Simon Fraser
Loch Errochty und die Tunneltiger
Für die Hunde in meinem Leben
Penny Louise
Tipper John
John
Flip
Archie und Ed
Tippy
Spots
Emily
Ajax
Molly
Gus
Homer und JJ
Prolog
Der menschliche Körper ist erstaunlich flexibel. Ebenso die Seele. Doch es gibt Erlebnisse, von denen keine Rückkehr möglich ist.
Glaubst du das, a nighean? Gewiss, ein Körper ist schnell verstümmelt, und eine Seele kann verkümmern – doch jeder Mensch hat auch etwas, das niemals zerstört werden kann.
Erster Teil
Die Wasser trüben sich
Kapitel 1
Manchmal sind sie wirklich tot
Der Kopf des Piraten war verschwunden. William hörte, wie einige Zaungäste nebenan auf dem Kai darüber spekulierten, ob er wohl noch einmal auftauchen würde.
»Näh, der is’ für immer weg«, sagte ein zerlumpter Mulatte und schüttelte den Kopf. »Holt ihn nicht der Alligator, tut’s das Wasser.«
Ein Siedler aus dem Hinterland schob sich den Kautabak in die Backentasche und spuckte ins Wasser. Er war anderer Meinung.
»Nein, der hält bestimmt noch ein, zwei Tage. Das Geknorpel, das den Kopf festhält, trocknet in der Sonne aus. Wird so hart wie Eisen. Hab’s schon oft bei Tierkadavern gesehen.«
William sah, wie Mrs MacKenzie den Blick rasch auf den Hafen richtete und dann wieder abwandte. Sie sah blass aus, dachte er und stellte sich etwas anders hin, sodass sie die Männer und die braune Flut nicht mehr sehen konnte – auch wenn tatsächlich Flut herrschte und die Leiche, die an einen Pflock gebunden war, natürlich nicht zu erkennen war. Der Holzpflock jedoch ragte aus dem Wasser und erinnerte die Zuschauer auf grimmige Weise daran, welchen Preis das Verbrechen hatte. Man hatte den Piraten vor einigen Tagen dort draußen im Watt angebunden, damit er ertrank, wenn das Wasser stieg, und die Hartnäckigkeit, mit der seine verwesende Leiche an Ort und Stelle verweilte, beherrschte das Tagesgespräch.
»Jem!«, rief Mr MacKenzie laut und stürzte an William vorbei, um seinem Sohn nachzusetzen. Der kleine Junge, der das rote Haar seiner Mutter hatte, war davonspaziert, um dem Gespräch der Männer zuzuhören, und beugte sich nun, an einen Poller geklammert, gefährlich über das Wasser hinaus, weil er den toten Piraten sehen wollte.
Mr MacKenzie packte den Jungen am Kragen, zog ihn an sich und nahm ihn mit Schwung in die Arme, obwohl sich der Junge wehrte und den Hals in Richtung des sumpfigen Hafens reckte.
»Ich will sehen, wie der Walligator den Piraten frisst, Papi!«
Die Gaffer lachten, und selbst MacKenzie lächelte schwach, obwohl sein Lächeln verschwand, als er den Blick auf seine Frau richtete. Im nächsten Moment stand er an ihrer Seite und hatte ihr die Hand unter den Ellbogen gelegt.
»Ich glaube, wir müssen gehen«, sagte MacKenzie und setzte sich seinen Sohn auf die Hüfte, um seine Frau besser stützen zu können, deren Bestürzung nicht zu übersehen war. »Leutnant Ransom – ich meine, Lord Ellesmere –«, verbesserte er sich mit einem entschuldigenden Lächeln in Williams Richtung, »– hat doch gewiss noch andere Verpflichtungen.«
Das stimmte; William war mit seinem Vater zum Essen verabredet. Doch sein Vater wollte sich mit ihm in dem Wirtshaus auf der anderen Kaiseite treffen, daher konnte er ihn unmöglich verfehlen. Das sagte William auch, und er drängte sie zu bleiben, denn er genoss ihre Gesellschaft sehr – vor allem die Gesellschaft Mrs MacKenzies –, doch obwohl ihre Gesichtsfarbe jetzt gesünder wirkte, lächelte sie bedauernd und tätschelte das Häubchen des Babys auf ihrem Arm.
»Nein, wir müssen aufbrechen.« Sie richtete ihre Augen auf ihren Sohn, der immer noch darum kämpfte, wieder auf den Boden gelassen zu werden, und William sah, wie ihr Blick zum Hafen und dem Pfosten huschte, der finster aus der Flut ragte. Dann riss sie sich entschlossen davon los und wandte sich stattdessen an William. »Die Kleine wacht auf; sie wird Hunger haben. Aber es war wirklich schön, Euch kennenzulernen. Ich wünschte, wir könnten uns noch länger unterhalten«, sagte sie mit der größten Aufrichtigkeit und berührte dabei sacht seinen Arm, was ein angenehmes Gefühl in seiner Magengrube auslöste.
Inzwischen schlossen die Gaffer Wetten darauf ab, ob der untergetauchte Kopf noch einmal erscheinen würde, obwohl es nicht so aussah, als hätte einer von ihnen auch nur einen Groschen dabei.
»Zwei gegen eins, dass er bei Ebbe noch da ist.«
»Fünf gegen eins, dass der Rest noch da ist, nur der Kopf nicht. Ist mir egal, was du über den Knorpel erzählt hast, Lem, aber als die Flut gekommen ist, hat der Kopf nur noch an einem Faden gehangen. Spätestens bei der nächsten Flut ist er weg.«
In der Hoffnung, dieses Gespräch zu übertönen, begann William, sich ausführlich zu verabschieden. Dabei ging er so weit, Mrs MacKenzie in bester höfischer Manier die Hand zu küssen – und ließ sich sogar dazu hinreißen, dem Baby einen Kuss auf den Kopf zu drücken, was sie alle zum Lachen brachte. Mr MacKenzie warf ihm zwar einen ausgesprochen seltsamen Blick zu, schien aber keinen Anstoß daran zu nehmen und schüttelte ihm nach Republikanersitte die Hand – und trieb den Scherz dann sogar noch weiter, indem er seinen Sohn auf den Boden stellte und dem kleinen Jungen auftrug, ihm ebenfalls die Hand zu schütteln.
»Habt Ihr schon einmal jemanden umgebracht?«, erkundigte sich der Junge und richtete den Blick neugierig auf Williams Paradeschwert.
»Nein, noch nicht«, erwiderte William lächelnd.
»Mein Großvater hat schon zwei Dutzend Männer umgebracht!«
»Jemmy!«, sagten seine Eltern wie aus einem Munde, und der kleine Junge zog die Schultern bis zu den Ohren hoch.
»Aber es stimmt doch!«
»Oh, er ist bestimmt ein tapferer und gefährlicher Mann, dein Großvater«, versicherte William dem Kleinen ernst. »Solche Männer kann der König immer gut brauchen.«
»Mein Opa sagt, der König kann ihm den Buckel herunterrutschen«, erwiderte der Junge nüchtern.
»JEMMY!«
Mr MacKenzie hielt seinem redseligen Nachwuchs die Hand vor den Mund.
»Du weißt genau, dass dein Opa das nicht gesagt hat!«, rügte Mrs MacKenzie. Der kleine Junge nickte zustimmend, und sein Vater zog die knebelnde Hand wieder fort.
»Nein. Aber Oma hat es gesagt.«
»Tja, das kann schon eher sein«, murmelte Mr MacKenzie, der sich sichtlich bemühte, nicht zu lachen. »Aber so etwas sagt man nicht zu einem Soldaten – Soldaten arbeiten doch für den König.«
»Oh«, sagte Jemmy, der das Interesse an dem Thema verlor. »Geht die Flut jetzt wieder?«, fragte er hoffnungsvoll und reckte den Hals noch einmal in Richtung des Hafens.
»Nein«, sagte Mr MacKenzie bestimmt. »Das dauert noch Stunden. Dann bist du längst im Bett.«
Mrs MacKenzie lächelte William entschuldigend zu, die Wangen ebenso verlegen wie entzückend gerötet, und dann entfernte sich die Familie hastig. William blieb stehen, hin- und hergerissen zwischen Gelächter und Bestürzung.
»He, Ransom!«
Beim Klang seines Namens wandte er sich um und sah sich Harry Dobson und Colin Osborn gegenüber, zwei Oberleutnants aus seinem Regiment, die offensichtlich ihren Dienstpflichten entronnen waren und nun darauf brannten, die Fleischtöpfe Wilmingtons zu kosten – sofern vorhanden.
»Wer ist denn das?« Dobson blickte den Davoneilenden neugierig nach.
»Ein gewisser Mr und Mrs MacKenzie. Freunde meines Vaters.«
»Oh, sie ist verheiratet?« Dobson, der die Frau immer noch beobachtete, zog die Wangen ein. »Nun, das macht es natürlich etwas schwieriger, aber was ist das Leben schon ohne die Herausforderung?«
»Herausforderung?« William warf seinem alles andere als hochgewachsenen Freund einen zynischen Blick zu. »Ihr Mann ist ungefähr dreimal so groß wie du, falls dir das nicht aufgefallen ist.«
Osborn lachte, und sein Gesicht lief rot an.
»Und sie ist doppelt so groß wie er! Sie würde dich erdrücken, Dobby.«
»Und wie kommst du darauf, dass ich vorhabe, unten zu liegen?«, erkundigte sich Dobson würdevoll. Osborn johlte los.
»Warum bist du nur so von Riesinnen besessen?«, wollte William wissen. Er warf noch einen Blick auf die kleine Familie, die nun am Ende der Straße fast nicht mehr zu sehen war. »Diese Frau ist doch fast so groß wie ich!«
»Ja, reib’s mir nur richtig unter die Nase!« Osborn, der den eins fünfzig großen Dobson zwar überragte, aber immer noch einen Kopf kleiner war als William, trat scherzhaft nach dessen Knie. William wich dem Tritt aus und knuffte Osborn, der sich duckte und ihn gegen Dobson schubste.
»Meine Herren!« Sergeant Cutters drohende Cockneytöne ließen sie innehalten. Auch wenn sie ranghöhere Positionen bekleideten als der Sergeant, hätte keiner von ihnen es gewagt, diesen darauf hinzuweisen. Das gesamte Bataillon erzitterte vor Sergeant Cutter, der zwar älter als der Herrgott war und ungefähr so groß wie Dobson, dessen Zwergenkörper jedoch die Rage eines ausgewachsenen Vulkans kurz vor dem Ausbruch beherbergte.
»Sergeant!« Leutnant William Ransom, Graf von Ellesmere und der Älteste der drei, richtete sich kerzengerade auf und presste das Kinn in seinen Kragen. Hastigst folgten Osborn und Dobson seinem Beispiel.
Cutter schritt vor ihnen auf und ab wie ein Leopard auf der Pirsch. Man konnte fast sehen, wie er mit dem Schwanz zuckte und sich erwartungsfroh die Schnurrhaare leckte, dachte William. Darauf zu warten, dass er zubiss, war fast schlimmer als die eigentliche Attacke.
»Wo sind eigentlich Eure Männer?«, fauchte Cutter. »Meine Herren?«
Osborn und Dobson begannen sofort, sich stotternd zu erklären, doch Leutnant Ransom war – ausnahmsweise – unschuldig wie ein Lamm.
»Meine Männer bewachen den Gouverneurspalast, unter Leutnant Colson. Ich wurde freigestellt, Sergeant, um mit meinem Vater zu dinieren«, sagte er respektvoll. »Von Sir Peter.«
Sir Peter Packers Name wirkte für gewöhnlich Wunder, und auch Cutter verschlug es die Sprache. Zu Williams großer Überraschung war es jedoch nicht Sir Peters Name, der diese Reaktion ausgelöst hatte.
»Euer Vater?«, sagte Cutter blinzelnd. »Das ist doch Lord John Grey, oder?«
»Äh … ja«, erwiderte William vorsichtig. »Kennt … Ihr ihn?«
Bevor Cutter antworten konnte, öffnete sich die Tür einer nahe gelegenen Gastwirtschaft, und Williams Vater kam heraus. William lächelte hocherfreut über sein rechtzeitiges Erscheinen, unterdrückte das Lächeln jedoch rasch, als sich der stechende Blick des Sergeanten auf ihn heftete.
»Grinst mich nicht so an, Affengesicht«, begann der Sergeant in bedrohlichem Ton, wurde jedoch unterbrochen, als ihm Lord John vertraulich auf die Schulter klopfte – etwas, das keiner der drei jungen Leutnants je gewagt hätte, nicht einmal gegen Bezahlung.
»Cutter!«, sagte Lord John mit einem herzlichen Lächeln. »Ich habe diesen Wohlklang gehört und mir gedacht, verdammt, wenn das nicht Sergeant Aloysius Cutter ist! Es kann sonst keinen Menschen unter der Sonne geben, der sich derart nach einer Bulldogge anhört, die eine Katze verschluckt hat und dabei keinen Schaden genommen hat.«
»Aloysius?«, hauchte Dobson William zu, doch William grunzte nur kurz. Ein Achselzucken kam nicht infrage, da sein Vater seine Aufmerksamkeit nun auf ihn gerichtet hatte.
»William«, sagte er und nickte freundlich. »Wie pünktlich du doch bist. Bitte entschuldige meine Verspätung; ich wurde aufgehalten.« Bevor ihm William jedoch die anderen vorstellen konnte, hatte er sich schon darangemacht, gemeinsam mit Sergeant Cutter von den guten alten Zeiten zu schwärmen, die sie mit General Wolfe vor Quebec erlebt hatten.
Dies gestattete es den drei jungen Offizieren, sich ein wenig zu entspannen – was in Dobsons Fall bedeutete, seinen anfänglichen Gesprächsfaden wieder aufzunehmen.
»Du sagst, die kleine Rothaarige ist eine Bekannte deines Vaters?«, flüsterte er William zu. »Warum fragst du ihn nicht, wo sie wohnt?«
»Idiot!«, zischte Osborn. »Sie ist ja nicht einmal hübsch! Ihre Nase ist so lang wie – wie – wie Willies!«
»So hoch konnte ich nicht sehen«, sagte Dobson grinsend. »Aber ihre Titten waren genau auf Augenhöhe, und die …«
»Esel!«
»Psst!« Osborn trat Dobson auf den Fuß, um ihn zum Schweigen zu bringen, denn Lord John wandte sich wieder den jungen Männern zu.
»Stellst du mich deinen Freunden vor, William?«, erkundigte sich Lord John höflich. Das tat William – der dunkelrot angelaufen war, wusste er doch, dass sein Vater trotz seiner Erlebnisse bei der Artillerie messerscharf hörte –, und Osborn und Dobson verneigten sich ehrfurchtsvoll. Ihnen war nicht klar gewesen, wer sein Vater war, und William war einerseits stolz, dass sie beeindruckt waren, und ein wenig bestürzt, dass sie seine Verwandtschaft mit Lord John herausgefunden hatten – bis zum morgigen Abendessen würde das ganze Bataillon davon wissen. Nicht dass Sir Peter es nicht ohnehin wusste, aber dennoch –
Er nahm seine Gedanken zusammen, weil er begriff, dass sich sein Vater gerade in ihrer beider Namen verabschiedete, und erwiderte Sergeant Cutters Salut – hastig, aber in vollendeter Ausführung –, bevor er seinem Vater nacheilte und Dobby und Osborn ihrem Schicksal überließ.
»Ich habe gesehen, wie du mit Mr und Mrs MacKenzie gesprochen hast«, sagte Lord John beiläufig. »Ich hoffe, es geht ihnen gut?« Er blickte suchend am Kai entlang, doch die MacKenzies waren längst außer Sichtweite.
»Anscheinend ja«, sagte Willie. Er würde nicht fragen, wo sie wohnten, aber die junge Frau hatte einen nachhaltigen Eindruck auf ihn gemacht. Er hätte nicht sagen können, ob sie hübsch war oder nicht, doch ihre Augen waren ihm aufgefallen – ein herrliches Dunkelblau mit langen, kastanienbraunen Wimpern –, und sie hatten sich mit einer Intensität auf ihn gerichtet, die ihm das Herz bis in den letzten Winkel wärmte. Ihre Körpergröße war natürlich grotesk, aber – was dachte er sich nur? Die Frau war verheiratet – und hatte Kinder! Und obendrein hatte sie rote Haare!
»Bist du schon lange mit ihnen – äh – bekannt?«, fragte er und dachte dabei an die verblüffend perversen politischen Überzeugungen, die in dieser Familie offenbar vorherrschten.
»Eine ganze Weile. Sie ist die Tochter eines meiner ältesten Freunde, Mr James Fraser. Erinnerst du dich vielleicht an ihn?«
William runzelte die Stirn, konnte den Namen aber nicht einordnen – sein Vater hatte Tausende von Freunden, wie sollte er …
»Oh!«, sagte er. »Du meinst gar keinen englischen Freund. War es nicht ein Mr Fraser, den wir damals in den Bergen besucht haben, als du an den – an den Masern erkrankt bist?« Bei dem Gedanken an diese entsetzliche Zeit wurde ihm flau im Magen. Die Reise durch die Berge war ein einziger Nebel des Elends gewesen; nur einen Monat zuvor war seine Mutter gestorben. Dann hatte sein Vater die Masern bekommen, und William war fest überzeugt gewesen, dass er ebenfalls sterben würde. In seinem Kopf war kein Platz für irgendetwas anderes als Angst und Schmerz gewesen, und ihm waren nur ein paar verworrene Eindrücke von diesem Besuch geblieben. Er erinnerte sich dumpf, dass Mr Fraser mit ihm fischen gegangen war und dass er freundlich zu ihm gewesen war.
»Ja«, sagte sein Vater mit einem halben Lächeln. »Ich bin gerührt, Willie. Ich hätte gedacht, dass du dich eher wegen deines eigenen Missgeschicks an diesen Besuch erinnerst als wegen des meinen.«
»Missgeschick –« Die Erinnerung stürmte auf ihn ein, gefolgt von einer Hitzewelle, die heißer war als die schwüle Sommerluft. »Besten Dank! Es war mir gelungen, das zu vergessen, bis du es erwähnt hast!«
Sein Vater lachte so schallend, dass er sich vor Heiterkeit bog.
»Bedaure, Willie«, sagte er schließlich keuchend und wischte sich mit dem Taschentuch über die Augen. »Ich kann nichts dagegen tun; es war wirklich das – das – o Gott, ich werde den Anblick nie vergessen, als wir dich aus dem Abort gezogen haben!«
»Du weißt genau, dass es ein Unfall war«, sagte William steif. Seine Wangen brannten bei dem Gedanken an diese Peinlichkeit. Wenigstens war Frasers Tochter nicht dabei gewesen und hatte seine Erniedrigung nicht mit angesehen.
»Ja, natürlich. Aber –« Sein Vater hielt sich das Taschentuch vor den Mund, und seine Schultern bebten lautlos.
»Du kannst gern aufhören zu gackern«, sagte William beleidigt. »Wohin zum Teufel gehen wir überhaupt?« Sie hatten das Ende des Kais erreicht, und sein Vater – der immer noch prustete wie ein Schwertwal – bog jetzt in eine der ruhigen, von Bäumen gesäumten Straßen ein und ließ die Wirtshäuser am Hafen hinter sich.
»Wir speisen mit einem gewissen Hauptmann Richardson«, sagte sein Vater, der sich mit sichtlicher Mühe zusammenriss. Er hustete, putzte sich die Nase und steckte das Taschentuch ein. »Im Haus eines gewissen Mr Bell.«
Mr Bells Haus war weiß verputzt, gepflegt und wohlhabend, ohne prahlerisch zu wirken. Hauptmann Richardson wirkte ganz ähnlich; er war in den mittleren Jahren, gepflegt und gut gekleidet, jedoch ohne sichtlichen Stil, und sein Gesicht hätte man zwei Minuten nach der ersten Begegnung in keiner Menschenansammlung mehr wiedergefunden.
Die beiden jungen Damen des Hauses machten da schon größeren Eindruck, vor allem die jüngere, Miriam, aus deren Häubchen honigfarbene Locken hervorlugten und deren große, runde Augen während des gesamten Essens nicht von William wichen. Sie saß zu weit von ihm entfernt, als dass er sich direkt mit ihr hätte unterhalten können, doch er ging davon aus, ihr mithilfe der Sprache seiner Augen vermitteln zu können, dass die Faszination auf Gegenseitigkeit beruhte, und falls sich später die Gelegenheit zu einem Gespräch unter vier Augen ergab …?
Ein Lächeln; die honigfarbenen Wimpern senkten sich züchtig, gefolgt von einem raschen Blick in Richtung einer geöffneten Tür, die Luft von der Veranda hereinließ.
»Meinst du nicht auch, William?«, fragte sein Vater. Seine Lautstärke deutete darauf hin, dass er die Frage bereits zum zweiten Mal stellte.
»Oh, gewiss. Äh … was genau?«, fragte er, da es schließlich Papa war, nicht sein Befehlshaber. Sein Vater warf ihm einen Blick zu, der ausdrückte, dass er die Augen verdreht hätte, wenn sie sich nicht in Gesellschaft befunden hätten, doch er antwortete ihm geduldig.
»Mr Bell hat sich erkundigt, ob Sir Peter die Absicht hat, lange in Wilmington zu bleiben.« Mr Bell, der auf der anderen Seite neben Lord John saß, verneigte sich freundlich, obwohl William beobachtete, wie er mit zusammengekniffenen Augen in Miriams Richtung blickte. Vielleicht war es ja besser, ihr morgen seine Aufwartung zu machen, wenn Mr Bell seinen Geschäften nachging.
»Oh. Ich glaube, dass wir nur kurz hierbleiben, Sir«, sagte er respektvoll zu Mr Bell. »Wenn ich es richtig verstehe, gibt es vor allem im Hinterland Unruhen, daher werden wir gewiss ohne Zögern aufbrechen, um sie niederzuwerfen.«
Das schien Mr Bell zu freuen, obwohl William aus dem Augenwinkel sah, wie Miriam ihren hübschen Mund verzog, als sie von seiner unmittelbar bevorstehenden Abreise hörte.
»Gut, gut«, sagte Bell jovial. »Gewiss werden auf dem Marsch Hunderte von Loyalisten zu Euch stoßen.«
»Ohne Zweifel, Sir«, murmelte William und aß noch einen Löffel Suppe. Er bezweifelte, dass Mr Bell zu ihnen zählen würde. Er sah nicht aus wie ein Mann, der viel marschierte. Außerdem würde den Soldaten der Beistand unzähliger unausgebildeter, mit Schaufeln bewaffneter Provinzler ohnehin keine Hilfe sein, doch das konnte er ja kaum laut aussprechen.
Während William versuchte, Miriam zu beobachten, ohne sie direkt zu fixieren, fing er stattdessen einen Blick auf, der zwischen seinem Vater und Hauptmann Richardson hin und her huschte, und erst jetzt begann er, sich zu wundern. Sein Vater hatte ausdrücklich gesagt, dass sie mit Hauptmann Richardson dinieren würden – also war die Begegnung mit dem Hauptmann der eigentliche Zweck des Abends. Warum?
Dann fiel ihm Ms Lillian Bell auf, die ihm gegenübersaß, neben seinem Vater, und er dachte nicht länger an Hauptmann Richardson. Dunkeläugig, hochgewachsener und schlanker als ihre Schwester – jedoch wirklich eine sehr hübsche junge Frau, wie ihm plötzlich klar wurde.
Als sich die Männer nach dem Essen auf die Veranda zurückzogen, überraschte es William nicht, sich am einen Ende neben Hauptmann Richardson wiederzufinden, während sein Vater am anderen Ende Mr Bell in ein angeregtes Gespräch über die Teerpreise verwickelte. Papa konnte sich mit jedem Menschen über alles Mögliche unterhalten.
»Ich möchte Euch einen Vorschlag unterbreiten, Leutnant«, sagte Richardson, nachdem sie die üblichen Höflichkeiten ausgetauscht hatten.
»Ja, Sir«, sagte William respektvoll. Er wurde zunehmend neugierig. Richardson war Dragonerhauptmann, befand sich jedoch im Moment nicht bei seinem Regiment; so viel hatte er bereits während des Essens preisgegeben und beiläufig fallen gelassen, er sei in einem Sonderauftrag unterwegs. Doch was für ein Sonderauftrag?
»Ich weiß nicht, wie viel Euch Euer Vater über meine Mission erzählt hat.«
»Gar nichts, Sir.«
»Ah. Ich bin damit beauftragt, im Südlichen Department Nachrichten zu sammeln. Nicht dass ich das Kommando über derartige Operationen hätte, versteht Ihr –« Der Hauptmann lächelte bescheiden. »Ich bin nur ein kleiner Teil davon.«
»Ich … bin mir des großen Wertes solcher Operationen bewusst, Sir«, sagte William, um Diplomatie bemüht, »doch ich – das heißt, was mich selbst angeht –«
»Ihr habt kein Interesse an der Spionage. Nein, natürlich nicht.« Es war dunkel auf der Veranda, aber der trockene Ton des Hauptmanns war nicht zu überhören. »Das haben nur wenige Männer, die sich als Soldaten betrachten.«
»Es war nicht als Beleidigung gemeint, Sir.«
»So habe ich es auch nicht aufgefasst. Ich habe nicht vor, Euch als Spion zu rekrutieren – das ist ein delikates Amt, das einiges an Gefahr mit sich bringt –, sondern als Boten. Solltet Ihr dabei allerdings die Gelegenheit bekommen, Euch als Spitzel zu betätigen – nun, das wäre ein zusätzlicher Beitrag, der großen Beifall finden würde.«
William spürte, wie ihm bei der Andeutung, er könne weder mit delikaten noch mit gefährlichen Situationen umgehen, das Blut ins Gesicht stieg, doch er beherrschte sich und sagte nur: »Oh?«
Allem Anschein nach hatte der Hauptmann wichtige Informationen über die Zustände in Carolina zusammengetragen, die er nun dem Kommandeur des Nördlichen Departments zukommen lassen musste – General Howe, der sich gegenwärtig in Halifax befand.
»Natürlich werde ich mehr als einen Boten schicken«, sagte Richardson. »Und ebenso natürlich geht es auf dem Seeweg schneller – aber ich hätte gern mindestens einen Boten, der über Land reist, einerseits aus Sicherheitsgründen und andererseits, um en route weitere Beobachtungen anzustellen. Euer Vater ist voll des Lobes über Eure Fähigkeiten, Leutnant.« Hörte er da einen Hauch von Belustigung in der staubtrockenen Stimme? »Und ich habe gehört, dass Ihr North Carolina und Virginia ausgiebig bereist habt. Das ist sehr viel wert. Ihr könnt sicher nachvollziehen, dass ich nicht wünsche, dass mein Bote auf Nimmerwiedersehen im Dismal-Sumpf verschwindet.«
»Haha«, machte William höflich, da er dies für einen Scherz hielt. Hauptmann Richardson war mit Sicherheit noch nie in der Nähe des Great-Dismal-Sumpfes gewesen; William hingegen schon, obwohl er sich nicht vorstellen konnte, dass irgendein vernünftiger Mensch diesen Weg absichtlich wählen würde, es sei denn, um zu jagen.
Auch erfüllte ihn Richardsons Vorschlag mit großer Skepsis – doch noch während er sich einredete, dass er gar nicht erst daran denken sollte, seine Männer zu verlassen, sein Regiment … hatte er bereits eine romantische Vision seiner selbst vor Augen, allein in der endlosen Wildnis, in Sturm und Gefahr mit wichtigen Neuigkeiten unterwegs.
Wichtiger jedoch war, was ihn am anderen Ende der Reise erwartete.
Richardson ahnte, dass diese Frage kommen würde, und antwortete, bevor er sie aussprechen konnte.
»Dort im Norden könntet Ihr Euch dann – falls es beliebt – General Howes Stab anschließen.«
Soso, dachte er. Das war also der Apfel, und wie schön rot und saftig er war. Ihm war zwar bewusst, dass Richardson meinte, falls es General Howe beliebte, nicht William – doch er vertraute durchaus auf seine Fähigkeiten und glaubte fest, dass er sich als nützlich erweisen konnte.
Er hatte sich nur einige Tage in North Carolina aufgehalten, aber das reichte aus, um die Situation des Nördlichen mit der des Südlichen Departments vergleichen zu können. Die gesamte Kontinentalarmee befand sich mit Washington im Norden; im Süden schien die Rebellion aus Nestern widerspenstiger Hinterwäldler und improvisierter Milizen zu bestehen – kaum eine Bedrohung. Und was den Vergleich zwischen Sir Peter und General Howe und ihrer Bedeutung als Kommandeure betraf …
»Ich würde gern über Euer Angebot nachdenken, wenn ich darf, Hauptmann«, sagte er und hoffte, dass man ihm den Eifer nicht anhören konnte. »Darf ich Euch meine Antwort morgen geben?«
»Gewiss. Ich denke, dass Ihr die Perspektiven mit Eurem Vater besprechen möchtet – das dürft Ihr gern tun.«
Dann wechselte der Hauptmann betont das Thema, und kurz darauf gesellten sich Lord John und Mr Bell zu ihnen, und das Gespräch widmete sich allgemeineren Dingen.
William hörte kaum zu, denn seine Aufmerksamkeit wurde von zwei schlanken weißen Gestalten abgelenkt, die wie Gespenster vor den Büschen am Rand des Gartens weilten. Zwei weiße Spitzenhauben näherten sich einander, dann trennten sie sich wieder. Hin und wieder wandte sich einer der Köpfe offenbar spekulierend der Veranda zu.
»Und um seine Kleider losten sie«, murmelte sein Vater kopfschüttelnd.
»Wie?«
»Oh, nichts.« Sein Vater lächelte und wandte sich Hauptmann Richardson zu, der gerade etwas über das Wetter gesagt hatte.
Glühwürmchen erleuchteten den Garten und schwebten wie grüne Funken über die feuchte, üppige Vegetation hinweg. Es war schön, wieder Glühwürmchen zu sehen; in England hatten sie ihm gefehlt – genau wie diese ganz besondere Sanftheit der Luft des Südens, die ihm das Leinen an den Körper schmiegte und das Blut in seinen Fingerspitzen pulsieren ließ. Ringsum zirpten die Grillen, und einen Moment lang schien ihr Lied alles außer dem Geräusch seines Pulsschlags zu übertönen.
»Kaffee ist fertig, die Herr’n.« Die leise Stimme der bellschen Sklavin durchdrang dann doch sein fermentierendes Blut, und er folgte den anderen Männern. Für den Garten hatte er nur einen flüchtigen Blick übrig. Die weißen Gestalten waren verschwunden, doch ein verheißungsvoller Hauch lag in der sanften, warmen Luft.
Eine Stunde später befand er sich auf dem Rückweg zu seinem Quartier. Seine Gedanken waren angenehm verworren; sein Vater schlenderte schweigend neben ihm her.
»Hauptmann Richardson hat mir von dem Angebot erzählt, das er dir gemacht hat«, sagte Lord John beiläufig. »Reizt es dich?«
»Weiß nicht«, erwiderte William genauso beiläufig. »Natürlich würden mir meine Männer fehlen, aber …« Mrs Bell hatte ihn gedrängt, doch später in der Woche einmal zum Tee zu kommen.
»Im Militärleben gibt es wenig Beständigkeit«, sagte sein Vater mit einem kleinen Kopfschütteln. »Ich habe dich gewarnt.«
William grunzte zustimmend, ohne ihm jedoch richtig zuzuhören.
»Eine gute Gelegenheit, sich zu profilieren«, sagte sein Vater und fügte dann wie nebenbei hinzu, »obwohl der Vorschlag natürlich nicht ganz ungefährlich ist.«
»Was?«, spottete William. »Ein Ritt von Wilmington zum Hafen von New York? Es gibt eine Straße, fast die ganze Strecke entlang!«
»Auf der es von Kontinentaltruppen wimmelt«, mahnte ihn Lord John. »General Washingtons gesamte Armee liegt auf unserer Seite von Philadelphia, wenn die Neuigkeiten, die ich gehört habe, korrekt sind.«
William zuckte mit den Achseln.
»Richardson hat gesagt, er will mich, weil ich das Land kenne. Ich komme genauso gut ohne Straßen zurecht.«
»Bist du sicher? Du bist seit fast vier Jahren nicht mehr in Virginia gewesen.«
William ärgerte sich über den skeptischen Ton dieser Worte.
»Meinst du etwa, ich bin nicht in der Lage, den Weg zu finden?«
»Nein, ganz und gar nicht«, sagte sein Vater, nach wie vor mit diesem skeptischen Unterton. »Aber dieser Vorschlag birgt ein beträchtliches Risiko; ich möchte nicht, dass du darauf eingehst, ohne angemessen darüber nachgedacht zu haben.«
»Nun, ich habe darüber nachgedacht«, sagte William verletzt. »Ich werde es tun.«
Lord John ging einige Schritte schweigend weiter, dann nickte er widerstrebend.
»Es ist deine Entscheidung, Willie«, sagte er leise. »Ich persönlich wäre jedoch froh, wenn du vorsichtig wärst.«
Williams Ärger schmolz augenblicklich dahin.
»Natürlich bin ich das«, sagte er gespielt schroff. Dann schritten sie weiter unter dem dunklen Dach der Ulmen und Erlen dahin, ohne zu reden, so dicht beieinander, dass sich hin und wieder ihre Schultern berührten.
Vor dem Gasthaus wünschte William Lord John eine gute Nacht, kehrte jedoch selbst nicht sofort in sein Quartier zurück. Stattdessen wanderte er unruhig am Kai entlang; er war noch nicht bereit zu schlafen.
Inzwischen herrschte Ebbe, wie er sah; der Geruch nach totem Fisch und verfaulendem Seetang war stärker, obwohl die Schlammbänke immer noch von einer glatten Wasserfläche bedeckt waren, reglos im Licht des Viertelmondes.
Er brauchte einen Moment, um den Pfosten auszumachen. Eine Sekunde lang dachte er, er wäre verschwunden, doch nein – da war er, ein schmaler dunkler Strich vor dem schimmernden Wasser. Leer.
Der Pfosten stand nicht länger senkrecht da, sondern schräg, als sei er im Begriff umzufallen, und eine dünne Seilschlaufe baumelte daran und trieb auf dem sinkenden Wasserspiegel wie eine Henkersschlinge. William empfand eine Beklommenheit, die ihm durch Mark und Bein ging; es war unmöglich, dass die Flut allein die Leiche mitgenommen hatte. Man sagte, dass es hier Krokodile oder Alligatoren gab, obwohl er selbst noch kein derartiges Tier gesehen hatte. Er spähte unwillkürlich zu Boden, als könnte eines dieser Reptilien plötzlich zu seinen Füßen aus dem Wasser geschossen kommen. Die Luft war warm, doch ihn durchlief ein leiser Schauder.
Er schüttelte das Gefühl ab und wandte sich seinem Quartier zu. Ihm würden noch ein oder zwei Tage bleiben, bis er aufbrechen musste, dachte er, und er fragte sich, ob er die blauäugige Mrs MacKenzie wohl noch einmal wiedersehen würde, bevor er abreiste.
Lord John blieb noch einen Moment auf der Veranda des Gasthauses stehen und sah zu, wie sein Sohn unter den Bäumen im Schatten verschwand. Er hatte seine Bedenken; die ganze Angelegenheit war sehr viel hastiger arrangiert worden, als ihm lieb gewesen wäre – doch er vertraute auf Williams Fähigkeiten. Zwar hatte die Abmachung eindeutig ihre Risiken, doch das war nun einmal die Natur des Soldatenlebens. Es gab allerdings Situationen, die besonders gefährlich waren.
Er hörte das Summen der Gespräche aus dem Schankraum und zögerte, fand dann jedoch, dass er für heute Abend genug Gesellschaft gehabt hatte. Dann stellte er sich allerdings vor, wie er sich in der stickigen Hitze seines Zimmers unter der niedrigen Decke hin und her wälzen würde, und beschloss, spazieren zu gehen, bis ihm die schiere körperliche Erschöpfung den Schlaf garantierte.
Es war nicht nur die Hitze, dachte er, während er von der Veranda trat und in die entgegengesetzte Richtung aufbrach, in die William gegangen war. Er kannte sich gut genug, um zu begreifen, dass selbst der augenscheinliche Erfolg seines Plans nicht verhindern würde, dass er wach lag und sich sorgte wie ein Hund, der einen Knochen gefunden hat – dass er ihn auf Schwächen inspizierte und nach Verbesserungsmöglichkeiten suchte. William würde schließlich nicht sofort aufbrechen; es blieb noch ein wenig Zeit, zu überlegen und nötigenfalls Veränderungen vorzunehmen.
General Howe zum Beispiel. War das die beste Wahl gewesen? Vielleicht Clinton … nein, doch nicht. Clinton war ein kleinliches altes Waschweib, und es widerstrebte ihm, auch nur einen Fuß zu rühren, solange es keine schriftliche Order in dreifacher Ausfertigung gab.
Die Gebrüder Howe – der eine General, der andere Admiral – waren für ihre Grobheit berüchtigt, und beide hatten das Benehmen, das Aussehen und die allgemeine Ausstrahlung wilder Eber in der Brunst. Allerdings waren sie beide nicht dumm – und weiß Gott nicht zimperlich –, und Grey war der Auffassung, dass grobes Benehmen und harte Worte Willie gewiss nicht umbringen würden. Mit einem Kommandeur, der die Angewohnheit hatte, auf den Boden zu spucken – einmal hatte Richard Howe sogar Grey angespuckt, doch das war keine Absicht gewesen, da der Wind unerwartet gedreht hatte –, kam ein junger Subalterner wahrscheinlich eher zurecht als mit einigen der Launen, die Greys andere Militärbekanntschaften an den Tag legten.
Allerdings war selbst der verschrobenste Vertreter der Waffenbruderschaft jedem Diplomaten vorzuziehen. Er fragte sich, ob es wohl eine Kongregationsbezeichnung für Diplomaten gab. Wenn die schreibende Zunft die Bruderschaft des Federkiels war – vielleicht die Bruderschaft des Stiletts? Nein, beschloss er. Viel zu direkt. Wohl eher die Bruderschaft der Langweiler. Obwohl diejenigen, die nicht langweilig waren, gelegentlich sehr gefährlich sein konnten.
Sir George Germain gehörte der seltensten Sorte an: langweilig und gefährlich.
Eine Zeit lang wanderte er auf den Straßen des Städtchens auf und ab, um endlich müde zu werden, bevor er in sein kleines, stickiges Zimmer zurückkehren würde. Der Himmel hing tief; Wetterleuchten huschte durch die Wolken, und die Atmosphäre war so feucht wie ein Badeschwamm. Er hätte längst in Albany sein sollen – auch nicht weniger feucht und von Ungeziefer verseucht, aber ein wenig kühler, in der Nähe der herrlichen dunklen Wälder der Adirondacks.
Dennoch, er bedauerte seine überhastete Reise nach Wilmington nicht. Für Willie war gesorgt; das war das Wichtigste. Und Willies Schwester Brianna – einen Moment lang erstarrte er mit geschlossenen Augen und durchlebte diesen schmerzhaft erhabenen Augenblick am Nachmittag noch einmal, als er die beiden zusammen gesehen hatte – die einzige Begegnung, die es je geben würde. Er hatte kaum atmen können; sein Blick war fest auf die beiden hochgewachsenen Gestalten geheftet, diese schönen, kühnen Gesichter, die einander so ähnelten – und die beide dem Mann so ähnelten, der neben ihm gestanden hatte, reglos, der, anders als Grey, jedoch in heftigen Zügen Luft geholt hatte, als fürchte er, nie wieder atmen zu können.
Grey rieb sich geistesabwesend den linken Ringfinger; er hatte sich noch nicht daran gewöhnt, ihn nackt vorzufinden. Er und Jamie Fraser hatten getan, was sie konnten, um für die Sicherheit derer zu sorgen, die sie liebten. Und bei aller Traurigkeit tröstete ihn der Gedanke, dass sie durch diese Verwandtschaft der Verantwortung verbunden waren.
Würde er Brianna Fraser MacKenzie je wiedersehen?, fragte er sich. Sie hatte Nein gesagt – und diese Tatsache schien sie genauso traurig zu stimmen wie ihn.
»Gott segne dich, Kind«, murmelte er und schüttelte den Kopf, als er sich zum Hafen zurückwandte. Sie würde ihm sehr fehlen – doch genau wie bei Willie war seine Erleichterung darüber, dass sie Wilmington und die Gefahr bald hinter sich lassen würde, größer als sein persönlicher Verlust.
Er spähte unwillkürlich zum Wasser hinüber, als er auf den Kai trat, und stieß einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus, als er den leeren Pfahl sah, der schräg im abebbenden Wasser stand. Er hatte nicht verstanden, warum sie getan hatte, was sie getan hatte, doch er kannte ihren Vater – und natürlich ihren Bruder – schon viel zu lange, um die hartnäckige Überzeugung in ihren blauen Katzenaugen nicht zu sehen. Also hatte er ihr das kleine Boot besorgt, um das sie gebeten hatte, und hatte am Kai gestanden, das Herz in der Kehle, nötigenfalls zu einem Ablenkungsmanöver bereit, während ihr Mann sie zu dem gefesselten Piraten hinausgerudert hatte.
Er hatte schon viele Männer sterben sehen, normalerweise unfreiwillig, hin und wieder resigniert. Noch nie hatte er einen mit solch leidenschaftlicher Dankbarkeit in den Augen gehen sehen. Grey hatte Roger MacKenzie nur sehr flüchtig kennengelernt, vermutete jedoch, dass er ein bemerkenswerter Mann war, da er nicht nur die Heirat mit diesem fabelhaften, gefährlichen Geschöpf überlebt, sondern sogar Kinder mit ihm gezeugt hatte.
Er schüttelte den Kopf und machte kehrt, um das Gasthaus anzusteuern. Er konnte getrost noch zwei Wochen warten, dachte er, bevor er Germains Brief beantwortete – den er mit geschickten Fingern aus der Diplomatenschatulle entwendet hatte, als er Williams Namen darauf sah. Zu diesem Zeitpunkt konnte er dann wahrheitsgemäß berichten, dass Lord Ellesmere bei der Ankunft des Briefes leider irgendwo zwischen North Carolina und New York in der Wildnis unterwegs war und es daher nicht möglich war, ihn von seiner Rückberufung nach England zu unterrichten, obwohl er (Grey) der festen Überzeugung sei, dass Ellesmere es sehr bedauern würde, dass ihm die Gelegenheit entgangen war, sich Sir Georges Stab anzuschließen, wenn er davon erfuhr – Monate später. Zu schade.
Er begann, »Lillibuleero« zu pfeifen, und schritt bester Laune zum Gasthaus zurück.
Er machte im Schankraum halt und bat darum, ihm eine Flasche Wein auf sein Zimmer zu bringen – um jedoch von der Kellnerin zu erfahren, »der Herr« hätte bereits eine Flasche mit nach oben genommen.
»Und zwei Gläser«, fügte sie mit einem vertraulichen Lächeln hinzu. »Also wollte er ihn wohl nicht ganz allein trinken.«
Grey hatte das Gefühl, dass ihm etwas wie ein Tausendfüßler über den Rücken kroch.
»Ich bitte um Verzeihung«, sagte er. »Habt Ihr gesagt, in meinem Zimmer befindet sich ein Herr?«
»Ja, Sir«, versicherte sie ihm. »Er sagt, er ist ein alter Freund von Euch … hmm … Er hat mir seinen Namen gesagt …« Ihre Stirn legte sich kurz in Falten, dann glättete sie sich wieder. »Bou-schah hat er gesagt, oder so ähnlich. Französischer Name«, erläuterte sie. »Sieht auch wie ein Franzose aus. Möchtet Ihr etwas essen, Sir?«
»Nein, ich danke Euch.« Er winkte ab und stieg die Treppe hinauf. Dabei überlegte er hastig, ob er irgendetwas in seinem Zimmer gelassen hatte, das dort besser nicht wäre.
Ein Franzose namens Bou-schah … Beauchamp. Der Name blitzte in seinem Kopf auf wie Wetterleuchten. Einen Moment blieb er mitten auf der Treppe stehen, dann ging er weiter, langsamer jetzt.
Es konnte doch nicht … doch wer sollte es sonst sein? Nachdem er vor einigen Jahren aus dem aktiven Dienst ausgeschieden war, hatte er das Diplomatendasein als Mitglied des Schwarzen Kabinetts von England begonnen – jener schattenhaften Organisation von Personen, die mit dem Abfangen und der Decodierung offizieller diplomatischer Post (und auch sehr viel weniger offizieller Dokumente) zwischen den europäischen Regierungen beauftragt war. Jede dieser Regierungen unterhielt ihr eigenes Cabinet noir, und es war nicht ungewöhnlich für die Mitglieder einer solchen Organisation, mit ihren Gegenspielern vertraut zu sein – denen sie zwar nie begegneten, die sie aber von ihren Signaturen, ihren Initialen oder ihren unsignierten Randnotizen her kannten.
Beauchamp war einer der aktivsten französischen Agenten gewesen; Grey war in den letzten Jahren noch mehrfach auf seine Spur gestoßen, auch wenn seine eigenen Tage im Schwarzen Kabinett längst hinter ihm lagen. Wenn er Beauchamp beim Namen kannte, war es absolut denkbar, dass der Mann ihn ebenfalls kannte – aber ihre unsichtbare Verbindung lag doch schon Jahre zurück. Sie waren sich nie persönlich begegnet, und dass eine solche Begegnung hier stattfinden sollte … Er berührte die geheime Tasche in seinem Rock und war beruhigt, als er gedämpftes Papierknistern hörte.
Am Kopf der Treppe zögerte er, doch es gab keinen Grund zur Verstohlenheit; er wurde ja eindeutig erwartet. Festen Schrittes ging er den Flur entlang und drehte den weißen Porzellanknauf seiner Tür, der glatt und kühl unter seinen Fingern lag.
Ihn überkam eine Hitzewelle, und er schnappte unwillkürlich nach Luft. Sehr gut, denn dies verhinderte, dass er den Fluch ausstieß, der ihm auf den Lippen lag.
Der Herr, der auf dem einzigen Stuhl des Zimmers saß, mutete in der Tat französisch an – Kaskaden schneeweißer Spitze an Hals und Manschetten hoben sich von einem exzellent geschnittenen Anzug ab, und die Silberschnallen seiner Schuhe passten perfekt zum Haar an seinen Schläfen.
»Mr Beauchamp«, sagte Grey und schloss langsam die Tür hinter sich. Das feuchte Leinen klebte ihm am Körper, und er konnte spüren, wie ihm der Puls in den Schläfen schlug. »Ich fürchte, Eure Ankunft überrumpelt mich.«
Perseverance Wainwright lächelte kaum merklich.
»Freut mich, dich zu sehen, John«, sagte er.
Grey biss sich auf die Zunge, um nichts Unüberlegtes zu sagen – eine Beschreibung, die auf so gut wie alles zutraf, was er hätte sagen können, dachte er, mit Ausnahme von »Guten Abend«.
»Guten Abend«, sagte er. Er zog fragend die Augenbraue hoch. »Monsieur Beauchamp?«
»Oh, ja.«
Percy machte Anstalten, sich zu erheben, doch Grey winkte ab. Er machte kehrt, um sich einen Hocker zu holen, und hoffte, dass ihm die Sekunden, die er für diesen Weg brauchte, helfen würden, die Fassung zurückzuerlangen. Da dies nicht so war, verbrachte er einen weiteren Moment damit, das Fenster zu öffnen, und saugte sich die dicke, feuchte Luft in die Lunge, bevor er sich wieder umdrehte und sich ebenfalls hinsetzte.
»Wie ist denn das gekommen?«, fragte er und stellte sich uninteressiert. »Beauchamp, meine ich. Oder ist das nur ein Nom de Guerre?«
»Oh, nein.« Percy ergriff sein spitzengesäumtes Taschentuch und tupfte sich geziert den Schweiß vom Haaransatz – der zurückzuweichen begann, wie Grey bemerkte. »Ich habe eine der Schwestern des Barons Amandine geheiratet. Der Name der Familie ist Beauchamp; ich habe ihn angenommen. Diese Verwandtschaft hat mir einen gewissen Zugang zu politischen Kreisen verschafft, sodass ich –« Er zuckte entwaffnend mit den Schultern und vollzog eine anmutige Geste, die seine Laufbahn im Schwarzen Kabinett umriss – und gewiss auch anderswo, dachte Grey grimmig.
»Meinen Glückwunsch zur Vermählung«, sagte Grey und versuchte erst gar nicht, die Ironie in seiner Stimme zu unterdrücken. »Mit wem schläfst du denn, mit dem Baron oder seiner Schwester?«
Percys Miene war belustigt.
»Gelegentlich mit beiden.«
»Gleichzeitig?«
Das Lächeln wurde breiter. Seine Zähne waren immer noch gut, bemerkte Grey, selbst wenn sie vom Wein verfärbt waren.
»Hin und wieder. Obwohl Cecile – meine Frau – in Wirklichkeit die Zuwendung ihrer Cousine Lucianne bevorzugt und ich selbst die des Hilfsgärtners. Ein Prachtkerl namens Emile – er erinnert mich an dich, als du jünger warst. Schlank, blond, muskulös und brutal.«
Zu seiner Bestürzung stellte Grey fest, dass er am liebsten gelacht hätte.
»Das hört sich wirklich sehr französisch an«, sagte er stattdessen trocken. »Ich bin mir sicher, dass es gut zu dir passt. Was willst du?«
»Es geht eher darum, was du willst, glaube ich.« Percy hatte den Wein noch nicht angerührt; er ergriff die Flasche und schenkte ihnen sorgfältig ein. Die rote Flüssigkeit ergoss sich dunkel in die Gläser. »Oder vielleicht sollte ich sagen – was England will.« Lächelnd hielt er Grey ein Glas entgegen. »Denn man kann deine Interessen doch kaum von denen deines Vaterlandes unterscheiden, oder? Ich muss sogar gestehen, dass ich stets das Gefühl hatte, dass du England bist, John.«
Grey hätte ihm gern verboten, seinen Vornamen zu benutzen, doch dies hätte die Erinnerung an ihre Intimitäten nur noch verstärkt – was natürlich genau Percys Absicht war. Also beschloss er, es zu ignorieren, und trank einen Schluck Wein, der gut war. Er fragte sich, ob er wohl die Rechnung dafür bezahlen würde – und wenn ja, womit.
»Was England will«, wiederholte er skeptisch. »Und was ist dein Eindruck davon, was England will?«
Percy nahm einen Schluck Wein und behielt ihn im Mund. Offensichtlich kostete er ihn aus, bevor er schließlich schluckte.
»Das, mein Lieber, ist doch wohl kaum ein Geheimnis, oder?«
Grey seufzte und starrte ihn bohrend an.
»Hast du diese ›Unabhängigkeitserklärung‹ gesehen, die der sogenannte Kontinentalkongress verfasst hat?«, fragte Percy. Er wandte sich ab, griff in eine Ledertasche, die er über die Stuhllehne gehängt hatte, und zog einige zusammengefaltete Blätter heraus, die er Grey reichte.
Tatsächlich hatte Grey das fragliche Dokument noch nicht gesehen, obwohl er natürlich davon gehört hatte. Es war erst zwei Wochen zuvor in Philadelphia gedruckt worden, aber die Kopien hatten sich wie vom Wind ausgesätes Unkraut in den Kolonien ausgebreitet. Er musterte Percy mit hochgezogener Augenbraue, faltete das Papier auseinander und überflog es rasch.
»Der König ist ein Tyrann?«, fragte er und konnte sich das Lachen über die teilweise hanebüchenen Behauptungen des Dokuments kaum verkneifen. Er faltete die Bogen wieder zusammen und ließ sie auf den Tisch fallen.
»Und wenn ich England bin, verkörperst du in diesem Gespräch Frankreich, nehme ich an?«
»Ich vertrete dort gewisse Interessen«, erwiderte Percy ausdruckslos. »Und in Kanada.«
Das ließ leise Alarmglocken schrillen. Grey hatte unter Wolfe in Kanada gekämpft, und ihm war sehr wohl bewusst, dass die Franzosen in diesem Krieg zwar den Großteil ihrer nordamerikanischen Besitztümer verloren hatten, dass sie jedoch unverrückbar in den nördlichen Regionen von Quebec bis zur Küste festsaßen. War das nah genug, um jetzt für Ärger zu sorgen? Er glaubte es nicht – allerdings gab es nichts, was er den Franzosen nicht zutraute. Oder Percy.
»England wünscht natürlich ein rasches Ende dieses Unsinns.« Eine lange, knochige Hand wies auf das Papier. »Die sogenannte Kontinentalarmee ist ein wilder Haufen von Männern, die über keinerlei Erfahrung verfügen und deren Vorstellungen einander widersprechen. Was, wenn ich in der Lage wäre, dich mit Informationen zu versorgen, die dazu dienen könnten, einen der wichtigsten Generäle Washingtons von seinem Ziel abzubringen?«
»Was, wenn du das wärst?«, erwiderte Grey, der sich keine Mühe gab, die Skepsis in seiner Stimme zu verbergen. »Inwiefern würde das Frankreich nützen – oder deinen eigenen Interessen, von denen ich mir anzunehmen erlaube, dass sie wohl nicht vollständig dieselben sind?«
»Ich sehe schon, dass die Zeit deinen angeborenen Zynismus nicht geschmälert hat, John. Einer deiner weniger anziehenden Charakterzüge – ich weiß nicht, ob ich dir das je gesagt habe.«
Grey weitete seine Augen ein wenig, und Percy seufzte.
»Also gut, Land«, sagte er. »Das Nordwest-Territorium. Wir wollen es zurück.«
Grey lachte kurz auf.
»Das kann ich mir vorstellen.« Die Franzosen hatten das fragliche Territorium, einen großen Landtrakt nordwestlich des Ohio-Flusstals, am Ende des Siebenjährigen Krieges an Großbritannien abgetreten. Britannien hatte es jedoch nicht besetzt und verhindert, dass sich Kolonisten dort ausbreiteten, weil die Eingeborenen bewaffneten Widerstand leisteten und man sich immer noch in Verhandlungen mit ihnen befand. Seines Wissens waren die Kolonisten darüber nicht begeistert. Grey war einigen der besagten Wilden persönlich begegnet und hielt die Haltung der britischen Regierung für ebenso vernünftig wie ehrenhaft.
»Die Franzosen hatten enge Handelsverbindungen mit den Eingeborenen in dieser Gegend; ihr habt keine.«
»Und die Pelzhändler zählen zu denen, deren … Interessen … du vertrittst?«
Bei diesen Worten lächelte Percy breit.
»Nicht in erster Linie. Dennoch, ja.«
Grey sparte sich die Mühe zu fragen, warum sich Percy in dieser Angelegenheit ausgerechnet an ihn wandte – einen augenscheinlich pensionierten Diplomaten ohne nennenswerten Einfluss. Percy wusste aus den Tagen ihrer persönlichen Beziehung um die Macht und den Einfluss der Familie Grey – und »Monsieur Beauchamp« wusste durch das Netz der Schwarzen Kabinette Europas noch einiges mehr über seine gegenwärtigen persönlichen Verbindungen. Grey selbst konnte natürlich nichts unternehmen. Doch er war in der Lage, jene, die es konnten, im Stillen von diesem Angebot in Kenntnis zu setzen.
Er fühlte sich, als stünde jedes Haar an seinem Körper zu Berge wie die Fühler eines alarmbereiten Insekts.
»Wir bräuchten natürlich mehr als eine bloße Andeutung«, sagte er kühl. »Den Namen des betreffenden Herrn zum Beispiel.«
»Den kann ich im Moment nicht weitergeben. Aber sobald ernst zu nehmende Verhandlungen beginnen …«
Grey fragte sich bereits, zu wem er mit diesem Angebot gehen sollte. Nicht Sir George Germain. Lord Norths Ministerium? Doch das konnte warten.
»Und deine persönlichen Interessen?«, fragte er mit scharfem Unterton. Er kannte Percy Wainwright gut genug, um zu wissen, dass Percy irgendeinen persönlichen Nutzen von der Sache haben würde.
»Ah, das.« Percy nippte an seinem Wein, dann ließ er das Glas sinken und blickte Grey darüber hinweg offen an. »Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe den Auftrag, einen Mann zu finden. Kennst du einen Schotten namens James Fraser?«
Grey spürte, wie der Stiel seines Glases splitterte. Er ließ ihn jedoch nicht los und nippte vorsichtig an seinem Wein, während er Gott erstens dafür dankte, dass er Percy niemals Jamie Frasers Namen gesagt hatte, und zweitens, dass Fraser Wilmington heute Nachmittag verlassen hatte.
»Nein«, sagte er ruhig. »Was willst du denn von diesem Mr Fraser?«
Percy zuckte mit den Achseln und lächelte.
»Nur ein oder zwei Fragen.«
Grey spürte, wie ihm das Blut aus der verletzten Handfläche rann. Er hielt das zerbrochene Glas vorsichtig zusammen und trank den Rest seines Weins. Percy schwieg und trank mit ihm.
»Mein Beileid zum Tod deiner Frau«, sagte Percy leise. »Ich weiß, dass sie –«
»Du weißt gar nichts«, sagte Grey schroff. Er beugte sich vor und legte das zerbrochene Glas auf den Tisch; der Kelch rollte wild hin und her, und die Weinreste spülten durch das Glas. »Ganz und gar nichts. Weder über meine Frau noch über mich.«
Percy zog die Schultern zu einem kaum merklichen Achselzucken hoch. Wie du willst, bedeutete er damit. Und doch ruhten seine Augen – sie waren immer noch schön, verdammt, dunkel und sanft – mit einem Ausdruck auf Grey, der diesem wie aufrichtiges Mitgefühl vorkam.
Grey seufzte. Ohne Zweifel war es aufrichtig. Man konnte Percy nicht trauen – niemals –, doch was er getan hatte, hatte er aus Schwäche getan, nicht aus bösem Willen oder auch nur aus Gefühllosigkeit.
»Dein Sohn –«, begann Percy, und plötzlich ging Grey auf ihn los. Er packte Percy so fest an der Schulter, dass der Mann leise aufkeuchte und erstarrte. Grey beugte sich über ihn und sah Wainwright – nein, Beauchamp – ins Gesicht, so dicht, dass er den warmen Atem des Mannes auf seiner Wange spürte und sein Toilettenwasser roch. Sein Blut tropfte auf Wainwrights Rock.
»Als ich dich das letzte Mal gesehen habe«, sagte Grey sehr leise, »war ich ganz kurz davor, dir eine Kugel in den Kopf zu jagen. Sorge jetzt nicht dafür, dass ich meine Zurückhaltung bedaure.«
Er ließ los und erhob sich.
»Halt dich fern von meinem Sohn – halt dich fern von mir. Und wenn du einen gut gemeinten Rat annehmen möchtest – fahr zurück nach Frankreich. Und zwar schnell.«
Er machte auf dem Absatz kehrt, verließ das Zimmer und schloss die Tür fest hinter sich. Er war schon die halbe Straße entlanggegangen, als er begriff, dass er Percy in seinem eigenen Zimmer zurückgelassen hatte.
»Ach, zum Kuckuck«, knurrte er und stapfte davon, um Sergeant Cutter um Quartier für die Nacht zu bitten. Am Morgen würde er dafür sorgen, dass Frasers Familie und William wohlbehalten aus Wilmington verschwanden.
Kapitel 2
Und manchmal sind sie’s nicht
Wir leben noch«, wiederholte Brianna MacKenzie mit bebender Stimme. Sie blickte zu Roger auf, das Blatt mit beiden Händen an die Brust gepresst. Tränen strömten ihr über das Gesicht, doch ihre blauen Augen leuchteten überglücklich. »Sie leben!«
»Lass mich sehen.« Sein Herz hämmerte so heftig in seiner Brust, dass er seine eigenen Worte kaum hören konnte. Er streckte eine Hand aus, und sie überließ ihm widerstrebend das Blatt, um sich im nächsten Moment an ihn zu drücken und sich an seinen Arm zu klammern, während er las, weil sie das antike Blatt Papier einfach nicht aus den Augen lassen konnte.
Es fühlte sich angenehm rau unter seinen Fingern an, handgemachtes Papier, zwischen dessen Fasern die Geister von Blättern und Blüten eingepresst waren. Vom Alter vergilbt, aber immer noch fest und überraschend flexibel. Bree hatte es selbst geschöpft – zweihundert Jahre zuvor.
Roger wurde bewusst, dass seine Hände zitterten, und das Blatt bebte so sehr, dass die krakelige, schwerfällige Handschrift, deren Tinte verblasst war, schwierig zu lesen war.
31. Dezember 1776
Meine liebe Tochter,
wie Du sehen wirst, wenn Dich dies je erreicht – wir leben noch …
Es verschwamm ihm vor den Augen, und er wischte sich mit dem Handrücken darüber, während er sich gleichzeitig sagte, dass es ohnehin keine Rolle spielte, denn inzwischen waren sie mit Sicherheit tot, Jamie Fraser und seine Frau Claire – doch er freute sich so sehr über diese Worte auf der Seite, dass es so war, als stünden die beiden lächelnd vor ihm.
Es waren tatsächlich beide, wie er herausfand. Der Brief begann zwar in Jamies Handschrift – und Tonfall –, doch auf der zweiten Seite ging es in Claires klarer Schrägschrift weiter.
Die Hand Deines Vaters versagt gleich den Dienst, schrieb sie. Und es ist eine verdammt lange Geschichte. Er hat den ganzen Tag Holz gehackt und kann seine Finger kaum noch gerade biegen, aber er hat darauf bestanden, Dir selbst zu sagen, dass wir – noch – nicht zu Asche verbrannt sind. Nicht dass dies nicht jeden Moment passieren könnte; es drängen sich vierzehn Menschen in der alten Blockhütte, und ich schreibe diese Zeilen mehr oder weniger im Kamin, während Großmütterchen MacLeod zu meinen Füßen auf ihrem Strohlager vor sich hin keucht, sodass ich ihr neuen Whisky in den Hals schütten kann, falls sie plötzlich Anstalten macht zu sterben.
»Mein Gott, ich kann sie hören«, sagte er staunend.
»Ich auch.« Brianna liefen immer noch die Tränen über das Gesicht, doch es war ein Schauer zwischen Sonnenstrahlen; lachend und schluchzend wischte sie sie ab. »Lies weiter. Warum sind sie in unserer Hütte? Was ist mit dem Haupthaus passiert?«
Roger fuhr mit dem Finger über die Zeilen, um die Stelle wiederzufinden, und las weiter.
»O Himmel!«, sagte er.
Erinnerst Du Dich noch an diesen Idioten Donner?
Bei diesem Namen überzogen sich seine Arme mit einer Gänsehaut. Ein Zeitreisender, Donner. Und einer der größten Nichtsnutze, die ihm je begegnet waren – was ihn aber nicht ungefährlicher machte.
Nun, er hat sich selbst übertroffen, indem er eine Schlägerbande aus Brownsville um sich geschart und zu uns gebracht hat, um den Schatz zu stehlen, der sich seiner Überzeugung nach in unserem Besitz befand. Nur dass es den natürlich nicht gab.
Es gab keinen Schatz – weil er, Brianna, Jemmy und Amanda die Handvoll verbliebener Edelsteine benutzt hatten, um sich auf ihrer Reise durch die Steine zu schützen.
Sie haben uns als Geiseln genommen und das Haus verwüstet, die Schufte – unter anderem haben sie dabei den Glasballon mit Äther in meinem Sprechzimmer zerbrochen. Fast hätten uns die Dämpfe alle auf der Stelle vergast …
Rasch las er den Rest des Briefes durch, während ihm Brianna über die Schulter lugte und dabei immer wieder kleine Schreckenslaute ausstieß. Als er fertig war, legte er die Blätter hin und wandte sich zu ihr um. Er zitterte am ganzen Körper.
»Du warst es also«, sagte er. Ihm war klar, dass er das besser nicht sagen sollte, doch er konnte es nicht lassen, konnte das prustende Gelächter nicht unterdrücken. »Du und deine verflixten Streichhölzer – ihr habt das Haus abgefackelt!«
Ihr Gesicht war eine Studie, deren Ausdruck zwischen Entsetzen und Empörung schwankte – und, ja, der gleichen hysterischen Fröhlichkeit wie bei ihm.
»Oh, haben wir nicht! Es war Mamas Äther. Irgendein Funke hätte die Explosion auslösen können –«
»Es war aber nicht irgendein Funke«, beharrte Roger. »Dein Vetter Ian hat eines von deinen Streichhölzern angezündet.«
»Na, dann war es eben Ians Schuld!«
»Nein, du warst es, du und deine Mutter. Frauen und Wissenschaft«, sagte Roger und schüttelte den Kopf. »Das achtzehnte Jahrhundert kann von Glück sagen, dass es euch überlebt hat.«
Sie zog einen Schmollmund.
»Nun, ohne diesen Trottel Donner wäre das Ganze nicht passiert!«
»Das stimmt«, räumte Roger ein. »Aber er war halt ebenfalls so ein Unruhestifter aus der Zukunft, nicht wahr? Wenn er auch zugegebenermaßen weder eine Frau war noch wissenschaftlich begabt.«
»Hmpf.« Sie nahm den Brief. Sie fasste ihn vorsichtig an, konnte es sich aber nicht verkneifen, die Seiten zwischen den Fingern zu reiben. »Tja, er hat das achtzehnte Jahrhundert ja auch nicht überlebt, oder?« Ihre Augen waren zu Boden gerichtet, die Lider gerötet.
»Er tut dir doch nicht leid, oder?«, wollte Roger ungläubig wissen.
Sie schüttelte den Kopf, doch ihre Finger bewegten sich immer noch sacht über das dicke, weiche Blatt Papier.
»Er weniger. Es ist nur … die Vorstellung, dass jemand so stirbt. Allein, meine ich. So weit fort von zu Hause.«
Nein, es war nicht Donner, an den sie dachte. Er legte einen Arm um sie und lehnte den Kopf an den ihren. Sie roch nach Prell-Shampoo und frischen Kohlköpfen; sie war im Gemüsegarten gewesen. Die Linien der Worte auf der Seite wurden abwechselnd dicker und schmaler, je nach Neigung des Stiftes, der sie geschrieben hatte, aber sie waren klar und deutlich – die Handschrift eines Chirurgen.
»Sie ist nicht allein«, flüsterte er und streckte einen Finger aus, um das Postskriptum nachzuzeichnen, das wieder in Jamies krakeliger Schrift verfasst war. »Keiner von ihnen ist allein. Und ob sie ein Dach über dem Kopf haben oder nicht – sie sind beide zu Hause.«
Ich legte den Brief beiseite. Zeit genug, ihn später zu beenden, dachte ich. Ich hatte während der letzten Tage nur daran gearbeitet, wenn es meine Zeit zuließ; es war ja schließlich nicht so, als hätten wir Eile gehabt, den Briefkasten vor der Leerung zu erwischen. Ich lächelte ein wenig bei diesem Gedanken, faltete die Blätter vorsichtig zusammen und steckte sie in meine neue Arbeitstasche, um sie dort aufzubewahren. Ich wischte den Federkiel sauber und legte ihn beiseite, dann rieb ich mir die schmerzenden Finger und erfreute mich noch einen Moment an dem sehnsüchtigen Gefühl der Nähe, das ich beim Schreiben empfand. Mir fiel das Schreiben sehr viel leichter als Jamie, aber Fleisch und Blut hatten nun einmal ihre Grenzen, und es war ein sehr langer Tag gewesen.
Ich blickte zu dem Strohlager auf der anderen Seite des Kaminfeuers hinüber, wie ich es alle paar Minuten machte, doch sie war ruhig. Ich konnte ihre Atmung hören, ein keuchendes Gurgeln, das in derart langen Abständen kam, dass ich jedes Mal hätte schwören können, sie wäre zwischendurch gestorben. Doch das war sie nicht, und meiner Einschätzung nach würde es auch in nächster Zeit nicht geschehen. Ich hoffte nur, dass sie sterben würde, bevor mein begrenzter Vorrat an Laudanum zu Ende ging.
Ich wusste nicht, wie alt sie war; sie sah aus wie hundert oder so, doch es war gut möglich, dass sie jünger war als ich. Ihre beiden jugendlichen Enkelsöhne hatten sie vor zwei Tagen hergebracht. Sie kamen aus den Bergen und hatten vorgehabt, ihre Großmutter zu Verwandten in Cross Creek zu bringen, bevor sie nach Wilmington weiterzogen, um sich dort der Miliz anzuschließen. Doch es hatte ihre Großmutter »böse erwischt«, wie sie es ausdrückten, und jemand hatte ihnen erzählt, dass es in Fraser’s Ridge eine Heilerin gab. Also hatten sie sie zu mir gebracht.
Großmütterchen MacLeod – einen anderen Namen hatte ich nicht für sie; die Jungen hatten nicht daran gedacht, ihn mir zu sagen, bevor sie wieder aufbrachen, und ihr Zustand erlaubte es nicht, dass sie es selbst tat – hatte mit großer Sicherheit irgendeine Krebsart im Endstadium. Ihr Körper war abgemagert, ihr Gesicht selbst in der Bewusstlosigkeit vor Schmerz verzerrt, und ich konnte es dem Grauton ihrer Haut ansehen.
Das Feuer war heruntergebrannt; ich sollte es wieder anfachen und einen frischen Kiefernscheit auflegen. Doch Jamies Kopf ruhte an meinem Knie. Konnte ich den Holzstapel erreichen, ohne ihn zu stören? Ich legte ihm sacht die Hand auf die Schulter, um mich abzustützen, und reckte mich, bis ich mit den Fingerspitzen gerade eben an das Ende eines kleinen Scheites gelangte. Ich bohrte mir die Zähne in die Unterlippe, während ich das Holzstück vorsichtig befreite, und schaffte es, mich so weit vorzubeugen, dass ich es in den Kamin stoßen konnte. Schwarzrote Glut stob auf, und die Funken stiegen in Wolken auf.