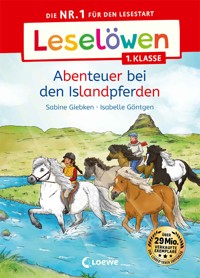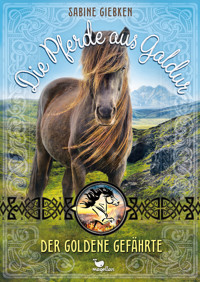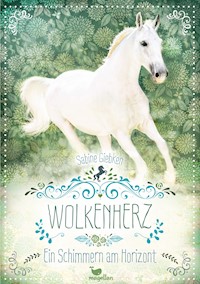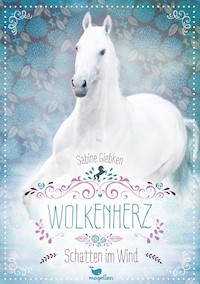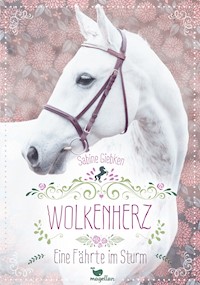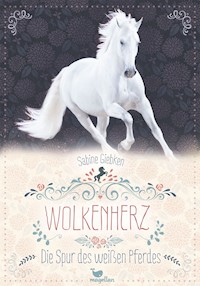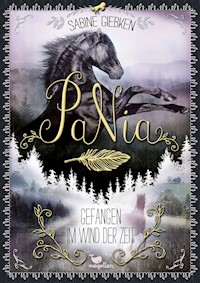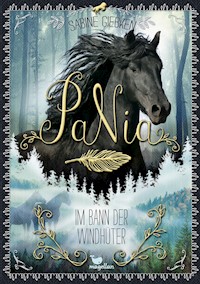Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: PaNia
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Mitten im Wald, zwischen tiefgrünen Blättern und knorrigen Bäumen, liegt Windheim, das neue Zuhause von Nia. Gleich am ersten Tag verläuft sie sich auf den verschlungenen Pfaden, als plötzlich ein wunderschönes, schimmerndes schwarzes Pferd vor ihr steht. Nia fühlt sofort eine starke Verbindung zu ihm und steigt auf seinen Rücken. Doch wie aus dem Nichts taucht ein junger Reiter auf, der Nia zwingt abzusteigen und das schwarze Pferd mit sich davontreibt. Die geisterhafte Begegnung lässt ihr keine Ruhe. Woher kam das einsame Pferd? Und was hat das alles mit der Legende der Windpferde zu tun, von der man sich in Windheim erzählt?
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PaNia
Band 1: Die Legende der Windpferde
Band 2: Im Bann der Windhüter
Band 3: Gefangen im Wind der Zeit
Band 4: Die Wächter der Windpferde
INHALT
PROLOG
IM WIND
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
IM WALD
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
DER STURM
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
ERWACHT
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
EPILOG
Kapitel 1
PROLOG
Sie wieherte, als er auf dem Hügel ankam. Trotz der Felsen, die ihr Gefängnis umgaben, konnte er sie hören, ihren verzweifelten Ruf, der irgendwo in der Nacht verhallte. Dieser viel zu langen Nacht. Millionen von Sternen kippten ihr Schimmerlicht über die Wiese, zauberten silbrige Ranunkeln und Hyazinthen aus der Dunkelheit, und einen Moment hielt er inne, um die Schönheit dieser Welt in sich aufzusaugen.
Und doch würde er sie verlassen.
Schon bald.
Vielleicht noch in dieser Nacht.
Er zog seine Füße aus den Steigbügeln, machte sich federleicht, atmete tief aus und ließ seine Gedanken davonschweifen, als würde er träumen. Der Bann löste sich und mit einem raschen Satz sprang er zu Boden. Das Gras raschelte leise, als seine Füße die Erde berührten, doch ein sanfter Wind blies und trug alle Geräusche mit sich fort.
Gin, dachte er. Ich befreie dich. Das habe ich dir versprochen.
Im Rhythmus des Windes bewegte er sich vorwärts, Schritt um Schritt, bis er den Eingang der Höhle erreicht hatte. Dort, irgendwo hinter all den Schatten, am wohl unlebenswertesten Ort der Welt, hatten sie das Verlies errichtet. Wie grausam Menschen sein konnten. Sein Herz schlug schneller, als er in die Schwärze trat und sich blind vorantastete. Sein Atem durfte ihn nicht verraten, er musste mit dem Fels verschmelzen, unsichtbar bleiben, bis er sie erreicht und aus ihrem Versteck geholt hatte.
Wieder wieherte sie, sacht und vertraut und so unendlich traurig. Aber diesmal klang noch etwas anderes in ihrem Ruf mit. Fürchtete sie sich etwa? Hatten sie etwas mit ihr angestellt, etwas viel Schlimmeres, als sie nur in der Dunkelheit einzusperren?
Ich bin bei dir, dachte er. Gleich bist du frei! Nur noch ein paar Schritte, nur noch …
Das Feuer loderte so plötzlich vor ihm hoch, dass er aufschrie und gegen den Felsen prallte. Er keuchte und versuchte, etwas zu erkennen, aber die Flammen versperrten ihm die Sicht, und dichter Rauch drang in seine Nase, bis er kaum noch atmen konnte. Instinktiv taumelte er rückwärts, der Nacht entgegen – da hörte er sie. Sie wieherte nicht, sie schrie nun, panisch, voller Todesangst vor dem Feuer, er konnte sie doch nicht hier verbrennen lassen, in ihrem Gefängnis! Hustend blieb er stehen, presste sich den Ärmel auf Mund und Nase und schob sich entschlossen zurück in die Höhle.
Das Feuer erlosch so plötzlich, wie es gekommen war. Alles, was blieb, war der matte Schimmer eines Kerzenflämmchens. Er hörte sie in ihrem Verlies rumoren, noch immer voller Furcht – und dann sah er die Augen.
Unzählige.
Sie glotzten ihn aus der Dunkelheit heraus an wie böse Glühwürmchen, und was das Feuer nicht geschafft hatte, das machten diese Augen, denn nun hatte er Angst. Er ließ den Arm sinken und sein Mut fiel von ihm ab wie ein zu großes Kleidungsstück.
»Vergiss nie, mit wem du es zu tun hast«, raunte eine Stimme aus der Finsternis. »Ihr Leben liegt in deiner Hand.«
IM WIND
1
Ein Pferd starrt mich an, als ich aufwache. Mein Kopf lehnt an der Scheibe, ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich eingeschlafen bin – aber ich spüre diesen Pferdeblick auf mir, und außerdem hat das Ruckeln aufgehört.
Es ist kein echtes Pferd. Nur ein gemaltes. Auf einem Schild mitten im Wald.
Irgendwie sieht es komisch aus, es hat kein Fell, sondern Federn wie ein Vogel. Nur seine Augen, die sehen ziemlich echt aus. Wie bei diesen lebensgroßen Figuren auf dem Volksfest, wo man sich dahinterstellen und seinen Kopf durch das Loch strecken kann, so als wäre man selbst die Figur. Das Pferdebild hat lebendige Augen.
»He, Nia!«
Ben hat sich auf dem Fahrersitz herumgedreht und schiebt sich die letzte Minisalami in den Mund. Sofort fällt mir auf, dass der Beifahrersitz leer ist.
»Wo ist Sammy?« Suchend schaue ich mich um. Wir stehen am Straßenrand, und das mitten im Wald. Um uns rum ist eine undurchdringliche Baumwelt voller dunkelgrüner Schatten – und keine Spur von Sammy.
»Musste mal.« Ben stippt das Wurstende aus dem Fenster und grinst. »Gruselig hier, was?«
Ich gucke wieder zu dem Pferd auf dem Schild. Hat sich gerade seine Pupille bewegt? Erst jetzt merke ich, dass die Federn echt sind – jemand muss sie auf das Bild geklebt haben. Und unten drunter steht etwas in einer blassen Schnörkelschrift. Ich drücke meine Nase an die Scheibe und kneife die Augen zusammen.
Den Menschen schuf Gott aus Erde, das Pferd formte er aus Wind. Willkommen in Windheim – Heimat der …
Weiter komme ich nicht, denn die Schrift löst sich langsam auf. Als hätte sie jemand von dem Schild gepustet.
»Kannst du das letzte Wort lesen? Rechts unten im Eck?«, frage ich Ben.
»Was, wo?« Ben rutscht auf den Beifahrersitz und presst ebenfalls das Gesicht an die Scheibe, aber genau in dem Moment wird die Beifahrertür aufgerissen, und er plumpst fast kopfüber auf den Grünstreifen.
»Alles klar bei euch?« Sammy stemmt kopfschüttelnd die Arme in ihre breite Hüfte. »In dem Wald kannst du dich keine zwei Schritte bewegen. Alles zugewuchert. Lasst uns bloß von hier verschwinden!«
Ben klettert zurück hinters Steuer, und sofort beschwert sich Sammy lautstark, dass ihre Minisalamis alle aufgegessen sind. Wir fahren wieder los und das Wort auf dem Schild ist vergessen. Aber irgendwie bin ich auch froh, als mir die Augen des Pferdebildes nicht mehr folgen.
Windheim liegt ganz am Ende der Straße in einer Sackgasse, umzingelt von Wald, und soweit ich mich erinnere, gibt es hier nicht viel – ein paar Läden, eine Bank, eine Kirche, einen Kindergarten. Aber seltsamerweise stört es mich gar nicht so arg. Nicht halb so arg wie Sammy.
»Das ist ja nicht zum Aushalten«, stöhnt sie. »Kann mir mal jemand sagen, was ich hier den ganzen Tag machen soll?«
»Na, hör mal«, braust Ben auf. »Du wolltest doch hierherziehen!«
»Ich wollte nur deiner Großtante helfen«, kontert Sammy mit lauter Stimme. »Wenn du mir gesagt hättest, in was für einem Kaff sie lebt …«
»Ja klar. Nur um meine Großtante geht es.«
Ich höre nicht hin, was Sammy zurückpfeffert, ich blende sie einfach aus, so wie immer, wenn sie streiten. Eigentlich streiten sie ja gar nicht richtig, sie sind nur beide müde und genervt und aufgeregt, und Sammy ist sowieso leicht reizbar wegen ihrer Hormone.
Sie merken gar nicht, was um sie herum geschieht.
Aber ich merke es.
Windheim ist … still. Also nicht ausgestorben oder so, es leben schon viele Menschen hier und laufen herum und reden miteinander. Autos und Radfahrer kommen uns entgegen und wir fahren sogar an einem kleinen Busbahnhof vorbei. Trotzdem ist es still. So als ob etwas fehlt, etwas Wichtiges.
Bei uns im Auto ist es nicht still. Ben und Sammy kabbeln sich immer noch, bis wir in eine Straße einbiegen und vor einem verwilderten, eingewachsenen Haus anhalten. Auch diese Straße ist eine Sackgasse. Drei Häuser weiter: Endstation Wald. Sammy sieht schon ganz verzweifelt aus, aber Ben hat leuchtende Augen gekriegt.
»Leute, ist das lange her! Das letzte Mal war ich hier, als du ein winziger Stöpsel warst, Nia.«
Wir steigen aus und klappern extralaut mit den Türen. An das Haus kann ich mich gar nicht so recht erinnern, obwohl ich die ersten Jahre meines Lebens darin gewohnt habe. Es ist komplett aus grauen Steinen gebaut und total mit Efeu zugewuchert. Es sieht aus, als würde es schon Jahrhunderte hier stehen, so robust und wild. An der Wand lehnt ein rostiges Fahrrad und in der Einfahrt steht ein Karton mit Milchtüten und einem Stapel Zeitungen darauf. Aber die Bewohnerin lässt sich nicht blicken.
»Die freut sich ja massig, dass wir hier sind«, murmelt Sammy. Sie legt die Hände auf ihren Bauch, atmet einmal tief durch und marschiert entschlossen auf die Haustür zu.
»Warte«, ruft Ben und hastet hinter ihr her. »Lass mich, ja?«
Aber er klopft nicht, er steht nur da und guckt die Tür an. Ich stelle mich hinter die beiden, ein Stück abseits, und warte. Über dem Knauf baumelt ein kleines Drahtgeflecht mit ein paar Federn darin, so ähnlich wie mein Traumfänger, nur viereckig und so, dass die Federn innen hängen und nicht unten dran baumeln.
Sammy verliert die Geduld, tritt vor und klopft an die Tür. Sie muss lange klopfen, bis endlich geöffnet wird und ein kleiner, schrumpeliger Kopf voller grauer, abstehender Haare in der Öffnung erscheint.
»Ja bitte?«, fragt die Frau und mustert Sammy gelangweilt.
»Ähm …« Sammy fehlen die Worte, aber Ben schiebt sie einfach zur Seite und breitet die Arme aus.
»Tante Lisbeth! Mensch, ist das lange her.«
Die alte Frau schaut jetzt Ben an, aber ihr Gesicht verändert sich nicht. Nur Ben ist ziemlich verwirrt.
»Ähm … ich bin es … der Ben … der Sohn von Clara? Wir haben telefoniert, erinnerst du dich?«
»Clara, soso …« Tante Lisbeth nickt. Aber ihre Augen bleiben trüb. Sie hat keine Ahnung, worum es geht, und ich glaube, es ist ihr auch egal.
»Dürfen wir reinkommen?« Ben deutet mit dem Daumen nach rechts. »Das ist meine Frau Samanta. Sammy.« Er dreht sich zu mir und winkt mich mit dem Kinn heran. »Und guck mal, wer wieder da ist – Nia! Na, hättest du sie noch erkannt?«
Ich trete einen winzigen Schritt nach vorn und strecke Tante Lisbeth die Hand hin. »Hallo, Tante Lisbeth!«
Auf einmal lächelt die alte Frau. Sie umschlingt meine Hand und drückt sie fest. »Nia! Meine kleine Nia … nein, was bist du gewachsen. Und so schnell alt geworden!« Sie beugt sich zur Seite, nimmt meinen Zopf in ihre freie Hand. »Was für wunderschöne lange Haare du hast! Weißt du noch, wie wir immer Federn hineingeflochten haben?«
Ein seltsames Gefühl strömt in meinen Bauch. Sie sieht so anders aus, so … gealtert. Aber ich erinnere mich an ihre Augen, an ihre Stimme, wenn sie Geschichten für mich erzählt hat, und an den Geruch, der aus dem Haus strömt. Diesen ganz eigenen Lisbeth-Geruch.
Mit einem Ruck lässt sie meine Hand los. Ihre Augen verändern sich und sie sieht wieder Ben und Sammy an. »Das ist lieb. Danke für euren Besuch! Kommt bald einmal wieder!«
Und damit will sie uns die Tür vor der Nase zuknallen.
»Halt!« Sammy hat blitzschnell ihren Fuß in der Tür. »Tante Lisbeth, ich weiß, es ist schwer. Für mich auch. Machen wir doch alle das Beste draus.«
Das Gesicht der alten Frau verhärtet sich. »Niemand vertreibt mich aus meinem Haus! Habt ihr verstanden? Niemand!«
Sammy holt tief Luft und will schon loslegen, aber Ben zieht sie entschlossen zurück. Mit einem Rums fällt die Tür ins Schloss.
Verzweifelt dreht Sammy sich zu uns um. »Was jetzt? Sie will uns hier nicht haben. Jetzt haben wir nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf!«
»Mir fällt schon was ein«, murmelt Ben. Er rauft sich die Haare, bis sie wie kleine Stacheln vom Kopf wegstehen. Dann schaut er mich an. »Lass uns mal eine Weile allein mit ihr reden, Nia.«
»Was? Und wo soll ich hin?«
»Schau dir das Dorf an.«
»Ich kenn mich hier doch null aus!«
»Dann hock dich ins Auto und hör Radio oder so.«
»Aber das haben wir jetzt vier Stunden lang gemacht!«
Sammy schnauft genervt, und ich merke, dass ich störe. Die haben mal wieder andere Probleme.
»Na, ganz toll«, murmle ich, drehe mich um und laufe ein paar Schritte, bis sie nicht mehr auf mich achten. Wir sind nicht mal fünf Minuten hier und schon gibt es Schwierigkeiten. Vielleicht hätten sie ja ein Mal auf mich hören sollen, bevor sie unser ganzes Leben umkrempeln.
Ich stapfe durch das hohe Gras und hocke mich auf einen Stein zwischen die Efeuranken. Der Nachbargarten hat einen schönen Zaun und einen gemütlichen grünen Grasteppich, auf dem das Gerippe eines riesigen Trampolins steht. Zwei Häuser weiter entdecke ich Skulpturen um einen Rosenteich, aus dem Frösche quaken. Also gut, nicht alles an Windheim ist alt und verwildert. Ich könnte mich ja doch mal ein bisschen umschauen gehen.
Das Rostfahrrad fällt mir wieder ein, also laufe ich zurück zur Haustür (die inzwischen wieder einen Spaltbreit offen steht) und ernte sofort einen strengen Blick von Sammy. Zum Glück lässt sich das Fahrrad einfach wegschieben.
Was jetzt? Als ich das letzte Mal hier gewesen bin, war ich drei Jahre alt. In welcher Richtung liegt der Dorfkern? Nein, das hat Zeit. Auf einmal weiß ich, was ich mache. Ich fahre zurück und schaue nach, was auf dem Schild stand – dem Schild mit den lebendigen Pferdeaugen.
2
Fünfmal biege ich in eine Seitenstraße ab – und fünfmal lande ich in einer Sackgasse. Das kann doch nicht sein, wieso baut man ein Dorf so, dass alle Straßen ins Leere führen? Oder besser in den Wald, denn dort enden all die Wege. Manchmal hören sie einfach an den dicht stehenden Bäumen auf, manchmal geht die Straße aber auch in einen schmalen Waldpfad über. Wir sind doch durch den Wald gefahren, oder? Aber da war eine Straße, für Autos, mit Asphalt. Wieso finde ich die dann nicht mehr?
Straße Nummer sechs und wieder ein Holzweg. Auf dem blauen Schild steht: Taifunweg. Ist ja megalustig. Wie hieß die Straße noch mal, in der Tante Lisbeth wohnt? Oh, verdammt, das weiß ich gar nicht! Warum habe ich bloß nicht nachgeschaut?
Ich radle zwischen den – zugegeben ziemlich hübschen und gepflegten – Einfamilienhäusern zurück und biege wieder auf die Straße ein, die ich für die Hauptstraße halte. Aus welcher Richtung bin ich gekommen? Von links, oder? Aber bin ich nicht schon umgekehrt? All diese Wege sehen gleich aus, obwohl die Häuser und Gärten so unterschiedlich sind. So schwer kann das doch nicht sein. Also links.
Auf dem Schild steht: Höllental. Irgendwie will ich da nicht reinfahren und es sieht sowieso aus wie die falsche Straße. Ich teste den Giblipfad und die Boreasstraße, wo mich ein Schild »Zum Alten Böhmwind« lotst. Das klingt nach einem Gasthof oder so was, und da in so einem Dorf bestimmt jeder jeden kennt, werden die mir auch sagen können, wie ich zurück zu Tante Lisbeths Haus finde.
Ich trete in die Pedale und folge der kurvigen, einspurigen Strecke, bis ich vor einem Gasthof stehe. Gemütlich sieht das hier aus, dichte Rosenranken bilden ein duftendes Tor zu einem Kiesplatz, auf dem hölzerne Tische und Bänke im Schatten unter Buchen stehen. Die Blätter rascheln im leisen Wind und es riecht eindeutig nach gebratenen Kartoffeln.
Nur leider ist da niemand, der Biergarten ist leer und die Fenster des Gasthofs sind abgedunkelt. Hinter dem Haus scheint es einen großen Garten zu geben und dahinter – natürlich – Wald. Ich stelle das Fahrrad in den Ständer und gehe die wenigen Stufen zur Haustür rauf.
Aus familiären Gründen bleibt unsere Gaststube heute geschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Schade – der Biergarten sieht gemütlich aus. Ich überlege gerade, ob ich einfach drum rumlaufen soll und gucken, ob jemand dort ist, der mir weiterhelfen kann, aber genau in dem Augenblick kommen fünf Wanderer aus dem Wald. Sie bleiben wie ich vor dem geschlossenen Gasthaus stehen und gucken sich enttäuscht um.
»Macht nichts«, sagt einer von ihnen und schwingt seinen Wanderstock. »Kommt mit, wir trinken im ›Gegenwind‹ noch was!«
Ich schaue ihnen nach, als sie wieder im Wald verschwinden, und dabei kommt mir eine Idee. Natürlich! Alle Straßen enden am Waldrand, also muss ich von dort auch zu Tante Lisbeths Haus zurückkommen! Wahrscheinlich finde ich die Straße sogar besser, weil man den Wald von ihrem Haus aus sehen konnte. Ich schnappe mir das Rostrad und fahre los. Das Schild ist mir gerade egal, das suche ich ein andermal. Wenn wir jetzt hier wohnen, werde ich noch hunderttausendmal daran vorbeifahren.
Im Wald ist es windstill und angenehm kühl. Vögel singen aus den Wipfeln und irgendwo in der Ferne höre ich die Wanderer schwatzen und lachen.
Das Rad hoppelt immer wieder, wenn eine Wurzel aus dem weichen Waldboden herausragt. Es ist gar nicht so leicht, die dünnen Reifen in der Spur zu halten, aber ich habe auch keine Lust, den ganzen Weg zu laufen. Eine Weile muss ich den Wanderern folgen, bis der Weg endlich eine Linksbiegung macht. Das Summen von Insekten erfüllt die Luft, Äste knacken, Blätter rascheln im Wind. Waldmusik. Am Wegrand wachsen lila-, türkis- und pinkfarbene Wedel, die aussehen wie Federn, die jemand auf einen Stiel geklebt hat. Dazwischen leuchten kleegrüne Farne und Sonnenlicht fließt durch das Blätterdach wie ein schimmernder Wasserfall. Ich wünschte, Sammy wäre hier und könnte das sehen.
Der Weg wird schmaler und schmaler, und ich muss den Kopf einziehen, als ich unter einer knorrigen Baumkrone durchfahre, die wie ein Torbogen auf die andere Seite hängt. Wie lange bin ich eigentlich schon unterwegs? Ich habe irgendwie das Zeitgefühl verloren, aber so langsam müsste ich doch wieder in Windheim ankommen. Ein Plätschern und Tröpfeln lotst mich wieder nach links. Tatsächlich, da fließt ein schmaler Bach! Schimmergrün und voller winziger Blütenblätter, die wie kleine Schiffchen durch den Wald treiben.
Ich steige ab, gehe hin und strecke meine Hände hinein. Herrlich kühl und so klar, dass ich nicht widerstehen kann, etwas davon in meine hohle Hand zu schöpfen und zu trinken. Schmeckt auch wie Märchenwaldwasser! Als ich den Kopf hebe, starrt mich ein Baum von der gegenüberliegenden Seite an. Eine uralte, knorrige Weide, die ihre Wurzeln ins Wasser streckt wie ich meine Hände. Der Baum hat eine Knollennase und zwei Astlöcher als Augen und um seinen Mund wächst Moos wie ein grüner Bart. Ich muss Sammy von diesem Ort erzählen, unbedingt. Sie sagt doch immer, der Englische Garten ist bloß eine riesige grüne Müllhalde. Diesen Märchenwald wird sie lieben!
Aber so langsam sollte ich wirklich zurückfinden. Was, wenn Tante Lisbeth Ben und Sammy rausgeworfen hat und wir wieder zurück nach München fahren müssen? Plötzlich kriege ich eine Gänsehaut und ziehe hastig meine Hände aus dem kalten Wasser. Die haben mich weggeschickt, um zu reden. In einem fremden Dorf, wo man sich irre leicht verlaufen kann. Wenn das nun volle Absicht war? Vielleicht wollen sie mich wieder hierlassen, so wie damals, als ich klein war. Vielleicht soll nur ich bei Tante Lisbeth leben, und sie fahren ganz woandershin, in ein neues Leben – ohne mich?
Ich packe das Fahrrad und schiebe es zurück auf den Pfad, der vom Weg noch übrig geblieben ist. Der Baum mit den Astaugen starrt mir nach, als ich die Richtung einschlage, aus der ich gekommen bin.
Glaube ich.
Der Pfad verschwindet nach wenigen Metern im dichten Gehölz, ich bin doch falsch gefahren. Wo ist denn dieser blöde Weg jetzt hin? Da, diese bunten Federblumen, die habe ich doch vorhin schon gesehen! Aber da sind sie am Wegrand gewachsen, und hier ist kein Weg, hier müsste ich das Fahrrad tragen, um voranzukommen.
Wieder kehre ich um. Aus der Richtung bin ich sicher nicht gekommen, dort fließt der Bach. Ich kann sein Wasser durch die Baumblätter schimmern sehen, seltsamerweise höre ich ihn aber nicht mehr. Der Wald um mich ist dicht und unwirklich.
Und irgendwie gruselig.
Ich bleibe stehen und stelle beide Füße auf den Boden. Der Wind spielt mit den Blättern über meinem Kopf, aber ihr Rascheln ist verstummt. Genau wie die Vögel, die gar nicht mehr herumpiepsen.
Und dann höre ich doch etwas, wie aus weiter Ferne, ganz dumpf und verzerrt: Stimmen.
Okay, das ist jetzt echt unheimlich. Fangen die Bäume hier an zu reden? Diese Weide am Wasser mit ihrem bemoosten Gesicht … ach, was für ein Quatsch. Wahrscheinlich sind die Wanderer noch in der Nähe. Ich halte die Luft an und drehe den Kopf, um die Geräusche einzufangen, aber sie schwimmen durch den Wald, mal hierhin, mal dorthin, und ich verstehe … ich verstehe kein Wort.
»Hallo?«, rufe ich laut. »Hallo, hört mich jemand?«
Der Wald fängt mein Echo auf und schluckt es wie dünnen Brei. Als würde er mich … leise drehen. Ich taste nach meinen Ohren. Alles klingt so dumpf, wie wenn man schnell von einem hohen Berg runterfährt und das Trommelfell zumacht – ich kann mich selbst kaum noch hören!
»Ist hier jemand?«, rufe ich noch mal, lauter. »Kann mich irgendwer hören?«
Stille.
Als ob ich die Stimmen mit meinem Gerufe verscheucht hätte. Oder nein, doch nicht – da sind sie wieder, hinter mir, links, nein rechts – oder eher vor mir?
Nüüüücht … nüüüücht … nüüüücht …
Ich wirble herum, das Fahrrad fällt fast um, ich kann gerade noch meine Knie um die Querstange schließen. Da ist doch niemand, woher kommen diese Stimmen?
… kooommen … kooommen …
Ich zucke zusammen, schaue wie wild hin und her. Diesmal habe ich die Stimmen ganz deutlich verstanden! Aber sehen kann ich immer noch niemanden, und das ist fast noch unheimlicher als das, was sie gesagt haben. Ich verschwinde jetzt, egal, wohin, hier bleibe ich keine Sekunde länger!
Aber mein Fuß bewegt sich nicht, ich bewege mich nicht, ich stehe wie festgewurzelt und lausche in den Wald. Irgendetwas … passiert hier, die Luft, alles wird dick und zäh, wie Honig. Die Stimmen werden lauter, wirbeln durcheinander, umkreisen mich – und werden alle zu einem einzigen, donnernden Befehl:
Nicht!
Entkommen!
Lassen!
3
Der Schmerz explodiert in meinem Kopf.
Ich schreie auf, drücke mir die Hände auf die Ohren und versuche, mich irgendwie gegen den Druck zu schützen, der plötzlich meine Ohren und meine Augen zusammenquetscht. Es tut so weh, dass ich kaum noch richtig sehen kann, aber ich muss hier weg, schnell, weg, nur weg, raus aus dem Wald!
Blind taste ich nach dem Lenker, ziehe mich auf den Sattel und fahre los, quer durchs Gehölz, über Äste und Wurzeln und Steine und rutschige Blätter, weg, schnell weg von den Stimmen. Verfolgen sie mich, sind sie immer noch hinter mir her? Der Druck lässt nach, mit jedem Meter, den ich strample und keuche und schlucke, also strenge ich mich noch mehr an, trete mit aller Kraft und …
Etwas springt vor mir auf den Weg, ein Schatten, der größer ist als mein Fahrrad. Ich kreische auf und versuche, dem Schatten auszuweichen, aber wir sind schon zu nah, und es kracht, als der Vorderreifen das Hindernis rammt.
Ein Ruck geht durch das Fahrrad und meine Füße rutschen von den Pedalen. Der Lenker verdreht sich, und ich lande hart auf dem Rücken, überschlage mich und kugle rückwärts einen Abhang hinunter. Das Pedal bohrt sich in meinen Bauch, und mein Bein, ich kann mein Bein nicht mehr bewegen! Ich schreie und reiße die Arme hoch, um irgendwie mein Gesicht zu schützen, aber mein Kopf rumst gegen einen Baumstamm, und für einen Moment sehe ich Sterne am Blätterhimmel.
Aua.
Der Schmerz holt mich zurück in die Wirklichkeit.
Blinzeln.
Atmen.
Das klappt noch.
Aufstehen geht nicht, auf mir liegt ein verdrehtes Stück Rostmetall, das einmal ein Fahrrad war. Besser gesagt zwischen mir und meinem Bein. Jetzt weiß ich wenigstens, wo der Schmerz herkommt. Ich bewege meine Zehen und hebe dann vorsichtig das Fahrrad ein Stück an, sodass ich meinen Fuß darunter rausziehen kann.
Der Schmerz lässt nach und vor lauter Erleichterung kommen mir die Tränen. Der Druck ist weg – und der Wald raschelt wieder. Überall um mich herum summt und pfeift und knackt es in den Bäumen. Ein ganz normaler Wald, in dem Vögel singen und keine Gruselstimmen herumraunen. Ich bin die Einzige, die hier nicht hingehört.
Vorsichtig rapple ich mich hoch. Was war das nur für ein Schatten, mit dem ich da zusammengeknallt bin? Sehen kann ich nichts, nur Blätter und Moos und jede Menge Bäume. Wahrscheinlich dachte ich nur, dass etwas vor mir auf den Weg springt, und bin gegen einen Baumstamm gefahren. Ja, so muss es gewesen sein. Dieser Druck im Kopf hat mir total die Sinne vernebelt.
Ich versuche aufzustehen, rutsche aber gleich wieder nach hinten weg. Au, verdammt! Das Bein fühlt sich gar nicht gut an und das ist definitiv keine Einbildung. Damit laufen wird lustig. Werde ich aber müssen, die Fahrradleiche bringt mich nirgendwo mehr hin. Ich schaue mich um. Die Böschung, die ich runtergekippt bin, sieht irre steil aus, und ich liege mitten im Gestrüpp, wo der Baum meinen Sturz gestoppt hat. Da hoch komme ich mit dem Bein im Leben nicht. Also muss ich runter, irgendwo wird dieser dumme Weg ja wohl sein.
Ich beiße fest die Zähne zusammen, dann lege ich das gequetschte Bein über das heile und beginne, vorsichtig die Böschung runterzurutschen. Es tut höllisch weh, aber ich schaffe es, heil unten anzukommen, ohne mit einem meiner unbeschädigten Körperteile an einem der dicken Baumstämme zu landen. Von der Fahrradleiche sehe ich nur noch den verrosteten Lenker. Ich kann sie ja später bergen, falls Tante Lisbeth einen Aufstand macht.
Nur leider gibt es hier auch keinen Weg und natürlich auch keine Hinweisschilder oder so. Weiterrutschen geht auch nicht, von hier aus wuchern Wildblumen und Riesenfarne alles kreuz und quer zu.
Oh Mann. Und was jetzt?
Ich schaue mich um. Also, hier war lange kein Mensch mehr. Alles dichter Buschwald. Aber Windheim kann doch nicht so weit weg sein! Oder? Links. Nein, rechts. Von wo komme ich noch mal? Scheiße, überall sieht es gleich aus! Was soll ich nur tun? Ob sie mich schon suchen gegangen sind? Sammy fällt mir ein. Sammy und Ben, die alles sind, was ich habe.
Die mich schon mal vergessen haben.
Nein. Wenn ich hier rauswill, muss ich es allein schaffen. Entschlossen schiebe ich mein heiles Bein unter den Po und stehe auf. Laufen kann ich so immer noch nicht, also strecke ich mich, bis ich an den untersten Ast einer gewaltigen Buche komme, und lehne mich einmal dagegen. Es knackst – und ich halte eine prima Krücke in der Hand.
Ich humple los und hinter mir knackt es unheimlich. Wald, das ist nur der Wald. Das Knacken wird lauter, da sind Schritte hinter mir, schwere Schritte – und plötzlich fällt mir der Schatten wieder ein, gegen den ich geknallt bin und der kein Baum war, so wie die Stimmen auch keine Einbildung waren! Ich bohre die Krücke in den Waldboden und wirble herum.
Hinter mir steht der Schatten und schaut auf mich herab. Bloß dass es kein Schatten ist.
Sondern ein Pferd.
Ich bin so überrascht, dass ich stolpere und auf den Po falle. Das Pferd kommt einen Schritt auf mich zu und senkt den Kopf, und irgendwie ist es diese Geste, die mein wild pochendes Herz beruhigt. Es wird mich nicht fressen und es wird mich auch nicht über den Haufen rennen. Es steht nur vor mir und guckt mich an.
Langsam strecke ich die Hand in Richtung seiner Nase.
»Na, du?«, flüstere ich.
Pferde soll man anpusten, wenn man ihnen zum ersten Mal begegnet. So machen es Pferde untereinander auch. Das Pferd hat die Nüstern tatsächlich weit gebläht und schnauft gegen meine Hand, also puste ich vorsichtig in seine Richtung, und eine ganze Weile atmen wir einfach nur gemeinsam.
Ein Pferd. Nur ein Pferd. Im Wald. Allein.
Ich stemme mich auf meine Krücke und stehe wieder auf. Das Pferd weicht nicht zurück, aber nun sind wir auf Augenhöhe, und ich kann es mir genauer angucken.
Wow. Oh, wow. Sein Fell ist schwarz und schimmert im Waldlicht, als hätte man es mit etwas Metallischem eingesprüht. Es trägt weder ein Halfter noch Hufeisen und in der üppigen Mähne haben sich kleine Blätter und lilafarbene Blüten verfangen. Ich kann nicht anders, ich mache meinen Arm noch länger und berühre seinen Hals. Sein Fell ist kühl und so weich wie Entenflaum. Das Pferd stupst die Nase gegen meine Schulter und ich zupfe ein paar der Blätter aus seinen Haaren. Auch die Mähne und der Schweif haben diesen eigenartigen Regenbogenschimmer. Wie ein schwarzes Auto, das grelles Sonnenlicht reflektiert.
Es ist sicher irgendwo abgehauen. So ein megatolles Pferd läuft doch nicht einfach ohne Besitzer herum! Und das erklärt auch die Gruselstimmen, bestimmt hat jemand versucht, ihn aufzuhalten, und ich habe das nur so verzerrt gehört, weil der Wind die Geräusche im Wald herumgewirbelt hat. Ich werde einfach warten, hier bei dem Pferd, bis der Besitzer kommt und es abholt und mir sagt, wie ich aus diesem verdammten Urwald herausfinde.
»Wie heißt du denn?«, frage ich.
Das Pferd schaut mich nur aus großen dunklen Augen an.
»Also, ich bin Nia. Aber ich bin nicht von hier, wir sind nur, also, wir sind hier … für eine Weile.« Es tut gut, jemanden zum Reden zu haben, also rede ich. »Als ich klein war, habe ich bei Tante Lisbeth gewohnt. Sie ist gar nicht meine Tante, sie ist irgendwie mit Ben verwandt, aber das war ihr egal. Ich war noch so klein damals, ich erinnere mich kaum an sie! Und jetzt sind wir hergezogen, weil sie krank ist. Aber Tante Lisbeth … die will uns gar nicht hierhaben. Sie hat uns die Tür vor der Nase zugeknallt. Ben sagt, sie weiß nicht, dass sie krank ist. Sie vergisst Dinge. Deshalb kann sie auch nicht mehr allein in ihrem Haus leben.«
Wieder stupst das Pferd gegen meine Schulter. Der ist ja irgendwie süß! Ich streichle über seine Brust und lege eine Hand auf seinen Rücken. Es ist größer als die Ponys zu Hause, aber auch nicht so groß, dass man nicht gut auf seinen Rücken klettern …
Auf einmal habe ich unbändige Lust, auf diesem Pferd zu reiten. Der könnte mich sicher aus diesem Wald herausbringen! Haben Pferde nicht einen guten Richtungssinn?
Es ist, als hätte das Pferd meine Gedanken verstanden. Noch einmal stupst es mich an, dann macht es eine Art Verbeugung und knickt mit den Vorderbeinen ein. Ich kann mich gerade noch auf meinem Krückenstock abstützen, sonst wäre ich über das Pferd gefallen, das plötzlich vor mir auf dem weichen Waldboden liegt und mich abwartend anschaut.
Das muss ein Trick sein, eine Zirkuslektion, die man ihm beigebracht hat. Und ich habe versehentlich das Signal dazu ausgelöst, vielleicht als ich über seinen Rücken gestreichelt habe? Die lange Mähne faltet sich über seinem Widerrist auseinander und strömt links und rechts davon über seine Schulterblätter, schimmernd wie ein nächtlicher Wasserfall.
Auf einmal will ich unbedingt auf ihm reiten, ich muss, ganz egal, was passiert! Sein runder, weicher Rücken sieht so einladend aus, wie ein Sofa, ein Sofa, das mich nach Hause tragen kann, sicher durch den Wald … Was soll schon passieren? Ganz offensichtlich kennt er es, geritten zu werden. Wenn ich herunterfalle, muss ich nur aufpassen, dass ich auf meinem verletzten Bein lande, sonst kann ich nämlich gar nicht mehr laufen.
Ich werfe meinen Krückenstock ins Gehölz, greife nach der Schimmermähne und lege mein verletztes Bein über seinen Rücken. Das Pferd ist tatsächlich so bequem, wie es aussieht, ganz weich und rund. Einen Augenblick lang steht die Zeit still, still … und dann geschieht alles auf einmal, so schnell, dass ich kaum folgen kann.
Das Pferd dreht den Kopf nach vorn, steht in einer einzigen fließenden Bewegung auf und läuft los. Läuft? Nein, es rennt, wir galoppieren! Ich sehe Bäume an uns vorbeisausen, Blätterwirbel, und der Wind scheint uns zu folgen, er bläst uns vor sich her wie ein Segel auf dem Meer! Ich bekomme Angst, weil wir zu schnell sind – aber schon eine Sekunde später ist das Gefühl wieder verschwunden, und eine tiefe Zufriedenheit hüllt mich ein. Ich fühle mich getragen, geschützt und irgendwie … glücklich.
Wie lange wir so durch den Wald rasen, weiß ich nicht, es ist mir auch egal – bis ich den fremden Hufschlag höre. Jemand ist hinter uns! In meinem Kopf herrscht noch immer dichter Nebel, also höre ich einfach auf mein Gefühl und drücke dem Pferd meine Füße gegen den Bauch.
»Lauf«, flüstere ich ihm zu. »Lauf einfach!«
Noch nie habe ich mich so frei gefühlt! Ich will nicht aufhören, ich will niemals wieder von diesem Pferd absteigen – aber da ist noch ein anderes Gefühl, etwas, was in die andere Richtung zieht. Ich komme nicht dazu, darüber nachzudenken, denn der fremde Hufschlag holt uns ein, und ein dunkel gekleideter Reiter auf einem hellen Fuchs versperrt uns den Weg, sodass wir jäh abbremsen müssen.
Beinahe sofort sind meine Gedanken wieder klar und ich schaue verwirrt an mir herab. Ich habe die Beine um dieses fremde Pferd geschlungen, ein Tier, das mir nicht gehört, auf das ich ohne Erlaubnis geklettert und mit dem ich durch den Wald galoppiert bin! Habe ich sie noch alle? Mir oder dem Pferd hätte sonst was dabei passieren können!
Der fremde Reiter springt aus dem Sattel und schleudert ein Seil um den Hals meines Pferdes. Ich kann sein Gesicht nicht erkennen, weil er einen schwarzen Kapuzenpullover trägt und die ganze Zeit nur das Pferd ansieht, so als gäbe es mich überhaupt nicht. Als er doch unvermittelt zu mir aufschaut, schnappe ich nach Luft.
Das ist ein Junge, nicht viel älter als ich! Aber offenbar weiß er, was er tut, denn er arbeitet mit schnellen, sicheren Handgriffen und hat aus dem Seil im Nu ein kompliziert verknotetes Halfter geknüpft.
»Kannst du absteigen?«, fragt er und starrt mir in die Augen.
»Ähm … Ja, na klar!« Ich schwinge mein rechtes Bein über den Pferdepo und springe zu Boden. Sofort sacke ich zusammen und jaule vor Schmerz auf.
Der Junge stößt einen Fluch aus und kniet sich neben mich. »Was ist? Sag schon, was fehlt dir?«
»Mein Bein …«, stöhne ich und halte mir den Unterschenkel. »Das Pferd kann nichts dafür, ich hatte einen Unfall mit dem Fahrrad!«
»Welchem Fahrrad?« Der Junge schaut sich um, auf seiner Stirn erscheinen haufenweise Falten.
»Nicht hier. Weiter hinten im Wald … da, wo ich ihn gefunden habe.«
»Er hat dich gefunden«, sagt der Junge und reibt sich die Stirn. »Du meinst, sonst fehlt dir nichts? Außer diesem … Fahrradschmerz im Bein?«
Verwirrt schüttle ich den Kopf. »Reicht doch auch.«
Der Junge rückt von mir ab, plötzlich hat er es eilig. »Dann tschüss.«
Der will mich hier einfach so liegen lassen? Obwohl er sieht, dass ich nicht mal auftreten kann? Ich rapple mich hoch, hüpfe auf einem Bein zu dem schwarzen Pferd und halte mich an seinem Rücken fest. Im selben Augenblick spüre ich wieder diese Ruhe, die auf mich überströmt wie warmer Atem.
»Ist das dein Pferd?«, frage ich. »Ist er dir abgehauen?«
Der Junge antwortet mir nicht. Er steigt auf seinen Fuchs und packt das Seil fester, sodass der Schwarze einen Schritt von mir wegmachen muss.
»Woher kommt ihr denn?«, versuche ich es noch mal. »Seid ihr aus Windheim?«
Das schwarze Pferd dreht sich zu mir um und wiehert, ganz leise, als würde es mir antworten. Ich humple wieder los, aber da treibt der Junge seinen Fuchs an und schneidet mir den Weg ab.
»Lass die Finger von ihm, klar?«, faucht er. »Du kannst von Glück sagen, dass dir nicht mehr passiert ist!«
»Aber er war total lieb, er wollte mich nur nach Hause tragen!« Wie irre das klingt, merke ich erst, als ich die Worte schon gesagt habe. Ich hatte weder Reithalfter noch Zügel oder irgendeine Ahnung, in welche Richtung wir unterwegs waren. Wie kann ich behaupten, ich wüsste, wohin das Pferd wollte?
Der Junge drängt den Schwarzen von mir weg und zieht etwas aus der Tasche, einen winzigen Gegenstand, den ich nicht sehen kann. Er knotet das Ende des Seils darum und lässt es einmal durch die Luft wirbeln. Als es den Schwarzen auf dem Hinterteil berührt, wiehert der los und steigt steil in die Luft. Es sieht spektakulär und gefährlich aus – aber wahrscheinlich hat ihm die Berührung wehgetan.
»Spinnst du?«, keuche ich. »Warum tust du ihm weh? Er hat doch gar nichts gemacht!«
»Rscht«, macht der Junge und wirbelt erneut mit dem Seilende, und diesmal weicht der Schwarze zurück. Was hat er nur dort festgebunden? Der Junge wirft seinen Fuchs herum und galoppiert los und das schwarze Pferd folgt ihm anstandslos.
»He«, rufe ich ihm nach. »Kannst du mir wenigstens sagen, wie ich nach Windheim zurückkomme?«
Zuerst sieht es so aus, als würde er einfach wegreiten und mich stehen lassen, aber dann dreht er sich doch noch mal um und deutet mit dem Kopf nach links. Die Kapuze hängt ihm so tief ins Gesicht, dass seine Augen pechschwarze Höhlen sind.
»Kannst du mir nicht …«
… helfen, denke ich noch, aber der Junge hört mir nicht mehr zu. Er hetzt das schwarze Pferd durch den Wald, den Weg zurück, den wir gekommen sind. Ich schaue ihm nach, bis sie im dichten Farngrün verschwunden sind, bis die Bäume nur noch leise vor sich hin rascheln und ich mich zum zweiten Mal an diesem Tag frage, ob alles, was gerade geschehen ist, wirklich war oder nur in meinem Kopf passiert ist.
Eins steht jedenfalls fest: Der fürchterliche Junge mit den Pechaugen kann gern aus meinem Gedächtnis verschwinden. Aber dieses Pferd – das werde ich so schnell nicht vergessen.
4
Das erste Haus, das im Abendlicht hinter den Bäumen auftaucht, ist eigentlich kein richtiges Haus, sondern eine Blockhütte, die irgendeine Erinnerung in mir wachruft. Die Lampen brennen, und vor dem Eingang hängt eine bunte Lichterkette, und dort sitzen auch die fünf Wanderer, die ich getroffen habe, vor ewigen Stunden bei dem Gasthaus.
Die sehen irgendwie nicht so aus, als hätten sie sich im Wald zwischen Gruselstimmen verlaufen. Aber dafür sind sie auch nicht von einem schönen schwarzen Pferd gerettet worden!
»Du bist ja verletzt!«
Ein kleines Mädchen steht plötzlich neben mir. Diesmal ist die Erinnerung sofort da – das ist meine Sandkastenfreundin, die ich damals in Windheim hatte! Wie hieß sie noch? Carolyn. Aber warum ist sie noch immer so klein? Sie scheint seitdem keinen Tag älter geworden zu sein! Fasziniert starre ich sie an.
Die kleine Carolyn beugt sich zu meinem Bein hinunter. »Was hast du angestellt?«
»Ich hatte einen Fahrradunfall«, krächze ich. »Im … im Wald.«
Sie legt den Kopf schräg und mustert mich, so als würde sie überlegen, ob sie mich ebenfalls wiedererkennt. Dann nimmt sie einfach meine Hand und führt mich zu der Blockhütte. Eine Frau kommt heraus, hört sich von dem Mädchen an, was geschehen ist, und bringt sofort ein Kühlpad und eine Flasche eiskalte Limo.
»Danke«, murmle ich erschöpft. »Ich habe aber gar kein Geld dabei.«
»Das geht schon in Ordnung«, sagt die Frau und kniet neben meinem Bein nieder. »Lass mich mal sehen, ja?«
Ich kremple die Hose hoch und sie betastet mein Bein vorsichtig.
»Hast Glück gehabt. Scheint nur eine Prellung zu sein. Gegen die Schürfwunden habe ich was.«
Sie verschwindet in der Blockhütte, die, wie ich jetzt sehe, ein Laden ist und »Gegenwind« heißt. Vor dem Eingang hockt ein kleiner Junge mit schmutzigen Füßen und buddelt im Kies herum. Und hinter einer der großen Fensterscheiben sitzt ein Mädchen, so alt wie ich, an der Kasse und schaukelt ein schreiendes Baby im Arm, hin und her.
Augenblicklich fällt mir Sammy wieder ein.
»Ich muss zurück!« Als ich aufspringe, fährt der Schmerz nur so durch mein Bein. Stöhnend sinke ich zurück auf meinen Sitz.
»Mal langsam.« Die Frau kommt wieder heraus, tupft eine bräunliche Flüssigkeit auf meine Wunden und wickelt zwei dicke Verbände darüber. »Wo musst du denn hin?«
»Zu Tante Lisbeths Haus«, erzähle ich matt. »Aber ich habe vergessen, in welcher Straße sie wohnt.«
Neue Wanderer kommen aus dem Wald und die Frau lächelt ihnen zu. »Wo? Hier, in Windheim?«
»Mhm.«
»Ich kenne keine Lisbeth. Willst du sie anrufen?«
»Sie wohnt in einem alten Steinhaus in dieser Straße am Wald …«
»Hier enden alle Straßen am Wald, Schätzchen.« Die Frau steht auf und hebt den Jungen mit den schmutzigen Füßen auf ihren Arm, damit die Wanderer den Laden betreten können. Dann klopft sie an die Scheibe, hinter der noch immer das Mädchen mit dem weinenden Baby hockt und einhändig etwas in die Kasse eintippt. »Aber ich denke, ich weiß, welches Steinhaus du meinst. Caro! Beweg deinen Hintern mal nach draußen!«
Wieder gucke ich das kleine Mädchen an, das ich für Carolyn gehalten habe. Natürlich! Das muss ihre kleine Schwester sein! Das Mädchen hinter der Scheibe hebt fragend die Schultern, aber dann steht sie doch auf und tritt kurz darauf aus der Tür. Sofort fallen mir ihre superlangen Wimpern auf. Die hatte sie als Kind auch schon. Aber die Haare sind anders, kurz und blau, und sie hat angemalte Fingernägel zum Augenauskratzen. Außerdem ist sie so groß, dass sie sogar ihre Mutter überragt.
»Was denn?«, fragt sie gelangweilt.
»Kannst du das Mädchen zu ihrer Tante zurückbringen? Santa-Ana-Straße.«
Caro stöhnt auf. »Kannst du das nicht schnell machen? Ich pass doch schon auf Timo auf!«
»Ich kann hier jetzt nicht weg.« Die Frau deutet mit dem Kinn zu den Wanderern, die in der Eiskarte blättern. Sie überlegt einen Moment, dann läuft sie hinters Haus und kommt kurz darauf mit einem breiten Doppelkinderwagen zurück, in den sie den Jungen mit den schmutzigen Füßen hockt. »Darauf kannst du dich aufstützen beim Gehen«, sagt sie zu mir. »Meinst du, das klappt?«
»Bestimmt.« Bis hierher bin ich schließlich auch gekommen. Ich rapple mich hoch, schiebe die noch verschlossene Limoflasche von mir und stütze mich auf den Kinderwagen, der dank seiner Größe tatsächlich ziemlich stabil ist. »Das ist super, vielen Dank!«
Caro legt das zappelnde Baby einfach in das andere Kinderwagenbett. »Geradeaus und da vorne rechts.«
»Ich will auch mit!« Das kleine Mädchen, das mich entdeckt hat, schiebt seine Hand wieder in meine.
»Och nö, Leyla, echt nicht«, stöhnt Caro, aber da ruft jemand aus dem Laden, und die Frau dreht sich um und läuft schnell hinein.
»Ich weiß auch, wo die Santa-Ana-Straße ist«, verkündet Leyla stolz. »Ich kann dich hinführen!«
»Aber du kannst nicht Timo und Paul zurückschieben«, meint Caro. »Kannst sie ja schlecht dalassen.«
Leyla kichert. »Das wäre aber doch lustig!«
Eine Weile schiebe ich schweigend Paul und das wackelnde Baby neben ihnen her, bis sich der kleine Schreihals endlich beruhigt und sich die Stille von Windheim zwischen uns drängt.
»Ist Timo dein Baby?«, frage ich, als die Stille zu laut wird.
»Was?« Caro lacht auf. »Nein! Natürlich nicht.«