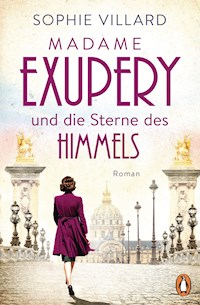7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Kunst war ihre Leidenschaft. Die Liebe ihr Schicksal.
Paris 1937: Die rebellische Erbin Peggy Guggenheim genießt ihr Leben in der schillernden Künstlerbohème, eine glamouröse Abendgesellschaft folgt auf die nächste. Doch Peggy hat einen Traum. Sie will ihre eigene Galerie eröffnen und endlich unabhängig sein. Da verliebt sie sich in einen hochgewachsenen Schriftsteller mit strahlenden Augen: Samuel Beckett. Aber ihre Liebe steht unter keinem guten Stern, denn Peggys Traum lässt sich nur im fernen London verwirklichen, weit weg von Beckett. Und auch am Horizont ziehen dunkle Wolken auf: Der Krieg zwingt zahlreiche Künstler zur Flucht aus Europa. Peggy hilft vielen von ihnen dabei – und begibt sich und ihre Liebe in große Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
SOPHIE VILLARDist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Autorin. Die gelernte Journalistin und Politologin lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Dresden. Die Figur der Peggy Guggenheim faszinierte sie seit dem Moment, als sie in ihrer Lieblingsstadt Venedig zum ersten Mal die berühmte Peggy Guggenheim Collection besuchte.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Sophie Villard
Peggy Guggenheim und der Traum vom Glück
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Zitate Zitat1 und Zitat2 stammen aus Peggy Guggenheims Autobiografie Ich habe alles gelebt, erschienen bei Bastei Lübbe. Das Zitat auf Zitat3 und Zitat4 stammt aus dem Film Peggy Guggenheim - EinLeben für die Kunst von Lisa Immordino Vreeland.
Copyright © 2020 by Sophie Villard
Copyright © 2020 by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literaturagentur Hille und Schmidt
Umschlag: Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagmotiv: © Ildiko Neer/Trevillion;
© VitalyEdush/iStock; Lightix/shutterstock; Surasak/iStock
Redaktion: Lisa Caroline Wolf
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-24633-4V002
www.penguin-verlag.de
»Es drehte sich alles um Kunst und Liebe.«
Peggy Guggenheim über ihr Leben
Erster Teil: Galerie Guggenheim Jeune, Beckett – und eine Idee
1937–1939
Kapitel 1
Paris, Avenue des Champs-Élysées, ein Tag nach Weihnachten 1937
Peggy schwang die Pelzstiefeletten aus dem Taxi auf das nasse Trottoir vor dem Eckhaus und zog den Zobel enger um sich. Die Fenster des Fouquet’s leuchteten ihr durch den Schneeregen golden entgegen, als sie dem Lachen, dem Swing und den Stimmen zueilte. Ein wenig Wehmut begleitete sie, denn dies sollte eine ihrer letzten Nächte hier in Paris werden. Der Stadt, in der sie als junge Frau die Liebe gefunden hatte und die sie nun verließ, um ihrer neuen Liebe zu frönen. Einer Liebe, die nichts mit Männern zu tun hatte, sondern die einem deutlich edleren Interesse diente, wie sie fand.
Die Einladung zu James Joyce’ Dinnerparty heute Abend hatte sie trotz der Reisevorbereitungen gerne angenommen. Denn die Partys des berühmten Schriftstellers waren stets ein ausgesprochen anregendes Vergnügen. Wie froh sie war, dass diese Freundschaft ihre Scheidung von Laurence überdauert hatte, denn das war absolut nicht mit allen Bekannten der Fall.
Schnell schob sie die trüben Gedanken fort, öffnete die Tür und trat durch den schweren Samtvorhang in die Wärme des Fouquet’s. Heute schien etwas Besonderes auf sie zu warten in dieser altehrwürdigen Brasserie, deren holzgetäfeltes und mit rotem Jacquard gestaltetes Interieur sich zu einem Lieblingsort der Joyce entwickelt hatte. Ihr selbst war das Ganze viel zu viktorianisch. Aber so waren sie nun mal, diese Leute von den Britischen Inseln.
Sie überließ dem Kellner den Zobel und überprüfte den Sitz ihrer Marlene-Hose im barockumrandeten Spiegel. Die Jüngste war sie mittlerweile tatsächlich nicht mehr, dachte sie, als sie den Hut vom zerdrückten Haar nahm und die durch Trauer und Schlafmangel entstandenen Augenringe betrachtete, die selbst das dicke Make-up nicht verdecken konnte. Aber sie war noch hier! Sie richtete sich gerade auf, drückte die Brust raus, so wie es ihr damals im Ballettunterricht eingebläut worden war. Und nun hatte sie auch noch diesen Plan entwickelt! Diesen verrückten, aber perfekten Plan. Warum war sie nicht schon viel früher darauf gekommen? Denn es war ja genau das, was sie immer hatte tun wollen: Künstler fördern und mit ihnen zusammen sein. Die letzten knapp zwanzig Jahre hatte sie das als Ehefrau und Lebensgefährtin beeindruckender Männer getan. Aber jetzt, mit beinahe vierzig, war es Zeit für einen neuen Lebensabschnitt. Sie würde selbst etwas Besonderes schaffen! Einen Ort, an dem Menschen Kunst hautnah erlebten, sie lieben lernten und ins Nachdenken kamen.
Und schon in knapp vier Wochen würde es so weit sein: Im Swinging London, in der Cork Street Nummer 30, hatte sie passende Räume in der ersten Etage gemietet. Dort würde sie, Peggy Guggenheim aus New York, ihre erste eigene Galerie eröffnen, mit Kunst handeln und sich schon bald einen ausgezeichneten Namen in der Branche gemacht haben. Allerdings! Schon bald wäre sie eine anerkannte Geschäftsfrau. Daran bestand kein Zweifel! Absolut keiner. Und kein Mann würde ihr bei diesem Vorhaben in die Quere kommen, jetzt nicht mehr. Sie war eine erwachsene Frau und konzentrierte sich ab sofort auf ihre Arbeit statt auf Männer.
Peggy schritt kerzengerade hinter dem Kellner über den dicken roten Teppich durch den Saal. Die Blicke der dinierenden Pariser Gesellschaft an den weiß gedeckten Tischen richteten sich durch den Zigarettenqualm auf sie, als offensichtlich wurde, dass sie die Gruppe des großen Schriftstellers ansteuerte, zu der illustre Gäste zählten.
»Peggy!« James Joyce erhob sich, umarmte und küsste sie, die Nickelbrille rutschte von seiner Nase, er richtete sie. James trug eine irische Weste, die er von seinem Großvater geerbt hatte, wie er stolz erzählte, als Peggy ihn auf die besondere Stickerei ansprach. Nora winkte ihr, dass sie neben ihr Platz nehmen sollte. Wie lange waren die beiden nun schon verheiratet? Peggy wusste es nicht mehr. Doch bereits als sie ihnen zum ersten Mal begegnet war, 1923 in Villerville in diesem gruseligen Ferienhaus mit der Badewanne im Keller, das Laurence für sie nach der Geburt von Sindbad gemietet hatte, waren sie unzertrennlich. So unzertrennlich, wie Peggy und Laurence es nie gewesen waren. Außer auf der ausgedehnten Hochzeitsreise, als sie Capri, Ägypten und Israel besucht hatten. Da schon. Aber auf Hochzeitsreisen war das ja auch nicht so schwierig. Nach acht Jahren war es Zeit geworden, sich aus dieser Ehe, dieser Amour fou, zu befreien. Überfällig und richtig, bestärkte sich Peggy wieder einmal. Laurence hatte ihr zwei wunderbare Kinder geschenkt, das war gewiss, und diese beiden wollte sie auch nie und nimmer missen. Er hatte sie zu Beginn ihrer Ehe mit seinem blonden Strandjungen-Look und seinem Charme verzaubert und sie in die Pariser Künstlerszene eingeführt. Aber als seine Karriere nicht voranging und er immer frustrierter wurde – als die Tritte, Schläge, Wutanfälle überhandnahmen –, da hatte sie das einzig Richtige getan und war gegangen. Bedauerlicherweise war die Scheidung sehr teuer für sie geworden, die Berichterstattung in der Presse schmerzhaft. Und die Kinder hatte man aufgeteilt: Sindbad zu Laurence und Pegeen zu ihr. Wie gut, dass sie die Schlammschlacht von ihnen weitestgehend hatten fernhalten können, weil ihre Lebensmittelpunkte inzwischen die Internate waren. Nein, es hatte keine andere Möglichkeit gegeben. Schließlich hatte sie sich befreien müssen. Sie hatte ihre Würde – und vermutlich auch ihr Leben – retten müssen.
Peggy verdrängte die traurigen Erinnerungen und zwang sich zu einem Lächeln, als sie endlich neben Nora Platz nahm, die wie immer etwas plump und gewöhnlich aussah. Auch der knallrote Lippenstift auf ihrem schlaffen Mund und die frische schwarze Farbe in ihrem störrischen Haar konnten nichts daran ändern. Dass diese Frau das Vorbild für Joyce’ berühmteste Frauenfigur Molly Bloom sein sollte, war ihr nach wie vor unbegreiflich. Sofort fing Nora an, von James’ Gedichtsammlung zu erzählen, die dieses Jahr erschienen war. James stoppte sie, indem er das Glas erhob.
»Auf diesen Abend, den wir mit lieben Freunden in Frieden verbringen dürfen, auch wenn die Welt um uns herum anfängt, verrückt zu spielen. Solange wir können, trinken wir: Auf die Liebe, auf die Worte, auf Paris!«
»Auf die Liebe, auf die Worte, auf Paris!«, erklang es aus den zehn Kehlen am Tisch, die alle offenbar zu trocken waren. Jeder stürzte den Champagner hinunter.
Aus dem Grammofon sang Fred Astaire »They Can’t Take That Away From Me«, und Peggy nahm sich die Zeit, die übrigen Gäste näher zu betrachten. Die Martins kannte sie. Nette Menschen aus Devon, mit denen sie und Laurence bereits an der Côte d’Azur geurlaubt hatten. Aber wer war das? Ihr genau gegenüber? Der junge Mann, er mochte vielleicht so um die dreißig sein, kam ihr vage bekannt vor. Er war hager und offenbar sehr groß, soweit sie das im Sitzen erkennen konnte. Sein billiger französischer Anzug beulte und hatte abgeschabte Ellenbogen. Aber er trug ihn mit der Eleganz eines Marquis aus einer anderen Zeit. Die schwarzen üppigen Haare hatte er offenbar mühsam mit Zuckerwasser gebändigt. Die blauen Augen über der scharfen Nase schauten traurig aus einem erstaunlich ernsten Gesicht für seine jungen Jahre. Sein Blick war in die Ferne gerichtet, und seine Gedanken schienen sich mit schwerwiegenden Dingen zu beschäftigen, jedenfalls nicht mit dem Studium der Speisekarte, die er in der Hand hielt.
»Peggy, du kennst sicherlich unseren Freund Sam«, sagte Nora, die ihren Blick wohl bemerkt hatte. »Samuel Beckett, James’ guter Bekannter und Helfer? Ich glaube, ihr hattet schon das Vergnügen.«
Peggy nickte ihm zu, und da fiel es ihr wieder ein. Der junge Mann korrigierte für Joyce Druckfahnen und erledigte Korrespondenzen. Sie hatte von ihm gehört, und vor ungefähr zehn Jahren war er bei einer Party bei ihr und Laurence in der Avenue Reille dabei gewesen, im Schlepptau der Joyce. Damals noch ein halbes Kind, Herrgott! Deshalb hatte sie ihn als Mann nicht wahrgenommen. Aber jetzt! Himmel hilf! Wie er sich zurücklehnte und rauchte, als ob ihn das alles hier nichts anginge. Famos!
»Was macht die Kunst?«, fragte Nora, nachdem sie ihre Speisekarte zugeklappt hatte.
Natürlich war das keine ernst gemeinte Frage. Niemand wusste bislang von Peggys Plänen. Es war reine Höflichkeit, dass Nora sich erkundigte, was in ihrem Leben los war, vielleicht sogar Mitleid. Denn was war das für ein Jahr gewesen! Nicht nur, dass sie noch immer unter der Scheidung und der Trennung von ihrem Sohn litt – auch ihre Mutter war im November verstorben. Sie schob die Bilder von den schwarz gekleideten Menschen bei der Beerdigung in New York, von der sie gerade erst zurückgekehrt war, mit Vehemenz beiseite. Fünfundzwanzig Jahre hatte ihre Mutter ihren Vater überlebt. Ein Schauder stieg in Peggy auf, als sie an die Umstände seines ungewöhnlichen Todes dachte, der die Familie damals mehrere Jahre gelähmt hatte. Schnell griff sie nach der Champagnerschale und nippte an dem perlenden Getränk. War es denn nicht endlich einmal Zeit für glücklichere Umstände?
»Was meinen Sie, was eine Frau glücklich macht, Peggy?«, fragte auf einmal James mitten in ihre Gedanken hinein, als ob er sie gelesen hätte. »Sind es Kinder, Kleider, Autos oder Männer?« Er lachte schon über seinen eigenen Scherz. Aber ganz so unernst hatte er das wohl gar nicht gemeint.
»Es sind die Zeiten im Leben, in denen sie mit sich und ihren Entscheidungen vollkommen im Einklang ist«, sagte Peggy prompt und stellte das leere Champagnerglas auf das Tischtuch.
Ein kleines Lächeln erschien auf dem traurigen Gesicht ihr gegenüber. Nur ein kleines, aber Peggy hatte es gesehen.
»Haben Sie denn in diesem Jahr Entscheidungen getroffen, die Sie glücklich machen?«, fragte Joyce weiter.
Peggy nickte. »Eine sehr wichtige: Ich werde im Januar eine Galerie für moderne Kunst in London eröffnen.« Sie fingerte eine Zigarette aus dem Elfenbein-Etui und ließ sich von James Feuer geben.
»In London, wie deprimierend«, sagte Nora. »Und dann auch noch ganz alleine?«
»Wie meinen Sie?« Peggy zog die Augenbrauen hoch und blies den Rauch aus. Hoffentlich meinte Nora es nicht so, wie es klang.
»Na, Sie als Frau?«
Natürlich hatte sie es so gemeint. Nora war eben doch so plump, wie sie aussah. »Das sollte doch wohl kein Hinderungsgrund mehr sein heutzutage«, entgegnete Peggy.
Nora verzog das Gesicht. »Also, ich bin der Meinung, der Platz einer Frau ist an der Seite eines hart arbeitenden Mannes.« Sie streichelte über James’ Arm.
Der nahm ihre Hand, wandte sich aber dann an Peggy: »Meinen herzlichen Glückwunsch. Wen stellen Sie aus?«
»Jean Cocteau ist der Erste.« Wie gut es sich anfühlte, das sagen zu können. Schließlich war der verrückte Universalkünstler in aller Munde. Und regelmäßig in den Skandalspalten der Zeitungen.
Joyce kaute an seinem Baguette, das der Kellner soeben gebracht hatte. »Cocteau? Alle Achtung. Wie ist Ihnen denn das gelungen?«
»Marcel hat mir geholfen.«
»Duchamp? Sie hat er also auch unter seine Fittiche genommen?« Er lächelte. »Sein Gemälde Akt, eine Treppe herabsteigend war mit dieser perfekten Illusion von Bewegung natürlich tatsächlich genial, seine Fountain provokant und wegweisend, das muss ich zugeben. Aber dass er sich nach diesen Treffern gleich als schaffender Künstler zur Ruhe setzt, finde ich ein wenig befremdlich.« Er lachte. »Dafür ist er ja nun sehr bewandert in der Förderung des weiblichen Kunstszene-Nachwuchses, wie man hört.«
Peggy bog den Rücken durch. »Er ist mein Berater. Mehr nicht.«
Wenn Joyce wüsste, wie lange sie den alten Freund schon kannte; seit wann genau konnte sie gar nicht mehr sagen. Irgendwann in den Zwanzigerjahren war er bei einer Party aufgetaucht, zusammen mit einer ihrer Bekannten. Inzwischen hatte er wohl mit fast all ihren Freundinnen geschlafen, auch wenn er kurzzeitig mit dieser armen, reichen, hässlichen Erbin verheiratet gewesen war. Wie hieß sie noch gleich? Egal. Jedenfalls – sie und Marcel? Niemals.
Die blauen Augen des jungen Mannes fixierten sie über den Tisch hinweg unter Rauchkringeln. Benny Goodman und Ella Fitzgerald sangen »Goodnight My Love«.
»Natürlich nicht.« Joyce goss sich und Nora Wasser nach.
Das war immer so, Peggy hatte das schon beobachtet. Familie Joyce blieb stets verhältnismäßig nüchtern und betrachtete das zunehmende Chaos um sich herum mit einer gewissen Distanz. Nur einmal hatte sie James sturzbetrunken erlebt, in seiner Wohnung am Square de Robiac. Dort allerdings hatte er randaliert und auf den Trümmern der Möbel getanzt und verdorbene Lieder gesungen.
»Ich meine gehört zu haben, dass Cocteau nur noch vor sich hindämmert?«, sagte er nun.
»Aber nein, mitnichten«, rief Peggy, vielleicht ein wenig zu laut. Denn ganz falsch lag James mit seiner Vermutung nicht.
»Du nimmst Cocteau«, hatte Marcel mit fester Stimme gesagt und den Fuchskragen seines Mantels gegen den Wind hochgeschlagen, als sie nach einem gemeinsamen Lunch am Ufer der Seine entlangspaziert waren. Es war so erleichternd gewesen, in ihm nun einen Freund an der Seite zu wissen, der sie unterstützte und in die Welt der modernen Kunst einführte. Denn obwohl Peggy seit Jahren im Freundeskreis von Surrealisten, Expressionisten und Dadaisten umgeben war, gehörte ihr Herz doch der klassischen Malerei. Wie hatte sie als Jugendliche die Touren durch die europäischen Museen genossen, die die Eltern mit ihr, Hazel und Benita unternommen hatten. Sie hatte sie alle im Original gesehen, die alten Meister: Rembrandt, Turner, van Gogh, Monet, Tizian. Und sie liebte sie nach wie vor. Marcel hatte sie in den letzten Monaten mit dem Unterschied zwischen Surrealismus und abstrakter Malerei vertraut gemacht, hatte ihr viele seiner Künstlerfreunde vorgestellt. Sie hatte sich sogar bei einem Besuch im Atelier spontan in eine dieser hübschen Bronzeskulpturen von Arp verliebt und sie auf der Stelle gekauft. Die zarte erste Liebe zur modernen Kunst war also aufgekeimt. Aber jetzt gleich Cocteau?
Peggy schüttelte heftig den Kopf.
»O ja«, sagte Marcel. »Den oder keinen. Er ist genau der Richtige für die Eröffnung. Mensch, Mädchen, du brauchst ein wenig scandal in deinen Räumen. Sollen die Leute sich zu Tode langweilen?«
»Aber Cocteau!« Peggy wand sich. »Doch nicht Cocteau!«
»Aber ja!«
Tags darauf hatten sie ein verräuchertes Zimmer im zweiten Stock eines Hotels an der Rue de Cambon betreten. Cocteau lag im King-Size-Bett und rauchte etwas, das angenehm roch, wie Peggy fand, bis ihr Marcel hinterher erzählte, es sei Opium gewesen. Vor dem Bett stehend stupste sie Marcel an, der glücklicherweise das Sprechen übernahm. Als er geendet hatte, wälzte sich der Meister auf die andere Seite, drapierte das Kopfkissen um und nickte. Eine Ausstellung in Peggys kleiner neuer Galerie in London, das sei nach seinem Geschmack, würde sie denn die Bettlaken nehmen?
Erschrocken schaute Peggy wieder zu Marcel, der mit ein paar Nachfragen das Rätsel löste: Es ging um zwei Betttücher, auf die Cocteau erst kürzlich einige explizite Szenen mit der Feder gezeichnet hatte. Sie seien ihm äußerst wichtig, ein Ausdruck seiner neuen Schaffensphase. Sie müssten mit. Ohne die Bettlaken ginge es nicht. Sie müssten nach London!
Das hatte der britische Zoll am Flughafen in Croydon am Tag des Transports zunächst ein wenig anders gesehen. Peggy hatte bei der Anhörung insistiert, dass antike Kunst ebenfalls solche Szenen zeige und dass diese das englische Königreich sicherlich schon des Öfteren beehrt hätte. Die Zollbeamten hatten genickt, aber weiterhin Anstoß genommen an der akkuraten Darstellung der Schamhaare. Schamhaare reisten nicht nach England ein und belästigten die Öffentlichkeit. God save the King!
Nach fast einstündiger Verhandlung war Peggy auf die Idee gekommen zu behaupten, sie würde die Bettlaken nur in ihren privaten Räumen zeigen.
Erleichtert hatten die Beamten die Papiere abgestempelt.
Cocteau höchstselbst wollte zum Hängen in der Galerie anreisen, hatte er angekündigt. Peggy hoffte, dass er es nicht schaffen würde. Marcel würde viel freier und besser agieren, wenn Cocteau nicht nörgelnd daneben stand. Aufgeregt sah sie den noch leeren Raum mit den hohen weißen Wänden an der Cork Street vor sich. Dort würden sich bald die Menschen drängen, um ihr, Peggy Guggenheim, Kunstwerke abzukaufen. Das würden sie doch, oder?
»Würden Sie mir wohl einmal den Salzstreuer reichen?«, sagte Samuel Beckett von der anderen Tischseite. Seine traurigen Augen waren auf Peggy gerichtet. Sie hatte beobachtet, dass er bereits zwei Gläser Champagner getrunken hatte sowie einen Brandy, den er sich zwischendurch bestellt hatte. Offenbar führte das nun zur plötzlichen Gesprächigkeit. »Sie träumen wohl gerne?«, fragte er auch noch hinterher, vermutlich weil sie, als sie über Cocteau nachgedacht hatte, so lange geschwiegen hatte.
Sie nahm sich zuerst selbst den Streuer und würzte. »Träumen ist das Wichtigste im Leben, finden Sie nicht?«
»So?« Er lächelte und schob sich ein Stück Foie gras in den Mund.
Sie nickte so heftig, dass ihr Ohrgehänge schaukelte. »In der Tat. Ohne Träume sind wir doch tot.«
Er kaute, seine Augen wurden wieder dunkler. Schon war er nicht mehr in diesem Raum.
Was war los mit diesem Mann? Peggy versuchte, ihn wieder in die Wirklichkeit zu holen, und drückte ihm den Salzstreuer in die Hand. Ihre Finger berührten sich kurz. »Es fehlt Ihnen wohl die Würze heute Abend?«
Die Augen kamen zurück und lächelten mit kleinen Falten rundherum. »Die Würze ist nicht die Hauptsache an einem Essen. Entscheidend ist doch das Dessert, finden Sie nicht?«
Schnell beugte sie sich über ihre eigene Foie gras. Ihr Herz, das sich schon zur Ruhe gesetzt hatte, wollte wieder schneller schlagen. Sie zwang sich, nichts Frivoles zu antworten. Sie würde diesen Beckett nicht reizen. Er sollte sie in Ruhe lassen, verdammt nochmal. Sie war jetzt eine Geschäftsfrau und interessierte sich nicht mehr für Männer. Punkt.
»Was schreiben Sie gerade?«, begab sie sich deshalb auf ein vermeintlich unverfängliches Gebiet, denn sie erinnerte sich jetzt auch, gehört zu haben, dass er selbst ein aufstrebender Schriftsteller war und Joyce ihn förderte.
Er lehnte sich zurück und schob den leer gekratzten Vorspeisenteller von sich. »Ich rede nicht gerne über meine Arbeit.«
Peggy lachte. »Ein Mann, der nicht gerne über seine Arbeit spricht?«
Er antwortete nicht. Die blauen Augen schauten nach innen. Er war wieder weg.
Peggy seufzte und wandte sich nach links. Dort saß Djuna und hatte bereits eine Batterie von leeren Gläsern vor sich stehen. Champagner, Brandy, Likör, alles durcheinander. Die Kellner waren wirklich nicht die schnellsten beim Abräumen. Peggy nahm Djunas Arm und drückte ihn.
»Wie verkauft sich Nachtgewächs? Sind Faber und Faber zufrieden?«, fragte sie. Es hatte sie so gefreut, als der zweite Roman der Freundin bei dem Verlag angenommen worden war. Immerhin war er größtenteils in einem Rokokogästezimmer im ersten Stock von Peggys ehemaligem Landhaus Hayford Hall in Devon entstanden.
Djuna winkte ab. »Erzähl mir lieber, was du noch in London geplant hast. Wer arbeitet für dich außer Marcel? Das kannst du doch nicht alles allein hinkriegen. Die ganze Administration und so weiter.« Sie griff nach dem Brandyglas und hielt in der Bewegung inne, als sie feststellte, dass es leer war.
»Wyn hilft mir.«
»Die Henderson?« Djuna lachte, der kunstvolle Seidentuchturban, den sie um ihre dunklen Haare gewunden hatte, bebte. »Ist das dein Ernst?«
»Sie ist sehr kompetent, kann gut mit der Presse umgehen und mit zahlungskräftiger Kundschaft auch. Sie ist perfekt für den Job.«
»Aber, meine Liebe, sie passt noch nicht mal auf einen normalen Stuhl, geschweige denn auf ein Foto.« Djuna winkte dem Kellner, der gerade vorbeikam, und deutete auf ihr Brandyglas.
»Dafür ist sie stets klar im Kopf«, schoss Peggy zurück und erntete einen giftigen Blick von Djuna, die aufstand und zur Toilette wankte.
Peggy seufzte und sah ein Lächeln auf Becketts Gesicht, bevor er sich tief über sein Bœuf Bourguignon beugte.
Die Crêpes Suzette wurden hinter Peggys Rücken flambiert; sie spürte die Wärme der offenen Flammen und sah der Arbeit des Kochs über den Spiegel hinter Beckett zu; aber Beckett und die Crêpes waren bei Weitem nicht das Heißeste im Raum. Über das Bœuf Bourguignon hinweg war es zu einem Streit zwischen Joyce und Mr. Martin gekommen. Es ging um die Frage, ob die Deutschen mit diesem Verrückten an der Spitze, der in diesem Jahr die Werke der Expressionisten, Dadaisten und Surrealisten aus den deutschen Museen hatte verbannen lassen, in nächster Zeit einen Krieg anzetteln würden. Joyce hatte mit der Wassertrinkerei heute Abend schnell aufgehört, und nun war es gut, dass der Tisch zwischen den Männern stand. Sonst wären Fäuste geflogen. Jeden anderen Gast und seine Gesellschaft hätte man ab einer gewissen Lautstärke sicherlich vor die Tür gesetzt. James Joyce aber durfte bleiben.
»Schmeckt Ihnen das Dessert?«, wandte sich Peggy schnell an Beckett, weil Djuna immer noch nicht von der Toilette zurückgekehrt und Nora ganz auf den erregten Joyce fixiert war. Vielleicht sollte sie einmal nach Djuna schauen und entkäme so der leidigen Diskussion?
»Sehr gut, danke der Nachfrage«, antwortete Beckett höflich durch den Lärm zurück, bevor er ihr wieder seinen gezuckerten Haarschopf zeigte.
Warum war er so wortkarg? Das war ja grauenvoll, dachte Peggy, die inzwischen ihren vierten Champagner leerte. Ein so wunderschön aussehender junger Mann in seinen besten Jahren – so voller Komplexe? Wie kam das? Sie sah, wie Joyce und Martin sich über den Tisch hinweg die Hand reichten; die Sache war offenbar erledigt. Peggy genoss nun den Geschmack von Orangenlikör und Zucker auf der Zunge. Die Marlene-Hose spannte in der Bauchregion etwas, stellte sie fest, vielleicht hätte sie auf den Nachtisch verzichten sollen. Aber, erinnerte sie sich, das war doch auch völlig egal. Sie wollte ja niemanden beeindrucken. Schon gar keine Männer. Zumindest nicht jetzt, in der Anfangsphase ihrer neuen Karriere. Darauf galt es sich schließlich zu konzentrieren. Nur darauf. Sie legte das Dessertbesteck auf den Tellerrand und lehnte sich zurück.
Beckett auf der anderen Seite des Tisches tat es ihr gleich, ohne den Blick von der Tischdecke zu heben, und zündete sich eine Zigarette an.
Die Gesellschaft verabschiedete sich auf dem Trottoir vor dem Fouquet’s von den Joyce. Der Schneeregen hatte aufgehört, die Luft war frisch, klar und kalt. Peggy wollte durch die Avenue Georges V zu der Wohnung von Freunden schlendern, die verreist waren und ihr das Heim für das Wochenende überlassen hatten. Ihre eigene Wohnung hatte sie längst gekündigt. Wie würde sie die Stadt vermissen, wenn sie bald in London arbeitete! Tränen stiegen in ihr auf. Es waren die schönsten und die schlimmsten Zeiten gewesen, die sie hier verbracht hatte, dachte sie, als sie Schritte hinter sich hörte und plötzlich Beckett neben sich hatte.
»Ich begleite dich nach Hause«, sagte er bestimmt und verzichtete auf das förmliche Sie. Ihr Bauchgefühl, das sie am Anfang des Abends gehabt hatte, hatte sie also nicht getrogen.
Er fasste ihren Arm und führte sie galant durch die Pariser Nacht. Nur noch wenige Automobile fuhren in der Straße an ihnen vorbei. Die Schaufenster der Boutiquen und Interieur-Läden waren längst erloschen. Die Straßenlaternen sandten Lichtkegel auf die Bürgersteigplatten. Der Schnee hatte Pfützen hinterlassen, um die herum sie lachend und sich an den Händen haltend balancierten. Beckett erzählte nun doch von seiner Arbeit und bat sie, seine Gedichte und den Roman Murphy zu lesen, für den er Anfang Dezember nach vierzig Absagen endlich einen Verleger gefunden hatte. Sie versprach, es zu tun.
So erreichten sie die Rue de Lille. Vor ihrer Haustür blieb sie stehen, er schaute sie nur stumm an. Sie schloss auf, er folgte ihr die Stufen in den zweiten Stock hinauf. Das Glas Wodka, das sie ihm noch anbot, landete auf dem Boden und zersplitterte, als er sie gegen die Wand drückte und küsste.
Kapitel 2
»Guten Morgen.« Sanft streichelte sie über seine störrischen schwarzen Haare, die auf dem gestärkten Leinenkopfkissenbezug so wunderbar zur Geltung kamen.
Er öffnete ein Auge und schaute durch das Zimmer, als ob er nicht ganz sicher sei, wo er war. Dann verzog sich sein Mund zu einem Lächeln. »Bonjour, ma belle.« Er zog sie zu sich heran und küsste sie sanft. »Schon wach? Du hast doch gesagt, man kann nie genug träumen.«
»Ich hätte da noch einen Traum. Einen Tagtraum.« Sie ließ ihre Hand unter der Bettdecke über seine behaarte Brust nach unten wandern.
Er lachte und hielt die Hand fest. »Ich bin ein irischer Hugenotte, weißt du. Wir übertreiben nichts.«
»Du meinst, mit deinen katholischen Landsleuten würde ich besser fahren?«
Er lachte. »Vermutlich.«
Sie befreite ihre Hand aus seinem Griff. »Die reizen mich aber nicht. Allein du bist für mich interessant. Warum schauen deine Augen stets so traurig?«
Er stopfte das Kissen gegen die Wand und lehnte sich an. »Wer könnte nicht trauern, bei allem, was in der Welt passiert.«
Peggy lachte. »Herr Nachwuchsschriftsteller, Sie klingen wie ein frustrierter Greis. War denn früher alles besser?«
Er lächelte kein bisschen. »Ich habe die letzten zwei Jahre in Deutschland gelebt und bin viel gereist. Ich habe gesehen, wie die modernen Bilder von den Museumswänden in Hamburg, Berlin und München genommen und in die Kellerdepots getragen wurden, habe geschaudert bei diesem ewigen ›Heil Hitler‹ allerorts. Da braut sich was zusammen. Und es ist leider kein Bier. Obwohl die das so gut können.«
Sie schwieg und betrachtete seine Augen, die gerade aus dem Zimmer hinaus in die offensichtlich finstere Welt blickten. Er war also ernsthaft besorgt. Aber es lag noch etwas Tieferes in diesem Blick. Und das machte ihr viel mehr Angst: Schwermut. Unendliche Schwermut.
Mit einem Ruck setzte er sich plötzlich auf, die blauen Augen kehrten zu ihr zurück. »Gibt es hier keinen Champagner?«
Erleichtert verließ sie nackt das Bett, um in der Küche nach dem Gewünschten zu suchen. Schließlich fand sie einen guten alten Veuve und kehrte mit zwei Gläsern zu Beckett zurück. »Dein Roman ist doch endlich angenommen worden. Wenn das kein Grund ist, die Schwermut hinter sich zu lassen und ab jetzt nur noch die Korken knallen zu lassen.«
»Ganz genau. Das wird jetzt zu meiner neuen Lieblingsbeschäftigung.« Er trank den ersten Schluck. »Aber um ehrlich zu sein, sieht mein Leben hier ein wenig anders aus. Ich hause, seit ich vor ein paar Wochen in Paris angekommen bin, im nicht eben sicheren und hygienisch etwas fragwürdigen Hotel Liberia in Montparnasse und leiste mir eine einzige Mahlzeit am Tag. Die aber sehr ausgedehnt und in einem Café, weil da immerhin geheizt ist.«
Peggy schmunzelte. »Und ansonsten machst du Arbeiten für Joyce und schreibst selbst etwas Neues?«
»No comment.« Er schenkte sich und ihr Champagner nach. »Erzähl mir lieber von deinem Leben.« Er ließ ein wenig Champagner auf ihren Bauchnabel perlen.
Sie lag ganz still, nur die Bauchdecke zuckte leicht. »Was willst du wissen?«
Er beugte sich vor, um den Champagner abzulecken. Sie musste sich sehr beherrschen, um ihn nicht an sich zu ziehen. Die Stuckdecke des alten Appartements hatte viele verstaubte Rosetten, stellte sie fest und klammerte sich an das Laken.
»Ich will alles wissen: woher du kommst, wohin du gehst, was du denkst.« Er küsste sich vom Bauchnabel in Richtung Hals vor.
»Wenn es nach meinem Elternhaus gegangen wäre, wäre ich seit knapp zwei Jahrzehnten eine Upper-East-Side-Ehefrau mit fester Hutmacherin, die Teegesellschaften gibt und auf ihren sie stets betrügenden Ehemann wartet.«
»Wie grausam realistisch.« Er küsste ihre Brustwarze.
»Naturalistisch eher. Meine Mutter hat nämlich genauso gelebt, weißt du. Bis die Geliebte meines Vaters die Gangway der RMS Carpathia herunterkam, auf der die Titanic-Überlebenden geborgen worden waren. Du weißt ja: Frauen und Kinder zuerst. Ein überlebender Steward hat uns später berichtet, wie Vater und sein Diener die Schwimmwesten ablegten, sich ihre feinsten Anzüge anzogen und im Salon Platz nahmen, als das Schiff bereits erhebliche Schlagseite hatte.«
Sam lachte nicht mehr und hörte auf zu küssen.
Sie zog sein Gesicht wieder an ihren Busen. »Wirst du wohl?«
Er grinste und setzte seinen Weg fort.
»Ich jedenfalls fand es daraufhin entschieden bodenständiger, mich mit Dadaisten, Surrealisten und jungen irischen Schriftstellern hier in Paris herumzuschlagen. Und nun schicke ich mich also an, reichen Engländern abstrakte Kunst in London anzudrehen.«
»Wie vernünftig von dir.« Seine Küsse erreichten ihren Mund und ließen sie verstummen. Er stieß gegen die Champagnerflasche; sie rollte vom Bett und ergoss sich auf dem Parkett.
»Kann man mit Ihnen auch ernsthaft reden, Madame Guggenheim? Also länger als fünf Minuten, bevor Sie wieder über mich herfallen«, sagte er eine halbe Stunde später.
»Ich? Wer war denn das eben?«
Er lächelte und streichelte ihr über den Nasenrücken. Ausgerechnet. Sie hasste sie so sehr, diese Nase, und musste sie doch jeden Tag sehen, seit die Schönheitsoperation vor mittlerweile beinahe zwanzig Jahren misslungen war. Sie hatte sich nicht getraut, einen zweiten Versuch zu unternehmen nach diesen Schmerzen, dieser Schmach. Sie stoppte seine Hand und setzte sich auf. »Der Champagner ist wohl leider aus.«
»Und jetzt?«
»Ich schlage vor, du holst neuen, unten im Café an der Ecke.« Sie zog einen Schein aus ihrem Handtäschchen und hielt ihn hoch.
»Wird erledigt«, rief er und stand auf.
»Und bring gleich ein paar Croissants mit.«
»Lieber Sandwiches, non?« Er sprang in seine Hose und war im nächsten Augenblick aus der Tür.
Peggy rutschte in die Horizontale. Trüber Schneehimmel hing draußen vor dem Fenster über der Stadt. Noch vor ein paar Wochen hätte dieses Wetter perfekt zu ihrem Leben gepasst. Jetzt nicht mehr! Sie hatte einen Liebhaber, einen sehr feschen jungen Schriftsteller. Gut, besonders erfolgreich war er nicht. Sie musste seinen Murphy wohl mal lesen, wenn er endlich herauskam. Aber er war so irisch, so groß, knurrig und verwegen.
Und dabei war er noch nicht mal das Beste an ihrem neuen Leben. Das war eindeutig die Galerie, die sie in weniger als vier Wochen eröffnen würde. Wyn hatte den perfekten Namen gefunden: Guggenheim Jeune. Wie frisch, neu und französisch das klang. Genau das Richtige für London und seinen versnobten Geldadel. Wie schön der Briefkopf und das Logo aussahen, das Wyn entworfen hatte. Gut, dass sie die alte Freundin gebeten hatte mitzumachen. Als gelernte Schriftsetzerin wusste sie eben genau, wie Druckerzeugnisse heutzutage auszusehen hatten. Besonders die so wichtigen Kataloge würde sie hervorragend gestalten, da war Peggy sich sicher. Und auch mit den Kunden würde Wyn einwandfrei umgehen, schließlich kannte sie sich in der gehobenen Gesellschaft aus.
Dass sie ein paar Kleidergrößen mehr hatte, als en vogue war, konnte dabei überhaupt nicht schaden. Schließlich waren die meisten Gattinnen der Kaufinteressenten vom selben Kaliber und fühlten sich dann vielleicht eher wohl, als wenn dort nur Hungerhaken wie Djuna oder sie selbst herumliefen. Sie hielt ihren Arm hoch und betrachtete die knochige Hand und die Elle, die sich deutlich unter der Haut abzeichnete. Der Kummer der letzten Wochen nach dem Tod ihrer Mutter hatte ihr noch weniger Appetit beschert als sonst. Sie sollte wohl mal wieder eine Köchin einstellen in London. Immer nur die paar Happen in den Cafés zwischen den Gesprächen, das genügte nicht. Jetzt, wo sie als Geschäftsfrau täglich präsent und auf der Hut sein musste. Die Konkurrenz in London war raubtierhaft – besonders in der Cork Street, der alten Galeriestraße in Mayfair.
Sie angelte nach ihrem Handtäschchen, zog die Gauloises heraus – wo war nur die Zigarettenspitze, sie musste sie im Fouquet’s liegen gelassen haben – und steckte sich eine an. Es war wirklich großes Glück gewesen, dass sie ausgerechnet in der Cork noch eine Fläche hatte ergattern können. Natürlich war das allein Wyns Hartnäckigkeit zu verdanken. Und ihrer eigenen. Was hatten sie sich die Hacken abgelaufen.
Ihr Magen knurrte und übertönte ihre Gedanken. Wann Sam nur mit den verdammten Sandwiches kam? Sie blickte auf ihre schmale goldene Armbanduhr. Viel Zeit hatte sie nicht mehr. Schließlich musste sie zum Essen mit Jean Arp, den sie für eine Skulpturenausstellung im Frühjahr gewinnen wollte. Was war das aber auch für eine schöne kleine Bronzestatue, die sie von ihm gekauft hatte. Sie hatte sie eigentlich nur betrachten wollen, neulich beim Besuch mit Marcel im Atelier, aber Arp hatte sie ihr in die Hand gegeben. Und ab dem Moment, wo sie das kalte, glatte Material so weich und perfekt geformt unter ihren Fingerkuppen gespürt hatte, war es um sie geschehen. Sie hatte sie haben müssen. Aber ab sofort würde sie selbstverständlich nichts mehr selbst kaufen. Schließlich wollte sie doch nicht sammeln, sondern handeln und Geld verdienen. Kunst sammeln, das war doch etwas für die Super-Superreichen. Zu denen sie nun mal nicht zählte. Onkel Salomon und die anderen Brüder ihres Vaters hatten nach dessen Tod ihr Erbe zwar so solide und langfristig angelegt, dass sie ihr Leben lang in keiner Weise am Hungertuch nagen würde. Es reichte für einen sehr komfortablen Lebensstil, den das Gros der Leute wohl als Luxus bezeichnet hätte. Aber für Eskapaden blieb dennoch kein Platz. Die einzigen Extravaganzen, die sie sich leistete, waren, dass sie einige Künstlerfreunde so wie Djuna mit monatlichen Stipendien bedachte. Und natürlich nun ihre Galerie. Wobei diese selbstverständlich schon in Kürze schwarze Zahlen schreiben würde. Gar kein Zweifel.
Onkel Salomon in New York hingegen, der sammelte wirklich. Besonders seit er diese deutsche Geliebte hatte, Hillachen. Baronesse Hilla Rebay von Ehrenwiesen, konnte man denn ernsthaft so heißen? Sie würde Onkel Sol mit ihrem Ehrgeiz und ihrem schlechten Geschmack schon noch das ein oder andere faule Ei in die Sammlung legen. Die beiden schickten sich nun sogar an, ein eigenes Museum aufzumachen. Sinnvoll wäre es sicher, denn die vielen Kunstwerke passten nicht mehr in seine Achtzimmersuite im Plaza Hotel, und auch die Räume, die er eigens dafür in der Carnegie Hall angemietet hatte, wurden zu klein. Regelrechte Kauforgien hatten die beiden in Europa veranstaltet. Wie man hörte, sollte Sol inzwischen an die fünfzig Kandinskys besitzen, hatte den Maler eigens in Dessau am Bauhaus aufgesucht.
Sie erinnerte sich an eine Begegnung mit den beiden in Hillas Atelier in New York, vielleicht vor fünf Jahren. Hilla malte damals noch selbst. Ihre zugegebenermaßen nicht mal schlechten Porträts in Öl lehnten an den Wänden, darunter auch eines von Salomon – möglicherweise dasjenige, in dessen Erschaffungsprozess die junge Malerin zur Geliebten des Onkels geworden war.
Hilla hatte ein Tuch um die Haare geknotet und Ölfarbe an den Fingern und bot Peggy einen Drink an. Während Onkel Sol den Arm um die Schultern seiner »Lieblingsnichte«, wie er Peggy nannte, gelegt hatte, berichtete Hilla von der wachsenden Sammlung und ihren Plänen, sie der Öffentlichkeit permanent zugänglich zu machen. Die New Yorker Bürger und die Besucher der Stadt sollten die Möglichkeit bekommen, die Kunstschätze täglich zu erleben. Der Erfolg, den die Erbinnen Rockefeller, Bliss und Sullivan mit dem Museum of Modern Art schon seit 1929 hatten, schien sie dabei anzustacheln. Das Gebäude für das Museum sollte allein schon ein Kunstwerk werden. Sie stritten noch, welcher Architekt beauftragt werden sollte, welchen Stil sie wählen wollten, um bereits die Behausung der Sammlung zu einem Wahrzeichen der Stadt zu machen.
Peggy hatte während der angeregten Diskussion im Atelier herumgeschaut. Das Handwerk beherrschte Tante Hilla wirklich gut. Das bewiesen die Porträts. Aber die abstrakten Gemälde, die sie an Miró erinnerten, weckten keinerlei Gefühl in Peggy, blieben leblos und entfachten keinen Zauber.
Nach einer halben Stunde und ohne sich viel nach der Familie oder Peggys Befinden erkundigt zu haben, hatten die beiden sie verabschiedet, weil sie zu einem Spendendinner mussten.
Peggy streifte die Zigarettenasche am Rand des Nachttischchens ab. Aber was gingen sie eigentlich Onkel Sol und Tante Hilla an? Sie würde nun diesseits des Atlantiks ihre eigene kleine Galerie aufbauen und handeln, davon sehr gut leben können und sich in kürzester Zeit einen Namen machen.
Wo blieb Beckett nur? Das Warten ging ihr allmählich auf die Nerven. Hatte er sich festgequatscht an der Bar? Unwahrscheinlich, dass sich einer wie er festquatschte. Eher festgetrunken. Sie warf den Zigarettenstummel in die leere Champagnerflasche und stellte sie ordentlich neben das Bett, als endlich der Schlüssel im Schloss zu hören war und Beckett vor ihr stand. »Voilà, deux baguettes avec du fromage.«
»Aber hoffentlich nicht der olle Stinkekäse aus der Normandie?« Peggy schaute ängstlich auf das Sandwich. »Ich bin mehr für den unverwüstlichen amerikanischen Scheibenkäse zu haben.«
Er lachte und streifte einfach so Hemd und sämtliche Hosen ab, um zu ihr ins Bett zu kommen – und der Hunger war vorerst vergessen.
Vier Stunden später rutschte sie an den Bettrand und verschwand im Badezimmer, um zu duschen und sich anzukleiden. Als sie wieder herauskam, war auch er angezogen, und der schreckliche französische Anzug verhüllte den Körper, der ihr so viel Freude bereitet hatte.
»Es tut mir leid, dass ich los muss, aber Arp hat kein Telefon«, sagte sie. Im selben Moment klingelte dasjenige in der Ecke des Raumes.
Sie hob ab und hörte Nora Joyce’ Stimme: »Ist Sam bei dir? Er ist nicht in seinem Hotel angekommen gestern Abend.«
»Wir sind gerade im Begriff aufzubrechen.«
»Er ist bei ihr!«, hörte sie Nora rufen, offenbar zu James im Hintergrund. »Dann ist gut. Wir waren schon etwas nervös. Man weiß ja nie, was einem jungen Mann in diesem fragwürdigen Quartier nachts alles passieren kann.«
Peggy musste lächeln und schaute zu Beckett, der seinen noch schäbigeren Lammfellwintermantel über den Anzug streifte. Sie hielt den Hörer zu. »Die Joyce haben sich Sorgen um dich gemacht.«
Er zog die Augenbrauen hoch. »Sag ihnen, ich bin wohlauf und komme jetzt zu ihnen.«
Peggy richtete es aus und legte auf. »Bist du ihr Ziehsohn?«
Er lächelte. »Sieht so aus. Irisches Blut, weißt du?«
Sie stiegen die Stufen hinunter und blieben vor der Haustür stehen.
»Danke«, sagte er und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Es war schön, solange es anhielt.«
Damit drehte er sich um und schlenderte die Straße hinunter, die Hände in den Taschen des furchtbaren Mantels versenkt.
Sprachlos blieb Peggy zurück. Was war denn das für eine Verabschiedung? Es war schön, solange es anhielt? Ging er etwa davon aus, dass sie sich nicht wiedersehen würden? Sie blickte ihm immer noch hinterher, bis er um die Hausecke in die Avenue Georges V bog. Dann stampfte sie mit dem Pelzstiefel auf. Wahrscheinlich spukte ihm eine neue Romanidee im Kopf herum, und darum hatte er keinen Platz mehr darin frei, um sich angemessen um menschliche Beziehungen zu scheren. Sie jedenfalls würde nicht aktiv dafür sorgen, dass sie sich wiedersahen. Sie nicht! Das würde sie ihm überlassen. Oder dem Schicksal.
Im Übrigen war ihre Galerie jetzt viel wichtiger als irgendein dahergelaufener Ire, so blau seine Augen auch sein mochten, so aufregend seine Küsse … Ach, zum Donnerwetter! Sie ballte die Fäuste und stapfte in die entgegengesetzte Richtung davon. Sie war eine eigenständige Frau mit einem eigenen Business! Sie würde sich doch jetzt nicht von so einem jungen Bengel aus dem Konzept bringen lassen. Das Business galt es nun zu fördern. Sonst nichts. Gleich würde sie Arp überreden, bei der Frühjahrsausstellung mitzumachen. Und morgen im Café de Flore würde sie Marcel dazu bringen, mit ihr nach London zu reisen und die Cocteau-Ausstellung selbst zu hängen. Schließlich war es die Eröffnung. Da musste alles perfekt sein. Und wer würde solch ein Ereignis besser in Szene setzen können als der Meister der Inszenierung?
Kapitel 3
Boulevard Saint-Germain Nr. 172, Ecke Rue Saint-Benoît, am nächsten Tag
Das Café de Flore war das Café de Flore. Darauf konnte man sich verlassen, dachte Peggy, als sie gegen Mittag an einem der runden Marmortischchen am bodentiefen Fenster Platz nahm und einen Kaffee bestellte. Ein Cafébesuch in diesem Hause war ihr bevorzugtes Medikament gegen Depression. Was brauchte sie Therapie? Sie ging einfach ins Café de Flore, badete zwei Stunden in Kaffeeduft und babylonischem Stimmengewirr, las vielleicht eine internationale Zeitung, bekam ein Kompliment vom Kellner, und schwupp war jeder graue Nebel verschwunden. So auch heute, wobei ohnehin nur vereinzelte irische Nebelschwaden durch ihre Seele waberten. Ansonsten schien die Sonne der Vorfreude – grell geradezu – und passte damit zu dem für die Stadt ungewöhnlich freundlichen Winterwetter vor dem Fenster. Viele Pariser schienen es ausnutzen zu wollen, denn die Trottoirs waren gefüllt mit Paaren, Leuten mit Hunden an der Leine oder Zeitungen unter dem Arm, die in dicke Mäntel gehüllt mit Hüten und Fellmützen dahinflanierten. Vielleicht sollte sie nachher auch einen ausgedehnten Spaziergang unternehmen.
Aber nun betrat erst einmal Marcel das Café. Wobei »betrat« kaum der passende Ausdruck war. Er trat auf! Langsam und milde lächelnd, kopfnickend zu diesem und jenem Bekannten, bahnte er sich in seinem langen Pelzmantel mit dem extragroßen Fuchskragen seinen Weg an den Tischen und Kellnern vorbei, die ihn allesamt begeistert grüßten. Zu Recht, fand Peggy, schließlich hatte dieser Mann, ob man seinen Kleidungsstil mochte oder nicht, früh und radikal die Kunstwelt revolutioniert. Erst mit seinem vor dem Auge des Betrachters wie in Bewegung erscheinenden kubistischen Gemälde Akt, eine Treppe herabsteigend und dann natürlich – sie musste schmunzeln –, als er das handelsübliche Urinal, betitelt als Fountain, 1917 bei der Big Show in New York eingereicht hatte. Die Malerei sei passé, überhaupt die retinale Kunst, wie er es nannte, die Kunst, die nur die Augen erfassten. Er hatte auf der Straße gefundene Alltagsgegenstände wie Schneeschaufeln und Räder von Fahrrädern zu Kunst erklärt, denn der Akt der Konzeption von Kunst sei allein schon zu hinterfragen. Peggy war für sich zu einem anderen Schluss gekommen, aber das tat dem Respekt, den sie Marcel entgegenbrachte, keinen Abbruch. Sie war ihm enorm dankbar, dass er sich ihrer Galerie annahm. Er öffnete ihr die Türen zu vielen Ateliers. Für ihre zukünftigen Ausstellungen in der Guggenheim Jeune waren seine Kontakte das Lebenselixier. Gemeinsam mit Laurence hatte sie hier in Paris in den letzten zwei Jahrzehnten die Künstlerszene kennengelernt. Gemeinsam mit Marcel trat sie nun als Geschäftsfrau in London auf. Wie schön, dass er wie Joyce zu ihr hielt. Vermutlich hatte er Laurence ohnehin nie richtig gemocht – ihn und seine dadaistischen Gehversuche.
Sie beobachtete, wie Marcel nun theatralisch Platz nahm. Der geflochtene Stuhl und der kleine Marmortisch wirkten viel zu simpel, als dass eine Erscheinung wie er daran sitzen könnte. Aber Marcel residierte hier fast jeden Tag, so wie Peggy selbst. Er musste gar keine Bestellung aufgeben, sondern bekam sofort einen Pastis und einen Espresso, in dem er so viel Zucker versenkte, wie das Tässchen es zuließ. »Hat es geklappt mit Arp?«, fragte er statt einer Begrüßung.
»Bien sûr.« Peggy legte ihre schwarz-weiß gemusterte Kaschmirstola ab, denn ihr war warm geworden inmitten des Dampfes der Tassen, Suppen und Gäste. Sie winkte dem Kellner, um einen zweiten von diesen äußerst starken Kaffees zu bekommen. Der erste ließ ihre Beine bereits unter dem Tisch trappeln. Sie sollte nachher wirklich unbedingt einen Spaziergang machen. »Wie sieht’s aus? Kommst du mit mir nach London, um die Ausstellung zu hängen?«
Er nippte am Pastis. Wieder einmal wunderte sich Peggy, dass ihm dieses Bauerngetränk wirklich schmeckte. »Wollte Cocteau das nicht selbst übernehmen?«, fragte er. »Oder geht’s ihm zu schlecht?«
»Hat abgesagt. Auch für die Vernissage. Nur das Vorwort zum Katalog schreibt er.«
»Immerhin.« Marcel schluckte den Espresso und den ganzen Zucker in einem hinunter und winkte sofort nach einem zweiten Espresso, der postwendend vor ihm stand. »Bin dabei. Aber nur, wenn Mary mich begleitet.«
»Unbedingt!« Das würde ein Spaß werden, wenn ihre alte Jugendfreundin Mary Reynolds mitkäme. Sie war die Erste von ihnen gewesen, die damals nach Paris gegangen war, und nun war sie schon seit geraumer Zeit mit Marcel liiert, ohne dass die beiden so gemein bürgerliche Manieren entwickelten, wie sich eine gemeinsame Wohnung zu nehmen.
»Sie lässt dich herzlich grüßen, sie ist in Arcachon für eine Weile, und ich soll dir den Schlüssel für ihre Wohnung geben. Vielleicht kannst du sie als Bleibe für die letzten Tage noch gebrauchen?«
Peggy nahm den Schlüssel entgegen. Das traf sich gut, denn die Freunde, deren Appartement sie jetzt bewohnte, kamen heute Abend wieder, und sie hatte schon befürchtet, in irgendein Hotel ziehen zu müssen. Sie mochte Hotels nicht besonders, hatte sie doch einen Teil ihrer Kindheit im St. Regis an der East 55th Street gewohnt. Heimisch wurde man in solchen Kästen nie, fand sie und schauderte, als sie an die steifen Gänge durch die Hotellobby an der Hand ihrer Mutter dachte, bei denen sie stets zur Ruhe ermahnt worden war und zum Lächeln ermutigt. Wie hatte sie die täglichen Zimmermädchenbesuche gehasst, das Tätscheln über ihre Kinderhaare durch die stets wechselnden Frauen. Wie das unter Silberglocken servierte Essen, das sie und ihre Schwestern schweigend mit einem Kindermädchen eingenommen hatten, während die Eltern bei einer Abendveranstaltung waren.
Sie schob die Gedanken beiseite, zog die Briefbogen der Galerie aus der Tasche und zeigte sie Marcel.
»Perfekt«, sagte er. »Wunderschön geworden.«
»Nicht wahr?« Peggy ließ ihre Fingerkuppe über die erhabene Prägung gleiten.
»Was macht der Katalog?« Er wurde kurz abgelenkt, als eine junge Dame im Hosenanzug an den Tisch trat und Marcel mit Küsschen begrüßte.
Peggy wartete mit ihrer Antwort, bis er sie verabschiedet hatte. »Ist in Arbeit.«
»Deine Wyn ist wahrhaft eine Perle. Das wird eine grandiose erste Ausstellung, von der die britische Hauptstadt noch lange sprechen wird.«
»Was meinst du, wen wir nach Cocteau fragen sollten?«
»Ich denke darüber nach. Hab schon eine Idee und versuche, dir einen Kontakt zu vermitteln.« Er zog Streichhölzer hervor und eine von seinen furchtbaren kubanischen Zigarren, die so stanken.
»Wer ist es? Welche Richtung?«
»Nicht so ungeduldig, junge Dame. Eins nach dem anderen. Jetzt hänge ich dir erstmal den Cocteau.«
Sie umarmte ihn und stand auf. »Schönen Gruß an Mary. Ich muss los.«
»Aber du kommst doch noch zu meiner Vernissage, bevor du abreist?« Er schaute durch die enorme Rauchwolke, die er beim Anzünden produziert hatte, zu ihr hoch.
»Aber natürlich. Wie könnte ich das verpassen?« War er verrückt geworden? Welcher kunstinteressierte Erdenmensch, der zurzeit in Paris weilte, würde sich denn wohl die Eröffnung der Exposition Internationale du Surréalisme entgehen lassen, für die Marcel zwar kein Kunstwerk beigesteuert, die er aber konzipiert und mit André Breton und Paul Éluard auf die Beine gestellt hatte.
»Es wird ein paar Überraschungen geben«, sagte er und lächelte.
»Kommt Dalí wieder im Taucheranzug?«
»Das wäre ja keine Überraschung mehr.«
»Auch wahr.« Sie rückte ihren Hut zurecht und setzte die Sonnenbrille auf. »Adieu, mein Lieber.«
Über das schöne grün-weiße Mosaik mit dem Namen des Cafés trat sie hinaus auf das Trottoir. Ein Abschiedsspaziergang durch Paris, einer der letzten in diesem Lebensabschnitt, der nun vorbeiging, bevor sich eine neue Welt für sie öffnen würde.
Die Stola unter dem Zobelcape eng um sich gezogen, wandte sie sich nach rechts und lief los. Sie freute sich, als sie den exquisiten Blumenladen passierte, in dem sie so oft üppige Mitbringsel für ihre zahlreichen Dinnereinladungen erworben hatte. Sie beobachtete, wie der alte Mann in dem typischen dunkelgrünen kiosque mit der kleinen Kuppel die Schlange abarbeitete und Zigaretten, Zeitungen, Illustrierte und Feuerzeuge herausreichte. Als sie an die Seine trat, roch sie den Fluss und hörte seine leichten Wellen gegen die Steine schwappen. Das Wasser zog sein braunes Band durch die Stadt, die sie so sehr liebte. Natürlich würde sie auch in London klarkommen, dem zukünftigen Dreh- und Angelpunkt der internationalen Kunstszene, wie all ihre Künstlerfreunde versichert hatten, und wo sie mit ihrer jungen Galerie nun mal genau am richtigen Ort war. Aber es war beileibe nicht der Platz auf Erden, der ihr am liebsten war. Würde sie jemals wieder hier leben? In Paris?
Sie hob den Zweig einer Uferbuche auf und warf ihn ins Wasser. Er trieb schnell und unaufhaltsam davon. Sie dachte an Marcels Ausstellung. In Deutschland wäre sie bereits völlig undenkbar. Im Nachbarland, nur wenige Stunden entfernt von hier. Wie absurd das war, wie beängstigend. Schnell drehte sie sich vom Ufer weg und schlenderte durch die Straßen vom Quartier Latin, ohne einem Plan zu folgen. Sie sah die Markisen der Cafés, in denen sie gelacht, getrunken und geküsst hatte. Die Schaufensterpuppen in den Auslagen der Boutiquen, in denen sie Kleider und Hüte für Empfänge und Partys gekauft hatte. Die Apotheke mit ihren Mahagonischränken bis unter die Decke, in der sie diverse Mittelchen erworben hatte. Und dort hinter dem verschnörkelten Zaungitter gab es immer noch den kleinen Souterrain-Laden der Wahrsagerin. Ein paar Stufen führten zur grün gestrichenen Tür hinab. Das selbst gemalte Schild darüber zeigte eine Glaskugel und Tarotkarten. Was bringt die Zukunft? Madame Gordon weiß es, stand dazwischen in geschwungener Schrift.
Die grüne Tür war stets geschlossen gewesen, wenn sie vorbeigekommen war. Peggy war nie eingetreten in diese andere Welt, die sie durchaus anregte. Sie wusste von ihrer Schwester Benita, die in New York regelmäßig zur Wahrsagerin gegangen war, dass einige Vorausdeutungen tatsächlich eingetroffen waren. Sollte sie vielleicht doch einmal hineingehen? Nach ihrer Zukunft in London fragen?
Die Tür öffnete sich. Peggy hielt den Atem an und ging langsamer, um einen Blick ins Innere zu erhaschen – wie sah es wohl bei einer Wahrsagerin aus? –, als eine füllige Frau mit einer bunt gestrickten Stola in den Türrahmen trat. Schwarze voluminöse Haare mit grauen Strähnen durchsetzt umrahmten das Gesicht. Ihr Rock ging bis zum Boden, und sie mochte um die sechzig sein. Als sie lächelte, entblößte sie eine Zahnlücke auf der linken Seite. Peggy nickte grüßend und wollte schnell vorbei, aber die Frau sprach sie an: »Wollen Sie wissen, was vor Ihnen liegt? Bei Mann? Bei Arbeit?« Sie winkte heftig, Peggy solle eintreten. »Kommen Sie, ce sera vite fait – es geht schnell und tut nicht weh.«
Peggy beschleunigte ihre Schritte. »Herzlichen Dank! Keine Zeit!« Nein, sie wollte doch nichts hören. Lieber nicht.
»Viele Überraschungen und Zufälle sehe ich bei Ihnen schon in naher Zukunft«, rief die Wahrsagerin, und ihre Augen, grau schimmernd wie eine Glaskugel, schienen sie zu durchbohren. »Schicksalsschläge. Treten Sie doch ein!« Sie winkte noch einmal.
Peggy machte, dass sie fortkam, und bog bei nächster Gelegenheit um die Ecke. Zufälle und Überraschungen. Na, hoffentlich waren die positiver Natur. Schicksalsschläge. Sie schauderte und blickte schnell zum Himmel hinauf, der noch wolkenlos und fröhlich war, genau wie das Geplapper der Passanten, das nun wieder an ihr Ohr drang, als sie einige Zeit später in einem Pulk von Menschen am Boulevard du Montparnasse stand und über die große Kreuzung wollte. Autos fuhren vorbei, Fahrräder klingelten, Busse hupten. Vergiss die Alte, dachte sie und schob sich mit auf die Straße. Wie üblich schaffte man es nur bis zur Verkehrsinsel, bevor die Fußgängerampel über die Gegenspur schon wieder rot wurde. Sie wandte ihr Gesicht der Sonne zu und schloss die Augen. Heute hatte sie Zeit. Sie nahm sich die Zeit. Die Besprechung mit Marcel war erfreulich verlaufen. Dank Marys Schlüssel würde sie heute Nacht kein Hotel aufsuchen müssen. Sie könnte zum Beispiel einfach … Auf einmal spürte sie, wie ein Kuss auf ihrer Wange landete, sie riss die Augen auf und erkannte sofort die störrische Frisur, die zackige Nase, die blauen Augen: Beckett!
Kapitel 4
Lächelnd stand er vor ihr. »Na, schöne Frau, so allein unterwegs?«
»Was um alles …?« Pardon, Pardon, hörte sie um sich herum von den Leuten, denen sie im Weg standen.
Er drehte sie in die Richtung, aus der sie gekommen war. »Wie wäre es mit einem hervorragenden Wein in einem schönen Café?«
Sie starrte ihn nur an. Der Verkehr rauschte wieder.
Er trat sehr nah an sie heran und beugte sich zu ihrem Ohr. »Oder sollen wir direkt zum Champagner übergehen?«
Ihr lief ein Schauer der Erregung durch den Körper. Sie roch seinen Duft, die Gauloise, sie sah die Lachfältchen um seine Augen. »Was ist mit: Es war schön, solange es anhielt?«
»Aber es ist doch noch gar nicht vorbei!«
Eine halbe Stunde später wälzten sie sich in Marys Bett. Sie waren Hand in Hand im Sturmschritt zur Rue Hallé Nummer 14 marschiert, beinahe gerannt. Peggy ahnte nicht, dass sie die Wohnung zehn Tage nicht verlassen würden, zehn ganze Tage! Außer um schnell Champagner zu kaufen und eine Kleinigkeit zu essen oder Becketts Post aus dem Hotel zu holen. Und sein Murphy-Manuskript. Es war gut, sie mochte es sehr. Ebenso wie der noch unveröffentlichte Essay über Proust, den er ihr scheu überreichte. Die Gedichte hingegen fand sie schlecht. Er fragte sie nach Laurence, den er damals erlebt hatte, als er vor zehn Jahren an ihrer Hausparty teilgenommen hatte. Er erkundigte sich nach den Kindern und war erstaunt, dass Sindbad bereits vierzehn Jahre alt war und Pegeen zwölf. Er freute sich zu hören, dass sie gerade in Megève bei Laurence und seiner neuen Frau Kay einen Winterurlaub verbrachten. Ob Peggy sie nicht vermisse? Die Kinder schon, Laurence und die Zicke Kay nicht so, gab Peggy zu verstehen. Zum Glück war verabredet, dass sie die Kinder an den internatsfreien Wochenenden oft bei sich haben würde, wenn sie mit der Galerie begann. Sie würden draußen auf dem Land in ihrem geliebten Ferienhaus Yew Tree Cottage entspannte Zeiten verbringen. Sie schwärmte Beckett von dem nach der alten Eibe benannten Anwesen vor – in der hügeligen Landschaft, mit dem großen Garten und dem Bach und den Kühen vor der Tür – und lud ihn ein, sie auch einmal dort in Hampshire zu besuchen. Aber er knabberte als Antwort nur an ihrem Ohr, seine Finger begaben sich auf Wanderschaft.
Es wurde Morgen, es wurde Abend. Es wurde wieder Morgen und wieder Abend. Peggy verlor das Zeitgefühl, und es war ihr egal. Sollte die Welt dort draußen sich doch weiterdrehen.
Sie war hier bei Sam.
Am zehnten Tag allerdings hatte sie einen Termin. Sie musste zu Cocteau, um ihn wegen des Einführungstextes für den Katalog zur Eile anzutreiben; der Katalog musste schließlich dringend in den Druck. Beckett kam mit heraus ans Tageslicht, blinzelte wie ein Murmeltier nach dem Winter. Sie versprachen, sich am Abend wiederzusehen. Als Peggy durch die Straßen lief, auf dem Weg zu Cocteau, summte sie beschwingt.
Der Termin verlief zufriedenstellend. Cocteau war ziemlich klar im Kopf und zeigte ihr, dass der Text schon fast fertig war. Sie konnte Wyn nach London telegrafieren, dass er in Kürze eintreffen würde. Sie wollte zu Sam, machte einen Abstecher in Marys Wohnung, zog sich ihr schönstes Negligé unter und begab sich auf dem schnellsten Weg zum Hotel Liberia, um ihn zum Essen abzuholen.
Wirklich keine sehr heimelige Ecke, dachte sie, als sie die dunkle, beinahe menschenleere Straße entlanglief. Nora hatte recht. Die Buchläden und Lebensmittelgeschäfte waren um diese Uhrzeit geschlossen, hier und da taumelten Paare aus einem Kellerlokal. Männer mit hochgestellten Mantelkrägen verschwanden in Etablissements mit rot blinkender Leuchtschrift. Peggy machte, dass sie zum Hotel kam – und entdeckte Beckett in einer Ecke der Halle, wie er gerade einer rothaarigen Schönheit einen Kuss gab! Ein Abschiedskuss wohl, denn die Rote ließ langsam ihre Hand aus der seinen gleiten, setzte eine Baskenmütze schief auf und verließ mit schnellen Schritten an Peggy vorbei das Hotel, gefolgt von Becketts Blick. Als er sie sah, erschrak er.
Was dann folgte, war eine lange Erklärung: Angeblich handelte es sich um eine alte Freundin aus Dublin, die zufällig in Paris aufgetaucht war. Gar nichts Ernstes. »Das war nur Sex ohne einen Funken Liebe, das ist doch wie Kaffee ohne Cognac.«
Liebe? Sprach er in dieser Situation von Liebe? Liebe. Das Wort zerriss ihr das Herz. Kurz war sie versucht, ihm zuzuhören, ihm zuzutrauen, dass er ihr tief verbunden war. Dass er … Ach was! Er hatte gerade mit dem roten Feger geschlafen, verdammt!
»Cognac?« Peggy schrie das Wort heraus. Der Portier, der nicht weit weg stand, zuckte zusammen. »Du kannst mich mal mit deinem Cognac. Salut, mein lieber Sam. ES WAR SCHÖN, SOLANGE ES ANHIELT!«
Damit drehte sie sich um und rannte die dunkle Straße zurück zum Boulevard du Montparnasse. Tränen purzelten ihr die Wangen hinunter, und sie rannte und rannte durch die kühle Nacht. Diesmal ließ sie sich nicht von der dummen Ampel an der Kreuzung ihr Tempo diktieren, sondern schlängelte sich durch den dichten Verkehr, angehupt von Dutzenden Autos und von einem Fahrrad fast überfahren. Sie rannte, bis ihre Lunge zu bersten drohte.
Endlich blieb sie stehen. Wie eine Olympia-Teilnehmerin beugte sie sich vornüber und stützte die Hände auf den Knien ab. Die Wolken ihres Atems verflogen stoßweise.
Was zum Henker tat sie hier? Was ließ sie sich von diesem jungen Mann verrückt machen? Sie war eine selbstständige, bald erfolgreiche Geschäftsfrau, die den Männern abgeschworen hatte. Zumindest den Ehemännern. Es war ein nettes Abenteuer gewesen mit einem einigermaßen talentierten Schriftsteller, der vielleicht seinen Weg finden würde, vielleicht aber auch nicht. Sie jedenfalls war nicht dazu da, um ihn auf diesem Weg zu begleiten. Sie hatte Besseres zu tun.
Sie richtete sich auf, orientierte sich, wo sie war, änderte ihre Route, stürzte ins Café de Flore, direkt an die Bar, und bestellte einen von Marcels grässlichen Pastis, der sie augenblicklich vollkommen zur Vernunft brachte. Sie würde sich nicht wie eine Jämmerliche an Paris klammern und an die Gestalten, die sich hier herumtrieben. Diese Stadt mit ihrem amourösen Getue machte sie eindeutig zu weiblich, zu weich, zu einer Sklavin ihrer Hormone und Hirngespinste. Nein, sie würde ihren Aufenthalt hier abkürzen und unverzüglich nach London reisen, um Wyn in der Galerie zur Seite zu stehen. Dort war ab jetzt ihr Platz. Das Einzige, was sie hier noch zu erledigen hatte, war der Besuch von Marcels verrückter Vernissage. Das konnte sie partout nicht sausen lassen. Aber danach war Schluss mit dieser gefühlsduseligen Stadt. Finalement!
Kapitel 5
Am Tag vor der Abreise wälzte sie sich früh aus dem Bett und holte die Koffer hervor. Vieles hatte sie schon vorausgeschickt, nur noch ein paar Kleider galt es einzupacken. Dazu ihre Kosmetik und natürlich die vielen Schuhe. Gut, dass sie mit dem Sportwagen – ihrem geliebten Delage – fahren und die Fähre von Calais nach Dover nehmen würde, anstatt zu fliegen. So würde sie alles mitnehmen können. Es wäre ein sauberer Abgang, so als ob sie all ihre Spuren in dieser Stadt hinter sich aufkehrte.
Sie stellte sich ans Fenster und zündete eine Zigarette an. In diesem Moment klingelte das Telefon. Vielleicht Mary, die aus Arcachon anrief, um sich nach dem Befinden der Freundin zu erkundigen? Sie nahm den schwarzen Hörer ab und verhedderte sich im Kabel, als sie versuchte, den Teekessel in der offenen Küchenzeile vom Herd zu ziehen, der in diesem Moment anfing zu pfeifen, sodass sie zunächst nicht mitbekam, wer sich meldete. Als sie das geschafft hatte, wusste sie, dass es nicht Mary war.
»Ich bin’s«, sagte Sam. »Es tut mir leid.«
Sie zog an der Zigarette und blies hörbar den Rauch aus.
»Ehrlich. Ich habe mich wie ein Idiot benommen. Aber du musst verstehen, sie ist eine sehr alte Freundin, und es hat wirklich nichts bedeutet. Ich konnte sie doch nicht kränken.«
Peggy lachte auf.
»Nun sag doch endlich etwas. Kann ich dich sehen?« Seine Stimme klang fast schon verzweifelt.
»Ich reise morgen in aller Frühe nach London. Es ist zu spät, Beckett.«
»Morgen ist morgen.«
»Ich bin jetzt verabredet.« Sie legte auf und goss kochendes Teewasser auf den Beutel Earl Grey. Mit der Tasse in beiden Händen bezog sie wieder ihre Position am Fenster, um dem Treiben unten auf der Rue Hallé zuzuschauen – und um zu lauschen, ob das Telefon noch einmal klingeln würde. Was es nicht tat.
Als sie am Abend an der Galerie Beaux-Arts in der Rue du Faubourg Saint-Honoré ankam, drängten sich bereits Hunderte neugierige Eröffnungsgäste vor der Tür. Sie sprach mit dem Einlasser, woraufhin er die Kordel entfernte und sie eintreten konnte. Marcel entdeckte sie in dem Gedränge nicht, dafür aber gleich am Eingang ein Taxi, auf dessen Fahrersitz ein ausgestopftes, grinsendes Krokodil saß – im Regen. Im Inneren des Wagens goss es nämlich ordentlich, nicht nur auf das Krokodil, sondern auch auf die blonde Schaufensterpuppe, die nackt auf dem Rücksitz thronte, die Füße in braunem Laub versenkt. Über ihren Plastikkörper krochen lebendige Schnecken. Regentaxi hieß die Installation.
»Ein echter Dalí, was?«, sagte neben ihr eine Frau und kicherte. »Das kann nur er.«