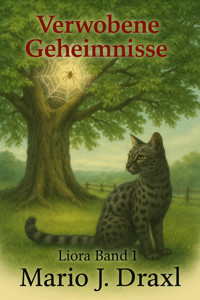Pflege in Krisensituationen. Information, Praxisbericht und Ratgeber zur familiären Bereitschaftspflege E-Book
Mario Draxl
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Pflege in Krisensituationen ist mehr als ein Fachbuch – es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für den Schutz der Kleinsten in unserer Gesellschaft. Mag. Mario Josef Draxl und Mag.a Christina Draxl, selbst langjährige Bereitschaftspflegeeltern und ausgewiesene Expert\:innen im Bereich Kinderschutz, eröffnen mit diesem Buch einen vielschichtigen Einblick in die Realität familiärer Krisenpflege in Österreich. Wenn Kinder aus ihrer Herkunftsfamilie herausgenommen werden müssen, ist schnelles, verlässliches Handeln gefragt. Die sogenannte Bereitschaftspflege stellt in solchen Situationen oft die erste Station auf dem Weg zu Sicherheit, Stabilität und neuer Hoffnung dar. Dieses Buch zeigt auf, warum dieser erste Schritt so entscheidend ist – und warum die Menschen, die ihn begleiten, besondere Unterstützung verdienen. In drei übersichtlich gegliederten Teilen vereint das Buch fundierte Information, berührende Erfahrungsberichte und konkrete Alltagshilfen: Teil 1 bietet eine differenzierte Aufklärungsarbeit rund um das System der Krisenpflege: Definitionen, rechtlicher Rahmen, regionale Unterschiede und zentrale Konzepte wie Bindung, Co-Regulation und transgenerationale Traumadynamiken werden kompakt, aber tiefgründig behandelt. Teil 2 öffnet das Fenster in den Alltag von Bereitschaftspflegefamilien. Anhand anonymisierter Praxisbeispiele wird greifbar, welche Herausforderungen, aber auch welche tiefen Sinnmomente mit dieser Form der Pflege verbunden sind. Teil 3 versteht sich als Ratgeber und enthält praktische Checklisten, Reflexionsübungen, Methoden zur Co-Regulation, Empfehlungen für Übergänge und Hinweise zur Selbstfürsorge. Besonders wertvoll ist der Blick auf die Kinder selbst: Was brauchen sie wirklich in dieser sensiblen Phase? Wie kann man ihnen helfen, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten – und gleichzeitig loslassen, wenn sie weiterziehen? Die Autor\:innen beantworten diese Fragen nicht nur mit Theorie, sondern mit gelebter Erfahrung und einer klaren Haltung. „Pflege in Krisensituationen“ richtet sich an (künftige) Pflegeeltern, Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, Entscheidungsträger:innen im sozialen Bereich sowie alle, die mehr über die Bedeutung der frühen Bindung und den Wert sicherer Übergänge erfahren möchten. Ein Buch, das berührt, bildet – und zum Handeln anregt. Geschrieben mit Herz, Verstand – und aus tiefster Überzeugung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Pflege in Krisensituationen.
Information, Praxisbericht und Ratgeber
zur familiären Bereitschaftspflege
Impressum
Titel: Pflege in Krisensituationen: Information, Praxisbericht und Ratgeber zur familiären BereitschaftspflegeAutoren: Mag. Mario J. Draxl und Mag. Christina DraxlAdresse: Rosengasse 18, 6063 Rum, ÖsterreichE-Mail:[email protected]
© 2025 Mag. Mario J. Draxl und Mag. Christina DraxlAlle Rechte vorbehalten.
Dieses E-book ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Wiedergabe oder sonstige Nutzung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne schriftliche Zustimmung der Autoren unzulässig.
Alle Fallbeispiele wurden zum Schutz der Beteiligten anonymisiert oder in wesentlichen Punkten verfremdet. Die enthaltenen Informationen dienen der fachlichen Orientierung, stellen jedoch keine rechtliche oder therapeutische Beratung dar.
Einleitung: Die Vielfalt der Bereitschaftspflege in Österreich
Die Bereitschaftspflege ist ein essenzieller Bestandteil des Kinderschutzes und eine unverzichtbare Unterstützung für Kinder in Krisensituationen. Doch wie bei einem Garten, dessen Pflege von Standort, Klima und Bodenbeschaffenheit abhängt, variiert auch die Qualität und Unterstützung der Bereitschaftspflege je nach Region erheblich.
In Österreich gibt es keine einheitlichen Standards – jedes Bundesland hat eigene Regelungen, Herangehensweisen und Rahmenbedingungen. Während in manchen Regionen Bereitschaftspflegeeltern umfassend begleitet, geschult und unterstützt werden, kämpfen andere mit mangelnden Ressourcen, fehlender Koordination und unzureichenden Strukturen. Diese Unterschiede beeinflussen nicht nur die Lebensqualität der Kinder, sondern auch die Arbeitsbedingungen der Bereitschaftseltern.
Dabei hat Österreich als Unterzeichnerstaat der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) die Verpflichtung, jedem Kind das Recht auf Schutz, Förderung und Beteiligung zu garantieren – unabhängig von seinem Wohnort. Artikel 20 der UN-KRK betont insbesondere die Fürsorge und den Schutz von Kindern, die vorübergehend oder dauerhaft nicht in ihrer Ursprungsfamilie leben können. Es ist daher unerlässlich, dass die Rahmenbedingungen der Bereitschaftspflege diesen Verpflichtungen gerecht werden und ein Höchstmaß an Qualität und Gerechtigkeit sicherstellen.
Das vorliegende Buch möchte einerseits die Herausforderungen der Bereitschaftspflege aufzeigen und andererseits Best Practices aus verschiedenen Regionen präsentieren, die als Vorbild dienen können. Es ist eine Einladung an alle Akteure – von der Politik über die Trägerorganisationen bis zu den Bereitschaftspflegeeltern selbst –, sich für eine bessere und gerechtere Gestaltung einzusetzen, damit jedes Kind, unabhängig von seinem Wohnort, die gleiche Chance auf Geborgenheit und Unterstützung erhält.
Erklärung zur Buchgliederung
Die Idee, dieses Buch in drei Hauptschwerpunkte zu gliedern – Aufklärungsarbeit, Praxisbericht und Ratgeber –, entstand aus dem Wunsch, sowohl Neulinge als auch erfahrene Leser gleichermaßen anzusprechen. Jeder dieser Bereiche hat eine klare Funktion: Aufklärung bietet einen fundierten Einstieg ins Thema, der Praxisbericht gewährt authentische Einblicke in den Alltag von Bereitschaftsfamilien(= die im Buch verwendete Abkürzung für Bereitschaftspflegefamilien), und der Ratgeber - Teil gibt einige wenige konkrete Hilfestellungen und einen Ausblick darüber, was sich im Bereich Bereitschaftspflege verbessern lässt.
Diese Struktur soll nicht nur Orientierung bieten, sondern auch sicherstellen, dass die Inhalte zielgerichtet und nachvollziehbar präsentiert werden. Unser Ziel ist es, Wissen und Erfahrungen so aufzubereiten, dass sie gleichermaßen informieren, inspirieren und unterstützen.
Entsprechend richten sich die Abschnitte eben auch an verschiedene Zielgruppen:
Teil 1 richtet sich vor allem an Interessierte ohne Vorwissen, z. B. neue Pflegeeltern oder Richter.
Teil 2 soll Menschen ansprechen, die sich vertieft mit der Praxis auseinandersetzen möchten.
Teil 3 versucht aktiven Pflegeeltern eine praktische Hilfestellung für den Alltag zu geben.
Für uns hatte die Einteilung den Vorteil, dass wir die Inhalte besser thematisch bündeln konnten. Für die Leserin besteht der Benefit darin, jene Kapitel, die relevant sind, leichter und rasch zu finden.
In dem Sinne werden im ersten, informativen Teil, auch wissenschaftliche, theoretische Erkenntnisse kurz erläutert (zum Beispiel Resilienz, generationsübergreifende Faktoren, Bindung), die im praktischen Teil durch die Anwendung dieser Konzepte weiter vertieft werden.
1. Teil: Aufklärungsarbeit – Was ist Krisenpflege?
Ziel dieses Abschnitts ist, dass der Leser / die Leserin ein grundlegendes Verständnis für die Bedeutung und die Herausforderungen der Krisenpflege erlangt. Am Ende soll deutlich werden, dass Krisen - bzw. Bereitschaftspflege ein zentrales Instrument im Kinderschutz darstellt – mit dem Potenzial, Kinder aus transgenerationalen Traumaspiralen zu befreien.
Kapitel 1 – Einleitung und Zielsetzung
Warum dieses Buch?
Bereitschaftspflege ist kein alltäglicher Begriff – und doch ist sie für viele Kinder der erste Schritt in ein sichereres Leben. Dieses Buch soll helfen, zu verstehen, was Krisenpflege bedeutet, wie sie funktioniert, wer sie leistet – und warum sie so dringend gebraucht wird. Es geht um Aufklärung und Information, aber auch um persönliche Einblicke, Reflexionen und Stimmen aus der Praxis.
Für wen ist dieses Buch gedacht?
Für Menschen, die überlegen, ein Kind in Krisensituationen aufzunehmen. Für Fachkräfte, die wissen wollen, wie es in den Familien aussieht, die mit ihnen zusammenarbeiten. Für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die Strukturen verbessern wollen. Und für alle, die Kinder unterstützen möchten – nicht nur mit Worten, sondern mit Taten.
Was ist das Ziel?
Dieses Buch gibt einen realistischen Einblick in den Alltag von Bereitschaftspflegefamilien – mit all seinen Höhen und Tiefen. Es zeigt auf, wo Hilfe nötig ist, wo Systeme gut funktionieren – und wo nicht. Es stellt die Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt und macht deutlich, was es braucht, damit Krisenpflege nicht zur Überforderung, sondern zur Chance für alle Beteiligten wird.
Ein persönlicher Einstieg
Unsere eigene Motivation, Bereitschaftspflegefamilie zu werden, wuchs über Jahre. Was mit beruflicher Nähe zum Thema begann, wurde zur Lebensaufgabe. Immer wieder sahen wir Kinder, die dringend einen geschützten Ort brauchten – und keinen fanden. Der Gedanke, dass ein Neugeborenes seine ersten Lebenstage in einer überfüllten Einrichtung verbringt, war schwer auszuhalten. Also entschieden wir uns, selbst Teil der Lösung zu werden.
Dabei war uns von Anfang an klar: Diese Aufgabe ist keine romantische Heldengeschichte. Sie ist fordernd, manchmal zermürbend – aber auch zutiefst sinnvoll. Es geht nicht um Selbstdarstellung, sondern um Verantwortung. Nicht um Perfektion, sondern um Präsenz. Um das Dasein, wenn ein Kind alles verloren hat – und um die Kraft, es auch wieder gehen zu lassen, wenn die nächste Etappe beginnt.
Und genau darum geht es in diesem Buch.
Kapitel 2: Definition und rechtlicher Rahmen
Was ist Krisenpflege?
Krisenpflege bedeutet, Kindern in akuten Notlagen ein sicheres, temporäres Zuhause zu bieten. Sie kommen meist aus belastenden Lebenssituationen wie Gewalt, Vernachlässigung, psychischer Erkrankung oder plötzlichem Ausfall der Eltern. Krisenpflegefamilien bieten diesen Kindern Schutz, emotionale Stabilität und Orientierung, bis eine dauerhafte Lösung – etwa Rückführung, Dauerpflege oder andere Unterbringungsformen – gefunden wird.
Die Rolle der Krisenpflege im Kinderschutz
Krisenpflege ist eine Soforthilfe, wenn akute Gefährdung besteht. Sie verhindert, dass Kinder in unpersönliche Heime kommen, und ermöglicht ihnen einen Start in einem familiären Umfeld. Diese Arbeit ist intensiv, oft belastend, aber gleichzeitig auch ein Schlüssel für Heilung und Resilienzbildung.
Abgrenzung: Krisenpflege – Dauerpflege – sozialpädagogische Pflege
Krisenpflege / Bereitschaftspflege: Kurzfristige, sofortige Unterbringung bei
qualifizierten Familien.
Dauerpflege: Langfristige Integration des Kindes in ein neues Familiensystem.
Sozialpädagogische Pflege: Betreuung durch Fachkräfte mit psychologischer/pädagogischer Ausbildung, meist mit intensiver Unterstützung.
Anforderungen an Krisenpflegeeltern
Geeignete Pflegepersonen sollten belastbar, empathisch, flexibel und teamfähig sein. Neben persönlicher Eignung sind rechtliche, räumliche und organisatorische Voraussetzungen nötig. Ausbildung und kontinuierliche Supervision sind entscheidend, ebenso wie die Fähigkeit, loslassen zu können, damit diese Familien diese schwierige Arbeit langfristig ausüben können.
Der rechtliche Rahmen in Österreich
Die rechtliche Grundlage der Bereitschaftspflege liegt in den Landesgesetzen zur Kinder- und Jugendhilfe, die in jedem Bundesland unterschiedlich geregelt sind.
Burgenland: Bgld. KJHG
Kärnten: K-KJHG
Niederösterreich: NÖ KJHG
Oberösterreich: OÖ KJHG
Salzburg: S. KJHG
Steiermark: Stmk. KJHG
Tirol: T-KJHG
Vorarlberg: V-KJHG
Wien: W-KJHG
Diese Gesetze regeln Organisation, Ausbildung, Bezahlung und Zuständigkeiten. Die Unterschiede sind erheblich: In Tirol z. B. ist keine gesetzlich festgelegte Betreuung für Bereitschaftsfamilien vorgesehen, in Salzburg hingegen gibt es flexible Vertretungsmöglichkeiten. Dabei ist es so, dass das Pflegegeld österreichweit gleich geregelt ist im Sinne einer Aufwandsentschädigung. Dies stellt kein Einkommen dar, daher ist man damit auch nicht sozialrechtlich abgesichert, also nicht kranken- und pensionsversichert. Dies geschieht eben regional ganz unterschiedlich, es gibt fixe Anstellungen, geringfügige Bezahlmodelle und anderes mehr.
Entlastung und Vertretung – ein unterschätztes Thema
Ein gravierender Mangel zeigt sich zum Beispiel bei der Vertretung: In vielen Bundesländern – besonders Tirol – ist es rechtlich und praktisch kaum möglich, kurzfristige Entlastung zu erhalten. Freunde oder Bekannte dürfen meist nicht einspringen. Ein strukturiertes "Springer*innen-System" wäre dringend nötig. Dabei ist nicht etwa an eine mehrstündige Erholung oder einen Wochenendkurztrip gedacht, sondern einfach an eine Vertretung, wenn man zum Arzt muss, zum Frisör oder einen wichtigen anderen Termin hat. Dies ist beispielsweise in Salzburg möglich, in anderen Bundesländern aber nahezu undenkbar.
Wer sollte die Vertretung ausüben und wie könnte das finanziert werden:
Es sollte „SpringerInnen“, also geschulte Ersatzpersonen geben, die auf Zeit abrufbar sind.
In Tirol muss eine derartige Vertretung , falls überhaupt möglich, derzeit aus eigener Tasche von der Bereitschaftsfamilie bezahlt werden. Hier sollte an eine zentrale Finanzierung gedacht werden, Vertretung ist ja auch in fast allen anderen Bereichen möglich und wird auch dort nicht aus privater Tasche bezahlt, sondern ist in den Gesamtkosten mit berechnet.
Am besten und einfachsten wäre es, die Zugänglichkeit für pensionierte Pflegepersonen zu ermöglichen, die mit allem bestens vertraut und eben auch spezifisch geschult sind.
Ein solches System würde Pflegefamilien stärken, die Qualität sichern und Kindern Stabilität gewährleisten.
Ein Plädoyer für einheitliche Standards
Der Flickenteppich an Regeln in Österreich benachteiligt Familien regional unterschiedlich. Einheitliche Standards würden:
Gerechtigkeit schaffen
Qualität sichern
Verwaltungsaufwand senken
Bereitschaftspflege attraktiver machen
Kinder in Not brauchen nicht regionale Unterschiede, sondern bestmögliche, verlässliche Hilfe – überall in Österreich zu gleichen Bedingungen.
Die Bundesländer im Direktvergleich: Modelle der Bereitschaftspflege, Bezahlung der Bereitschaftspflegeeltern, Häufigkeit der Unterbringung, Anforderungen an die Familien, mit Daten, Fakten und kurzen Ausschnitten aus Berichten Betroffener
Wir haben versucht zu recherchieren, wie die aktuelle Datenlage ist. Verlässt man sich dabei auf Auskünfte oder offizielle Stellen, kommt man nicht weit. Zahlen über Bereitschaftspflege, Krisenpflege oder Kurzzeitpflege werden nicht extra geführt, oft wird lediglich zwischen Dauerpflegefamilien und sozialpädagogischer Unterbringung unterschieden und mit letzterem sind dann auch meistens die Bereitschaftsfamilien mitgenannt.
Österreichweit werden jedes Jahr mehrere tausend Kinder durch die Kinder- und Jugendhilfe aus ihren Familien genommen; 2024 befanden sich rund 13.050 Minderjährige in voller Erziehung (Fremdunterbringung). Davon lebten etwa 38 % in Pflegefamilien (inkl. Dauer- und Krisenpflege), der Rest in sozialpädagogischen Einrichtungen. Ein bundesweiter Gesamtwert speziell für Krisenpflegekinder wird in der öffentlichen Statistik nicht separat ausgewiesen, anhand der von uns durchgeführten Recherchen können wir aussagen, dass österreichweit mindestens 500 und maximal 800 Kinder bis zu einem maximalen Alter von 3 Jahren pro Jahr in Bereitschaftspflegefamilien betreut werden.
Wir legten mit unseren Nachforschungen den Fokus auf:
die Konzepte und Rahmenbedingungen in allen neun Bundesländern,
die Bezahlung bzw. finanzielle Unterstützung für Krisenpflegefamilien je Bundesland,
die Anzahl der betreuten Kinder in diesem Setting (sofern verfügbar),
sowie die typischen Aufgaben und Anforderungen an Krisenpflegefamilien.
Es kann sein, dass es einige Abweichungen von der Realität gibt, denn laut offizieller Darstellung werden zum Beispiel in Tirol Bereitschaftsfamilien nur geringfügig bezahlt und von niemandem betreut. Fakt ist aber, dass man seit relativ kurzer Zeit eine Anstellung bekommt, die höher als geringfügig ist und dass eine offizielle Betreuung durch ein Team des Landeskinderheim Axams besteht. Dies nur als ein Beispiel.
Wien
Konzepte und Trägerschaft: In Wien wird Krisenpflege vor allem für Säuglinge und Kleinkinder (0–3 Jahre) durch die städtische Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) organisiert. Kinder dieser Altersgruppe sollen bei akuter Gefährdung nicht in Krisenzentren mit älteren Jugendlichen untergebracht werden, sondern bevorzugt in Krisenpflegefamilien. Die Stadt Wien hat seit 2022 ein Anstellungsmodell für Krisenpflegeeltern eingeführt: Krisenpflegepersonen schließen einen Vertrag mit der MA 11 ab und sind dadurch angestellt, versichert und erhalten ein Grundgehalt. Zusätzlich zum Gehalt bekommen sie das sogenannte Krisenpflegekindergeld pro aufgenommenem Kind sowie Zuschläge bei weiteren Kindern. Ältere Kinder (über 3 Jahre) werden bei Bedarf in eigenen Kleinkinder-Krisenzentren der Stadt betreut (aktuell gibt es in Wien ein Krisenzentrum für 0–3-Jährige mit 7 Plätzen und eines für 3–6-Jährige mit 6 Plätzen).
Finanzielle Unterstützung: Die finanzielle Abgeltung für Wiener Krisenpflegefamilien setzt sich aus zwei Teilen zusammen: einem monatlichen Gehalt und dem Krisenpflegekindergeld. Seit der Reform 2022 werden Krisenpflegeeltern mit ca. 1.500 € netto Grundgehalt pro Monat angestellt. Für jedes weitere gleichzeitig betreute Krisenkind kommen 500 € netto pro Monat hinzu. Daneben erhalten Krisenpflegeeltern pro Kind rund 1.000–1.500 € monatlich Krisenpflegekindergeld (Stand 2024: etwa 1.500 €), das als Aufwandsentschädigung für Unterhalt, Pflege und Erziehung des Kindes dient. In Summe ergibt sich für ein Krisenpflegekind ein monatliches Einkommen von etwa 2.500–3.000 €; bei zwei Kindern liegt es bei etwas über 3.000 €. Diese Beträge umfassen auch die Familienbeihilfe und sind dafür gedacht, alle Kosten der Betreuung zu decken. Beispielsweise nennt die Stadt Wien als Richtwert etwa 2.995 € monatlich bei einem Krisenpflegekind (inklusive Pflegegeld und Familienbeihilfe). Wichtig ist, dass die angestellten Krisenpflegeeltern durch die Gehaltszahlung sozialversichert sind (Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung).
Anzahl der betreuten Kinder: In Wien waren im Vorjahr (2024) 138 Kinder unter drei Jahren in Krisenpflegefamilien untergebracht. Der Bedarf ist also hoch, aber mangels Pflegeeltern konnte zuletzt weniger Kindern ein Platz geboten werden. Aktiv im Einsatz sind derzeit 44 Krisenpflegeeltern, davon 37 im Anstellungsverhältnis der Stadt. Die Stadt sucht dringend zusätzliche Kriseneltern – etwa 10 weitere Familien werden benötigt, um den Bedarf zu decken. Aufgrund von Pandemie und Teuerung ist es schwieriger geworden, neue Pflegeeltern zu finden, sodass derzeit kein Überschuss an freien Pflegeplätzen besteht.
Aufgaben und Anforderungen: Wiener Krisenpflegeeltern betreuen (laut Eigenwerbung) ein Kleinkind rund um die Uhr in ihrem Haushalt. Sie versorgen und fördern das Kind liebevoll, übernehmen Arzt- und Therapietermine und stellen sämtliche Grundbedürfnisse sicher. Wichtig ist die stets abrufbereite Verfügbarkeit – oft bleibt nur ein Anruf und wenige Stunden Vorlauf, bis ein Kind in die Familie kommt. Die Betreuungsdauer liegt im Regelfall bei 8–12 Wochen, kann aber je nach Situation variieren. Während dieser Zeit klärt die MA 11, ob das Kind wieder zur Herkunftsfamilie zurückkehren kann oder anderweitig (Dauerpflege, Verwandte oder institutionell) untergebracht werden muss. Von Krisenpflegeeltern wird erwartet, dass sie Flexibilität, psychische Stabilität und pädagogisches Geschick mitbringen. Sie müssen sich immer wieder auf neue Kinder und deren oft traumatische Vorgeschichten einstellen und auch die emotionale Fähigkeit zum Loslassen mitbringen, wenn das Kind nach der Krisenphase weiterzieht. Außerdem arbeiten sie eng mit der Kinder- und Jugendhilfe zusammen: Wöchentliche Treffen mit den leiblichen Eltern (Besuchskontakte) und das Führen von Berichten gehören dazu. Voraussetzungen sind eine Pflegeeltern-Ausbildung (in Wien dauert diese zwei Wochen Vollzeit), ein stabiler familiärer Rahmen sowie genügend Wohnraum und Zeit. Oft werden bevorzugt BewerberInnen mit eigener Erziehungserfahrung (eigene Kinder/Pflegekinder) gesucht, da diese bereits bewiesen haben, mit Kindern umgehen zu können. Insgesamt sind Wiener Krisenpflegeeltern so etwas wie die „Feuerwehr der Kinderbetreuung“: Sie springen kurzfristig ein, bieten den Kleinsten ein geborgenes Zuhause auf Zeit und arbeiten daran, dass die Kinder die Krisenzeit gut überstehen.
Niederösterreich
Konzepte und Trägerschaft: In Niederösterreich wird Krisenpflege durch die Landes-Kinder- und Jugendhilfe koordiniert, in Zusammenarbeit mit privaten Trägern. Eine zentrale Rolle spielt dabei die “Peter PAN – Pflege und Adoption in NÖ GmbH”, eine private Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, die vom Land beauftragt ist, Pflege- und Adoptivfamilien zu beraten, auszubilden und zu begleiten. Krisenpflegefamilien in NÖ betreuen vorwiegend Säuglinge und Kleinkinder bis ca. 5 Jahre für die Dauer von maximal 6 Monaten. Man unterscheidet in NÖ zwei Modelle: angestellte Krisenpflegepersonen im Dienst des Landes und selbstständige Pflegepersonen auf Abruf. Wer Krisenpflegefamilie wird, kann sich nämlich entweder für eine Anstellung beim Land oder für eine Tätigkeit „ohne Vertrag“ entscheiden. Seit einigen Jahren setzt NÖ verstärkt auf das Anstellungsmodell, um Pflegeeltern soziale Absicherung und attraktiveres Einkommen zu bieten. Angestellte Krisenpflegepersonen stehen in einem formalen Anstellungsverhältnis mit dem Land und sind über das Land NÖ sozialversichert. Alternativ gibt es „Bereitschaftspflegepersonen auf Abruf“, die keine feste Bezahlung erhalten, sondern nur im Bedarfsfall einspringen (hierfür gibt es dann Aufwandsentschädigungen, aber keine dauerhafte Vergütung). Organisatorisch wird die Eignung der Familien von der regionalen Kinder- und Jugendhilfe geprüft, und es sind strenge Kriterien (psychologisches Gutachten, Hausbesuche, Erste-Hilfe-Kurs etc.) zu erfüllen, bevor man ein Pflegekind aufnehmen darf.
Finanzielle Unterstützung:Mit Jänner 2023 hat Niederösterreich die Bezahlung für Krisenpflegeeltern deutlich erhöht, um mehr Menschen für diese Aufgabe zu gewinnen. Angestellte Krisenpflegepersonen erhalten nun ein Mindestgehalt von 1.700 € netto pro Monat (vorher etwa 725 €). Dieses Grundgehalt steht als Bereitschaftsentschädigung zur Verfügung – also auch in Zeiten, in denen vorübergehend kein Pflegekind in der Familie ist. Kommt es zur Aufnahme eines Kindes, wird zusätzlich Pflegekindergeld pro Kind bezahlt, das jedoch mit der Reform etwas reduziert wurde: Statt vormals 911 € beträgt der Richtsatz nun 550–600 € pro Monat (je nach Alter des Kindes). Unterm Strich führt die Reform aber zu einem deutlich höheren Einkommen und vor allem zu besseren Pensionsansprüchen der Pflegeeltern, da nun viel mehr Gehalt in die Sozialversicherung einbezahlt wird. Beispiel: Für ein Baby in Krisenpflege erhält eine NÖ-Familie nun rund 2.250 € netto monatlich (1.700 € Gehalt + ca. 550 € Pflegegeld). Bei Bedarf können auch zwei Kleinkinder gleichzeitig betreut werden – dann kommen die jeweiligen Pflegegeld-Beträge hinzu; die Landesrätin betont jedoch, dass die Entscheidung über ein zweites Kind freiwillig ist (die früher bestehende Aufnahmepflicht für ein zweites Kind wurde abgeschafft). Familien, die nicht angestellt sind, erhalten lediglich die Aufwandsentschädigungen (vergleichbar dem Pflegekindergeld, ca. 949 € pro Kind früher) für die Dauer einer Platzierung, jedoch kein fixes Gehalt in Bereitschaftszeiten. Insgesamt bietet NÖ mit dem Mindestgehalt eine finanzielle Wertschätzung und Absicherung, die in der Vergangenheit von Pflegeeltern lange gefordert wurde.
Anzahl der betreuten Kinder: Niederösterreich hat einen anhaltenden Mangel an Pflegefamilien, jedoch ein kleines Stammteam an Krisenpflegeeltern. Stand 2020 gab es im ganzen Bundesland 14 angestellte Krisenpflegeeltern sowie weitere 10 auf Abruf verfügbare Familien. Diese Zahlen sind relativ niedrig und verdeutlichen, wie rar diese Familien sind. Neuere Zahlen lassen vermuten, dass die Zahl trotz Gehaltserhöhung nicht stark gestiegen ist (die Landesregierung betonte 2023 weiterhin, dass Pflegefamilien fehlen). Konkrete aktuelle Kinderzahlen werden in öffentlichen Quellen selten genannt; es ist aber bekannt, dass jährlich mehrere hundert Gefährdungsabklärungen in NÖ stattfinden (2018–2022 über 23.000 Verdachtsfälle) – in einigen dieser Fälle müssen Kinder kurzfristig aus Familien genommen werden. Mangels ausreichend Krisenpflegefamilien werden in NÖ Kleinstkinder notfalls auch in sozialpädagogischen Wohngruppen oder Babyheime gebracht, doch bevorzugt versucht man, sie bei Krisenpflegeeltern unterzubringen. Die Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) ruft laufend engagierte Menschen auf, sich als Pflegeeltern zu melden – jeder zusätzliche Platz hilft.
Aufgaben und Anforderungen: Krisenpflegeeltern in Niederösterreich übernehmen elterliche Verantwortung auf Zeit, wenn ein Kind wegen akuter Kindeswohlgefährdung nicht bei den leiblichen Eltern bleiben kann. Sie nehmen Babys oder Kleinkinder meist für maximal 6 Monate auf, bis entschieden ist, ob das Kind zurück zur Familie kann oder in Dauerpflege/Heim kommt. Rund-um-die-Uhr-Betreuung ist gefordert – die Pflegepersonen geben „ihren Schützlingen“ Geborgenheit, Sicherheit und ein liebevolles Zuhause in einer hoch belasteten Phase. Flexibilität und Einsatzbereitschaft sind essenziell: Auf einen Anruf muss die Familie binnen Stunden reagieren und ein fremdes Kind aufnehmen können. Die Kinder kommen oft traumatisiert oder zumindest mit „einem großen Rucksack“ an Problemen zu den Pflegeeltern. Pflegepersonen benötigen daher viel Einfühlungsvermögen, Geduld, Belastbarkeit und die Fähigkeit zur professionellen Distanz. In NÖ wird auch betont, dass Krisenpflege kein Einzelprojekt ist: Die ganze Familie muss dahinterstehen (Partner, eigene Kinder etc.), da alle mithelfen müssen, den neuen Alltag zu stemmen. Vor Beginn durchlaufen BewerberInnen ein strenges Auswahlverfahren (inkl. psychologischer Eignungsfeststellung) und einen Vorbereitungslehrgang über mehrere Module. Zu den Aufgaben gehören neben Versorgung und Förderung des Kindes auch die Zusammenarbeit mit Behörden: So müssen Pflegeeltern etwa Dokumentationen führen, an Hilfeplangesprächen teilnehmen und regelmäßigen Kontakt mit den leiblichen Eltern ermöglichen (Besuchscafé o. Ä.). NÖ honoriert diesen Einsatz neuerdings durch das Gehaltsmodell, macht aber auch klar: Es handelt sich um eine 24/7-Tätigkeit, die an die Substanz gehen kann und die man nur mit Herz und Idealismus ausübt.
Oberösterreich
Konzepte und Trägerschaft: In Oberösterreich liegt die Verantwortung für Krisen- und Bereitschaftspflege bei der Kinder- und Jugendhilfe der Bezirke, die jedoch eng mit dem Verein “Plan B” (Soziale Initiative) zusammenarbeitet. Plan B ist ein gemeinnütziger Träger, der im Auftrag des Landes OÖ Pflegefamilien sucht, ausbildet und begleitet. Bereitschaftspflege wird in OÖ als Teil der Pflegekinderhilfe angesehen. Für kurzfristige Krisenbetreuung ist ein Modell etabliert, bei dem Bereitschaftspflegefamilien für Kleinkinder (0–2 Jahre) bereitstehen. Tatsächlich werden in OÖ Babys in Notfällen möglichst in Bereitschaftsfamilien untergebracht, während ältere Kinder eher in Krisengruppen betreut werden. Die Besonderheit in OÖ: Bereitschaftspflegeeltern können sich via “plan B” anstellen lassen, um sozialrechtlich abgesichert zu sein. Dieses Anstellungsverhältnis ist oft als geringfügige Beschäftigung (Teilanstellung) geregelt – z.B. vergleichbar mit 15 Wochenstunden – und ermöglicht den Pflegepersonen Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung. Alternativ können Pflegeeltern einen freien Dienstvertrag mit dem Land abschließen, wodurch das Land die Selbstversicherungskosten refundiert. In jedem Fall arbeiten OÖ-Krisenpflegefamilien eng mit Plan B und der KJH zusammen. Schulung und Prüfung der Eignung sind verpflichtend: Bewerber absolvieren eine spezielle Pflegeeltern-Ausbildung (oft modular, an Wochenenden) und einen Zusatzmodul für Bereitschaftspflege. Oberösterreich legt Wert darauf, dass Krisenpflegefamilien bereits Erziehungserfahrung haben – idealerweise haben sie schon ältere Pflege- oder eigene Kinder, da das Loslassen eines kleinen Kindes nach kurzer Zeit sehr herausfordernd ist.
Finanzielle Unterstützung: Die finanzielle Unterstützung in OÖ ähnelt den Regelungen anderer Bundesländer, jedoch mit individuellen Ausgestaltungen durch Plan B