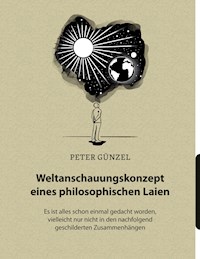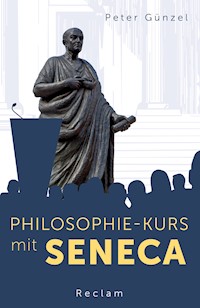
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Was macht ein glückliches Leben aus? Und wie gelingt es? Seneca (4 v. Chr. – 65 n. Chr.) hat diese Fragen in den Mittelpunkt seiner Philosophie gerückt und der Nachwelt eine Fülle an Werken hinterlassen, in denen er ganz konkret einen Weg zu einem zufriedenen Leben aufzeigt. Warum also seine Grundsätze nicht als Leitfaden nehmen? Dieser Kurs in zehn Lektionen macht es möglich – konzipiert aus Senecas Tipps und mit Beispielen aus seiner Feder. Lektion 1: Wie führt man ein glückliches Leben? Lektion 2: Der Mensch als Vernunftwesen Lektion 3: Die innere Distanz zu Emotionen finden Lektion 4: Wahre Freiheit erlangen Lektion 5: Mit anderen zurechtkommen Lektion 6: Sich um das Gemeinwohl bemühen Lektion 7: Materielles richtig bewerten Lektion 8: Mit Misserfolg und Fehlern umgehen Lektion 9: Sterblichkeit und Tod akzeptieren Lektion 10: Der Natur gemäß leben
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Peter Günzel
Philosophie-Kurs mit Seneca
Reclam
2022 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH nach einem Konzept von Tanja Jung, dialog-grafik.de
Coverabbildung: neuzeitliches Seneca-Standbild in Córdoba, Spanien (akg-images / Schütze / Rodemann)
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2022
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962072-5
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014307-0
www.reclam.de
Inhalt
Einleitung
Warum Philosophie?
Warum antike Philosophie?
Warum gerade Seneca?
Wie ein glückliches Leben gelingt
LEKTION 1: Wie führt man ein glückliches Leben?
LEKTION 2: Der Mensch als Vernunftwesen
LEKTION 3: Die innere Distanz zu Emotionen finden
LEKTION 4: Wahre Freiheit erlangen
LEKTION 5: Mit anderen zurechtkommen
LEKTION 6: Sich um das Gemeinwohl bemühen
Lektion 7: Materielles richtig bewerten
LEKTION 8: Mit Misserfolg und Fehlern umgehen
LEKTION 9: Sterblichkeit und Tod akzeptieren
LEKTION 10: Der Natur gemäß leben
Literaturhinweise
Ausgaben und Übersetzungen der Werke Senecas
Zitierte, benutzte und weiterführende Literatur
Einleitung
Wenn Sie, liebe Leserin und lieber Leser, das vorliegende Büchlein aufgeschlagen haben, so kann es im Grunde dafür nur zwei Gründe geben: Entweder Sie müssen sich mit Seneca und seiner Philosophie beschäftigen, oder Sie wollen es. Für beide Fälle gibt es nachvollziehbare Gründe. Wer sich mit Seneca befassen muss, besucht möglicherweise eine höhere Lateinklasse am Gymnasium oder studiert die klassischen Sprachen oder Philosophie. Der Titel dieses Buches verspricht ja einen unkomplizierten und recht lebenspraktischen Umgang bzw. eine einfache Vermittlung von Senecas stoischer Philosophie, und bereits ein vorsichtiger Blick auf die vielen Regalmeter selbst einer nur durchschnittlich ausgestatteten Universitätsbibliothek zu den Themen ›Stoa‹ und ›Seneca‹ zeigt, dass es dazu viel zu forschen und zu sagen gab und gibt.
Wer sich außerhalb eines Bildungs- oder gar Prüfungszusammenhangs mit Seneca und seiner Philosophie beschäftigen will, kennt den Philosophen und seine Texte eventuell noch aus der Schule und denkt mit guten oder gemischten Gefühlen daran zurück. Auch an Suchende sei in diesem Zusammenhang gedacht. In einer Welt überbordender Ratgeberliteratur zu Resilienz, Work-Life-Balance, Anti-Stress sowie ganzheitlicher und nachhaltiger (was immer das auch heißen mag!) Lebensgestaltung ist der Blick auf das, was schon vor Jahrtausenden die gebildeten und lebensklugen Köpfe vor uns gedacht haben, oftmals ein heilsamer. Senecas philosophische Ansichten und Aussagen sind alles andere als verstaubt, sind brandaktuell, weil zeitlos, und laden uns zur stetigen Auseinandersetzung mit unserer eigenen Lebensgestaltung ein. Es gibt kaum eine Leserin oder einen Leser, der bzw. dem die Lektüre beispielsweise der moralischen Lehrbriefe nicht das ein oder andere zustimmende Kopfnicken entlocken würde. Dennoch sind Senecas philosophische Aussagen auch streitbar, und nicht jede und jeder kann und will dem zustimmen, geschweige denn danach leben.
Das vorliegende Buch richtet sich also an all diejenigen, die Senecas stoische Philosophie in einem knappen und auf lebenspraktische Elemente ausgerichteten Format kennenlernen oder wiederentdecken möchten. Seine Hauptintention ist demzufolge deren verständliche und moderne Vermittlung. So wurden verschiedene Texte Senecas aus ihrem unmittelbaren Kontext gelöst, ohne dass sie dabei aus dem Zusammenhang gerissen werden. Seneca kommt selbst ausführlich zu Wort und dient nicht nur als reiner Stichwortgeber wie bei Kalendersprüchen. Die einzelnen Kapitel bauen aufeinander auf, da sie von den Grundanliegen der stoischen Philosophie verschiedene Aspekte des menschlichen Lebens aus dieser Perspektive betrachten, sie sind aber auch einzeln als in sich geschlossene Einheiten lesbar, und Vorwissen aus vorangegangenen Kapiteln wird nicht zwingend vorausgesetzt. Die einzelnen Lektionen an sich sind dann zwischen den Aspekten der philosophischen Theorie und deren lebenspraktischer Umsetzung aus der Sicht Senecas aufgespannt, so dass sich die Theorie immer auch an den praktischen Anweisungen messen lassen muss.
In der Übersetzung der ausgewählten Stellen wurde ein Sprachduktus gewählt, der den lateinischen Ausgangstext zwar noch deutlich erkennbar werden lässt, jedoch in Syntax und Lexik auch für Leserinnen und Leser unserer Zeit verständlich ist. Zentral ist dabei, dass die häufig verwendeten philosophischen Fachtermini in moderne Begrifflichkeiten überführt wurden, die für uns Heutige auch ein nachvollziehbares Bedeutungsspektrum repräsentieren. Diese sind als Vorschlag zu verstehen. Wer weiß, welche verschiedenen Bedeutungen die lateinischen Begriffe animus, virtus oder ratio haben, wird sich an mancher zeitgemäßen Übersetzung stoßen. Übersetzungen wie »Geist«, »Mannbarkeit« und »Vernunft« für die genannten lateinischen Begriffe verkürzen jedoch einerseits diese begriffiche Vielfalt empfindlich und sind andererseits für viele Menschen unserer Zeit schlicht miss- oder gar unverständlich.
Jenseits dieser rein philologischen Hinweise sei diese Vorrede aber drei zentralen Fragen unterworfen, die den nachfolgenden Inhalt der Texte Senecas entsprechend einordnen wollen: Warum Philosophie? Warum antike Philosophie? Und schließlich: Warum Seneca?
Warum Philosophie?
Dieser Frage müsste streng genommen die Frage ›Was ist Philosophie?‹ vorausgehen. Zunächst sollte man nämlich wissen, welchen Gegenstand man vor sich hat, bevor man sich darüber klar wird, warum man sich mit ihm auseinandersetzen möchte. Die Frage, was Philosophie sei, wurde in unzähligen Einführungen und philosophiehistorischen Überblicksdarstellungen zuhauf behandelt und zu beantworten versucht.
Der große deutsche Philosoph Immanuel Kant (1724–1804) hat in der Rückschau auf sein philosophisches Forschen und Fragen angemerkt, dass sich seine Beschäftigungen vor allem mit drei zentralen Fragen befasst haben: Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir glauben? Mit diesen Fragen ist auch eine Einteilung der Aspekte vorgenommen, mit denen sich die Philosophie befasst: Die erste Frage betrifft das menschliche Erkennen, die zweite das menschliche Handeln, die dritte schließlich die Gegenstände, über die wir keine sichere Auskunft geben können, die uns als Menschen jedoch unweigerlich angehen, ja bedrängen. Gerade mit der letzten Frage befinden wir uns schon im Bereich der Metaphysik und damit in einem Übergangsbereich zwischen Philosophie und Religion, die über viele Jahrhunderte nicht voneinander getrennt betrachtet wurden.
Man kann anhand der drei kantschen Fragen zunächst also festhalten, dass es der Philosophie um die großen und wichtigen Fragen der Welt und des Menschen in ihr geht. Die Antworten auf diese Fragen sollen dabei für die oder den Einzelnen und die Menschheit insgesamt Gültigkeit besitzen, und dennoch kann es in der Philosophie keine letzt- bzw. endgültigen Antworten geben, so dass jeder Mensch in seinem Nachdenken über das ›Warum?‹ in der Welt immer wieder von Neuem beginnen muss.
Dass der Mensch aber über diese Frage nachdenkt, ja nachdenken muss, ist zugleich Antwort auf die Frage ›Warum Philosophie?‹. Der Mensch ist höchstwahrscheinlich als einziges Lebewesen auf diesem Planeten zu einem Nachdenken und Hinterfragen seiner eigenen Existenz fähig. Dieses Hinterfragen ist zudem ein Kernbedürfnis des Menschen. Wir fragen nach tieferen Zusammenhängen, nach einem Sinn, nach einem Warum. Philosophie ist also ein menschliches Grundbedürfnis, und ein jeder Mensch sucht Antworten auf die sogenannten letzten Fragen, betreibt in seinem Inneren somit Philosophie – häufig ohne sich dessen immer voll bewusst zu sein.
Warum antike Philosophie?
Philosophisches Fragen ist untrennbar verbunden mit einem Blick in die Vergangenheit. Zentrale Fragen über den Kosmos, unser menschliches Dasein darin und die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen beiden sind keine modernen. Es ist Kennzeichen unserer Spezies als Homo sapiens, unsere Umwelt unseren Wünschen und Bedürfnissen anzupassen. Der Mensch selbst in seinem Wollen, seinen Ängsten, seinen Wünschen und Zielen ist jedoch immer noch der gleiche wie vor Jahrtausenden. Einen Unterschied machen lediglich die kulturelle Prägung bestimmter ethnischer Gruppierungen und der technische Fortschritt aus.
Die allermeisten tiefen Fragen wurden in der Vergangenheit bereits gestellt und von den damaligen Denkern und Gelehrten im Geiste ihrer Zeit – und ihr häufig weit voraus – beantwortet. Die ersten für uns noch greifbaren Spuren dieser Antworten finden wir im alten Indien und im alten China. In Zusammenhang mit der chinesischen Philosophie sind vor allem der Name Konfuzius (6./5. Jahrhundert v. Chr.) und dessen lebenskluge Spruchweisheiten heute noch ein Begriff.
Wenn wir von antiker Philosophie sprechen, meinen wir jedoch nicht das alte Indien oder China, sondern die Hochkulturen der alten Griechen und Römer. Sie haben nämlich unseren europäischen Kulturraum in vielerlei Hinsicht maßgeblich geprägt und sind in unserer heutigen Art zu leben nicht mehr wegzudenken – von den philosophischen Abhandlungen eines Platon, Aristoteles oder Cicero bis hin zu den Fremdwörtern unserer Sprache. Selbst der Begriff ›Philosophie‹ entstammt der klassischen Antike, meint »Liebe zur Weisheit«, und hat damit dem suchenden Fragen nach dem Warum erst seinen Namen und seine für unseren Kulturkreis typische Prägung gegeben. Der britische Philosoph und Mathematiker Alfred North Whitehead (1861–1947) behauptete gar, »die sicherste allgemeine Charakterisierung der philosophischen Tradition Europas lautet, dass sie aus einer Reihe von Fußnoten zu Platon besteht«. Dies mag sicher überzogen sein, zeigt aber dennoch genau den Grund auf, warum es sich lohnt, sich mit antiker Philosophie zu beschäftigen. Sie ist das Denk-Fundament Europas. Wenn wir uns mit ihr befassen, befassen wir uns mit den Grundpfeilern abendländischen Denkens, das in vielerlei Hinsicht so aktuell ist, wie es zur Zeit seiner Abfassung war.
Warum gerade Seneca?
Wenn wir Whiteheads Zitat ernst nehmen, dürften wir nicht Seneca lesen, sondern müssten uns rein auf die Schriften Platons (428–348 v. Chr.) konzentrieren. Und wenn die Lektüre dieses herausragenden Philosophen grundlegend für beinahe alle weiteren Denker des Abendlandes ist, so weist doch Senecas Philosophie bestimmte Merkmale auf, die eine Beschäftigung mit seinen Schriften als besonders ertragreich erscheinen lassen:
Zunächst ist zu beachten, dass sich Senecas Denken aus der Philosophie des Hellenismus speist, jener Zeit, die vom Regierungsantritt Alexanders des Großen (336 v. Chr.) bis zur Eroberung Ägyptens durch die Römer (30 v. Chr.) reicht. Maßgeblich für die Philosophie dieser Zeit sind die Schulen des Epikureismus und der Stoa, die im Kern auf eine zentrale philosophische Fragestellung unterschiedliche, ja teilweise kontroverse Antworten gaben: der Frage nach dem für den Menschen höchsten Gut.
Während im Epikureismus ein an Annehmlichkeiten orientiertes Leben als das höchste Ziel gilt, geht die Stoa von einem grundlegenden Unterschied zwischen Weisen und Nicht-Weisen aus. Nur ein weiser Mensch kann sittlich gut handeln, besitzt Tugend in Vollendung, nur er kann als frei und glücklich gelten. Für die Stoa ist der gesamte Kosmos von einer höheren Kraft, der sogenannten Weltvernunft, durchströmt. Der weise Mensch hat mit seiner Vernunft Anteil an dieser Weltvernunft, so dass Kosmos, Welt und Mensch als beseeltes Ganzes gesehen werden können. Durch diese Ordnung ist der gesamte Ablauf des weltlichen Geschehens vorherbestimmt, und es ist Aufgabe und Ziel eines Weisen, sich in diese Ordnung einzufügen und sein damit verbundenes Schicksal freiwillig anzunehmen.
Was sich hier sehr rigoros und sehr theoretisch liest, gewinnt in Senecas Philosophie eine deutlich lebenspraktische Ausrichtung. Er selbst, 4 v. Chr. in Spanien geboren, erhielt seine philosophische und rhetorische Ausbildung in Rom, schlug zunächst eine politische Karriere ein, geriet unter die Räder einer kaiserlichen Machtpolitik und wurde im Zuge dessen für acht Jahre nach Korsika verbannt. Doch eine jede Machtstruktur benötigt fähige und gebildete Leute, und so wurde Seneca aus dem Exil zurückberufen, um als Erzieher des späteren Kaisers Nero zu wirken. Gerade die ersten Herrschaftsjahre Neros (er trat im Jahr 54 die Regierung an) standen stark unter dem Einfluss Senecas, der mit einem Amtskollegen zusammen die Verwaltungsgeschäfte des Reiches leitete. Als sich der labile Geisteszustand Neros jedoch immer offener zeigte, zog sich Seneca aus der Politik zurück, wurde wenig später von Nero der Verschwörung bezichtigt und zum Selbstmord gedrängt. Ihn vollzog er in philosophischer Gelassenheit im Kreise seiner Freunde. Wir erkennen in dieser aufs Wesentliche reduzierten Biographie das wechselvolle Leben eines gleichermaßen gebildeten und politisch engagierten Menschen.
Gerade die Kenntnis dieser Wechselfälle führt dazu, dass Senecas Philosophie den stoischen Rigorismus durchbricht und die Emotionen als einen Teil des Menschen anerkennt – der jedoch keine Macht auf ihn ausüben dürfe. Bei Seneca steht hauptsächlich die Frage nach einem glücklichen und erfüllten Leben im Mittelpunkt der Betrachtung. Dieses besteht vor allem in der Unabhängigkeit von äußeren Gütern. An ihre Stelle tritt ein Leben gemäß der Weltvernunft, die den Kosmos durchzieht und an der, wie schon angesprochen, auch der Mensch Anteil haben kann. Die Aufgabe des Menschen liegt daher in einem Leben in Orientierung an dieser Weltvernunft und in der Vervollkommnung des eigenen Ichs.
Diesen Auftrag vermittelt Seneca in seinen Schriften insbesondere in Dialogform und in Briefform; damit nimmt er immer auf ein persönlich gedachtes Gegenüber Bezug und kann dadurch – anders als bei einem wissenschaftlichen Traktat – seinen Lesern auf Augenhöhe begegnen, persönliche Erfahrungen miteinbeziehen und einen unkomplizierteren Sprachstil anschlagen, der bisweilen sogar im Plauderton dem Gegenüber Tipps zur Lebensgestaltung gibt:
Der Hauptinhalt meines Vorgehens ist wie folgt: Was wir meinen, wollen wir aussprechen, was wir aussprechen, wollen wir auch so meinen. Die Rede soll mit der Lebensführung übereinstimmen.
(Epistulae morales 75,4)
Folgen wir also Seneca als Lotsen hin zu einem sinnerfüllten Leben im Glauben an die Autonomie des Menschen unter dem Gebot der Vernunft!
Wie ein glückliches Leben gelingt
Zehn philosophische Lektionen mit Seneca
LEKTION 1: Wie führt man ein glückliches Leben?
Die Frage, wie man ein glückliches Leben führt, ist eine der schwierigsten und gleichzeitig wichtigsten, und in allen Epochen haben die Menschen sie sich gestellt. Sie ist unmittelbar verknüpft mit der Frage, was generell unter Glück im Sinne von Lebensglück bzw. Glückseligkeit zu verstehen ist. Die Vorstellung, dass Glück vor allem in Reichtum, Ehre, Macht, Gesundheit, Leistungsfähigkeit und einer langen Lebensspanne besteht, ist vermutlich älter als die Philosophie selbst, und man darf konstatieren, dass die genannten Aspekte vor allem in ihrer Kombination das Leben ungemein erleichtern und angenehmer gestalten.
Gleichzeitig sind alle diese Güter aber auch dem unwägbaren Schicksal ausgesetzt und kein Mensch hat eine Garantie, immer vermögend und gesund zu sein oder in ehrbarer Stellung und lange zu leben. Ebenso gibt es Menschen, die ein Leben in großer Glückseligkeit führen, dabei weder eine machtvolle gesellschaftliche Position innehaben noch mit außergewöhnlichem Reichtum gesegnet sind. Wenn wir an den Jahrhundertphysiker Stephen Hawking (1942–2018) denken, müssen wir sogar zu dem Schluss kommen, dass selbst ein extrem schlechter gesundheitlicher Zustand nicht per se ein glückliches und erfülltes Leben verunmöglicht.
Bereits der vorsokratische Philosoph Heraklit (6./5. Jahrhundert v. Chr.) hielt fest, dass wenn Glück in der Befriedigung leiblicher Genüsse bestünde, dann auch Ochsen ein glückliches Leben führen müssten, wenn sie Erbsen zum Fressen gefunden hätten. Eine inhaltlich vergleichbare, wenn auch differenziertere Sichtweise bietet Seneca in seinem Œuvre, besonders in dem programmatischen Werk De vita beata – Vom glücklichen Leben.
Definition: Was ist ein glückliches Leben?
Ein glückliches Leben besteht in der Übereinstimmung mit dem eigenen Wesen. Dies kann nur gelingen, wenn erstens ein gesunder Geist vorhanden ist und dieser fortdauernd im Besitz seiner Gesundheit ist. Zweitens, wenn er stark und energisch ist, ferner auf vortrefflichste Art leidensfähig, den Zeitumständen gewachsen, achtsam hinsichtlich des eigenen Körpers und der damit zusammenhängenden Dinge, jedoch nicht ängstlich. Sodann, wenn er achtsam gegenüber sonstigen Dingen ist, die das Leben ausmachen, ohne irgendeiner Sache zu viel Bedeutung beizumessen. Wenn er die Gaben des Schicksals nutzen, nicht ihnen dienen will.
(De vita beata 3,3)
Seneca stellt seine Definition eines glücklichen Lebens ganz in stoischer Tradition außerhalb der genannten vom Schicksal abhängigen Glücksgüter auf. Diese spielen für das Lebensglück keine Rolle. Ein Leben wird vor allem durch die innere Einstellung glücklich, wenn Ausgeglichenheit, Maß und Mitte die zentralen Orientierungspunkte sind.
Lebensglück: Eine Frage der eigenen Einstellung
Diese Ausgeglichenheit bezieht sich jedoch nur auf äußere Güter, also vom Schicksal abhängige Aspekte des menschlichen Lebens. Hinsichtlich der inneren Güter, allen voran der ethisch-moralisch richtigen und charakterfesten inneren Einstellung (virtus) des Menschen, gibt es jedoch kein Maß und keine Mitte – sie gilt als summum bonum, als höchstes Gut.
Das höchste Gut besteht in einer stabilen inneren Stärke, in Weitblick, Erhabenheit, Besonnenheit, Freiheit, Harmonie und sittlicher Würde. Das höchste Gut ist eine innere Einstellung, die Zufälliges verachtet und froh ist über ihre ethische Grundhaltung. … Was nämlich hindert uns daran, ein glückliches Leben als eine freie, aufrichtige, unerschrockene und feste innere Einstellung zu definieren, jenseits von Furcht und Gier? Als eine innere Einstellung, der ein ehrbares Verhalten das einzige Gut, ein unmoralisches Verhalten als einziges Übel gilt? Der die übrige Menge an Dingen bedeutungslos ist, weil diese dem glücklichen Leben weder zu- noch abträglich ist und ohne Steigerung oder Minderung des höchsten Gutes kommt und geht? (De vita beata 2,2–3)
… Deshalb darf man mutig bekennen, dass das höchste Gut innere Harmonie bedeutet. Charakterstärke wird sich nämlich zwangsläufig dort einfinden, wo jemand mit sich im Reinen ist. Charakterliche Schwächen sind immer ein Ausdruck innerer Zerrissenheit.
(De vita beata 8,6)
Nicht äußere Güter also, sondern nur die inneren sind willentlich beeinflussbar. Nur hinsichtlich seines inneren Wesens vermag der Mensch daher Veränderungen vorzunehmen, die dann jedoch weitreichende Folgen haben. Sobald man nämlich die geforderte innere Einstellung, äußere Güter geringzuschätzen, angenommen hat, folgt als Konsequenz die Möglichkeit zur willentlichen Beeinflussung des eigenen Lebens.
Man erkennt aber, welcher schlimmen und schädlichen Sklaverei derjenige dienen wird, den Vergnügen und Schmerz – Herrscher ohne jegliche Beständigkeit und ohne jeglichen Einfluss – abwechselnd in Besitz nehmen. (De vita beata 4,4)