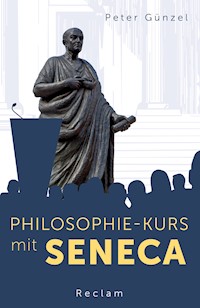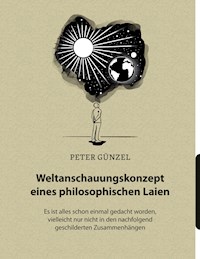
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit meiner Jugend beschäftige ich mich mit weltanschaulichen Fragen, insbesondere religiöser, gesellschaftspolitischer und wissenschaftlicher Natur. Nach Abkehr vom Christentum auf Grund seiner Widersprüchlichkeit habe ich nach einem Glaubensbekenntnis gesucht, das mit wissenschaftlicher Erkenntnis vereinbar ist und durch wissenschaftlichen Fortschritt nicht in Frage gestellt wird. Darüber hinaus habe ich mit Hilfe der kritisch-rationalen Denkweise versucht, ein Gesamtbild der Entwicklung des Kosmos vom Urknall bis zur Gegenwart auf unserer Erde zu entwickeln. Das Ergebnis dieser Überlegungen ist in dem vorliegenden Weltanschauungskonzept dargelegt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Autor
Dr. Peter Günzel, geboren am 22.04.1937 in Breslau hat nach der Vertreibung aus Schlesien in Forst (Lausitz) in der damaligen DDR 1955 Abitur gemacht und anschließend an der Humboldt- und der Freien Universität (FU) Berlin Veterinärmedizin studiert. Nach kurzer Tätigkeit an der FU war er 37 Jahre in der pharmazeutischen Forschung der Schering AG beschäftigt, zunächst mit der Fortbildung in Pharmakologie, Toxikologie und Versuchstierkunde, danach mit dem Aufbau der Abteilung, dem späteren Institut für Experimentelle Toxikologie, das er 33 Jahre geleitet hat.
Neben der wissenschaftlichen Arbeit war er in mehreren wissenschaftlichen Gesellschaften und Gremien auf deutscher und europäischer Ebene engagiert und hat an einer Vielzahl von Publikationen und zwei Lehrbüchern mitgewirkt.
Nach seiner Pensionierung hat er 15 Jahre lang als selbständiger Sachverständiger und Gutachter für Fragen der Arzneimitteltoxikologie für national und international engagierte Firmen, Gesellschaften und Organisationen gearbeitet.
Inhalt
0. Apodictum
1. Vorwort
2. Mein Weg vom traditionellen (christlich-evangelischen) spirituellen Glauben zur religions- und ideologiefreien philosophischen Betrachtung der Welt
3. Mein jetziges Glaubensbekenntnis und seine Einordnung in die spirituelle Welt
4. Hierarchisch gegliederte Ebenen zur Strukturierung der kritisch-rationalen Diskussion
5. Die wesentlichen evolutionären Prozesse
6. Mensch und Gesellschaft – Voraussetzungen
7. Grundbedürfnisse des Menschen (mein anthropologisches Menschenbild)
7.1 Primäre Grundbedürfnisse
7.2 Sekundäre Grundbedürfnisse
8. Lebensbereiche des Menschen
8.1 Physikalisch-biologischer Lebensbereich (PBL)
8.2 Geistig-kultureller Lebensbereich (GKL)
8.3 Bereich der psychologischen Befindlichkeit (siehe sekundäre Grundbedürfnisse) (BPB) – des Individuums mit seiner Seele / der Gemeinschaft
9. Grundregeln, deren Einhaltung das friedliche Zusammenleben der Menschen ermöglichen (Ethik, Moral, Sitten und Gebräuche)
9.1 Begriffsklärung
9.2 Inhalte und ihre Entwicklung
9.3 Einige allgemeine Grundsätze
10. Die Erde als Raumschiff
10.1 Vorbemerkung
10.2 Das Klima
10.3 Die Erdbevölkerung und ihre Folgen
10.4 Fazit
11. Versuch eines konzentrierten Gesamtbildes
12. Danksagung
13. Literatur- und Quellenverzeichnis
14. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
15. Schlagwortverzeichnis
0. Apodictum
Ein Apodictum ist eine unumstößlich geltende Aussage. Im vorliegenden Fall handelt es sich in erster Linie um das methodische Vorgehen bei der Gewinnung neuer Erkenntnisse. Gemeint ist die dialektische Methodik und die Denkweise von Popper (Popper, K. 1974) bei der Erkenntnisgewinnung, d.h. die logische Reihenfolge von
Problemidentifikation ⇒ Problemanalyse ⇒ Formulierung einer Lösungshypothese ⇒ Entwicklung einer Lösungstheorie ⇒ Versuch der Falsifikation dieser Theorie ⇒ Überprüfung der Theorie durch Experiment bzw. Vergleich mit der Realität ⇒ bei Fehlschlagen der Falsifikation zum gegenwärtigen Zeitpunkt Akzeptanz dieser Theorie als die beste z.Zt. erreichbare „Wahrheit“.
Diese Denkweise ist von genereller Bedeutung. Auch der Volkswirtschaftler, Ökonom und Hochschullehrer des Jahres 2016, Hans-Werner Sinn, bekennt sich dazu, wenn er sagt:
„Die Revision des bisherigen Standpunkts aufgrund neuer Fakten und wahrer Argumente ist das A und O der Wissenschaft“(Sinn, Hans-Werner, 2018, Seite 628)
Diese Vorgehens- (Denk-) weise impliziert, dass es keine absoluten Wahrheiten gibt. Die Überprüfung der Theorie durch Experiment bzw. Vergleich der Theorie mit der Realität erfordern kluges rationales Handeln. Dabei erweist sich noch immer die alte chinesische Weisheit (Konfuzius, 551–479 v. Chr.) als relevant:
„Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken, das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.“
Bei der o.g. Vorgehensweise in der Erkenntnisgewinnung, die als „wissenschaftlich“ im Sinne Popper’s gilt, muss immer von der letzten besten „Wahrheit“ (siehe oben) ausgegangen werden. Von dieser Wahrheit (Erkenntnis) ausgehend, kann man nur zeitlich rückblickend analysieren, während über die Zukunft nur Vermutungen (Spekulationen, Hypothesenbildungen) angestellt werden können. Sichere Vorhersagen sind nicht möglich.
Allerdings gelangt man bei der rückblickenden Analyse mangels exakter wissenschaftlicher Erkenntnisse ebenfalls in den spekulativen Bereich (Vermutungen, Hypothesenbildungen etc.), jedoch mit der Aussicht, durch den anhaltenden Forschungsprozess zu neuen, besser gesicherten Erkenntnissen zu gelangen.
1. Vorwort
Mit weltanschaulichen Fragen, und zwar mit Glaubensfragen beginnend, habe ich mich schon seit früher Jugendzeit beschäftigt. Näheres dazu werde ich im nächsten Kapitel darlegen. Später kamen dann weitergehende Überlegungen dazu. Insbesondere waren es zunächst neben den Glaubensfragen die Beziehungen der Menschen zueinander, das Funktionieren der Gesellschaft mit ihren Regelgebungen (z.B. Gesetzgebung; siehe auch Kapitel 9.), die physikalischen und chemischen Zusammenhänge in unserer Welt und die Entwicklung des Universums. Während meiner beruflichen Tätigkeit im Angestelltenverhältnis bis 1997 und in den 15 Jahren danach als Freiberufler hatte ich wenig bis keine Zeit, mich intensiver mit den einzelnen Problemkreisen zu befassen und einschlägige Literatur zu lesen. Erst danach bin ich zu intensiverem Literaturstudium gekommen. In gelegentlichen Gesprächen im Familien- und Freundeskreis wurden mehr und mehr einzelne Fragen diskutiert. Allmählich begann ich die Übersicht über die Argumente zu einzelnen Fragen und Problemdiskussionen zu verlieren. Daneben fiel mir mehr und mehr auf, dass in den Gesprächen von einem Problem zum nächsten gesprungen und kein Thema konzentriert ausdiskutiert wurde. Es fehlten ein „roter Faden“ und eine klare Strukturierung der Gespräche. Also begann ich etwa ab 1998 zunächst einmal meine Gedanken, Argumente und Antworten in sehr konzentrierter Form zu notieren und mein „Weltanschauungskonzept“ zu entwickeln. Diese Notizen habe ich dann im Familien- und Freundeskreis an 15 Personen versandt und um kritische Diskussion gebeten. Daraufhin kamen zunächst einmal ausnahmslos vorsichtig positive bis eindeutig und einschränkungslos zustimmende Antworten und vereinzelt die Ankündigung ausführlicherer schriftlicher Rückäußerungen. Bis auf fünf, für die ich sehr dankbar bin, ist es dabei geblieben. In einzelnen Gesprächen danach habe ich allerdings den Eindruck gewonnen, dass neben der Scheu davor, sich zu diesen Dingen schriftlich festzulegen, doch erhebliche Schwierigkeiten bestanden und bestehen, sich gegenseitig verständlich auszudrücken und sicher zu stellen, dass man sich auch wirklich verstanden hat. Das lag nicht zuletzt daran, dass die einzelnen Gesprächsteilnehmer bestimmte Begriffe mit z.T. recht unterschiedlichen inhaltlichen Vorstellungen verbanden. So wurde und wird z.B. nicht deutlich unterschieden, ob mit dem Wort „Glaube(n)“ gemeint ist
oder
ich glaube (ich bin gläubig), weil ich einer bestimmten Religions- (Glaubens-) Gemeinschaft angehöre (spiritueller Glaube
mit
religiöser Ideologie, sowohl
mit
als auch
ohne
Gottesglauben; letzteres z.B. im Buddhismus),
oder
ich glaube an Gott
1)
(ich bin gläubig)
ohne
einer Religions- (Glaubens-) Gemeinschaft anzugehören (spiritueller Glaube
ohne
religiöse oder weltanschauliche Ideologie),.
oder
ich glaube an das absolute Nichts, denn irgendwoher muss das Universum (das All, der ganze Kosmos) ja kommen,
oder
ich glaube an die ewige Existenz des Universums, aus dem der Kosmos durch den Urknall entstanden ist.
1)Gott, ein „übermenschliches Sein (Seiendes, Gott); Gott als ewiges unveränderliches Wesen jenseits des menschlichen Verstandes(Dennett D.C. 2008, S.25)
Nur die Anhänger der beiden letzten Glaubenskategorien sind wirkliche Atheisten, aber doch „gläubig“. Ich erwähne das ausdrücklich, da sich relativ häufig Menschen, die keiner Religion angehören, als Atheisten bezeichnen, obwohl sie lediglich „areligiös“ sind.
Aus dem oben gesagten resultiert, dass es mit Ausnahme der Realitätsgläubigen keine wirklich Ungläubigen gibt und geben kann, da keine der vier anderen genannten Glaubenskategorien auf eine wirkliche Beweisführung zurück greifen kann. Das wird in Kapitel 4 näher erläutert.
Es ist leicht verständlich, dass Missverständnisse und „Aneinander – vorbei – reden“ geradezu vorprogrammiert sind, wenn die Gesprächspartner nicht geklärt haben, über welchen der fünf o.g. möglichen Inhalte des Wortes „Glaube(n)“ sie diskutieren wollen.
Deshalb habe ich mich entschlossen, meine Gedanken in ausführlicherer Form darzulegen, verbunden mit der Hoffnung, dadurch das Verständnis zu fördern und die gewollt kritischen Gespräche zu erleichtern und fruchtbarer zu gestalten.
Schon an dieser Stelle eine Anmerkung zum „Realitätsglauben“ (erste Glaubenskategorie, siehe oben): Er ist sowohl sprachlich wie inhaltlich ein Paradoxon. Sprachlich bedeutet doch glauben, etwas als „richtig“ zu akzeptieren, was man sachlich nicht beweisen kann. Realitäten aber sind doch, wie oben bereits gesagt, Dinge, die man hören, sehen, fühlen, schmecken, riechen, verstehen, begreifen/wissen kann. Sie sind wissenschaftlich beweisbar. Insofern sind sie nicht dem „Glauben“ sondern dem „Wissen“ zuzuordnen. Dabei ist natürlich nicht zu vergessen, dass „Wissen“ nicht „absolut wahr“ sondern immer die zu einem bestimmten Zeitpunkt bestmögliche Annäherung an die Wahrheit ist (Popper’sche Definition, siehe Apodictum).
Wenn sich jemand auf diesen „Realitätsglauben“ beschränkt, kann das eigentlich nur bedeuten, dass er über die letzten Dinge – woher kommt das Universum mit allem, was dazu gehört (das All) – nicht nachdenkt, weil ihn diese Dinge nicht berühren oder interessieren oder er/sie nicht darüber nachdenken will oder kann, obwohl nach dem Wesen und nach dem Grunde zu fragen das zentrale philosophische Anliegen mindestens seit Thales von Milet (6. Jahrhundert vor Christus) ist (Weischedel, W. 2017, S. 11-15).
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Lee Smolin in seinem Ausblick jenseits der Quantenwelt (Smolin, Lee, 2019, S. 302-303) Leibniz (16461716 n. Chr.) als den Schöpfer des „Prinzips des zureichenden Grundes“ zitiert. Dieses Prinzip besagt, dass sich das Universum völlig verstehen lässt d.h., dass wir für jedes Ereignis im Laufe der Evolution des Universums eine rationale Erklärung entdecken können, dass
„jedes Ereignis in der Geschichte des Universums durch Relationen zu anderen Ereignissen verwoben ist, die ausdrücken, welche Ereignisse eine Ursache von welchen anderen sein könnten. Diese Kausalrelationen zeichnen die Geschichte von Veränderungsprozessen auf“(Smolin, Lee, 2019, S 328)
Er ist mit dieser An- und Einsicht also letztlich nicht weiter, als es Thales von Milet vor rund 2500 Jahren auch schon war. Sie bildet im Übrigen auch die Grundlage für die von mir vorgeschlagene Strukturierung der kritischen Diskussion in Kapitel 4. Sie bildet dort den Ausgangspunkt für den „Start“ der kritisch-rationalen Diskussion auf der Ebene 1 (siehe Kapitel 4).
Wie oben bereits dargelegt, habe ich mich mit weltanschaulichen Fragen von früher Jugend (nach meiner Konfirmation mit 14 Jahren) gedanklich beschäftigt, d.h. meine Ansichten durch eigene Überlegungen „errungen“ und weiterentwickelt. Erst nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben bin ich dazu gekommen, ein wenig in die einschlägige Literatur einzusteigen.
Dabei habe ich, in für mich zunächst überraschender Weise, den Eindruck gewonnen, dass in der Welt der Philosophie nahezu alles schon einmal gedacht wurde; deshalb auch die Wahl der Überschrift zu diesem Papier. Das „zunächst überraschend“ möchte ich allerdings gleich wieder relativieren. In den ca. 6000 Jahren unserer Kulturgeschichte hat sich der Mensch biologisch im Sinne der Evolution nicht in für uns erkennbarer Weise weiterentwickelt, auch wenn es in ca. 10 000 Jahren dokumentierter DNA-Geschichte einige nachweisbare Veränderungen der menschlichen DNA gegeben hat (Hawking,S., 2018, S. 101). In der Zeitrechnung der Evolution (ca. 105-109 Jahre) ist der Zeitraum von 6000 Jahren für deutlich wahrnehmbare evolutionäre Qualitätsänderungen der Spezies Mensch jedoch viel zu kurz.
Ein Bit Information ist die Antwort auf eine ja/nein-Frage. Hawking (2018, S.: 101) schätzt die Gesamtmenge der nützlichen Informationen in unseren Genen auf etwa 100 Millionen Bits. Möglicher Weise ist sie noch viel größer, da noch nicht alle Sequenzen der etwa 3 Milliarden Basenpaare hinsichtlich ihres Informationsgehalts entschlüsselt sind. So hätte das Genom des Menschen mit etwa 3,27 Milliarden Basenpaaren einen maximal möglichen Informationsgehalt von 6,54 Milliarden Bit (Wikipedia , Genom, 2021). Bleibt man jedoch bei der Schätzung von Hawking (siehe oben), haben sich in der etwa 20 Millionen Jahre währenden Entwicklung des Menschen aus den gemeinsamen Vorfahren mit den Affen die nützlichen Informationen der menschlichen DNA nur um einige Millionen Bit verändert. Daraus ergibt sich, dass die biologische Evolutionsrate im Menschen nur ungefähr ein Bit pro Jahr beträgt (Hawking. S., 2018, S.: 102-103). Mithin dürfen wir davon ausgehen, dass sich das menschliche Gehirn und das Denkvermögen im Zeitraum unserer Kulturgeschichte (ca. 6000 Jahre) und Zivilisation [(ca. 10 000 Jahre; wenn man das Alter der ältesten Höhlenmalereien als Ausgangspunkt wählt, ca, 37 000 Jahre) (Wikipedia 27.08.2017)] nicht oder zumindest nicht wesentlich verändert haben (siehe auch Hawking, S., 2018, S.: 184 und 204). Deshalb ist gar nicht so erstaunlich, dass schon die antiken Philosophen zu Einsichten gelangt sind, die uns heute auf Grund der kolossalen Fortschritte der Wissenschaften, insbesondere auf den Gebieten der Physik (und Astrophysik), Chemie (und Astrochemie), Astronomie und Mathematik sehr viel leichter fallen. So hat z.B. etwa 300 Jahre v. Chr. der Philosoph Aristarch von Samos aus seinen Studien über Mondfinsternisse abgeleitet, dass die Erde um die Sonne kreist. Ferner war er der Ansicht, dass die Sterne Sonnen in sehr viel weiterer Entfernung sind und das Universum bestimmten Prinzipien oder Gesetzen gehorcht (Hawking, 2018, S. 50-51). Geradezu phantastisch finde ich die weise Ansicht des Thales von Milet bereits im 6.Jahrhundert vor Christus, dass in der Welt ein einheitliches Prinzip („ein mächtig Göttliches“) waltet, aus dem sich alles, was ist, entwickelt hat (Weischedel, W., 2017, S. 17). Das entspricht exakt der Ansicht und Einsicht des z.Zt. berühmtesten theoretischen Physikers Hawking (siehe Kapitel 4 und 5).
2. Mein Weg vom traditionellen (christlich-evangelischen) spirituellen Glauben zur religions- und ideologiefreien philosophischen Betrachtung der Welt
Die nachfolgenden Notizen sind der Extrakt meiner Überlegungen und Studien zu weltanschaulichen Problemen, mit denen ich bald nach meiner Konfirmation im 15. Lebensjahr begonnen habe. Auslöser war mein Empfinden der Widersprüchlichkeit des Christentums in sich und die Vermessenheit, vermeintlich zu wissen, was Gott will (intensive Gespräche mit Pfarrer Fiebig in Groß-Kölzig 1951).
Der fundamentale Widerspruch ist auch heute noch für mich:
Einerseits heißt es „ ...vor Gott sind alle Menschen gleich“ (Bibel, Roemer 2:11), andererseits „Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich“ (Bibel, Johannes 14:6). Letzteres setzt also zwangsläufig voraus, dass ein Mensch Christ sein muss, „um zu Gott zu kommen“. Dabei unterstelle ich einmal, dass mit dem „zu Gott kommen“ sowohl der Glaube an Gott als auch der Glaube an die Wanderung der Seele zu Gott nach dem Ableben gemeint sind. Fatal ist auch die Unterteilung in Christusgläubige und -ungläubige, wie das Gleichnis vom Weltgericht (Matthäus25, 31-46) zeigt, in dem der kommende Menschensohn als Weltenrichter die Völker zu sich ruft, um sie zu richten. Er unterteilt sie als Hirte in Schafe (die Guten) und Böcke (die Bösen). Oder: „Wer da glaubt und getauft ist, der soll selig werden, wer aber nicht glaubt, der soll verdammt werden“ (Markus 16,16). Oder: „Dann übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen, und dem Evangelium Jesu, unseres Herrn, nicht gehorchen…., mit ewigem Verderben werden sie bestraft“ (2. Thessalonicher 1,7-9). Oder: „Wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht“ (1. Korinther 16,22).
Sehr eindrücklich schildert Voltaire die Absonderlichkeiten der christlichen Kirche:
„Dieser Herrscher (gemeint ist der christliche Gott, Gü.) , der das, was wir Gerechtigkeit nennen, in verschwenderischer Fülle besitzt, dieser Vater, der seine Kinder so unendlich liebt, dieser Allmächtige soll Wesen nach seinem Bilde geschaffen haben, um sie alsbald durch einen bösen Geist in Versuchung zu führen und der Versuchung erliegen lassen, um Wesen, die er unsterblich geschaffen hatte, sterben zu lassen, um ihre Nachkommenschaft mit Unglück und mit Verbrechen zu überhäufen? Und das ist noch nicht der empörendste Widerspruch für unsere schwache Vernunft. Wie kann Gott, der später das Menschengeschlecht erlöst durch den Tod seines einzigen Sohnes oder vielmehr, da er ja selbst Mensch wird und für die Menschen stirbt, durch seinen eigenen Tod, fast das gesamte Menschengeschlecht, für das er gestorben ist, dem Schrecken ewiger Qualen preisgeben? Betrachtet man diese Lehre als Philosoph, dann ist sie gewiss ungeheuerlich, abscheulich. Sie macht aus Gott die Bosheit selbst“.(Weischedel, W., 2017, S. 184-185)