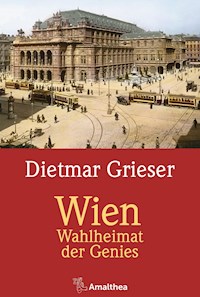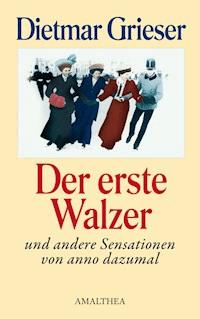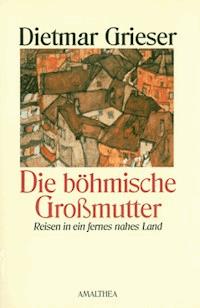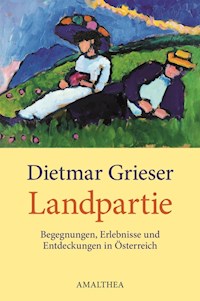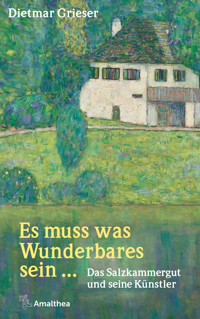11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Nach seinen berühmten ›Schauplätzen der Weltliteratur‹ ist der Literatourist Dietmar Grieser wieder einmal auf Spurensuche gegangen. Er erreiste eine reizvolle Literaturgeschichte in lebenden Bildern. Der Dichter und sein Modell – ein unterhaltsames literarisches Who is Who. Wer steckte hinter berühmten Romanfiguren, die zum großen Teil auch Filmhelden wurden, und was ist später aus ihnen geworden? (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Ähnliche
Dietmar Grieser
Piroschka, Sorbas & Co.
Schicksale der Weltliteratur
FISCHER Digital
Inhalt
»Was da, Identität!
Will er mich wohl mit
seinen Identitäten
in Frieden lassen?«
THOMAS MANN
»Die Nachwelt wird auf dich als auf ein Muster sehen.«
EWALD VON KLEIST
Meinem Bruder Helmut in memoriam
Piroschka, Sorbas & Co.
Zur Einführung
»Der Kellner des Gasthofes ›Zum Elephanten‹ in Weimar, Mager, ein gebildeter Mann, hatte an einem fast noch sommerlichen Tag ziemlich tief im September des Jahres 1816 ein bewegendes, freudig verwirrendes Erlebnis.« Nach vierundvierzig Jahren der Distanz war die »Hofräthin Witwe Charlotte Kestner, geb. Buff«, Goethes Jugendgeliebte, Werthers Lotte, der Versuchung erlegen (Stefan Zweig nennt es eine »süße Torheit«), den Theseus ihrer Mädchenjahre wiederzusehen: »Lotte in Weimar«. Thomas Mann wird dem »wahrhaft buchenswerten Ereignis« einen seiner vergnüglichsten Romane abgewinnen.
Dem Kellner Mager, ein »Mann von Kopf«, »wohlbelesen und citatenfest«, eine »von jung auf literärische Seele«, den die unverhoffte Konfrontation mit dem »geheiligten Wesen« gänzlich aus der Fassung bringt, räumt der Dichter fast das gesamte erste Kapitel ein. »Das Haus hat also die Ehre und die unschätzbare Auszeichnung, die wahre und wirkliche, das Urbild, wenn ich mich so ausdrücken darf –« stammelt der gute Mann und unternimmt alles, die Formalitäten der Ankunft künstlich in die Länge zu ziehen, nur um der »Begegnung mit einer von Schimmer der Poesie umflossenen Persönlichkeit« das Möglichste abzugewinnen, »die hier waltende Identität und die sich eröffnende Perspective« auszukosten: »Es ist nicht gemeine und unstatthafte Neugier.«
Was aber ist es dann?
»Es ist einem beschieden, an der Quelle selbst – man muß es wahrnehmen, man darf es nicht ungenützt –«: Wieder geraten ihm im Taumel der Erregung die Sätze außer Kontrolle. Begreiflich: »Ich habe es mir einfach nicht träumen lassen.«
Eine lächerliche Figur, dieses Faktotum Mager – auf einer Stufe stehend mit dem Autogrammsammler?
Nun, ganz so einfach wird man ihn wohl doch nicht abtun dürfen; immerhin kann er – aller Personenkult einmal außer Betracht – auch auf eine präzise Kenntnis des Werkes verweisen, dessen »weltberühmte und unsterbliche Heldin« ihm nun »in voller Leiblichkeit« gegenübersteht: Wie oft haben er und »Madame Mager« sich »bei der Abendkerze mit zerflossenen Seelen über die himmlischen Blätter gebückt«! Man wird ihn also lediglich in seinem Gleichsetzungsdrang etwas bremsen müssen: »Mein lieber Herr Mager, Sie übertreiben gewaltig, wenn Sie mich oder auch nur das junge Ding, das ich einmal war, einfach mit der Heldin jenes vielbeschrienen Büchleins verwechseln.«
Dann aber wird man wohl sagen dürfen: Es hat schon allerlei Reiz, seinen Blick auf das literarische Urbild zu richten – was immer von diesem in die betreffende Gestalt eingeflossen ist: rüde Abschilderung oder bloß entfernte Ahnung, behutsame Verfremdung oder radikale Umformung, Kunstfigur oder Prototyp. Wie war das doch gleich mit der »wirklichen« Effi Briest? Und wer steht hinter diesem Sorbas? Wie kam Franz Werfel zu seiner Teta Linek, wie Scholem Alejchem zu seinem Milchmann Tewje? Überhaupt: Was sind das für Leute, die in die Literatur eingehen: Sind es Auserwählte? Oder Durchschnitt? Tun sie selber etwas dazu, oder passiert »es« einfach – wie ist das? Und wie wirkt das Ganze auf sie zurück? Zahlt ihnen der Schriftstellerverband eine Leibrente, gehen sie fortan stolzerhobenen Hauptes durchs Leben oder im Gegenteil aufs schwerste verunsichert – wie Schlemihl, dem man seinen Schatten abgekauft hat?
Thomas Manns Tadzio – ist er nicht einem Knaben nachgezeichnet, dem der Dichter wirklich in Venedig begegnet ist? Heute vielleicht ein Mann im Greisenalter – wie wär’s, man nähme seine Spur auf? Gerhart Hauptmanns Fuhrmann Henschel – auch da hat man irgendwann einmal von persönlichen Nahverhältnissen gehört; das könnte ein Flüchtlingsthema werden. Und der verkrüppelte Bettler Porgy aus dem Negerviertel von Charleston – richtig: Auch er hat leibhaftig gelebt. Auf nach Amerika!
In keinem Adreßbuch der Welt wird man die Namen Piroschka und Don Camillo finden. Besuchen kann man sie trotzdem. In Brechts »Hauspostille« steht eines der schönsten Liebesgedichte deutscher Sprache: »Erinnerung an die Marie A.« Die Dame ist kein Phantom. Nur: Klammern Sie sich nicht an das A, sie hat inzwischen geheiratet. Mit Stefan Georges »Maximin« hat es ein böses Ende genommen; um den alten Gunderloch aus Zuckmayers »Fröhlichem Weinberg« und um den »lendengewaltigen Selcher« aus Anton Wildgans’ »Kirbisch« hat es Ärger gegeben; das Käthchen von Heilbronn, der Lügenbaron von Münchhausen und der Spork aus Rilkes »Weise von Liebe und Tod« machen noch heute ihren Nachfahren zu schaffen; Prozente beanspruchte der polnische Bankier Stephan Jakobowicz, dem Franz Werfel die Fabel seiner Emigrationskomödie »Jacobowsky und der Oberst« verdankte; um den »Onkel Franz« aus Thomas Bernhards »Ursache« wurde prozessiert; und wer sich, auf Becketts »Godot« wartend, dem Landstreicher Estragon anschlösse, landete unversehens hinter Schloß und Riegel.
Bei Proust und Doderer wimmelt es von »Modellen« und Wolfgang Bauer hat ganz bestimmt seine Gründe, wenn er sich absichert: »Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre purer Zufall.« An der Entschlüsselung von Hofmannsthals »Rosenkavalier« und Raimunds »Verschwender« haben sich Generationen von Lokalhistorikern die Zähne ausgebissen – nicht immer machen es einem die Dichter so leicht wie Kafka, dessen Schankmädchen Frieda aus dem Romanfragment »Das Schloß« die Züge seiner Freundin Milena Jesenska trägt, oder Ringelnatz, hinter dessen »Muschelkalk« sich niemand anderer als die ostpreußische Bürgermeisterstochter Leonharda Pieper verbirgt, seine Frau.
Die Frage nach dem »Who is who?«, für die einen kleinliche Neugier und somit verächtlich, für die anderen Pikanterie am Rande der Künstlerbiographie und somit legitimer Teil der Datensammlung, zieht sich durch die gesamte Literaturgeschichte, und manches davon ist gängiges Lexikonwissen: Susette Gontard, die Mutter von Hölderlins Frankfurter Zöglingen, ist für die Nachwelt als Diotima verewigt; in der Beatrice der »Divina Commedia« spiegelt sich Dantes florentinische Jugendliebe; von einem Türknauf im alten Bamberg ließ sich E.T.A. Hoffmann zur Märchengestalt des »Äpfelweibs« inspirieren. Friedrich de la Motte-Fouqué begegnet im Sommer 1795 als Besatzungsoffizier in Minden der fünfzehnjährigen Elisabeth von Breidenbauch: Urbild seiner »Undine«; an Walther Rathenau denkt Musil, als er im »Mann ohne Eigenschaften« die Figur des Finanzmagnaten und »Großschriftstellers« Dr. Paul Arnheim, an seinen Neffen Gioacchino der Autor des »Leoparden«, Tomaso di Lampedusa, als er die Figur des Charmeurs Tancredi entwirft; und Lessing setzt seinem Freund Ewald von Kleist, fünf Jahre nach dessen Tod, mit dem Major Tellheim ein so lebendiges Denkmal, daß dies für den mit eingeweihten Verleger Nicolai eine ganz »besondere Rührung« hat.
1904 schreibt Arthur Schnitzler die erste Fassung seiner Tragikomödie »Das Wort«. Es soll ein Literatenstück werden, ein verschlüsselter Peter Altenberg die Hauptperson. Nun heißt es den richtigen Dreh finden, die Dinge zu verfremden. Bei den Namen fängt’s an. Altenberg – das wird einfach auf den Kopf gestellt, aus »alt« wird »neu«, aus »Berg« wird »Hof«: Neuenhof. Es ist noch immer zu deutlich, zu platt. Der Dichter drechselt weiter. Bis er’s schließlich hat: Treuenhof. Anastasius Treuenhof. Alphonse Daudet muß seinen »Barbarin de Tarascon« mit Rücksicht auf eine ortsansässige Familie gleichen Namens in einen »Tartarin« umtaufen – so wie sich ein Jahrhundert später Tennessee Williams von der Heldin seines Schauspiels »Süßer Vogel Jugend« trennen wird: Das »Original« besteht auf Zahlung von 50000 Dollar Schmerzensgeld.
Als sich Max Frisch bei der Uraufführung seines »Grafen Öderland« über manche allzu aktuelle »Deutung« ärgern muß, sperrt er das Stück vorübergehend für alle Bühnen, und Heinrich Böll, sowieso allergisch gegen jeden Versuch, »fiktiv« und »dokumentarisch« gegeneinander auszuspielen, wehrt nach dem Erscheinen des Romans »Gruppenbild mit Dame« alle Fragen nach den Realien seiner Leni mit der lakonischen Auskunft ab: »Sie ist zusammengesetzt aus meiner Erfahrung mit Frauen in Krieg und Frieden.« Françoise Sagan, ähnlich angesprochen, gibt sich blasiert: »Leute, die mir bereits bekannt sind, in meinen Romanen unterzubringen, würde mich zu Tode langweilen.« Um die Identität in Hertha Kräftners »Beschwörung eines Engels« flackert einen Augenblick lang Eifersucht auf, wie es auch schon von den Gespielinnen Ovids überliefert ist; die Dichtermuse Lisa Matthias plärrt 325 Buchseiten lang »Ich war Tucholskys Lottchen«; und als im Oktober 1960 im Londoner Old Bailey der Lady-Chatterley-Prozeß über die Bühne geht, scheut der Vertreter der Anklage, Sir Mervyn Griffith-Jones, nicht davor zurück, die Titelfigur des inkriminierten Buches mit Frieda von Richthofen, der Frau des Verfassers, gleichzusetzen, so daß deren Biograph, Robert Lucas, ihre Lebensgeschichte mit dem Seufzer enden läßt: »Arme Frieda! Vier Jahre nach ihrem Tod saß man über sie zu Gericht …«
Man sieht, Modell zu stehen für eine literarische Figur (oder auch nur diesen Ruf zu genießen), schafft Probleme. Freilich auch Ruhm. Die spanische Bürgerkriegskämpferin Dolores Ibárruri, die legendäre »Pasionaria«, ließ es sich gern gefallen, in Hemingways Roman »Wem die Stunde schlägt« als Partisanin Pilar verherrlicht zu werden; wenn der Bredstedter Advokat Heinrich Momsen die alten Kupferstiche aus dem Familienbesitz abstaubt, tut er es im stolzen Bewußtsein, der Ururenkel jenes »nordfriesischen Kopernikus« Hans Momsen zu sein, der Storms Schimmelreiter Hauke Haien zum Verwechseln ähnlich sieht? Boris Pasternaks Gefährtin Olga Iwinskaja benutzte ihre Memoiren dazu, ihren Alleinanspruch auf »Identität« mit der »Schiwago«-Heldin Lara zu verankern; und ebenso wird man sicher sein dürfen, daß der Theaterschauspieler Bernhard Minetti es genießt, in einem Stück aufzutreten, das seinen eigenen Namen zum Titel hat: Minetti.
Der Maler kann sich sein Modell mieten – es gibt dafür eigene Agenturen, feste Honorarsätze. Der Dichter hat es schwerer und leichter zugleich: schwerer, weil sich Inspiration und Arrangement in seinem Fall weniger gut vertragen, leichter, weil sein Reservoir praktisch unbegrenzt ist. Das Urbild der »Ehrbaren Dirne« läuft Sartre in die Arme, als er Vladimir Pozners Amerikabuch »Les Etats Désunis« liest – dort ist von einer einschlägigen Affäre die Rede. Von Schnitzlers »Lieutnant Gustl« weiß man, daß der Stoff auf einen tatsächlichen Vorfall im Wiener Musikverein zurückgeht, der damals in der k.u.k. Reichshaupt- und Residenzstadt die Runde machte; und im Wien der Zweiten Republik gibt es Leute, die sich hinter vorgehaltener Hand rühmen, das Urbild von Qualtingers »Herrn Karl« zu kennen. Einer, der bei der »Modellbeschaffung« einfach seinem Glück vertraute: es werde schon auf ihn zukommen, was er brauche, war James Joyce. Als ihn einmal eine Arbeitsflaute lahmlegte, reiste er für ein paar Tage nach Locarno und machte dort die Bekanntschaft einer reichlich abenteuerlichen Dame, die ihn auf »ihre« Insel im Lago Maggiore einlud. Zwei Monate später nahm der Dichter die Arbeit am »Ulysses« wieder auf: am Circe-Kapitel … Und eine Zeitungsnotiz gab den Anstoß zu Flauberts »Madame Bovary«: die Nachricht vom Selbstmord einer gewissen Delphine Delamare, Frau eines Landarztes in einem Dorf bei Rouen, die aus Langeweile zur Ehebrecherin wird, sich in Schulden stürzt und am Ende zum Gift greift. Aber was macht der Dichter nicht aus dem banalen »sujet terre-à-terre«! So sehr geht er darin auf, daß er bei Abschluß der Arbeit, nach der »wahren« Madame Bovary gefragt, ohne jedes Pathos sagen kann: »C’est moi.« Ich, Modell und Autor werden eins.
Wer sich auf dieses Thema einläßt, muß auf mancherlei gefaßt sein. Edmond Dantès, der Graf von Monte Christo, ist eine durch und durch erfundene Figur – ohne jede noch so ferne Entsprechung in der Wirklichkeit. Der Reisende, der nach Marseille kommt und sich zum Chateau d’If übersetzen läßt, wird gleichwohl in »seine« Kerkerzelle geführt.
Ja, es sind Fälle bekannt, wo sogar der Dichter selber munter beim Phantomspiel mitmischt. Vier Jahre nach Erscheinen des »Baal« schreibt Brecht eine Art Nachwort; darin läßt er sich über das Urbild der Figur aus: »Es war ein gewisser Josef K., von dem mir Leute erzählten, die sich sowohl an seine Person als auch an das Aufsehen, das er seinerzeit erregte, noch deutlich erinnern konnten. K. war das ledige Kind einer Waschfrau. Er geriet früh in üblen Ruf … Verschiedene dunkle Fälle, zum Beispiel der Selbstmord eines jungen Mädchens, wurden auf sein Konto gesetzt.« Nach einer Messerstecherei sei er fluchtartig aus A. verschwunden. »Und soll im Schwarzwald elend verstorben sein.«
Brecht-Forscher haben sich die Mühe gemacht, an Hand der Augsburger Kriminalakten dem Prototyp auf die Spur zu kommen. Es ist ihnen nicht gelungen. Inzwischen weiß man auch wieso: weil es diesen Josef K. nie gegeben, weil der Dichter die ganze Sache fingiert hat. Welches Interesse er daran haben konnte? Ohne realen Hintergrund drohte der »große Baal« sich zum unverbindlichen Mythos zu verflüchtigen, das wollte Brecht verhindern, und deshalb das unechtechte Modell.
Auch das also gibt es. Der Mann, der einmal den »Gotha« der literarischen Figuren schreiben wird, mag noch ganz anderes zu ergründen haben – das Terrain ist unabsehbar groß: von Alving bis Gatsby, von Forsyte bis Karamasow, vom Nymphchen Lolita bis zur Irren von Chaillot.
Einigen wenigen von ihnen bin ich gefolgt, lebenden und toten. Manchen bloß aus Neugier, manchen aus alter Anhänglichkeit, manchen – wie Mager, der Kellner des Gasthofes »Zum Elephanten« in Weimar – auch aus Idolatrie. Nur vielleicht ein wenig kühleren Sinnes als er. Freilich, Mager hat für seine Benommenheit gute Gründe: »Ich habe es mir einfach nicht träumen lassen.«
Ich schon. Ich habe es mir träumen lassen. Träumen Sie mit.
Venedig – der Nerven wegen
Wie Thomas Manns »Tadzio« sich treu geblieben ist
»Mit dem ›Tod von Venedig‹ ist es eine ganz komische Geschichte, insofern als sämtliche Einzelheiten der Erzählung passiert und erlebt sind«, teilt Katia Mann ohne viel Umschweife in ihren »Ungeschriebenen Memoiren« mit. Gott segne sie – endlich einmal eine ehrliche Zeugin, die sich nicht spreizt und nicht ziert, die nicht für jeden Beistrich im Werk eines Dichters, dem sie über die Schulter hat schauen können, das Walten einer höheren Vorsehung in Anspruch nimmt, die über das Phänomen des literarischen Rohstoffs nicht anders spricht als über eine gute Mahlzeit oder über Erziehungsprobleme im Flegelalter. Da wimmelt’s nur so von Modellen – ich kann sie mir nachgerade aussuchen. Es ist klar, daß meine Wahl auf das berühmteste unter ihnen fällt: Tadzio, den »kleinen Phäaken«, den »lieblichen Psychagogen«, dem der Schriftsteller Gustav von Aschenbach »Andacht und Studium« widmet, dessen vollkommene Schönheit – »schöner, als es sich sagen läßt« – den alternden Künstler so sehr erschüttert und unter dessen Lächeln, »voranschwebend ins Verheißungsvoll-Ungeheure«, er schließlich seinen letzten Atemzug tut.
Frühjahr 1911. Das Ehepaar Mann – er sechsunddreißig, sie achtundzwanzig – reist zur Erholung nach Istrien, man hat ihnen Brioni empfohlen. Aber sie bleiben nur kurz, es gefällt ihnen nicht besonders. Erstens fehlt der Sandstrand, zweitens verdrießen sie die Allüren der am selben Ort zur Kur weilenden Erzherzogin Maria Josepha, Mutter des späteren letzten österreichischen Kaisers, bei deren Auftritt und Abgang im Speisesaal des Hotels sich regelmäßig die gesamte Gästeschaft devot von den Sitzen erhebt.
So fährt man mit dem Dampfschiff weiter nach Venedig. Am Lido, im Hotel des Bains, sind Zimmer bestellt. »Und gleich bei Tisch, gleich den ersten Tag, sahen wir diese polnische Familie, die genau so aussah, wie mein Mann sie geschildert hat: mit den etwas steif und streng gekleideten Mädchen und dem sehr reizenden, bildhübschen, etwa dreizehnjährigen Knaben, der mit einem Matrosenanzug, einem offenen Kragen und einer netten Masche gekleidet war und meinem Mann sehr in die Augen stach. Er hatte sofort ein Faible für diesen Jungen, er gefiel ihm über die Maßen, und er hat ihn auch immer am Strand mit seinen Kameraden beobachtet. Er ist ihm nicht durch ganz Venedig nachgestiegen, das nicht, aber der Junge hat ihn fasziniert, und er dachte öfters an ihn.«
Frühjahr 1977 – sechsundsechzig Jahre später. Thomas Manns Novelle ist fünfundsechzig Jahre alt, Viscontis Verfilmung hat das Werk, obgleich keinen Augenblick vergessen, erneut weltweit ins Gespräch gebracht und den tausenderlei Phantasiebildern vom Knaben Tadzio in der Gestalt des Schweden Björn Andresen ein sehr dezidiertes weiteres hinzugefügt. Wird es sich als stärker erweisen als die eigene Vorstellung? Wird, wer von nun an den »Tod in Venedig« liest, immer den blondlockigen Skandinavier vor Augen haben?
Ich nicht. Ich werde an einen alten Herrn in einer Dachwohnung in Krakau denken, der sich behutsam seiner Krücken entledigt, sich vorsichtig in seinem schleißigen Fauteuil zurücklehnt und mir in einem amüsanten Sprachgemisch aus Deutsch und Englisch und Französisch von jenem venezianischen Kuraufenthalt des Jahres 1911 berichtet, bei dem er, ein Kind von elf, ohne jedes Wissen für ein Stück Weltliteratur Modell stand …
1923, auf einem Ball in gräflichem Warschauer Hause, erfuhr er es zum erstenmal: »Der Tod in Venedig« war gerade in polnischer Übersetzung herausgekommen, Gabriella Czesnowska, seine Tanzpartnerin, hatte das Buch als eine der ersten gelesen. »Du weißt wohl noch gar nicht, was für ein Held du bist?« hänselte sie den jungen Baron, und als Wladyslaw von Moes daraufhin Nachschau hielt und selber den strittigen Text prüfte, gab es auch für ihn nicht den geringsten Zweifel: Wahrhaftig – dieser Tadzio, das bin ich.
Zeit und Ort, Personnage und Geschehensablauf – in allem herrschte die vollkommenste Übereinstimmung. Die drei Geschwister, »bis zum Entstellenden herb und keusch hergerichtet« – ganz klar: das waren seine Schwestern Jadwiga, Alexandra und Maria Anna; die »große Frau, grauweiß gekleidet und sehr reich mit Perlen geschmückt, kühl und gemessen, die Anordnung ihres leicht gepuderten Haares sowohl wie die Machart ihres Kleides von jener Einfachheit, die überall da den Geschmack bestimmt, wo Frömmigkeit als Bestandteil der Vornehmheit gilt«, mit »zurückhaltendem Lächeln« den Kindern die Hand zum Kusse reichend: das war das perfekte Spiegelbild seiner Mutter; die Gouvernante, »eine kleine und korpulente Halbdame mit rotem Gesicht«, die das strenge Aufmarschzeremoniell mit knappen Kommandos dirigierte: das war das Fräulein Lina Perisich aus Cilli; und »Jaschu«, der derbe Spielkamerad am Strand, der stämmige Bursche mit dem leinenen Gürtelanzug und dem pomadisierten Haar: das war Janek Fudakowski, mit dessen Familie die Moes ihre Tage am Lido teilten, bis sie der plötzliche Ausbruch einer leichten Choleraepidemie allesamt zu überstürzter Abreise zwang.
Zwölf Jahre später. Wladyslaw von Moes, eben aus dem polnisch-russischen Krieg heimgekehrt, wo er als Ulan seinen Mann gestellt hat, kann nicht den ihm vorgezeichneten Plan verwirklichen, in Grenoble Papiertechnik zu studieren: Eine schwere Erkrankung des Vaters zwingt ihn, ohne Verzug in den elterlichen Betrieb einzutreten, der ihm als Erbe zugedacht ist: die Papierfabrik in Pilica. Von seiner Entdeckung, in die Literatur eingegangen zu sein, macht er weiter kein Aufhebens – es gibt Wichtigeres. Natürlich schmeichelt es ihm, natürlich amüsiert es ihn – er ist auch mit dreiundzwanzig Jahren eine attraktive Erscheinung, von Frauen und Mädchen umschwärmt. Doch auf den Gedanken, sich dem Dichter zu erkennen zu geben, käme er nicht. Auch als Thomas Mann im März 1927 auf Einladung des polnischen PEN-Clubs in Warschau weilt und, mit Ehrungen überhäuft und von einem Empfang zum anderen eilend, Schlagzeilen macht, hält sich »Tadzio« diskret im Hintergrund. Frühstück beim Prinzen Radziwill, Empfang beim Grafen Branicki in Schloß Wilanow, Warschaus Adel drängt sich um den Dichter aus Deutschland – es wäre für den jungen Herrn aus bestem Hause ein leichtes, seine Bekanntschaft zu machen. Doch erst 1964, als alter Herr, neun Jahre nach Thomas Manns Tod, findet er den Mut, das Geheimnis zu lüften: in einem Brief an Witwe Katia, für die die späte Decouvrierung ein »drolliges Nachspiel« ist. Andrzej Dolegowski, der Mann-Übersetzer, hatte den Stein ins Rollen gebracht: minuziöse Vergleiche des Novellentextes mit der Moes’schen Familienchronik anstellend, mittels Tagebuchaufzeichnungen und Photographien endlich die Beweiskette schließend.
Anna Lewandowska, die mir von der staatlichen Agentur Interpress als Organisatorin, Betreuerin und Dolmetscherin zugeteilt ist, unterzieht sich mit bewundernswerter Selbstverleugnung der Aufgabe, mir bei der Ausforschung des »Tadzio«-Modells zur Hand zu gehen: Sie ist es gewohnt, westliche Journalisten mit Minister-Interviews zu versorgen, an Gedenkstätten zu lotsen, Betriebsbesichtigungen zu arrangieren – mich mit einem Vertreter des verarmten Adels, einem ehemaligen Fabrikanten und Gutsbesitzer, einem Klassenfeind also, zusammenzubringen, kann unmöglich nach ihrem Geschmack sein. Aber sie läßt sich nichts davon anmerken. Auch später, wenn ich dem alten Herrn gegenübersitze, wird sie sich nobler Zurückhaltung befleißigen, wird nie korrigierend in unser Gespräch eingreifen: kein Ordnungsruf, kein Einschüchterungsversuch; auch dem abgehalfterten »kapitalistischen Ausbeuter« gegenüber wird sie es nicht einen Augenblick lang an Respekt fehlen lassen – seine gewinnende, bescheidene Art, selbst in der Aufzählung all der armseligen Stationen seiner Nachkriegsexistenz frei von Groll und Bitterkeit, macht es ihr freilich auch leicht.
Unser Wagen hält vor einem älteren Mietshaus in der ulica Smolensk, gleich weit vom Weichselknie wie vom Krakauer Altstadtkern entfernt. Nebenan das Sportstadion, vis-à-vis das neue Großhotel Cracovia. Wir fahren mit dem Aufzug in den letzten Stock, die Lifttür ist zugleich das Entree zur Wohnung. Der Neffe läßt uns ein – er hat den »Herrn Onkel«, zu dessen Anrede er sich beharrlich des ehrerbietigen »Sie« bedient, zu sich genommen, seit dessen Frau, eine geborene Gräfin Miaczynskia, schwerkrank darniederliegt und in ihrem Haus in der Warschauer Vorortgemeinde Komorow nicht einmal mit sich selbst mehr zurechtkommt. Der Neffe betreibt eine kleine Krawattenmanufaktur in der Stadt – dazu ein paar Schafe auf einem winzigen Wiesengrundstück an der Peripherie, das er vor kurzem erworben hat.
Wir werden in die Wohnstube gebeten: ein nicht zu großes Balkonzimmer mit einigen wenigen Antiquitäten, in der Mitte des Raumes der Lehnstuhl für »Tadzio«. Sein Auftritt läßt allerdings noch auf sich warten: Wladyslaw Moes, so alt wie unser Jahrhundert, ist seit einem Hüftbruch gehbehindert, jeder falsche Schritt bereitet Schmerzen, für das Anlegen der Krücken braucht er fremde Hilfe. Er muß erst die richtige Position in seinem Fauteuil eingenommen haben – früher ist an Begrüßung nicht zu denken. Ein eigenes Lächeln umspielt dabei seinen Mund: bei allem Stolz immer dieses gewisse Erstaunen, wie man mit solch flüchtigem Gastspiel in der Literatur so nachdrückliches Interesse erwecken kann. Sogar Selbstironie wird laut: Wenn er an all die Post denke, die er in den vergangenen Jahren im Zeichen Thomas Manns erhalten habe (und sei es mitunter auch nur, um einem Schreiber aus der Bundesrepublik bei der Ausfindigmachung eines Kriegsgefallenengrabes behilflich zu sein), komme er sich bisweilen direkt wie eine »fameuse artiste« vor, Sängerinnen und berühmten Schauspielerinnen gehe es wohl ebenso, und vielleicht erwarteten sich auch seine Fans eine Autogrammkarte von ihm, dabei wüßte er doch gar nicht, wie er sie rechtens zu unterschreiben hätte: »Tadzio«, wie ihn, auf Grund eines Hörfehlers, der Dichter genannt habe, oder »Adzo«, wie er tatsächlich als Kind gerufen worden sei. Als ich ihn später selber um Signierung meines »Tod in Venedig«-Exemplars ersuche, entscheidet er sich ohne Zögern für die korrekte Version und kritzelt mit leicht zittriger Hand »Adzo Moes« aufs Titelblatt.
Die Frau des Hauses schleppt während unserer Unterhaltung zierliche Jour-Tischchen ins Zimmer und breitet unauffällig Sandwiches darauf aus, dazu gibt es Wodka. Einer der Söhne photographiert den alten Onkel – im Keller hat er sich ein Labor eingerichtet, wo er den Film selber entwickeln kann. Der andere, den sie seit seiner großen Überseereise den »Amerikaner« nennen, hängt auf dem Balkon die Jeans zum Trocknen auf, er hält sich von unserer Runde fern. Die Tochter steht am Herd und bereitet das Mittagessen vor – wir werden dazu in überschwenglicher Gastfreundschaft mit eingeladen: in der Sitzecke der Küche. Wir dürften uns allerdings nicht daran stoßen, daß es ein einfaches Mahl sei, baut der Onkel vor, Langusten kämen keine auf den Tisch – so wie etwa damals am Lido, im Frühjahr 1911. Dabei habe er als Kind alle diese Meeresdelikatessen gar nicht gemocht, vor Fischen habe es ihn geradezu geekelt: der großen Augen wegen, die ihn bei derlei Mahlzeiten vom Teller angeblickt hätten – übersensibel, wie er damals gewesen sei. Ja, die bewußte Venedig-Reise sei ja eigentlich überhaupt nur zustande gekommen, weil sie ihm vom Nervenarzt, den man in Wien konsultiert habe, verordnet worden sei: »Frau Baronin, ich rate Ihnen, reisen Sie mit dem Kind für drei Monate nach Venedig, und sorgen Sie dafür, daß er recht viel mit dem Vaporetto fährt – das wird seine Nerven wieder in Ordnung bringen.«
In Wien, wo man im vornehmen Hotel Krantz an der Kärntnerstraße abgestiegen war, wurde also rasch das Passende an Kleidung besorgt: das »englische Matrosenkostüm, dessen bauschige Ärmel sich nach unten verengerten« und »mit seinen Schnüren, Maschen und Stickereien der zarten Gestalt etwas Reiches und Verwöhntes« verlieh, der »leichte Blusenanzug aus blau und weiß gestreiftem Waschstoff mit rotseidener Masche und Stehkragen«, die »dunkelblaue Seemannsüberjacke mit den goldenen Knöpfen«, der blauweiße Badeanzug. Kurz darauf traf man am Lido mit dem Rest der Familie zusammen: Vater und Geschwister.
Von diesen allen ist Wladyslaw-Tadzio der einzige, der heute noch lebt. Ich sehe Photos von der Mutter: eine überragende Erscheinung, ganz in Spitze, darüber die Zobelboa und die »dreifache Kette kirschengroßer, mild schimmernder Perlen«, Photos von den drei Schwestern, schließlich Photos von ihm selbst. Der zarte Wuchs ist ihm bis ins hohe Alter geblieben, desgleichen der edle Kopf, die vornehme Haltung, die Eleganz der Bewegung – dem Greis gegenüberzusitzen und sich den Knaben vorzustellen, bereitet keine Schwierigkeiten: Da ist noch immer sehr viel Ähnlichkeit, noch immer sehr viel Kontinuum.
Beim Kaffee erfahre ich die weiteren Stationen dieses Lebens: wie die Zwischenkriegszeit der väterlichen Papierfabrik schlagartig die russischen Absatzmärkte versperrte, wie das Kapital daraufhin rapid schwand, wie man 1927 verkaufen mußte, wie man sich auf seine Ländereien zurückzog und wie man nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch diese verlor. Wierbka, der alte Familiensitz im Norden von Krakau, ging in Staatseigentum über: Das Schloß ist heute ein Arbeiterheim.
Wladyslaw Moes, während des Zweiten Weltkriegs Kavallerieoffizier der polnischen Armee, nun aus deutscher Gefangenschaft heimkehrend, traf in Hirschberg mit Frau und Sohn zusammen – einer seiner früheren Direktoren verschaffte ihm einen ersten Arbeitsplatz. Viele weitere sollten ihm folgen: Keiner davon von Dauer – bei jedem neuen Versuch, eine Existenz zu gründen, war ihm seine Vergangenheit als Großgrundbesitzer im Weg. Ein Weilchen Landwirtschaftsministerium, ein Weilchen Papierexport, dann wieder Buchhalter in einer pharmazeutischen Fabrik, Kooperativführer im Bauwesen, Magazineur in einer Manufaktur für Volkskunst. Bis ihn schließlich die Gräfin Potocka in der Diplomatie unterbrachte: als Sekretär der Iranischen Botschaft. Hier faßte er endlich Tritt, hier gewann er seine innere Freiheit wieder, an diese letzten fünfzehn Arbeitsjahre denkt er gern zurück – gern und dankbar. Die Berufsdiplomaten kamen und gingen, er, der ständige Sekretär, war der ruhende Pol der Gesandtschaft. So kam es, daß man ihn dem Schah, wie dieser in Warschau Visite machte, als »den eigentlichen Botschafter des Iran in Polen« vorstellte – es wird wohl mehr als bloß Courtoisie, mehr als bloß ein freundlicher Scherz gewesen sein.
Heute zehrt Wladyslaw Moes von einer kümmerlichen Rente: etwas über tausend Zloty. Die Frau ist krank, der Sohn mit achtzehn an Leukämie gestorben. In Paris lebt die Tochter – als er bei ihr zu Besuch weilte, sah er sich den »Tod in Venedig« im Kino an. Auch aus seiner Sicht ein vollendet schöner Film, an dem er nur zweierlei auszusetzen hat: daß der Tadzio des Visconti an Alter wie an Wuchs größer war als er, dazu blond und nicht »châtaign«, und daß man die Mutter zur Zigarettenraucherin verfälscht habe: »Das wäre in unseren Kreisen zu jener Zeit ganz und gar undenkbar gewesen.«
Als Visconti seinerzeit auf der Suche nach einem Tadzio-Darsteller auch nach Polen kam (und unverrichteter Dinge wieder abreiste), wurde er gefragt, wieso er es denn bei dieser Gelegenheit versäumt habe, dem in Reichweite befindlichen Urbild zu begegnen. Er gab zur Antwort: »Weil ich von dieser Figur eine eigene Vision habe – die will ich mir nicht durch die Realität zerstören.« Und Moes selbst: »Ich hätte mich nicht anders verhalten. Visconti hatte recht.«
Der Film hatte übrigens noch ein weiteres Nachspiel: Er führte »Tadzio« und »Jaschu« auf ihre alten Tage noch einmal zusammen. Als der »Tod in Venedig« in London anlief, wohin es das »Jaschu«-Modell Janek Fudakowski nach dem Zweiten Weltkrieg verschlagen hatte, schickte dieser, im Stolz auf seine literarische Verewigung weniger zurückhaltend als der Jugendgespiele, einer großen englischen Zeitung ein Photo, das die beiden während ihres gemeinsamen Aufenthalts am Lido zeigt. Und als dafür nach erfolgter Veröffentlichung ein Honorar bei ihm einging, richtete »Jaschu« aus England an »Tadzio« in Polen eine briefliche Anfrage, auf welches Konto er denn die ihm zustehende Hälfte des Betrages überweisen solle, schließlich sei er, Tadzio, ja auf dem betreffenden Bild mit drauf. Die Geldüberweisung unterblieb – statt dessen fuhr »Tadzio« zu »Jaschu« nach London auf Besuch. Es wurde ein herzliches Wiedersehen – ungetrübt von der Erinnerung an jene »Ausschreitungen« am Strand, mit denen einst der »stämmige Geringere« den »schwächeren Schönen« bezwungen und damit ihrer Freundschaft ein so abruptes Ende gesetzt hatte.
Es wird Zeit, Abschied zu nehmen: Der alte Herr ist seinen Mittagsschlaf gewöhnt. Das aufrechte Sitzen, stundenlang, bereitet ihm Pein – jetzt, seitdem er invalid ist. Aber er würde sich’s nie anmerken lassen. Und er ist ja auch, von diesem einen Malheur abgesehen, ein in keiner Weise angeschlagen wirkender Mann. In diesem Punkt hat der Dichter gründlich geirrt: »Er ist sehr zart, er ist kränklich. Er wird wahrscheinlich nicht alt werden.« Tadzio ist siebenundsiebzig.
Zurück nach Warschau. Im Hotel Europejski, wo man mich in der Nobelsuite des zweiten Stocks einquartiert hat, schließt sich der Kreis: Hier hat Thomas Mann – damals im März 1927 – seinen polnischen Gastgebern, die sich in »herzlicher Aufmerksamkeit« nicht hatten genugtun können, mit einem Vortrag seinen Dank abgestattet. Der große Saal des »Europejski« war überfüllt, der Titel seines Referats könnte der Titel meiner Tadzio-Story sein: »Freiheit und Vornehmheit«. Denn ist das nicht genau die Formel, die auch das Wesen dieses bemerkenswerten Mannes ausdrückt – weit zutreffender als der alte Wappenspruch der Moes? »Ubi venio ibi vinco«: was für ein Unsinn – heute. Ja, damals, nach den napoleonischen Kriegen, als der holländische Zuckerbaron de Moes, vor der kubanischen Konkurrenz kapitulierend, die Heimat verließ, sein Glück im Osten versuchte und mit einer Tuchfabrik bei Byalistok so viel Gewinn scheffelte, daß er bald aufs noch lukrativere Papier umsteigen konnte, 1864 vom Zaren geadelt – da mochte dergleichen Hoppla-jetzt-komm-ich-Euphorie angemessen gewesen sein, – heute ist sie bestenfalls als Übungssatz für den Lateinunterricht zu gebrauchen. Ich lese die anachronistische Devise im Stammbuch der Moes, das »Tadzios« Bruder Alexander in Verwahrung hält. Denn auch ihm mache ich meine Aufwartung – draußen in seiner Datscha in Milanowek, tief in den Wäldern vor Warschau.
Wieder dieser kuriose Hang zum Zeremoniell, auch hier dieses überzeugte Festhalten an den alten Umgangsformen – über alle Zeitenwende hinweg: der Sohn, der dem alten Vater die Hand küßt, die französische Floskel als Aufputz der Konversation, allgemeines Sich-Erheben, wenn einer bei Tisch die Sprache auf den Zarenhof bringt. Thomas Mann und den »Tod in Venedig« auf die Tagesordnung zu setzen, bereitet dagegen Mühe. Verständlich: Alexander war nicht mit von der Partie – damals, im Frühjahr 1911. Er hatte schlechte Noten aus der Schule heimgebracht – zur Strafe durfte er nicht mit an den Lido fahren. »Tadzios« exklusiver Rang war damit gesichert: das »verzärtelte Vorzugskind, von parteilicher und launischer Liebe getragen«. Daß ich auf alle meine Fragen nach ihm so karge Auskunft erhalte, daß man mich hier, wie ich bald merke, sehr viel lieber über »Magdeburger Morgen« und Getreidesorten instruierte, über die ehemals bewirtschafteten Ländereien, über Schloßpersonal und Viehbestand – sollte das Reste von geschwisterlicher Eifersucht verraten, Geringschätzung des »Tadzio«-Kults?
Wie auch immer: Alexanders schlechtes Schulzeugnis und Wladyslaws nervenärztliches Attest hatten ihr Gutes – literaturgenetisch gesehen. Sie haben einem Dichter die ideale Modellkonstellation beschert – so wie der Dichter seinerseits von dieser Konstellation idealen Gebrauch gemacht hat. Aber das alles wissen wir ja längst. Was wir nicht gewußt, was ich erst auf dieser Reise erfahren habe, ist dies: wie sehr dieses Modell – auch über die Novelle hinaus – sich treu geblieben ist, ein Leben lang. Thomas Mann brauchte seinem »Tadzio« auch heute nichts von seiner Zuneigung zu entziehen.
Käthchen en gros
Die späte Rehabilitierung der Lisette Kornacher
Was ist denn das für ein Lärm in meinem Zimmer? Schon auf dem Gang schlagen mir Gekicher und Gejohle entgegen. Ich reiße die Tür auf, um dem Frevel ein Ende zu machen – Borka und Daniza, die beiden bosnischen Hotelstubenmädchen, fahren erschrocken zurück. Doch ebenso rasch haben sie sich wieder gefaßt; Borka, die keckere, weist mit verschmitztem Grinsen auf ihr gemeinsames Werk: Sie haben meinem Käthchen ein Lager bereitet. Und was für eins! Kissen über Kissen, das Nachttischdeckchen als Ziertuch obenauf – die reinste Prinzessin auf der Erbse. Dann fährt Borka dem Käthchen noch einmal flugs übers Blondhaar, streicht ihr den hellblauen Faltenrock zurecht und flüstert ihr etwas ins Plastikohr, was wahrscheinlich soviel wie »So – und nun schlaf schön!« zu bedeuten hat.
Nachdem sich Borka und Daniza vergewissert haben, daß ich keine Anstalten treffe, ihren Übergriff zu ahnden, sondern mir im Gegenteil Anerkennung für ihre mütterliche Obsorge anmerken lasse, treiben sie ihr Spiel weiter, tuschelnd machen sie sich dafür gegenseitig Mut. Es geht um die Klärung der Frage, was denn im Zimmer eines ausgewachsenen Mannes eine Puppe sucht – was soll das? Entwicklungshemmung? Sexuelle Verirrung? Wieder einer dieser Ticks? Oder ist dieser Mensch einfach ein Handlungsreisender in Spielsachen? Abermals muß Borka herhalten; von schweren Lachreizen behindert, preßt sie es schließlich heraus: »Deine Frau?«