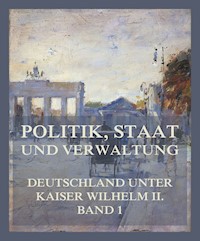
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Deutschland unter Kaiser Wilhelm II.
- Sprache: Deutsch
Die 1914 im Original veröffentliche Reihe "Deutschland unter Kaiser Wilhelm II. " gehört zu den umfangreichsten historischen Abhandlungen über die Entwicklung und den Aufbau des Kaiserreiches. Hier in einer Wiederauflage von insgesamt acht Bänden vorliegend, umfasst das Werk auf fast 2000 Gesamtseiten Beiträge der wichtigsten Koryphäen ihrer Zeit zu relevanten Themen. Dies ist Band 1, der unter anderem die Themen Auswärtige und Innere Politk, Staats- und Verwaltungsrecht, Finanzen und Steuern behandelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Politik, Staat und Verwaltung
Deutschland unter Kaiser Wilhelm II.
Band 1
Deutschland unter Kaiser Wilhelm II., Band 1
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849663148
Quelle: https://de.wikisource.org/wiki/Deutschland_unter_Kaiser_Wilhelm_II. Der Text folgt dem 1913/1914 erschienen Werk und wurde in der damaligen Rechtschreibung belassen.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Deutsche Politik. 1
Auswärtige Politik. 1
Innere Politik. 57
I. Einführung.57
II. Der nationale Gedanke und die Parteien.73
III. Wirtschaftspolitik. 113
IV. Ostmarkenpolitik.132
Schlußwort.149
Staats- und Verwaltungsrecht155
I. Das Reich. 155
1. Die Reichsverfassung und die Grundlagen des Reiches. 155
2. Heer und Flotte. 170
3. Das Finanzwesen des Reiches. 174
4. Die Rechtspflege. 178
5. Das Verkehrswesen. 180
6. Handel, Landwirtschaft und Gewerbe. 187
II. Preußen. 194
1. Die Preußische Verfassungsurkunde und die Grundlagen des Staates194
2. Die Verwaltungsorganisation. 200
3. Die materielle Verwaltung. 209
4. Das Finanzwesen. 221
Die Selbstverwaltung. 224
Die Reichsversicherung. 244
I.244
II.249
III.264
IV.277
Finanzen und Steuern. 279
1. Das Ausgabewesen. Die Ausgaben im allgemeinen.281
2. Die Einnahmen und das Schuldenwesen. Das Einnahmewesen im allgemeinen.288
3. Abschließende Betrachtungen.303
Deutsche Politik
Bernhard Fürst von Bülow
Auswärtige Politik
„Die deutsche Nation ist trotz ihrer alten Geschichte das jüngste unter den großen Völkern Westeuropas. Zweimal ward ihr ein Zeitalter der Jugend beschieden, zweimal der Kampf um die Grundlage staatlicher Macht und freier Gesittung. Sie schuf vor einem Jahrtausend das stolzeste Königtum der Germanen und mußte acht Jahrhunderte nachher den Bau ihres Staates auf völlig verändertem Boden von neuem beginnen, um erst in unseren Tagen als geeinte Macht wieder einzutreten in die Reihe der Völker.“
Diese Worte, mit denen Treitschke seine „Deutsche Geschichte“ einleitet, enthalten nicht nur tiefe geschichtliche Erkenntnis, sie haben auch sehr modernen politischen Sinn. Deutschland ist die jüngste unter den großen Mächten Europas, der Homo novus, der, in jüngster Zeit emporgekommen, sich durch überragendes eigenes Können in den Kreis der alten Völkerfamilien gedrängt hat. Als ungebetener und lästiger Eindringling wurde die neue Großmacht angesehen, die Furcht gebietend nach drei glorreichen Kriegen in die europäische Staatengesellschaft eintrat und das Ihre forderte von der reichbesetzten Tafel der Welt. Jahrhunderte hindurch hatte Europa nicht an die Möglichkeit einer national-staatlichen Einigung der deutschen Ländermasse geglaubt. Jedenfalls hatten die europäischen Mächte ihr Möglichstes getan, um eine solche zu verhindern. Insbesondere war die französische Politik von Richelieu bis auf Napoleon III. in der richtigen Erkenntnis, daß das Übergewicht Frankreichs, la Préponderance légitime de la France, in erster Linie auf der staatlichen Zerrissenheit Deutschlands beruhe, bestrebt, diese Zerrissenheit zu erhalten und zu vertiefen. Aber auch die anderen Mächte wollten die Einigung Deutschlands nicht. In dieser Beziehung dachte Kaiser Nikolaus wie Lord Palmerston, Metternich wie Thiers. Es ist wohl der stärkste Beweis für das wundervolle Zusammenwirken der abgeklärten Weisheit unseres alten Kaisers mit dem Genie des Fürsten Bismarck, daß sie die Einigung Deutschlands durchgesetzt haben, nicht nur gegen alle Schwierigkeiten, die ihr die innerdeutschen Verhältnisse, uralte Rivalitäten und Rankünen, alle Sünden unserer Vergangenheit und alle Eigenheiten unseres politischen Charakters entgegentürmten, sondern auch gegen den offenen oder versteckten Widerstand und gegen die Unlust von ganz Europa.
Auf einmal war das Deutsche Reich da. Schneller, als man gefürchtet, stärker als irgend jemand geahnt hatte. Keine der anderen Großmächte hatte die staatliche Wiedergeburt Deutschlands gewünscht, jede hätte sie, so wie sie erfolgte, lieber verhindert. Kein Wunder, daß die neue Großmacht nicht mit Freude begrüßt, sondern als unbequem empfunden wurde. Auch eine sehr zurückhaltende und friedliebende Politik konnte an diesem ersten Urteil wenig ändern. Man sah in der lange verhinderten, oft gefürchteten, endlich von den deutschen Waffen und einer unvergleichlichen Staatskunst ertrotzten staatlichen Einigung der Mitte des europäischen Festlandes an sich etwas wie eine Drohung und jedenfalls eine Störung.
Mitte der neunziger Jahre sagte mir in Rom, wo ich damals Botschafter war, mit einem Seufzer mein englischer Kollege, Sir Clare Ford: „Wie viel gemütlicher und bequemer war es doch in der Politik, als England, Frankreich und Rußland den europäischen Areopag bildeten, und höchstens gelegentlich Österreich herangezogen zu werden brauchte.“ Diese gute alte Zeit ist vorüber. Der hohe Rat Europas ist vor mehr als vier Jahrzehnten um ein stimmberechtigtes Mitglied vermehrt worden, das nicht nur den Willen hat mitzureden, sondern auch die Kraft mitzuhandeln.
Staatliche Wiedergeburt Deutschlands.
Ein Stück harter, weltgeschichtlicher Arbeit hatte mit dem Meisterwerk des Fürsten Bismarck seine Vollendung erhalten. Dem zielbewußten Willen der Hohenzollern mußten durch Jahrhunderte der ausdauernde Heroismus der preußischen Armee und die nie erschütterte Hingebung des preußischen Volkes zur Seite stehen, bis unter wechselvollen Schicksalen die brandenburgische Mark zur preußischen Großmacht wurde. Zweimal schien der schon gewonnene Kranz dem Staate Preußens wieder zu entgleiten. Die vernichtende Niederlage von 1806 stürzte Preußen von der bewunderten und gefürchteten Höhe friderizianischen Ruhmes jäh hinab. Diejenigen schienen recht zu bekommen, die in dem stolzen Staat des großen Königs nie mehr als ein künstliches politisches Gebilde hatten sehen wollen, das stand und fiel mit dem einzigartigen staatsmännischen und kriegerischen Genie des Monarchen. Die Erhebung nach dem tiefen Sturz von Jena und Tilsit bewies der staunenden Welt, welche urwüchsige und unzerstörbare Kraft in diesem Staate lebte. Solcher Opferwillen und solcher Heldenmut eines ganzen Volkes setzten eingewurzeltes nationales Selbstbewußtsein voraus. Und als das Volk Preußens sich nicht in regellosem Aufstande, gleich den vielbewunderten Spaniern und den wackeren Tyroler Bauern erhob, sondern sich Mann für Mann gleichsam selbstverständlich dem Befehl des Königs und seiner Berater unterstellte, da sah man staunend, wie Nationalbewußtsein und Staatsbewußtsein in Preußen eins waren, daß das Volk durch die harte Schule des friderizianischen Staates zur Nation erzogen worden war. Die Reorganisation des staatlichen Lebens unter der Leitung schöpferischer Männer in der Zeit von 1807 bis 1813 gewann dem Staate zum Gehorsam die bewußte Liebe der Untertanen. Der Befreiungskampf von 1813 bis 1816 erwarb Preußen die Achtung aller und das Vertrauen vieler nichtpreußischer Deutschen. Es war ein reiches Erbe, das die große Zeit der Erhebung und Befreiung hinterließ. Aber unter der Rückwirkung einer matten und glanzlosen äußeren Politik und durch eine Geschäftsführung im Innern, die weder im richtigen Augenblick zu geben noch zu weigern verstand, wurde dieses Erbe während der nächsten Jahrzehnte zum guten Teil wieder verwirtschaftet. Gegen Ende der fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts stand Preußen an innerer Haltung und an äußerer Geltung zurück hinter dem Preußen, wie es aus den Freiheitskriegen hervorgegangen war. Wohl hatte die nationale Einheitsbewegung durch die preußische Zollpolitik das erste feste Fundament erhalten. Aber der Tag von Olmütz zerstörte die Hoffnung der deutschen Patrioten, die von Preußen die Erfüllung der nationalen Wünsche erwarteten. Preußen schien auf seine weltgeschichtliche Mission zu verzichten und der machtpolitischen Fortführung des Einigungswerts zu entsagen, das es wirtschaftspolitisch zielbewußt begonnen hatte. Wohl waren durch die Überleitung des Staatslebens in konstitutionelle Bahnen neue Kräfte für das nationale Leben frei geworden. Unendliches hätte dieser Staat an innerer Lebendigkeit und nationaler Stoßkraft gewonnen, wenn dieses treue Volk zu rechter Zeit zur politischen Mitarbeit berufen worden wäre, wie es Stein und Hardenberg, Blücher und Gneisenau, Wilhelm von Humboldt und Boyen, auch Yorck und Bülow-Dennewitz gewünscht hatten. Als der große Schritt 33 Jahre zu spät getan wurde, war das Mißtrauen zwischen Volk und Obrigkeit schon zu tief eingefressen, hatte das Ansehen der Regierung im Verlauf der revolutionären Erhebung zu schweren Schaden genommen, als daß die modernen Staatsformen unmittelbar hätten Segen bringen können. Der Gang der preußischen Politik war gehemmt im Innern durch eine mißtrauische und in Doktrinen befangene Volksvertretung, nach außen durch den unbesiegten Widerstand der österreichischen Vormachtsansprüche. Da griff, von König Wilhelm im entscheidenden Augenblick berufen, nahezu in zwölfter Stunde Bismarck in das stockende Räderwert der preußischen Staatsmaschine.
Daß eine normale geschichtliche Entwicklung zur staatlichen Einigung Deutschlands unter preußischer Führung gelangen mußte, daß es das vornehmste Ziel preußischer Staatskunst war, diese Entwicklung zu beschleunigen und zu vollenden, das war den einsichtigen Patrioten jener Jahre wohl bewußt. Aber alle Wege, die man beschritten hatte, um zum Ziele zu gelangen, hatten sich als ungangbar erwiesen. Von der Initiative der preußischen Regierung schien je länger, je weniger zu erwarten. Die gutgemeinten, aber unpraktischen Versuche, das deutsche Volk zu veranlassen, die Bestimmung seiner Geschicke selbst in die Hand zu nehmen, scheiterten, weil die in Deutschland wie kaum in einem anderen Lande ausschlaggebende treibende Kraft der Regierungen fehlte. Im „Wilhelm Meister“ erwidert der erfahrene Lothario der schwermütigen Aurelie, die an den Deutschen vieles auszusetzen hat, es gäbe in der Welt keine bravere Nation als die deutsche, sofern sie nur recht geführt werde. Der Deutsche, welches Stammes er immer sei, hat stets unter einer starken, stetigen und festen Leitung das Größte vermocht, selten ohne eine solche oder im Gegensatz zu seinen Regierungen und Fürsten. Bismarck hat uns in seinen „Gedanken und Erinnerungen“ selbst erzählt, daß er sich hierüber von Anfang an nicht im Zweifel war. Mit genialer Intuition fand er den Weg, auf dem sich die Hoffnungen des Volkes mit den Interessen der deutschen Regierungen zusammenfinden mußten. Er war wie kaum je ein Staatsmann eingedrungen in die Geschichte der Nation, deren Leitung in seine Hände gelegt war. Hinter dem äußeren Zusammenhang der Ereignisse suchte und fand er die treibenden Kräfte des nationalen Lebens. Die große Zeit der Befreiung und Erhebung Preußens ist ihm, der im Jahre von Waterloo geboren und von Schleiermacher in der Berliner Dreifaltigkeitskirche eingesegnet worden war, nie aus dem Gedächtnis geschwunden, sie stand im Anfang seines weltgeschichtlichen Wirkens in voller Lebendigkeit vor seinen Augen. Er fühlte, daß sich in Deutschland nationaler Wille und nationale Leidenschaft nicht entzünden in Reibungen zwischen Regierung und Volk, sondern in den Reibungen deutschen Stolzes und Ehrgefühls an den Widerständen und Ansprüchen fremder Nationen. Solange die Frage der deutschen Einigung nur ein innerpolitisches Problem war, ein Problem, um das vorwiegend zwischen den Parteien und zwischen Regierung und Volk gehadert wurde, konnte sie eine Fürsten und Völker mitreißende gewaltige zwingende nationale Bewegung nicht erzeugen. Als Bismarck die deutsche Frage hinstellte als das, was sie im Kern war, als eine Frage der europäischen Politik, und als sich bald die außerdeutschen Gegner der deutschen Einigung regten, da gab er auch den Fürsten die Möglichkeit, sich an die Spitze der nationalen Bewegung zu stellen.
In Frankfurt, in Petersburg, in Paris hatte Bismarck den Mächten Europas in die Karten gesehen. Er hatte erkannt, daß die Einigung Deutschlands eine reine deutsch-nationale Angelegenheit nur so lange bleiben konnte, wie sie frommer Wunsch und unerfüllbare Hoffnung der Deutschen war, daß sie eine internationale Angelegenheit werden mußte mit dem Moment, in dem sie in das Stadium der Verwirklichung eintrat. Der Kampf mit den Widerständen in Europa lag auf dem Wege zur Lösung der großen Aufgabe der deutschen Politik. Anders als in einem solchen Kampfe aber waren die Widerstände in Deutschland selbst kaum aufzulösen. Damit war die nationale Politik der internationalen eingegliedert, die Vollendung des deutschen Einigungswerkes durch eine unvergleichliche staatsmännische Schöpferkraft und Kühnheit den ererbt schwächsten Fähigkeiten der Deutschen, den politischen, genommen und den angeborenen besten, den kriegerischen, zugewiesen. Eine günstige Fügung wollte es, daß Bismarck einen Feldherrn wie Moltke, einen militärischen Organisator wie Roon an seiner Seite fand. Die Waffentaten, die uns unsere europäische Großmachtsstellung zurückgewonnen hatten, sicherten sie zugleich. Sie nahmen den Großmächten die Lust, uns den Platz im europäischen Kollegium wieder zu entreißen, den wir in drei siegreichen Kriegen erobert hatten. Wenn uns dieser Platz auch ungern eingeräumt worden war, so ist er uns doch seitdem nicht ernstlich bestritten worden. Frankreich ausgenommen, hätte sich wohl alle Welt mit der Machtstellung Deutschlands allmählich befreundet, wenn unsere Entwicklung mit der Reichsgründung beendet gewesen wäre. Die staatliche Einigung ist aber nicht der Abschluß unserer Geschichte geworden, sondern der Anfang einer neuen Zukunft. In der vordersten Reihe der europäischen Mächte gewann das Deutsche Reich wieder vollen Anteil am Leben Europas. Das Leben des alten Europa aber war schon lange nur noch ein Teil des gesamten Völkerlebens.
Deutschland als Weltmacht.
Die Politik wurde mehr und mehr Weltpolitik. Die weltpolitischen Wege waren auch für Deutschland geöffnet, als es eine mächtige und gleichberechtigte Stelle neben den alten Großmächten gewann. Die Frage war nur, ob wir die vor uns liegenden neuen Wege beschreiten oder ob wir in Besorgnis um die eben gewonnene Macht vor weiterem Wagen zurückschrecken sollten. In Kaiser Wilhelm II. fand die Nation einen Führer, der ihr mit klarem Blick und festem Willen auf dem neuen Wege voranging. Mit ihm haben wir den weltpolitischen Weg beschritten. Nicht als Konquistadoren, nicht unter Abenteuern und Händeln. Wir sind langsam vorgegangen, haben uns das Tempo nicht vorschreiben lassen von der Ungeduld des Ehrgeizes, sondern von den Interessen und Rechten, die wir zu fördern und zu behaupten hatten. Wir sind nicht in die Weltpolitik hineingesprungen, wir sind in unsere weltpolitischen Aufgaben hineingewachsen, und wir haben nicht die alte europäische Politik Preußen-Deutschlands gegen die neue Weltpolitik ausgetauscht, sondern wir ruhen heute noch wie vor alters mit den starken Wurzeln unserer Kraft im alten Europa.
„Die Aufgabe unserer Generation ist es, gleichzeitig unsere kontinentale Stellung, welche die Grundlage unserer Weltstellung ist, zu wahren und unsere überseeischen Interessen so zu pflegen, eine besonnene, vernünftige, sich weise beschränkende Weltpolitik so zu führen, daß die Sicherheit des deutschen Volkes nicht gefährdet und die Zukunft der Nation nicht beeinträchtigt wird.“ Mit diesen Worten suchte ich am 14. November 1906 gegen Ende einer ausführlicheren Darstellung der internationalen Lage die Aufgabe zu formulieren, die Deutschland gegenwärtig und nach menschlichem Ermessen auch in Zukunft zu erfüllen hat: Weltpolitik auf der festen Basis unserer europäischen Großmachtstellung. Anfangs wurden wohl Stimmen laut, die das Beschreiten der neuen weltpolitischen Wege als ein Abirren von den bewährten Bahnen der Bismarckischen Kontinentalpolitik tadelten. Man übersah, daß gerade Bismarck uns neue Wege dadurch wies, daß er die alten zu ihren Zielen geführt hatte. Seine Arbeit hat uns die Tore der Weltpolitik recht eigentlich geöffnet. Erst nach der staatlichen Einigung und der politischen Erstarkung Deutschlands war die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft zur Weltwirtschaft möglich. Erst nachdem das Reich seine Stellung in Europa gesichert sah, konnte es daran denken, für die Interessen einzutreten, die deutsche Unternehmungslust, deutscher Gewerbefleiß und kaufmännischer Wagemut in aller Herren Länder geschaffen hatten. Gewiß sah Bismarck den Verlauf dieser neuen deutschen Entwicklung, die Aufgaben dieser neuen Zeit nicht im einzelnen voraus und konnte sie nicht voraussehen. In dem reichen Schatz politischer Erkenntnisse, die Fürst Bismarck uns hinterlassen hat, finden sich für unsere weltpolitischen Aufgaben nirgends die allgemeingültigen Sätze, wie er sie für eine große Zahl von Möglichkeiten unseres nationalen Lebens geprägt hat. Vergebens suchen wir in den Entschlüssen seiner praktischen Politik nach einer Rechtfertigung für die Entschließungen, die unsere weltpolitischen Aufgaben von uns fordern. Wohl wurde auch diese neue andere Zeit von Bismarck vorbereitet. Nie dürfen wir vergessen, daß wir ohne die gigantische Leistung des Fürsten Bismarck, der mit einem mächtigen Ruck in Jahren nachholte, was in Jahrhunderten vertan und versäumt worden war, die neue Zeit nicht hätten erleben können. Wenn aber auch jede neue Epoche geschichtlicher Entwicklung durch die vorhergehende bedingt ist, ihre treibenden Kräfte mehr oder minder stark der Vergangenheit dankt, so kann sie doch nur einen Fortschritt bringen, wenn sie die alten Wege und Ziele hinter sich läßt und zu anderen eigenen dringt. Entfernen wir uns auf unseren neuen weltpolitischen Bahnen auch von der europäischen Politik des ersten Kanzlers, so bleibt es doch wahr, daß die weltpolitischen Aufgaben des 20. Jahrhunderts die rechte Fortführung sind der kontinentalpolitischen Aufgaben, die er erfüllt hat. In jener Rede vom 14. November 1906 wies ich darauf hin, daß die Nachfolge Bismarcks nicht eine Nachahmung, sondern eine Fortbildung sein muß. „Wenn die Entwicklung der Dinge es verlangt,“ so sagte ich damals, „daß wir über Bismarckische Ziele hinausgehen, so müssen wir es tun.“
Die Entwicklung der Dinge aber hat die deutsche Politik längst hinausgetrieben aus der Enge des alten Europa in die weitere Welt. Es war nicht ehrgeizige Unruhe, die uns drängte, es den Großmächten gleichzutun, die seit lange die Wege der Weltpolitik gingen. Die durch die staatliche Wiedergeburt verjüngten Kräfte der Nation haben in ihrem Wachstum die Grenzen der alten Heimat gesprengt, und die Politik folgte den neuen nationalen Interessen und Bedürfnissen. In dem Maße, in dem unser nationales Leben ein Weltleben geworden ist, wurde die Politik des Deutschen Reichs zur Weltpolitik.
Im Jahre 1871 sammelte das neue Deutsche Reich 41 058 792 Einwohner in seine Grenzen. Sie fanden Nahrung und Arbeit in der Heimat, und zwar besser und leichter als zuvor, unter dem Schutze verstärkter nationaler Macht, unter vielfältig durch die Reichsgründung erleichterten Verkehrsbedingungen, unter den Segnungen der neuen allgemein-deutschen Gesetzgebung. Im Jahre 1900 aber war die Bevölkerungszahl auf 56 367 178, heute ist sie auf mehr als 65 000 000 angewachsen. Diese gewaltige Volksmasse konnte das Reich in seinen Grenzen in der alten Weise nicht mehr ernähren. Die Bevölkerungszunahme stellte dem deutschen Wirtschaftsleben und damit auch der deutschen Politik ein gewaltiges Problem. Es mußte gelöst werden, sollte der Überschuß an deutscher Kraft, den die Heimat nicht zu erhalten imstande war, nicht fremden Ländern zugute kommen. Im Jahre 1885 wanderten etwa 171 000 Deutsche aus, 1892 waren es 116 339, 1898 nur noch 22 921, und bei dieser letzten niedrigen Anzahl ist es seither durchschnittlich geblieben. Es konnte Deutschland also im Jahre 1885 einer um 20 000 000 geringeren Menschenzahl weniger gute Existenzbedingungen gewähren als gegenwärtig seinen 66 000 000 Reichsangehörigen. In dem gleichen Zeitraum ist der deutsche Außenhandel von etwa 6 Milliarden Mark Wert auf 19,16 Milliarden gestiegen. Welthandel und Volksernährung stehen in unverkennbarem Zusammenhange. Selbstverständlich viel weniger durch die eingeführten Nahrungsmittel selbst als durch die vermehrte Arbeitsgelegenheit, die die mit dem Welthandel verbundene Industrie zu gewähren vermag. Die Entwicklung der Industrie in erster Linie hat das dem nationalen Leben durch die Bevölkerungsvermehrung gestellte Problem der Lösung zugeführt, unbeschadet der durch das überraschend geschwinde Entwicklungstempo älteren Gebieten des volkswirtschaftlichen Lebens vorerst zugefügten Nachteile. Die enorme Vermehrung und Vergrößerung der industriellen Betriebe, die heute Millionen von Arbeitern und Angestellten beschäftigen, konnte nur erreicht werden dadurch, daß sich die Industrie des Weltmarktes bemächtigte. Wäre sie heute noch angewiesen auf die Verarbeitung der Rohstoffe, die der Kontinent liefert und auf den europäischen Markt für den Absatz ihrer Fabrikate, so könnte von den modernen Riesenbetrieben nicht die Rede sein, und es wären Millionen Deutscher, die heute unmittelbar durch die Industrie ihren Lebensunterhalt haben, ohne Lohn und Brot. Nach den statistischen Erhebungen wurden im Jahre 1911 Rohstoffe für Industriezwecke im Werte von 5393 Millionen eingeführt und fertige Waren ausgeführt im Werte von 5460 Millionen Mark. Hierzu kommt eine Ausfuhr von Rohstoffen, vor allem Bergwerkserzeugnissen im Werte von 2205 Millionen. Nahrungs- und Genußmittel werden für 3077 Millionen Mark ein-, für 1096 Millionen ausgeführt. Diese toten Zahlen gewinnen Leben, wenn bedacht wird, daß ein großes Stück deutschen Wohlergehens an ihnen hängt, Existenz und Arbeit von Millionen unserer Mitbürger. Der Welthandel vermittelt diese gewaltigen Warenmassen. Sie gehen nur zum geringen Teil auf den Land- und Wasserwegen des Festlandes, überwiegend über das Meer auf den Fahrzeugen deutscher Reeder. Industrie, Handel und Reederei haben dem alten deutschen Wirtschaftsleben die neuen weltwirtschaftlichen Formen gewonnen, die das Reich auch politisch hinausgeführt haben über die Ziele, die Fürst Bismarck der deutschen Staatskunst gesteckt hatte.
Mit seinen 19 Milliarden Außenhandel ist heute Deutschland hinter Großbritannien mit 25 und vor den Vereinigten Staaten mit 15 Milliarden die zweitgrößte Handelsmacht der Welt. Die deutschen Häfen sahen im Jahre 1910 11 800 eigene und 11 698 fremde Schiffe ankommen, 11 962 eigene und 11 678 fremde Schiffe auslaufen. Durchschnittlich 70 Dampfschiffe und an 40 Segelschiffe stellen die deutschen Reedereien jährlich neu ein. In rapider Entwicklung haben wir Deutschen unseren Platz gewonnen in der vordersten Reihe der seefahrenden und Seehandel treibenden Völker.
Notwendigkeit der Kriegsflotte.
Das Meer hat eine Bedeutung für unser nationales Leben gewonnen, wie niemals zuvor in unserer Geschichte, auch nicht in den großen Zeiten der deutschen Hansa. Es ist ein Lebensstrang für uns geworden, den wir uns nicht durchschneiden lassen dürfen, wenn wir nicht aus einem aufblühenden und jugendfrischen ein verwelkendes und alterndes Volk werden wollen. Dieser Gefahr waren wir aber ausgesetzt, solange es unserem Welthandel und unserer Schiffahrt gegenüber den übermächtigen Kriegsflotten anderer Mächte an nationalem Schutz auf dem Meere gebrach. Die Aufgaben, die die bewaffnete Macht des Deutschen Reichs zu erfüllen hat, hatten sich wesentlich verschoben, seitdem der kontinentale Schutz, den uns unsere Armee sicherte, nicht mehr genügte, den heimischen Gewerbefleiß gegen Störungen, Eingriffe und Angriffe von außen zu schirmen. Eine Kriegsflotte mußte der Armee zur Seite treten, damit wir unserer nationalen Arbeit und ihrer Früchte froh werden konnten.
Als im Frühjahr 1864 der englische Gesandte in Berlin den damaligen preußischen Ministerpräsidenten auf die Erregung aufmerksam machte, die das Vorgehen Preußens gegen Dänemark in England hervorrufe und dabei die Bemerkung fallen ließ, daß, wenn Preußen nicht Halt mache, die englische Regierung zu kriegerischen Maßnahmen gegen Preußen gedrängt werden könnte, erwiderte ihm Herr von Bismarck-Schönhausen: „Ja, was wollen Sie uns denn eigentlich tun? Schlimmstenfalls können Sie ein paar Granaten nach Stolpmünde oder Pillau werfen, das ist aber auch alles.“ Bismarck hatte recht für jene Zeit. Wir waren damals für das seebeherrschende England so gut wie unangreifbar, weil wir zur See nicht verwundbar waren. Wir besaßen weder eine große Handelsmarine, deren Zerstörung uns empfindlich treffen konnte, noch einen nennenswerten Überseehandel, dessen Unterbindung wir zu fürchten hatten.
Ganz anders heute. Wir sind zur See verwundbar geworden. Milliardenwerte haben wir dem Meere anvertraut und mit diesen Werten Wohl und Wehe vieler Millionen unserer Landsleute. Wenn wir nicht rechtzeitig für den Schutz dieses kostbaren und unentbehrlichen nationalen Besitzes sorgten, waren wir der Gefahr ausgesetzt, eines Tages wehrlos ansehen zu müssen, wie er uns genommen wurde. Dann aber wären wir nicht etwa wirtschaftlich und politisch in das behagliche Dasein eines reinen Binnenstaates zurückgesunken. Wir wären vielmehr in die Lage versetzt worden, einen beträchtlichen Teil unserer Millionenbevölkerung in der Heimat weder beschäftigen noch ernähren zu können. Eine wirtschaftliche Krise wäre die Folge gewesen, eine Krise, die sich zu einer nationalen Katastrophe auswachsen konnte.
Bau der Kriegsflotte.
Der Bau einer zum Schutze unserer überseeischen Interessen ausreichenden Flotte war seit Ausgang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts eine Lebensfrage für die deutsche Nation geworden. Daß Kaiser Wilhelm II. das erkannt und an die Erreichung dieses Zieles die ganze Macht der Krone und die ganze Kraft der eigenen Individualität gesetzt hat, ist sein großes geschichtliches Verdienst. Dieses Verdienst wird noch dadurch erhöht, daß das Oberhaupt des Reichs für den Bau der deutschen Flotte in dem Augenblick eintrat, wo sich das deutsche Volk über seine weitere Zukunft entscheiden mußte und wo nach menschlicher Berechnung die letzte Möglichkeit vorlag, für Deutschland den ihm notwendigen Seepanzer zu schmieden. Die Flotte sollte gebaut werden unter Behauptung unserer Stellung auf dem Kontinent, ohne Zusammenstoß mit England, dem wir zur See noch nichts entgegenzusetzen hatten, aber unter voller Wahrung unserer nationalen Ehre und Würde. Der damals noch recht erhebliche parlamentarische Widerstand war nur zu überwinden, wenn die öffentliche Meinung einen nachhaltigen Druck auf das Parlament ausübte. Die öffentliche Meinung ließ sich nur in Bewegung bringen, wenn gegenüber der im ersten Jahrzehnt nach dem Rücktritt des Fürsten Bismarck in Deutschland herrschenden unsicheren und mutlosen Stimmung das nationale Motiv mit Entschiedenheit betont und das nationale Bewußtsein wachgerufen wurde. Der Druck, der seit dem Bruch zwischen dem Träger der Kaiserkrone und dem gewaltigen Manne, der diese Krone aus der Tiefe des Kyffhäusers hervorgeholt hatte, auf dem deutschen Gemüt lastete, konnte nur überwunden werden, wenn dem deutschen Volk, dem es gerade damals an einheitlichen Hoffnungen und Forderungen fehlte, von seinem Kaiser ein neues Ziel gesteckt und ihm der Platz an der Sonne gezeigt wurde, auf den es ein Recht hatte und dem es zustreben mußte. Das patriotische Empfinden sollte aber auch nicht überschäumend und in nicht wieder gut zu machender Weise unsere Beziehungen zu England stören, dem gegenüber unsere Defensivstärke zur See noch für Jahre hinaus eine ganz ungenügende war und vor dem wir 1897, wie sich in jenem Jahr ein kompetenter Beurteiler einmal ausdrückte, zur See dalagen wie Butter vor dem Messer. Den Bau einer ausreichenden Flotte zu ermöglichen, war die nächstliegende und große Aufgabe der nachbismarckischen deutschen Politik, eine Aufgabe, vor die auch ich mich in erster Linie gestellt sah, als ich am 28. Juni 1897 in Kiel, auf der „Hohenzollern“, am gleichen Tage und an derselben Stelle, wo ich 12 Jahre später um meine Entlassung bat, von Seiner Majestät dem Kaiser mit der Führung der auswärtigen Angelegenheiten betraut wurde.
Am 28. März 1897 hatte der Reichstag in dritter Lesung die Anträge der Budgetkommission angenommen, die an den Forderungen der Regierung für Ersatzbauten, Armierung und Neubauten beträchtliche Abstriche vornahmen. Am 27. November veröffentlichte die Regierung, nachdem der bisherige Staatssekretär des Reichsmarineamts, Admiral von Hollmann, durch eine Kraft ersten Ranges, den Admiral von Tirpitz, ersetzt worden war, eine neue Marinevorlage, die den Neubau von 7 Linienschiffen, 2 großen und 7 kleinen Kreuzern forderte, den Zeitpunkt für die Fertigstellung der Neubauten auf den Schluß des Rechnungsjahres 1904 festsetzte und durch Begrenzung der Lebensdauer der Schiffe und die Bestimmung über die dauernd im Dienst zu haltenden Formationen die rechtzeitige Vornahme von Ersatzbauten sicherstellte. In der Vorlage hieß es: „Unter voller Wahrung der Rechte des Reichstages und ohne neue Steuerquellen in Anspruch zu nehmen, verfolgen die verbündeten Regierungen nicht einen uferlosen Flottenplan, sondern einzig und allein das Ziel, in gemessener Frist eine vaterländische Kriegsmarine von so begrenzter Stärke und Leistungsfähigkeit zu schaffen, daß sie zur wirksamen Vertretung der Seeinteressen des Reiches genügt.“ Die Vorlage schob die Flottenpolitik auf ein vollkommen neues Geleis. Bisher waren von Zeit zu Zeit einzelne Neubauten gefordert und zum Teil bewilligt worden, aber das feste Fundament, das die Armee im Sollbestand ihrer Formationen besaß, hatte der Kriegsmarine gefehlt. Erst durch die Festsetzung der Lebensdauer der Schiffe einerseits, des Bestandes an dienstfähigen Schiffen andererseits wurde die Flotte ein fester Bestandteil unserer nationalen Wehrmacht.
Der Bau der deutschen Flotte mußte wie vor ihm andere große Aufgaben unserer vaterländischen Geschichte mit dem Auge auf das Ausland durchgeführt werden. Es war vorauszusehen, daß diese folgenschwere Verstärkung unserer nationalen Macht in England Unbehagen und Mißtrauen hervorrufen würde.
Die traditionelle Politik Englands.
Die Politik keines Staates der Welt bewegt sich so fest in traditionellen Bahnen wie die englische, und gewiß nicht zuletzt dieser sich durch Jahrhunderte forterbenden zähen Konsequenz seiner auswärtigen Politik, die in ihren Endzielen und Grundlinien unabhängig vom Wechsel der Parteiherrschaft gewesen ist, verdankt England seine großartigen weltpolitischen Erfolge. Das A und O aller englischen Politik war seit jeher die Erreichung und Erhaltung der englischen Seeherrschaft. Diesem Gesichtspunkt sind alle anderen Erwägungen, Freundschaften wie Feindschaften stets zielbewußt untergeordnet worden. Es wäre töricht, die englische Politik mit dem zu Tode gehetzten Wort vom „perfiden Albion“ abtun zu wollen. In Wahrheit ist diese angebliche Perfidie nur ein gesunder und berechtigter nationaler Egoismus, an dem sich andere Völker, ebenso wie an anderen großen Eigenschaften des englischen Volkes, ein Beispiel nehmen können.
Während der zweiten Hälfte des 18. und der ersten des 19. Jahrhunderts stand England an der Seite Preußens, und zwar gerade in kritischen Zeiten preußischer Geschichte während des Siebenjährigen Krieges und im Zeitalter Napoleons I. Es war aber weniger gemütvolle Sympathie mit dem kühn und mühevoll emporstrebenden blutsverwandten Staat im deutschen Norden, was die englische Haltung bestimmte. England trat für englische Zwecke an die Seite des tüchtigsten Gegners der stärksten europäischen Macht und ließ Friedrich den Großen in schwerer Stunde, ließ Preußen auf dem Wiener Kongreß kaltblütig im Stich, als es seine Zwecke erreicht sah. Während der Fesselung der französischen Kräfte im Siebenjährigen Kriege brachte England seinen nordamerikanischen Besitz in Sicherheit. In den großen Jahren 1813 bis 1815 zertrümmerte die stürmische Tapferkeit Preußens endlich und endgültig die napoleonische Weltherrschaft. Als Preußen in Wien um jeden Quadratkilometer Land bitter hadern mußte, hatte England seine Weltmacht errungen und konnte sie nach der Niederwerfung des französischen Gegners für absehbare Zeit als gesichert ansehen. Als Feind der stärksten Kontinentalmacht waren wir Englands Freund, durch die Ereignisse von 1866 und 1870 wurde Preußen-Deutschland die stärkste Macht des europäischen Festlandes und rückte in der englischen Vorstellung allmählich an den Platz, den früher das Frankreich des Sonnenkönigs und der beiden Bonapartes eingenommen hatte. Die englische Politik folgte ihrer traditionellen Richtung, die Front gegen die jeweilig stärkste Kontinentalmacht zu nehmen. Nach dem Niedergange des habsburgischen Spaniens war das Frankreich der Bourbonen Englands natürlicher Gegner, von der hervorragenden Teilnahme Marlboroughs am spanischen Erbfolgekrieg bis zum Bündnis mit dem Sieger der Schlacht bei Roßbach, die in London wie ein Triumph der britischen Waffen gefeiert wurde. Nach den Jahrzehnten eifersüchtigen Mißtrauens gegen das unter Katharina II. mächtig erstarkende Rußland wandte sich die englische Politik aufs neue und mit voller Energie gegen Frankreich, als Bonaparte die Armeen der Republik zum Siege über alle Staaten des europäischen Festlandes führte. In dem Ringkampf zwischen dem ersten Kaiserreich und England blieb England Sieger, gewiß in erster Linie dank der unerschütterlichen und grandiosen Stetigkeit seiner Politik, dem Heldenmut seiner Blaujacken bei Abukir und Trafalgar und den Erfolgen seines eisernen Herzogs in Spanien, aber auch durch die Zähigkeit der Russen und Österreicher und den Ungestüm unseres alten Blücher und seiner Preußen. Als nach dem Sturz Napoleons das militärische Übergewicht vom Westen Europas auf den Osten überzugehen schien, wandte England seine politische Front. An dem für Rußland unglücklichen Ausgang des Krimkrieges und an dem Scheitern der hochfliegenden Pläne des stolzen Kaisers Nikolaus I. hatte England hervorragenden Anteil, und auch Kaiser Alexander II. fand die englische Politik nicht selten auf seinen politischen Wegen, am fühlbarsten im nahen Orient, dem alten Hoffnungsfelde russischen Ehrgeizes. Das englische Bündnis mit Japan ging aus ähnlichen Erwägungen hervor wie die entente cordiale mit Frankreich, die die internationale Politik der Gegenwart entscheidend beeinflußt.
Das Interesse, das England an der Gestaltung der Machtverhältnisse auf dem europäischen Festlande nimmt, gilt selbstverständlich nicht allein dem Wohlbefinden derjenigen Mächte, die sich durch die überlegene Stärke einer einzigen unterdrückt oder bedroht fühlen. Solche menschenfreundliche Anteilnahme pflegt selten einen überwiegenden Einfluß auf die politischen Entschließungen der Regierung eines großen Staates auszuüben. Für die Richtung der englischen Politik sind die Rückwirkungen der europäischen Machtverhältnisse auf die englische Seeherrschaft maßgebend. Und jede Machtverschiebung, die eine solche Wirkung nicht im Gefolge haben konnte, ist der englischen Regierung immer ziemlich gleichgültig gewesen. Wenn England traditionell, das heißt seinen unveränderlichen nationalen Interessen angemessen, der jeweils stärksten Kontinentalmacht unfreundlich oder mindestens argwöhnisch gegenübersteht, so liegt der Grund vornehmlich in der Bedeutung, die England der überlegenen kontinentalen Macht für die überseeische Politik beimißt. Eine europäische Großmacht, die ihre militärische Stärke so drastisch gezeigt hat, daß sie im normalen Lauf der Dinge eines Angriffs auf ihre Grenzen nicht gewärtig zu sein braucht, gewinnt gewissermaßen die nationalen Existenzbedingungen, durch die England zur ersten See- und Handelsmacht der Welt geworden ist. England dürfte mit seinen Kräften und seinem Wagemut unbesorgt auf das Weltmeer gehen, weil es seine heimischen Grenzen durch die umgebende See vor feindlichen Angriffen geschützt wußte. Besitzt eine Kontinentalmacht eben diesen Schutz der Grenzen in ihrer gefürchteten, siegreichen und überlegenen Armee, so gewinnt sie die Freiheit zu überseeischer Politik, die England seiner geographischen Lage dankt. Sie wird Wettbewerberin auf jenem Felde, auf dem England die Herrschaft beansprucht. Die englische Politik fußt hier auf den Erfahrungen der Geschichte, man könnte fast sagen, auf der Gesetzmäßigkeit in der Entwicklung der Nationen und Staaten. Noch jedes Volk mit gesundem Instinkt und lebensfähiger Staatsordnung hat an die Meeresküste gedrängt, wenn sie die Natur ihm versagt hatte. Um Küstenstriche und Hafenplätze ist am hartnäckigsten und bittersten gerungen worden, von Kerkyra und Potidäa, um die sich der Peloponnesische Krieg entzündete, bis zu Kavalla, um das in unseren Tagen Griechen und Bulgaren haderten. Völker, die das Meer nicht gewinnen konnten oder von ihm abgedrängt wurden, schieden stillschweigend aus dem großen weltgeschichtlichen Wettbewerb aus. Der Besitz der Meeresküste bedeutet aber nichts anderes als die Möglichkeit zu überseeischer Kraftentfaltung und letzten Endes die Möglichkeit, die kontinentale Politik zur Weltpolitik zu weiten. Die Völker Europas, die ihre Küsten und Häfen in diesem Sinne nicht nutzten, konnten es nicht tun, weil sie ihre gesamte nationale Kraft zur Verteidigung ihrer Grenzen gegen ihre Widersacher auf dem Festlande nötig hatten. So mußten die weitausschauenden kolonialpolitischen Pläne des Großen Kurfürsten von seinen Nachfolgern aufgegeben werden.
Der stärksten Kontinentalmacht standen die weltpolitischen Wege stets am freiesten offen. Auf diesen Wegen aber hielt England die Wacht. Als Ludwig XIV. bei Karl II. ein französisch-englisches Bündnis anregte, erwiderte ihm dieser im übrigen sehr franzosenfreundliche englische König, es stünden einem aufrichtigen Bündnis gewisse Hindernisse im Wege, und von diesen sei das vornehmste die Mühe, die sich Frankreich gebe, eine achtunggebietende Seemacht zu werden. Das sei für England, das nur durch seinen Handel und seine Kriegsmarine Bedeutung haben könne, ein solcher Grund zum Argwohn, daß jeder Schritt, den Frankreich in dieser Richtung tun werde, die Eifersucht zwischen beiden Völkern von neuem aufstacheln müsse. Nach dem Abschluß des Hubertusburger Friedens gab der ältere Pitt im Parlament seinem Bedauern Ausdruck, daß man Frankreich die Möglichkeit gewährt habe, seine Flotte wieder aufzubauen. Vornehmlich als Gegner der französischen Überseepolitik wurde England der Feind Frankreichs im spanischen Erbfolgekriege, der der französischen Vorherrschaft in Europa den ersten empfindlichen Stoß versetzte, England mit Gibraltar den Schlüssel zum Weltmeer und das Kerngebiet des von Frankreich heiß umstrittenen Kanada eintrug. In der Mitte des 18. Jahrhunderts sagte Lord Chatam: „Die einzige Gefahr, die England zu befürchten hat, entsteht an dem Tage, der Frankreich im Range einer großen See-, Handels- und Kolonialmacht sieht.“ Und vor dem Krimkriege schrieb David Urquhart: „Unsere insulare Lage läßt uns nur die Wahl zwischen Allmacht und Ohnmacht. Britannia wird die Königin des Meeres sein oder vom Meer verschlungen werden.“
Die englische Politik ist sich bis in die Gegenwart treu geblieben, weil England heute wie einst die erste Seemacht ist. An die Stelle der robusten Konflikte der älteren Zeit sind die feineren diplomatischen getreten. Der politische Zweck ist unverändert.
Deutschland und England.
Als Deutschland nach Lösung seiner kontinentalpolitischen Aufgaben, nach der Sicherung seiner europäischen Machtstellung, sich weder willens zeigte, noch überhaupt in der Lage war, auf das Beschreiten der weltpolitischen Wege zu verzichten, mußte es für England unbequem werden. Die Konsequenzen dieser Wendung konnten in ihren Wirkungen durch die Diplomatie gemildert werden, zu verhindern waren sie nicht.
Wenn wir aber auch die Traditionen der englischen Politik verstehen können, so liegt in einem solchen Verständnis doch keineswegs das Zugeständnis, daß England Grund hat, der Ausweitung der deutschen Volkswirtschaft zur Weltwirtschaft, der deutschen Kontinentalpolitik zur Weltpolitik und insbesondere dem Bau einer deutschen Kriegsflotte mit dem gleichen Mißtrauen zu begegnen, das in früheren Jahrhunderten anderen Mächten gegenüber vielleicht am Platze war. Der Gang unserer Weltpolitik ist in den Mitteln wie in den Zielen grundverschieden von den Welteroberungsversuchen Spaniens, Frankreichs und zu Zeiten auch Hollands und Rußlands in der Vergangenheit. Die Weltpolitik, gegen die England früher so nachdrücklich auftrat, ging zumeist auf eine mehr oder minder gewaltsame Veränderung der internationalen Verhältnisse aus. Wir tragen lediglich unseren veränderten nationalen Lebensbedingungen Rechnung. Die von England oft bekämpfte Weltpolitik anderer Länder trug einen offensiven, die unsere trägt einen defensiven Charakter. Wir wollten und mußten zur See so stark werden, daß jeder Angriff auf uns für jede Seemacht mit einem sehr erheblichen Risiko verbunden war, und wir so in der Wahrung unserer überseeischen Interessen frei wurden von dem Einfluß und der Willkür anderer seemächtiger Staaten. Unsere kraftvolle nationale Entwicklung vornehmlich auf wirtschaftlichem Gebiet hatte uns über das Weltmeer gedrängt. Um unserer Interessen wie um unserer Würde und Ehre wegen mußten wir dafür Sorge tragen, daß wir für unsere Weltpolitik dieselbe Unabhängigkeit gewannen, die wir uns für unsere europäische Politik gesichert hatten. Die Erfüllung dieser nationalen Pflicht konnte durch den etwaigen englischen Widerstand wohl erschwert werden, aber kein Widerstand der Welt konnte uns ihr entheben.
Mit dem Auge auf die englische Politik mußte unsere Flotte gebaut werden – und so ist sie gebaut worden. Der Erfüllung dieser Aufgabe hatten meine Bemühungen auf dem Felde der großen Politik in erster Linie zu gelten. In doppelter Hinsicht mußte sich Deutschland international unabhängig stellen. Wir durften uns weder von einer grundsätzlich gegen England gerichteten Politik das Gesetz unseres Entschließens und Handelns vorschreiben lassen, noch durften wir uns um der englischen Freundschaft willen in englische Abhängigkeit begeben. Beide Gefahren waren gegeben und rückten mehr als einmal in bedenkliche Nähe. In unserer Entwicklung zur Seemacht konnten wir weder als Englands Trabant, noch als Antagonist Englands zum erwünschten Ziele kommen. Die vorbehaltlose und sichere Freundschaft Englands wäre schließlich nur zu erkaufen gewesen durch Aufopferung eben der weltpolitischen Pläne, um derentwillen wir die britische Freundschaft gesucht hätten. Wären wir diesen Weg gegangen, so würden wir den Fehler begangen haben, den der römische Dichter meint, wenn er sagt, man dürfe nicht propter vitam vivendi perdere causas. Als Englands Feind aber hätten wir schwerlich Aussicht gehabt, in unserer Entwicklung zur See- und Welthandelsmacht so weit zu kommen, wie wir am Ende gelangt sind.
Deutschland und England während des Burenkrieges.
Während des Burenkrieges, der die Kraft des britischen Imperiums auf das äußerste anspannte und England vor große Schwierigkeiten führte, schien sich wohl eine Gelegenheit zu bieten, den stillen Widersacher unserer Weltpolitik empfindlich zu treffen. Wie im übrigen Europa gingen auch in Deutschland die Wogen der Burenbegeisterung hoch. Unternahm es die Regierung, England in den Arm zu fallen, so war sie des Beifalls der öffentlichen Meinung gewiß. Für einen momentanen Erfolg gegen England schien vielen die europäische Konstellation günstig und namentlich die französische Hilfe sicher. Aber die europäische Interessengemeinschaft gegen England war nur scheinbar, und scheinbarer noch wäre für uns der Wert eines etwaigen politischen Erfolges gegen England in der Burenfrage gewesen. Der Versuch, unter dem Eindruck der damaligen burenfreundlichen Stimmung zu Taten zu schreiten, hätte bald eine Ernüchterung zur Folge gehabt. In der französischen Nation hätte der tiefsitzende nationale Groll gegen das Deutsche Reich die momentane Verstimmung gegen England rasch und elementar verdrängt, sobald wir uns gegen England festgelegt hätten, und ein grundsätzlicher Frontwechsel der französischen Politik in greifbare Nähe gerückt worden wäre. Mochte die frische Erinnerung an Faschoda für den französischen Stolz auch noch so ärgerlich sein, gegen die Erinnerung an Sedan wog sie federleicht. Der ägyptische Sudan und der weiße Nil hatten den Gedanken an Metz und Straßburg nicht aus den französischen Herzen verdrängt. Die Gefahr lag nahe, daß wir von Frankreich gegen England vorgeschoben wurden, während Frankreich selbst sich im psychologischen Moment der Mitwirkung versagte. Wie in Schillers schönem Gedicht „Die Ideale“ hätten die Begleiter sich auf des Weges Mitten verloren. Aber selbst, wenn es gelang, Englands südafrikanische Politik durch eine europäische Aktion zu durchkreuzen, so war für unsere nächsten nationalen Interessen damit nichts gewonnen. Unsere Beziehungen zu England wären selbstredend von Stund an und für lange Zeit gründlich vergiftet worden. Der passive Widerstand Englands gegen die Weltpolitik des neuen Deutschland hätte sich in eine sehr aktive Gegnerschaft verwandelt. Wir gingen gerade in jenen Jahren an die Begründung der deutschen Seemacht durch den Bau unserer Kriegsflotte, England aber hatte, auch unbeschadet eines etwaigen Mißerfolges im südafrikanischen Kriege, damals die Macht, unsere Entwicklung zur Seemacht im Keim zu ersticken. Unsere neutrale Haltung während des Burenkrieges entsprang gewichtigen nationalen Interessen des Deutschen Reiches.
Uns den Weg zur Erringung zureichender Seemacht über die Interessen Englands hinweg gewaltsam zu bahnen, waren wir zur See nicht stark genug. Im Schlepptau englischer Politik war das den Engländern unerwünschte Ziel deutscher Machtentfaltung zur See ebensowenig zu erreichen.
Preßerörterungen über die Möglichkeit eines deutsch-englischen Bündnisses.
Der Gedanke lag nahe, es könne der englische Widerstand gegen die deutsche Weltpolitik und vor allem gegen den deutschen Flottenbau am leichtesten überwunden werden durch ein Bündnis zwischen Deutschland und England. Die Idee einer deutsch-englischen Allianz ist in der Tat in der Presse beider Länder bisweilen erörtert worden. Dieser Gedanke hat schon Bismarck beschäftigt, freilich, um ihm schließlich die resignierte Bemerkung zu entlocken: „Wir wären ja gern bereit, die Engländer zu lieben, aber sie wollen sich nicht von uns lieben lassen.“ Auch später wäre Deutschland vielleicht nicht abgeneigt gewesen, auf der Basis voller Parität und gleichmäßiger Bindung in ein vertragsmäßiges Verhältnis zu England zu treten. Mit Stipulationen, die England im Falle eines Regierungswechsels oder bei Eintritt anderer, von unserem Willen unabhängiger Ereignisse hätte abstreifen können, während wir an sie gebunden geblieben wären, würde den deutschen Interessen nicht gedient gewesen sein. Es hätte uns auch nicht genügen können, daß nur dieser oder jener Minister einem deutsch-englischen Abkommen geneigt schien. Um ein Abkommen haltbar zu machen, mußte sich die gesamte Regierung und vor allem der Premierminister dafür einsetzen. Bismarck hat darauf hingewiesen, wie schwierig es sei, in ein festes Verhältnis zu England zu treten, weil Bündnisse von längerer Dauer nicht den englischen Traditionen entsprächen und die Meinungsäußerungen englischer Politiker selbst in leitender Stellung oder momentane Stimmungen der englischen Presse nicht den Wert unwandelbarer Zusagen hätten. Frankreich, dem aus vielen Gründen die englische öffentliche Meinung geneigter ist als uns, in dem England heute nicht mehr einen Rivalen und namentlich keinen ernstlichen Konkurrenten zur See und im Welthandel sieht, befindet sich England gegenüber in einer anderen Lage als wir. Nur bei absolut und dauernd bindenden englischen Verpflichtungen hätten wir angesichts der Eifersucht weiter englischer Kreise gegen die wirtschaftlichen Fortschritte Deutschlands und vor allem gegen das Anwachsen der deutschen Kriegsflotte die Brücke einer englisch-deutschen Allianz betreten dürfen. Wir konnten uns an England nur unter der Voraussetzung binden, daß die Brücke, die über die wirklichen und vermeintlichen Gegensätze zwischen uns und England führen sollte, auch wirklich tragfähig war.
Die Weltlage war damals, als die Allianzfrage ventiliert wurde, in vieler Hinsicht eine andere als heute. Rußland war noch nicht durch den japanischen Krieg geschwächt, sondern gewillt, seine eben gewonnene Stellung an der asiatischen Ostküste und speziell im Golf von Petschili zu befestigen und auszubauen. Die Beziehungen zwischen England und Rußland waren gerade wegen der zwischen beiden Reichen schwebenden asiatischen Fragen damals recht gespannte. Die Gefahr lag nahe, daß einem mit England verbündeten Deutschland die Rolle gegen Rußland zufallen würde, die später Japan allein übernahm. Nur hätten wir diese Rolle unter Bedingungen durchführen müssen, die nicht zu vergleichen sind mit den günstigen Voraussetzungen, die Japan für seinen Zusammenstoß mit Rußland vorfand. Der japanische Krieg war in Rußland unpopulär, und Rußland mußte ihn auf ungeheure Entfernungen gleichsam als Kolonialkrieg führen. Ließen wir uns gegen Rußland vorschieben, so kamen wir in eine viel schwierigere Lage. Der Krieg gegen Deutschland wäre unter solchen Umständen in Rußland nicht unpopulär gewesen, er wäre von russischer Seite mit dem nationalen Elan geführt worden, wie er dem Russen eigen ist in der Verteidigung seines heimatlichen Bodens. Für Frankreich hätte der Casus foederis vorgelegen. Frankreich hätte seinen Revanchekrieg unter nicht ungünstigen Bedingungen führen können. England stand damals vor dem Burenkrieg. Seine Lage würde erleichtert worden sein, wenn seine große kolonialpolitische Unternehmung unterstützt und begleitet worden wäre von einer europäischen Verwicklung, wie sie England in der Mitte des 18. und im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts gute Dienste geleistet hatten. Wir Deutschen hätten bei einem allgemeinen Konflikt einen schweren Landkrieg nach zwei Fronten zu tragen gehabt, während England die leichtere Aufgabe zugefallen wäre, sein Kolonialreich ohne große Mühe weiter zu vergrößern und von der gegenseitigen Schwächung der Festlandmächte zu profitieren. Endlich und nicht zuletzt hätten wir während eines kriegerischen Engagements auf dem Festlande und geraume Zeit nachher keinesfalls Kraft, Mittel und Muße gefunden, den Aufbau unserer Kriegsflotte so zu fördern, wie wir es haben tun können. So blieb uns nur die Möglichkeit, an den englischen Interessen gleichsam vorüberzugehen, den feindlichen Zusammenstoß und die gefügige Abhängigkeit in gleicher Weise zu meiden.
England und die deutsche Flotte.
So ist es denn auch in der Tat gelungen, uns unbehelligt und unbeeinflußt von England diejenige Macht zur See zu schaffen, die unseren wirtschaftlichen Interessen und unserem weltpolitischen Willen die reale Grundlage gibt, und die anzugreifen auch dem stärksten Gegner als ein ernstes Wagnis erscheinen muß. Während der ersten zehn Jahre nach der Einbringung der Marinevorlage von 1897 und dem Beginn unserer Schiffsbauten wäre eine zum äußersten entschlossene englische Politik wohl in der Lage gewesen, die Entwicklung Deutschlands zur Seemacht kurzer Hand gewaltsam zu unterbinden, uns unschädlich zu machen, bevor uns die Krallen zur See gewachsen waren. In England wurde ein solches Vorgehen gegen Deutschland wiederholt gefordert. Der Civillord der Admiralität Mr. Arthur Lee erklärte am 3. Februar 1905 in öffentlicher Rede, man müsse die Augen auf die Nordsee richten, die britische Flotte in der Nordsee sammeln und im Kriegsfalle „den ersten Schlag führen, bevor die andere Partei Zeit finden würde, in den Zeitungen zu lesen, daß der Krieg erklärt ist“. Diese Auslassung unterstrich der „Daily Chronicle“ mit den Worten: „Wenn die deutsche Flotte 1904 im Oktober zerstört worden wäre, würden wir in Europa für sechzig Jahre Frieden gehabt haben. Aus diesen Gründen halten wir die Äußerungen von Mr. Arthur Lee, angenommen, daß sie im Auftrage des Kabinetts erfolgten, für eine weise und friedfertige Erklärung der unwandelbaren Absicht der Herrin der Meere.“ Im Herbst 1904 hatte die Army and Navy Gazette ausgeführt, wie unerträglich es sei, daß England allein durch das Vorhandensein der deutschen Flotte dazu gezwungen werde, Vorsichtsmaßregeln zu treffen, deren es sonst nicht bedürfen würde. „Wir haben“, hieß es in diesem Artikel, „schon einmal einer Flotte das Lebenslicht ausblasen müssen, von der wir Grund hatten zu glauben, daß sie zu unserem Schaden verwendet werden könnte. Es fehlt in England wie auf dem Festlande nicht an Leuten, die die deutsche Flotte für die einzige und wirkliche Bedrohung der Erhaltung des Friedens in Europa halten. Sei dem, wie es wolle, wir begnügen uns damit, darauf hinzuweisen, daß der gegenwärtige Augenblick besonders günstig ist für unsere Forderung, daß diese Flotte nicht weiter vergrößert werde.“ Um dieselbe Zeit schrieb eine angesehene englische Revue: „Wenn die deutsche Flotte vernichtet würde, wäre der Friede Europas auf zwei Generationen gesichert; England und Frankreich oder England und die Vereinigten Staaten oder alle drei würden die Freiheit der Meere verbürgen und den Bau neuer Schiffe verhindern, die in den Händen ehrgeiziger Mächte mit wachsender Bevölkerung und ohne Kolonien gefährliche Waffen sind.“ Gerade um diese Zeit, im Herbst 1904 schickte Frankreich sich an, uns in Marokko zu brüskieren. Einige Monate vorher, im Juni 1904, hatte ein französischer Publizist mir erzählt, der Bau unserer Flotte rufe in weiten englischen Kreisen große und wachsende Unruhe hervor. Man sei sich dort noch nicht im klaren darüber, wie die Fortführung unserer Schiffsbauten zu verhindern sei, ob durch direkte Vorstellungen oder durch Begünstigung der chauvinistischen Elemente in Frankreich. Heute läßt uns England als Seemacht gelten, als die stärkste Seemacht nach sich selbst. Als im Winter 1909 ein englischer Parlamentsredner die Tatsache feststellte, daß England nicht nötig haben würde, so fieberhaft zur See zu rüsten, wenn es zehn Jahre zuvor das Aufkommen der deutschen Seemacht verhindert hätte, sprach er einen Gedanken aus, der vom Standpunkt reiner Machtpolitik begreiflich und vielleicht zutreffend ist. Die Gelegenheit, eine werdende Flotte im Keime zu ersticken, die England in früheren Zeiten und gegen andere Länder wiederholt wahrnahm, hätte es aber Deutschland gegenüber nicht finden können, da wir nicht die Flanke boten.
Die Friedlichkeit deutscher Weltpolitik.
Die Flotte, die wir uns seit 1897 geschaffen haben und die uns, freilich in weitem Abstande von England, zur zweiten Seemacht der Erde macht, sichert uns die Möglichkeit, der Vertretung unserer deutschen Interessen in der Welt machtpolitischen Nachdruck zu leihen. Ihr ist in erster Linie die Aufgabe zugedacht, unseren Welthandel, Leben und Ehre unserer deutschen Mitbürger im Auslande zu schützen. Diese Aufgabe haben deutsche Kriegsschiffe in Westindien und Ostasien erfüllt. Gewiß ist es eine vorwiegend defensive Rolle, die wir unserer Flotte zuweisen. Daß diese defensive Rolle sich in ernsten internationalen Konflikten erweitern könnte, ist selbstverständlich. Wenn das Reich mutwillig angegriffen werden sollte, gleichviel von welcher Seite, wird in unseren Zeiten die See als Kriegsschauplatz eine ganz andere und vermehrte Bedeutung gewinnen als 1870. Daß in einem solchen Fall die Flotte wie die Armee getreu der preußisch-deutschen Tradition im Hieb die beste Parade sehen würde, darüber braucht kein Wort gesagt zu werden. Völlig gegenstandslos aber ist die Sorge, die den Bau unserer Flotte begleitet hat, es möchte mit dem Erstarken Deutschlands zur See die deutsche Angriffslust erwachen.
Von allen Völkern der Erde ist das deutsche dasjenige, das am seltensten angreifend und erobernd vorgegangen ist. Wenn wir von den Römerfahrten der deutschen Kaiser des Mittelalters absehen, deren treibende Kraft mehr ein großartiger traumhafter politischer Irrtum gewesen ist als ungebändigte Eroberungs- und Kriegslust, so werden wir vergeblich in unserer Vergangenheit nach Eroberungskriegen suchen, die denen Frankreichs im 17., 18. und 19. Jahrhundert, denen des Habsburgischen Spaniens, Schwedens in seiner Glanzzeit, denen des russischen und englischen Reichs im Zuge ihrer grundsätzlich expansiven nationalen Politik an die Seite zu setzen sind. Mehr als die Verteidigung und Sicherung unseres Vaterlandes haben wir Deutschen in Jahrhunderten nie erstrebt. So wenig wie der große König seine unbesiegten Bataillone nach der Eroberung Schlesiens und der Sicherung der Selbständigkeit der preußischen Monarchie zu Abenteuern führte, so wenig dachten Kaiser Wilhelm I. und Bismarck daran, nach den beispiellosen Erfolgen zweier großer Kriege zu neuen Taten auszuholen. Wenn ein Volk sich der politischen Selbstbeschränkung rühmen darf, so ist es das deutsche. Wir haben uns unsere Erfolge immer selbst begrenzt und nicht abgewartet, daß uns durch die Erschöpfung unserer nationalen Mittel eine Grenze gesetzt wurde. Unsere Entwicklung entbehrt deshalb der Epochen blendenden plötzlichen Aufstiegs und ist mehr ein langsames unverdrossenes Vorwärtsarbeiten und Fortschreiten gewesen. Die rastlose Art anderer Völker, aus den erreichten Erfolgen den Ansporn zu neuen größeren Wagnissen zu schöpfen, fehlt dem Deutschen fast gänzlich. Unsere politische Art ist nicht die des wagehalsig spekulierenden Kaufmannes, sondern mehr die des bedächtigen Bauern, der nach sorgsamer Aussaat geduldig die Ernte erwartet.
Nach dem deutsch-französischen Kriege war die Welt voll Furcht vor neuen kriegerischen Unternehmungen Deutschlands. Kein irgendmöglicher Eroberungsplan, der uns damals nicht angedichtet wurde. Seitdem sind mehr als vier Jahrzehnte vergangen. Wir sind an Volkskraft und materiellen Gütern reicher, unsere Armee ist stärker und stärker geworden. Die deutsche Flotte entstand und entwickelte sich. Die Zahl der großen Kriege, die seit 1870 ausgefochten wurden, war eher größer denn geringer als früher in dem gleichen Zeitraum. Deutschland hat die Teilnahme an keinem gesucht und allen Versuchen, in kriegerische Verwicklungen hineingezogen zu werden, kühl widerstanden.
Ohne Ruhmredigkeit noch Übertreibung kann gesagt werden, daß noch nie in der Geschichte eine Waffenmacht von so überlegener Stärke wie die deutsche in gleichem Maße der Erhaltung und Sicherung des Friedens gedient hat. Mit unserer über jeden Zweifel erhabenen Friedensliebe ist diese Tatsache nicht erklärt. Friedliebend ist der Deutsche stets gewesen und hat doch wieder und wieder zum Schwerte greifen müssen, weil er sich gegen fremden Angriff zur Wehr setzen mußte. Tatsächlich ist der Friede in erster Linie erhalten geblieben, nicht weil ein deutscher Angriff auf andere Nationen unterblieb, sondern weil andere Nationen die deutsche Abwehr des etwaigen eigenen Angriffs fürchteten. Die Stärke unserer Rüstung hat sich als ein Schutz des Friedens erwiesen, wie ihn die letzten bewegten Jahrhunderte nicht gekannt haben. Ein weltgeschichtliches Urteil liegt in dieser Tatsache.
Die Ergänzung unserer Wehrmacht durch die Flotte bedeutet bei richtig geleiteter deutscher auswärtiger Politik eine vermehrte und verstärkte Friedensgarantie. Wie die Armee die mutwillige Störung der kontinental-politischen Wege Deutschlands verhindert, so die Flotte die Störung unserer weltpolitischen Entwicklung. Solange wir die Flotte nicht hatten, waren unsere gewaltig anwachsenden weltwirtschaftlichen Interessen, die zugleich unveräußerliche nationalwirtschaftliche Interessen sind, die freie Angriffsfläche, die das Deutsche Reich seinen Widersachern bot. Als wir diese Blöße deckten, den Angriff auf das Reich auch zur See zu einem Wagnis für jeden Gegner machten, schützten wir nicht nur den eigenen, sondern mit ihm den europäischen Frieden. Um die Gewinnung von Schutzmitteln, nicht von Angriffsmitteln war es uns zu tun. Wir sind, nachdem wir in die Reihe der Seemächte eingetreten sind, auf den zuvor beschrittenen Bahnen ruhig weiter gegangen. Die neue Ära uferloser deutscher Weltpolitik, die im Auslande vielfach prophezeit wurde, ist ausgeblieben. Wohl aber haben wir jetzt die Möglichkeit, unsere Interessen wirksam wahrzunehmen, Übergriffen entgegenzutreten und überall, vornehmlich in Kleinasien und Afrika unsere Stellung zu behaupten und auszubauen.
Das Netz unserer internationalen Beziehungen mußte sich in dem Maße ausdehnen, in dem wir in unsere weltpolitischen Aufgaben hineinwuchsen. Fern gelegene überseeische Reiche, die uns in der Zeit reiner Kontinentalpolitik wenig zu kümmern brauchten, wurden von größerer und größerer Bedeutung für uns. Die Pflege guter, wenn möglich freundschaftlicher Beziehungen zu ihnen wurde eine bedeutsame Pflicht unserer auswärtigen Politik. In erster Linie handelte es sich hierbei um die beiden neuen Großmächte des Westens und des Ostens, um die Vereinigten Staaten von Nordamerika und um Japan. Hier wie dort galt es, gewisse zeitweilige Trübungen zu überwinden, ehe an die Anbahnung freundschaftlicher Beziehungen gedacht werden konnte.
Deutschland und die Vereinigten Staaten.
Während des spanisch-amerikanischen Krieges waren in einem Teil der deutschen öffentlichen Meinung starke Sympathien für Spanien hervorgetreten, die in Nordamerika nicht angenehm empfunden wurden. Auch hatte die Art und Weise, in der ein Teil der englischen und amerikanischen Presse Zwischenfälle ausgebeutet hatte, die sich vor Manila zwischen unserem Geschwader und der amerikanischen Flotte abgespielt hatten, die deutsch-amerikanischen Beziehungen getrübt. Ihren Höhepunkt erreichte diese Verstimmung im Februar 1899, so daß es angezeigt erschien, der Anbahnung günstigerer Beziehungen zwischen den beiden bluts- und stammverwandten Völkern mit Nachdruck das Wort zu reden. Was ich in dieser Richtung im Reichstag damals ausführte, hat sich seitdem als wahr erwiesen: „Vom Standpunkte einer verständigen Politik ist gar kein Grund vorhanden, warum nicht Deutschland und Amerika in den besten Beziehungen zueinander stehen sollten. Ich sehe keinen Punkt, wo sich die deutschen und amerikanischen Interessen feindlich begegneten, und auch in der Zukunft sehe ich keinen Punkt, wo die Linien ihrer Entwicklung sich feindlich zu durchkreuzen brauchten. Wir können es ruhig aussprechen, in keinem anderen Lande hat Amerika während des letzten Jahrhunderts besseres Verständnis und gerechtere Anerkennung gefunden als in Deutschland.“ Dieses Verständnis und diese Anerkennung brachte mehr als irgendein anderer Kaiser Wilhelm II. Amerika entgegen. Die Anbahnung eines guten und sicheren Verhältnisses zu den Vereinigten Staaten ist ihm in erster Linie zu danken. Er gewann die Amerikaner allmählich durch eine ebenso konsequente wie verständnisvolle freundliche Behandlung. Mit dem Präsidenten Roosevelt verbanden ihn persönliche gute Beziehungen. Die Entsendung des Prinzen Heinrich nach Amerika hatte den vollen erhofften Erfolg. Sie trug wesentlich dazu bei, beide Völker daran zu erinnern, wie viele gemeinsame Interessen sie verbinden und wie wenig wirkliche Gegensätze sie trennen. Ein glücklicher Gedanke unseres Kaisers war es auch, durch den Austausch namhafter Universitätslehrer deutscher und amerikanischer Hochschulen den geistigen Konnex der beiden germanischen Völker noch fester und inniger zu gestalten. Deutsches Geistesleben, deutsche Dichtkunst, Philosophie und Wissenschaft haben vielleicht nirgends in der Welt so aufrichtige Bewunderung gefunden wie in den Vereinigten Staaten. Andererseits sind die Wunder amerikanischer Technik wohl in keinem anderen Lande so eifrig studiert und so freudig anerkannt worden wie in Deutschland. Dieser intime Austausch geistiger, wissenschaftlicher Errungenschaften gewann durch die Einrichtung der Austauschprofessoren seinen äußeren Ausdruck. Die intimer werdenden Beziehungen zwischen den Völkern und Staatsoberhäuptern förderten auch unsere politischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Wir haben uns nicht nur über Samoa mit den Amerikanern freundschaftlich auseinandergesetzt, Amerika ist uns auch während der kritischen Periode, die unsere Politik am Anfang des neuen Jahrhunderts zu durchlaufen hatte, nie störend in den Weg getreten. Es gibt außer Österreich wohl kaum ein Reich, wo so natürliche Voraussetzungen für fortdauernde freundschaftliche Beziehungen mit uns bestehen als Nordamerika. In den Vereinigten Staaten leben etwa 12 Millionen Deutsche. In ihnen ist seit der Gründung des „deutsch-amerikanischen Nationalbundes“ im Jahre 1901 das Bestreben im Wachsen, bei voller Treue gegen ihr neues Vaterland doch die Verbindung mit der alten deutschen Heimat festzuhalten und zu beleben. Solange die Politik hüben und drüben von ruhigen Händen geleitet wird, übertriebene Freundschaftsbeteuerungen ebenso vermieden werden wie nervöse Stimmungen gegenüber den gelegentlichen Reibungen, die auf wirtschaftlichem Gebiet sich immer einmal einstellen können, brauchen wir für unsere Beziehungen zu den Vereinigten Staaten nichts zu besorgen. Achtung vor dem anderen auf der Grundlage und in den Grenzen der Selbstachtung wird auch der Freundschaft zwischen uns und den Vereinigten Staaten am zuträglichsten sein.
Deutschland und Japan.
Ähnlich wie unsere Beziehungen zu Amerika hatte auch unser Verhältnis zu Japan gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Periode der Verstimmung zu durchlaufen. Bis zum Beginn der neunziger Jahre hatten wir den Japanern als Vorbild gedient und als Freund gegolten. Unsere militärischen Einrichtungen, unsere kriegerische Vergangenheit fanden in dem ostasiatischen Kriegervolk glühende Bewunderer, und nach der Besiegung Chinas nannten sich die Japaner gern und mit Stolz die Preußen des Ostens. Unsere Beziehungen zu Japan bekamen einen starken Stoß, als wir 1895 mit Frankreich und Rußland das siegreiche Japan nötigten, seine Forderungen gegenüber dem besiegten China zurückzuschrauben. Als wir damals Japan in den Arm fielen, verloren wir viele seit Jahrzehnten dort aufgespeicherte Sympathien, ohne dafür bei Frankreich und Rußland sonderlichen Dank zu ernten. Ein vom Deutschen Kaiser um diese Zeit entworfenes Bild, das nur idealen Friedensbestrebungen dienen sollte, war von unseren Gegnern und Konkurrenten mit Eifer und Erfolg dazu benutzt worden, uns in Japan Abbruch zu tun. Durch jahrelange Sorgfalt gelang es allmählich, in Japan wieder einer besseren Stimmung gegen Deutschland Raum zu schaffen. Wir haben kein Interesse daran, das hervorragend tüchtige und tapfere Volk zum Gegner zu haben. Natürlich sind wir ebensowenig dazu da, den Japanern die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Es wäre nicht nur für Japan, sondern auch für England eine erhebliche Entlastung gewesen, wenn wir uns um ihrer ostasiatischen Interessen willen gegen Rußland hätten vorschieben lassen. Uns selbst wäre damit schlecht gedient worden. So wenig glücklich der Gedanke war, für die schönen Augen Frankreichs und Rußlands Japan zu verstimmen und uns zu entfremden, so wenig konnte uns daran liegen, uns wegen der ostasiatischen Interessen anderer Mächte mit Rußland zu entzweien. Gegen Ende der 80er Jahre sagte mir Fürst Bismarck einmal mit Bezug auf Rußland und Asien: „In dem russischen Faß gärt und rumort es ja ganz bedenklich, das könnte einmal zu einer Explosion führen. Am besten für den Weltfrieden wäre es wohl, wenn die Explosion nicht in Europa, sondern in Asien erfolgte. Wir müssen uns dann nur nicht gerade vor das Spundloch stellen, damit der Zapfen nicht uns in den Bauch fährt.“ Hätten wir uns vor dem russisch-japanischen Kriege gegen Rußland vorschieben lassen, so wären wir bei der Explosion vor das Spundloch zu stehen gekommen. Ich habe den Fürsten Bismarck auch gelegentlich sagen hören: „Wenn Ihnen Herr N. etwas vorschlägt, das für ihn nützlich, für Sie aber schädlich ist, so ist das nicht dumm von N. Es ist aber dumm von Ihnen, wenn Sie darauf eingehen.“
Kontinental- und Weltpolitik.
Wenn Deutschland nach der Erreichung des großen Zieles seiner europäischen Politik mit den vermehrten und ständig sich vermehrenden Kräften in die weitere Welt hineinlangen kann, so ist damit nicht gesagt, daß nun die ganze Summe unserer nationalen Kraft für Unternehmungen außerhalb des europäischen Festlandes frei geworden ist. Der Übergang zur Weltpolitik bedeutet uns die Eröffnung neuer politischer Wege, die Erschließung neuer nationaler Aufgaben, aber kein Verlassen aller alten Wege, keinen grundstürzenden Wechsel unserer Aufgaben. Die neue Weltpolitik ist eine Erweiterung, nicht eine Verlegung unseres politischen Betätigungsfeldes.
Wir dürfen nie vergessen, daß die Konsolidierung unserer europäischen Großmachtstellung es uns ermöglicht hat, die nationale Wirtschaft zur Weltwirtschaft, die kontinentale Politik zur Weltpolitik zu weiten. Die deutsche Weltpolitik ist auf die Erfolge unserer europäischen Politik gegründet. In dem Augenblick, in dem das feste Fundament der europäischen Machtstellung Deutschlands ins Wanken geriete, wäre auch der weltpolitische Aufbau nicht mehr haltbar. Es ist der Fall denkbar, daß ein weltpolitischer Mißerfolg unsere Stellung in Europa unberührt ließe, es ist aber der Fall undenkbar, daß eine empfindliche Einbuße an Macht und Geltung in Europa nicht eine entsprechende Erschütterung unserer weltpolitischen Stellung zur Folge hätte. Nur auf der Basis europäischer Politik können wir Weltpolitik treiben. Die Erhaltung unserer starken Position auf dem Festlande ist heute noch wie in der bismarckischen Zeit Anfang und Ende unserer nationalen Politik. Sind wir auch weltpolitisch unseren nationalen Bedürfnissen folgend über Bismarck hinausgegangen, so werden wir doch stets die Grundsätze seiner europäischen Politik als den festen Boden unter unseren Füßen behaupten müssen. Die neue Zeit muß mit ihren Wurzeln in den Überlieferungen der alten ruhen. Die Garantie für eine gesunde Entwicklung liegt auch hier in einem verständigen Ausgleich zwischen Altem und Neuem, zwischen Erhaltung und Fortschritt. Der Verzicht auf Weltpolitik wäre gleichbedeutend gewesen mit einem langsamen sicheren Verkümmern unserer nationalen Lebenskräfte. Eine Politik weltpolitischer Abenteuer ohne Rücksicht auf unsere alten europäischen Interessen würde vielleicht zunächst reizvoll und imponierend wirken, bald aber zu einer Krisis, wenn nicht zur Katastrophe in unserer Entwicklung führen. Die gesunden politischen Erfolge werden nicht viel anders wie die kaufmännischen gewonnen: in ruhiger Fahrt zwischen der Skylla ängstlicher Vorsicht und der Charybdis wagehalsigen Spekulierens. Ich bin seit dem Tage, wo ich die Geschäfte des Auswärtigen Amts übernahm, fest davon überzeugt gewesen, daß es zu einem Zusammenstoß zwischen Deutschland und England, der für beide Länder, für Europa und für die Menschheit ein großes Unglück wäre, nicht kommen werde, wenn wir 1. uns eine Flotte bauten, die anzugreifen für jeden Gegner mit einem übermäßigen Risiko verbunden wäre, 2. darüber hinaus uns auf kein ziel- und maßloses Bauen und Rüsten einließen, auf kein Überheizen unseres Marinekessels, 3. keiner Macht erlaubten, unserem Ansehen und unserer Würde zu nahe zu treten, 4. aber auch nichts zwischen uns und England setzten, was nicht wieder gutzumachen gewesen wäre. Darum habe ich ungehörige und unser nationales Empfinden verletzende Angriffe immer zurückgewiesen, von welcher Seite sie auch kommen mochten, aber jeder Versuchung zu einer Einmischung in den Burenkrieg widerstanden, denn eine solche würde dem englischen Selbstgefühl eine Wunde geschlagen haben, die sich nicht wieder geschlossen hätte. 5. Wenn wir ruhige Nerven und kaltes Blut behielten, England weder brüskierten noch ihm nachliefen.
„Die Basis einer gesunden und vernünftigen Weltpolitik ist eine kräftige nationale Heimatpolitik.“ Das sagte ich im Dezember 1901, als der Abgeordnete Eugen Richter einen Gegensatz hatte konstruieren wollen zwischen der Politik, die dem neuen Zolltarif zugrunde lag, die den Schutz der heimischen Arbeit, insbesondere der landwirtschaftlichen, bezweckte, und der neuen Weltpolitik, die den Interessen des Handels folgte. Der scheinbare Gegensatz war tatsächlich ein Ausgleich, denn die deutsche Weltwirtschaft war hervorgegangen aus einem zu höchster Blüte entwickelten nationalen Wirtschaftsleben. Die Verbindung zwischen Politik und Volkswirtschaft ist in unserer modernen Zeit eine innigere als in der Vergangenheit. Die modernen Staaten reagieren mit ihrer inneren wie mit ihrer auswärtigen Politik unmittelbar auf die Schwankungen und Veränderungen des hochentwickelten wirtschaftlichen Lebens, und jedes bedeutsame wirtschaftliche Interesse drängt alsbald in irgendeiner Weise zum politischen Ausdruck. Der Welthandel mit allen Lebensinteressen, die von ihm abhängen, hat unsere Weltpolitik notwendig gemacht. Das heimische Wirtschaftsleben fordert eine entsprechende Heimatpolitik. Hinüber und herüber muß ein Ausgleich gesucht und gefunden werden.
Sieben Jahre nach den Zolltarifverhandlungen kam der damals wirtschaftspolitisch umstrittene Ausgleich zwischen deutscher Welt- und Heimatspolitik in der großen Politik zur Geltung bei Gelegenheit der bosnischen Krise im Jahre 1908. Dies Ereignis ist vielleicht besser als jede akademische Erörterung geeignet, das rechte wirkliche Verhältnis zwischen unserer überseeischen und unserer europäischen Politik klarzulegen. Die deutsche Politik bis zur Aufrollung der bosnischen Frage war vorwiegend beherrscht von den Rücksichten auf unsere Weltpolitik. Nicht als ob Deutschland seine auswärtigen Beziehungen nach seinen überseeischen Interessen orientiert hätte, aber weil das Mißfallen Englands an der Entfaltung des deutschen Überseehandels und insbesondere an der Erstarkung der deutschen Seemacht auf die Gruppierung der Mächte und ihre Stellung zum Deutschen Reich einwirkte. Die öffentliche Meinung des sonst so besonnenen und unerschrockenen englischen Volkes überließ sich zeitweise einer gänzlich unbegründeten, ja sinnlosen und deshalb fast panikartigen Besorgnis vor einer deutschen Landung in England. Von einem nicht kleinen Teil der weitverzweigten und mächtigen englischen Presse wurde diese Besorgnis systematisch genährt.
Die englische Einkreisungspolitik.
In der englischen Politik machte sich seit dem Anfang des neuen Jahrhunderts der Einfluß König Eduards VII. geltend, eines Monarchen von ungewöhnlicher Menschenkenntnis und Kunst der Menschenbehandlung, von reicher und vielseitiger Erfahrung. Die englische Politik richtete sich nicht so sehr direkt gegen die deutschen Interessen als daß sie versuchte, durch eine Verschiebung der europäischen Machtverhältnisse Deutschland allmählich mattzusetzen. Sie suchte durch eine Reihe von Ententen, denen zuliebe vielfach nicht unwichtige britische Interessen geopfert wurden, die anderen Staaten Europas an sich zu ziehen und so Deutschland zu isolieren. Es war die Ära der sogenannten englischen Einkreisungspolitik. Mit Spanien war ein Mittelmeervertrag geschlossen worden. Frankreich kam dem Widersacher des Deutschen Reichs selbstverständlich entgegen, und der britisch-französische Vertrag über Ägypten und Marokko im Jahre 1904 ließ die Erinnerung an Faschoda völlig in den Hintergrund treten. Rußland hatte sich unter der Nachwirkung der schweren Niederlagen, die es im Krieg mit Japan zu Lande und zu Wasser erlitten hatte, und schwerer innerer Unruhen zu einer Abmachung mit England über die Interessensphären in Asien entschlossen und damit England genähert. Italien wurde mit Eifer umworben. Ähnliche Bemühungen gegenüber Österreich-Ungarn scheiterten gelegentlich der Monarchenzusammenkunft in Ischl an der unerschütterlichen Bündnistreue des greisen Kaisers Franz Joseph. In Algesiras hatten wir einen schwierigen Stand, obwohl Deutschlands Politik das eigene nationale Interesse als Glied der allgemeinen internationalen Interessen gegen die von England gestützten französischen Ansprüche vertrat. Die Einkreisungspolitik schien damals in der Konstellation der Mächte äußerlich standzuhalten, wiewohl durch das Zustandekommen der Konferenz überhaupt und ihre wichtigsten Beschlüsse die Absichten der deutschen Politik mit Bezug auf Marokko im wesentlichen erreicht worden waren. Es war nun die Frage, wie das Ententensystem auf dem Gebiete der eigentlichen europäischen Politik bestehen würde.
Die bosnische Krise.





























