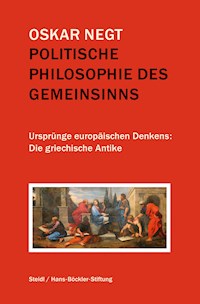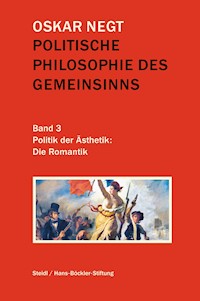
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl GmbH & Co. OHG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Oskar Negt hatte unter dem Titel »Philosophie und Gesellschaft« im Wintersemester 1974/75 an der Universität Hannover einen großen Vorlesungszyklus begonnen. Er wollte darin eine neue Interpretation des Marxismus als epochaler Theorie in praktischer Absicht entwickeln. Ausgangspunkt dieses Unternehmens war die Auseinandersetzung mit seinen philosophischen Quellen: eine Vorlesung zu Kant bildete den Anfang, worauf eine weitere zur dialektischen Philosophie Hegels folgte. Am Ende beschlichen Negt jedoch Zweifel am eigenen Vorhaben und gaben Ausschlag dafür, die Pläne zu verändern. Ins Zentrum rückte Negt nun anstelle von Kant, Hegel, Marx und Freud die verschiedenen deutschen Ver- arbeitungsformen der französischen Revolution, in der Philosophie wie in der Literatur. Zwei Autoren standen dabei für ihn, neben allgemeinen Reflexionen zu Politik und Ästhetik, im Mittelpunkt des Interesses – Novalis und E. T. A. Hoffmann. Sie brachten die Unterseite der menschlichen Existenz ins Bewusstsein: Gebrochenheit, Zweifel und Sinnfragen, die auch als eine Verarbeitung politischer Verhältnisse verstanden werden können. Vielleicht ging es Negt auch um eine Politisierung der Romantik, in jedem Fall aber um eine politische Neubewertung der Epoche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 955
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
OSKAR NEGT
POLITISCHE PHILOSOPHIE DES GEMEINSINNS
Band 3 Politik der Ästhetik: Die Romantik
Herausgegeben von der Hans-Böckler-Stiftung Steidl
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorbemerkung
Editorische Notiz
»Literatursoziologie I« Wintersemester 1976/77
Ankündigung der Vorlesung »Literatursoziologie I« Wintersemester 1976/77
25. Juni 1976
Literatur und Erkenntnis
Vorlesung vom 21. Oktober 1976
Die politische Substanz großer Literatur – Grundkategorien der Interpretation
Vorlesung vom 22. Oktober 1976
Der Begriff der Geschichte
Vorlesung vom 28. Oktober 1976
Subjektive und objektive Phantasie – Revolution und Zeitbewusstsein
Vorlesung vom 29. Oktober 1976
Das Problem der Masse
Vorlesung vom 4. November 1976
Massen in der Oktoberrevolution – Majakowski
Vorlesung vom 5. November 1976
Majakowski – Charakter der Oktoberrevolution
Vorlesung vom 12. November 1976
Dichter und Gesellschaft – Biermann
Vorlesung vom 18. November 1976
Subjekt-Objekt-Konstitution in ihrer politischen Dimension
Vorlesung vom 29. November 1976
Veränderung der Naturwahrnehmung Ursprüngliche Akkumulation – B. Traven
Vorlesung vom 2. Dezember 1976
Subjektkonstitution Ursprünglche Akkumulation – B. Traven
Vorlesung vom 3. Dezember 1976
Romantik
Vorlesung vom 9. Dezember 1976
Novalis Biographie
Vorlesung vom 10. Dezember 1976
Novalis Biographie, »Ofterdingen«
Vorlesung vom 16. Dezember 1976
Natur, Poesie, Sinne
Vorlesung vom 17. Dezember 1976
Die Sinne – Orpheusmythos
Vorlesung vom 6. Januar 1977
Interpretation des ›Bergmann-Kapitels‹ im »Ofterdingen«
Vorlesung vom 7. Januar 1977
Kontexte des »Ofterdingen«
Vorlesung vom 13. Januar 1977
Symbolik und Neuplatonismus bei Novalis – E.T.A. Hoffmann
Vorlesung vom 14. Januar 1977
Erzählstruktur des »Ofterdingen« – Naturphilosophie
Vorlesung vom 20. Januar 1977
Roman, Märchen und Erzählung im romantischen Kunstwerk
Vorlesung vom 21. Januar 1977
Das Klima der Romantik I: Annäherungen an eine Gesamtinterpretation
Vorlesung vom 27. Januar 1977
Das Klima der Romantik II: die Suche nach der deutschen Identität
Vorlesung vom 28. Januar 1977
Grunderfahrungen der Romantik: Tod, Identität, Widerspruch und Versöhnung
Vorlesung vom 3. Februar 1977
Das Verhältnis von Besonderem und Allgemeinem am Problem des Todes
Vorlesung vom 4. Februar 1977
Subjekt der Romantik – Gegenwart und Romantik
Vorlesung vom 10. Februar 1977
Realität und Realismus bei E.T.A. Hoffmann – Kater Murr
Vorlesung vom 21. April 1977
Bedeutung des Alltags – Wahnsinn und Gesellschaft
Vorlesung vom 22. April 1977
Wahnsinn bei Platon und Hegel
Vorlesung vom 5. Mai 1977
Wahnsinn bei Hegel – Einsiedler Serapion und Rat Krespel
Vorlesung vom 6. Mai 1977
Verlebendigung der Sachen – die Automate
Vorlesung vom 20. Mai 1977
Ich und Nicht-Ich – Automaten und Verdinglichung
Vorlesung vom 26. Mai 1977
Ich-Spaltung und bürgerliche Gesellschaft – Sandmann
Vorlesung vom 27. Mai 1977
Freuds ›Sandmann‹
Vorlesung vom 9. Juni 1977
Biographie – Kreisleriana
Vorlesung vom 10. Juni 1977
Biographisches – Meister Floh
Vorlesung vom 16. Juni 1977
Meister Floh – Verfolgungsklima
Vorlesung vom 23. Juni 1977
Nachwort
Anmerkungen
Vorbemerkung
Aus der Rückschau betrachtet, mit einer Distanz von 45 Jahren, stelle ich heute fest, dass dem Experiment der Vorlesungen zur Romantik, die als Literatursoziologie angekündigt waren, eine Intention zugrunde lag, die ich wohl an keiner Stelle explizit begründet habe. Womöglich war sie mir auch nicht völlig bewusst, stellte vielleicht eine Art heimlichen Leitfaden oder »Lehrplan« dar, der mir selbst erst retrospektiv klar vor Augen tritt.
Kurz gesagt: Ich hatte und habe die Idee, dass die Romantik als eine Form der Aufklärung begriffen werden kann. Diesen Grundgedanken habe ich an Produkten der Literatur nachvollziehbar machen wollen. Das mag wenig plausibel erscheinen, insbesondere weil die deutsche Romantik als Inbegriff des Rückzugs in die Innerlichkeit angesehen wurde; die blaue Blume, Symbol für individuell erlebte und erlittene Sehnsucht des vereinzelten Menschen, steht geradezu im Gegensatz zu den Heroen der Revolution, denen die Erstürmung der Bastille durch eine Massenbewegung gelingt. Die Französische Revolution hat in Deutschland keine Entsprechung durch gesellschaftsgestaltende, sozialrevolutionäre Bewegungen erfahren. Es ist ein Defizit entstanden, das sich gesellschaftlich als eine biedermeierliche Behäbigkeit und Entpolitisierung darstellt.
In den ersten dieser Vorlesungen beschäftige ich mich mit »un-romantischen« Themen, mit den Romanen von Traven etwa und der Lyrik von Majakowski. In dieser Literatur ist das Thema Revolution unmittelbar, hier findet sich ein Niederschlag revolutionärer Energie, diese Texte sind eine Antwort auf reale revolutionäre Prozesse. Was aber geschieht, wenn eine Gesellschaft keine revolutionäre Umwälzung erlebt hat? Hier öffnet sich die Tür zur Literatur der Romantik. Romantik ist kein Fluchtverhalten, kein bloßer Rückzug von der Realität; vielmehr zieht sie das Subjekt in seinen vielfältigen Erscheinungsformen in den Prozess der Aufklärung hinein.
Ein Element der Aufklärung ist die Romantik insofern, als sie die Gebrochenheit des Subjekts zum Ausdruck bringt und diese Gebrochenheit nicht allein als Seelenzustand und somit in den Bereich der Psychologie gehörend verweist, sondern zahllose Bezüge zur historisch-spezifischen gesellschaftlichen Wirklichkeit herstellt und die Art und Weise beleuchtet, wie sie im Subjekt – das hier als das Pendant zum revolutionären Heroen verstanden werden kann – Gestalt annimmt. Wenn ein junger Mann sich in E.T.A. Hoffmanns Erzählung vom Sandmann in eine Puppe verliebt, die der echten Frau nachgeformt wurde, so wird damit der gesellschaftliche Fortschritt – Erfindung der Apparate – ebenso exploriert wie das menschliche Liebes- und Bindungsbedürfnis.
Somit wird deutlicher, dass ich mit dieser Perspektive die Romantik als eine Ergänzung, sogar Vervollständigung der Aufklärung begreife, indem sie die subjektive Dimension bis in ihre extremen Ausschläge einbezieht. Diese Dimension ist in der vernunftbetonten Aufklärung nicht zum Ausdruck gelangt. Vernunft ist der Maßstab der Aufklärung und Mündigkeit, die zu rationalem Handeln geeignet ist, ihr Ziel. Im Gegensatz dazu bringt der »romantische Modus« die Unterseite der menschlichen Existenz ins manifeste Bewusstsein: Gebrochenheit, Zweifel und Sinnfragen, die aber nicht als Eskapismus allein zu verstehen sind, sondern auch als eine Verarbeitung politischer Verhältnisse im besonderen ästhetischen und literarischen Modus. Vielleicht ist es mir auch um eine Politisierung der Romantik gegangen, in jedem Fall um eine politische Neubewertung.
Oskar Negt, im Dezember 2021
Editorische Notiz
Was für Oskar Negts Vorlesungen im Allgemeinen gilt, gilt für die vorliegende Vorlesung im Besonderen: Sie tragen nicht bereits vor- und ausformulierte Skripte vor, sondern entwickeln öffentlich Gedanken.* Dies muss in diesem Falle besonders betont werden, weil dieser Sachverhalt nicht nur die Art und Weise von Negts Vorlesungstätigkeit betrifft, sondern auch dessen Wiedergabe in Buchform. Was nicht reproduziert werden konnte, waren die vielen Diskussionen mit den Studierenden und die kollektiven Interpretationsversuche des zugrunde liegenden literarischen Materials. Diesbezüglich beanspruchte Negt, wie er den Zuhörenden vorab gesteht, keine ihn ausweisende Expertise. Entsprechend offen wurden bisweilen in den Vorlesungen die literarischen Texte diskutiert. Dies gilt insbesondere für Negts Interpretation von Novalis und E.T.A. Hoffmann, deren Texte er auch ausführlicher direkt zitiert, als dies sonst in seinen Vorlesungen geschieht, die weitgehend frei gehalten wurden. Das hier vorliegende Buch war darum bemüht, gleichermaßen den offenen Charakter der geistigen Suchbewegung von Negt zu erhalten, wie auch den roten Faden, der sich durch alle Vorlesungssitzungen und Diskussionen zieht, herauszuarbeiten und für die Leserschaft nachvollziehbar zu machen.
Hendrik Wallat
* Vgl. ausführlicher zum Charakter von Negts Vorlesungen Wallat, Hendrik: Nachwort. In: Negt, Oskar: Politische Philosophie des Gemeinsinns. Band 1. Ursprünge des europäischen Denkens: Die griechische Antike, Göttingen 2018, S. 289–306, bes. S. 289–294.
»Literatursoziologie I« Wintersemester 1976/77
Ankündigung der Vorlesung »Literatursoziologie I« Wintersemester 1976/77
25. Juni 1976
Ich möchte den großen Vorlesungszyklus in der alten Form nicht fortführen, jedenfalls nicht gleich im nächsten Semester.1 Es ist ja auch wirklich ein Problem, diese alten Theorien als ganze Komplexe zu vermitteln. Vielleicht haben sich die Aneignungs- und Bildungsbedürfnisse tatsächlich verändert; streckenweise habe ich mich in meiner Vorlesung bei der systematischen Aufarbeitung dieser Hegel’schen Sachen selbst gelangweilt. Es war ja nun Hegel, der dargestellt werden sollte, man kann nicht sagen, dass es sich um veraltete Sachen handelt, aber die Zugangsweise müsste eine andere sein. Ich glaube nicht mehr, dass man wie vor zwanzig Jahren über mehrere Semester die Logik machen kann. Sicher, einige Kollegen machen das, vielleicht auch mit großem Erfolg, aber mir fehlen dazu die Ausdauer und die Kraft. Ich will es einmal anders versuchen, ich springe aus dem Zusammenhang heraus. An irgendeinem Punkt werde ich die Hegel’sche Problematik wiederaufnehmen, aber zunächst möchte ich im Wintersemester etwas behandeln, das mich gegenwärtig interessiert. Es spielt immer eine Rolle, ob man sich für die Sachen selbst interessiert oder sie nur anderen mitteilen will.
Was mich interessiert, gehört genau in den geschichtlichen Zusammenhang Hegels, nämlich in den Komplex der deutschen Frage: Was bedeutet es, dass sich in Deutschland so etwas wie eine Innendimension ausbildet, die in gewisser Weise das Universum in sich hineinzieht und reproduziert? Und zwar nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Literatur; mit Sicherheit gilt es auch für die Politik. Dafür gibt es in der Geschichte nur wenige Beispiele. Natürlich die Zeit des Perikles, in der auf der Grundlage der attischen Tragödie eine Form der Verarbeitung verschiedener gesellschaftlicher Produktionsweisen entsteht, die wahrscheinlich in Widerspruch geraten sind. Aber diese Umsetzung in eine Innendimension kann man nicht zutreffend analysieren, wenn man die Realitätsteile aus diesen Produktionen herausnimmt und sie etwa auf die Klassen bezieht, wie Lukács das in einer an sich sehr gelungenen Weise mit dem jungen Hegel gemacht hat.2 Er diskutiert Hegel auf dem Hintergrund bestimmter Traditionen des Standes der Warenproduktion, was also in die Hegel’sche Philosophie eindringt und was er hinterher wieder rausholt, indem er sagt, da und da bezieht sich Hegel auf die und die Zustände, die Verfassung von Württemberg etwa, oder darauf, dass die Probleme, die in der Verarbeitung des Christentums entstehen, eigentlich Probleme der Französischen Revolution seien usw. Mein Interesse wäre hingegen, diese Theorien auf einen politischen Konstitutionszusammenhang der deutschen Gesellschaft zu beziehen, also als konstituierte Produkte eines Zusammenhangs, der mit Sicherheit durch ein Element gekennzeichnet ist: durch die Ungleichzeitigkeit der Entwicklungen in Deutschland.
Deutschland ist in dem Sinne das klassische Land der Ungleichzeitigkeit: von Ökonomie und Politik, von Zentralismus und Partikularismus, von Ökonomieentwicklung und kultureller Produktion, von Land und Stadt. Sie kommen eigentlich erst im Faschismus wieder zusammen, erst da wacht das Land wieder auf, während es seit den Bauernkriegen nur ganz partikulare Landrevolten gegeben hat, und eine der Schwierigkeiten von Georg Büchner (1813–1837) ist die Stummheit der Bauern. Der »Hessische Landbote« (1834) ist genial formuliert und geht auf die unmittelbaren Interessen der Bauern ein; diese hören aber nicht zu, sondern bringen die Flugblätter und Schriften zur Polizei. Dies ist nur ein Beispiel für Ungleichzeitigkeit von Stadt- und Landentwicklung, also dass sich, wie Marx sagt, in bestimmten Regionen der Stumpfsinn des Landlebens über Jahrhunderte hält und nirgendwo eine autonome Kraft sichtbar wird.
Das wäre das erste Problem, die Frage der Ungleichzeitigkeit, die anders gestellt ist als in der Form fortgeschrittener Ökonomie versus nachhinkender Überbau. Das Problem ist vielmehr genau, dass es gleichzeitig läuft, dass es nicht in dieser Fortschrittslogik vorangeht, sondern dass sich der Widerspruch bestimmter Produktionsweisen von Erfahrungen in Deutschland akkumuliert – von Produktionsweisen, die sich auf ganz anderen Ebenen übrigens auch in Russland vor der Revolution finden: hochzentralisiertes Proletariat, fortgeschrittene Technologie mit rückständigem Land, mit zaristischer Zentralverwaltung, die aber autonome Regionen kennt, sodass der Mir, die alte Ackerbaugemeinde, nicht zerstört ist. Marx hat in den Briefen an Vera Sassulitsch dargestellt, dass das eine Explosionsform enthält, von der die Russische Revolution überhaupt nicht zu trennen ist.3 Was aber in Russland nicht in gleicher Weise erfolgt, ist die Ausbildung einer durch Rationalitäten gehenden Innendimension. Das ist der entscheidende Punkt.
Ich meine, ein Christentum, wie es Fjodor Dostojewski (1821– 1881) vertreten hat oder auch Leo Tolstoi (1828–1910), ist nicht das Problem. Dazu gehört eine christliche Entwicklung, die durch die Aufklärung hindurchgeht und damit auch die fortgeschrittenste Rationalität mit aufnimmt. Das kennzeichnet ja die große bürgerliche Philosophie, Literatur und auch Musik. Die Entfaltung und Differenzierung des musikalischen Materials auf den höchsten Stand der Produktivkräfte treibt gewissermaßen diese Produktionsform hervor. Und gleichzeitig ist diese Produktionsweise in einem durchkapitalisierten Land nicht nötig. Das heißt, man kann nicht sagen, je fortgeschrittener das Land, desto eher zeigen sich Formen der künstlerischen Produktion, der Dichtung und der Philosophie, die sich eben in diesen Produkten zeigen, wie wir sie vorfinden. Sondern das eigentliche Problem ist, dass diese ganze Produktionsform auch auf dem Boden von Rückständigkeit, und zwar prinzipieller Rückständigkeit, wächst. Das bedeutet, dass es so sein muss, dass Produktionsweisen materieller Art und kultureller Erfahrungen usw. nicht aufgezehrt sein dürfen. Aber sie dürfen nicht ihre alte, bloß traditionalistische Form haben, sondern sie müssen in Frage gestellt sein, problematisiert sein und durch diese Entwicklung auch gebrochen sein, um dann genau in der Verarbeitung dieses Widerspruchs sich artikulieren zu können. Aus bloßer politischer Ohnmacht von Klassen entsteht keine Produktion. Es muss noch erklärt werden, warum eine Akkumulation von Prozessen in Deutschland stattfindet, die eine spezifische Konstellation und einen spezifischen Nährboden haben muss. Es ist ja nicht zufällig, dass ein Kant, Fichte, Schelling und Hegel in einer Linie auftreten, die sich bis Marx fortsetzt. Doch in diesem Zusammenhang ist nicht nur die politische Rückständigkeit relevant, es kommen weitere Momente hinzu.
Ich will diese anderen Momente, die mir wichtig erscheinen, hier kurz einbeziehen. Das zweite Problem ist das mit der Identität, also dass in Deutschland nie eine nationalstaatliche Identität zustande kommt, die auch zu einer kollektiven Identität der Individuen führt. Das Problem der Fremdbeherrschung ist eine wesentliche Energiequelle für die Verletzung des kollektiven Narzissmus, eines Kollektivs, das noch nicht da ist: Es wird noch danach gesucht, was wir eigentlich sind, was die deutsche Nation ausmacht, was die Deutschen ausmacht, die zwar eine Sprache haben, aber keine Identität. Das wäre ein weiterer Punkt, die permanente Suche nach der Identität.
Eine dritte zentrale Kategorie verbindet sich mit dem Begriff der Revolution, mit dem Versuch, Gleichheit herzustellen, den Citoyen herzustellen, weil er durch die Entwicklung auch nahegelegt wird. Die Universalisierung des Warenverkehrs führt dazu, dass auch in Preußen so etwas wie eine Rechtsperson entstehen muss. Aber diese Rechtsperson setzt sich nicht in den Citoyen um, sondern in Preußen kommt dabei eine Kuriosität heraus: der Staatsbürger. Der Staatbürger ist genau die verkrüppelte Form, die das ganze deutsche Problem bezeichnet, dass es keinen Citoyen und Bourgeois gibt, sondern einen Citoyen-Bourgeois. Da ist in einem Wort zusammengezogen, was die geschichtliche Bewegung ausmacht. In Deutschland wird der Citoyen auf die Seite des absolutistischen Rechtsstaates gezogen, während der Citoyen in Frankreich sich gerade gegen den alten Staat befreit und sich als allgemeiner Bürger versteht. Das ist der Komplex der Orientierung an der Französischen Revolution als jener Emanzipationsform, die in Literatur, Dichtung, Philosophie, ja bis in die Musik eindringt, als Emanzipationshoffnung; allerdings auch nicht buchstäblich. Es ist kein Zufall, dass Ludwig van Beethoven (1770–1827) die »Eroica« (1802/03) Napoleon widmet und dann die Widmung zerreißt, als der sich zum Kaiser krönen lässt. Das sind Indizien dafür, ganz abgesehen von der großen Zahl von Jakobinern, die es gegeben hat, wobei man bei Jakobinern vorsichtig sein muss, weil das damals auch ein Schimpfwort gewesen ist. Nicht alle, die als Jakobiner bezeichnet wurden, waren Anhänger von Robespierre (1758–1794), sondern einfach Sympathisanten der Französischen Revolution.
Nicht nur die Orientierung an der Französischen Revolution ist das Problem, sondern auch der Versuch, die Französische Revolution mit der Zwiespältigkeit der eigenen Revolution zu vermitteln. Es ist die Frage, wie Prozesse im eigenen Land verarbeitet werden, die an sich auf etwas Ähnliches hindrängen, aber auf Blockierungen stoßen, zum Beispiel auf die Tatsache, dass bei denjenigen, die die Französische Revolution zunächst feiern, plötzlich die Revolution von oben kommt, also etwas ganz anderes gemacht wird, oder dass die Verbindung von Freiheit und Gleichheit in den sogenannten Befreiungskriegen durch nationale Freiheit und Einheit ersetzt wird und nur noch das Problem der Einheit übrig bleibt, die Freiheit aber abgetragen wird. Dieses Problem erfährt in Deutschland eine Dreispaltung: erstens allgemein die Fremdorientierung an der Französischen Revolution; zweitens die Orientierung an den eigenen Möglichkeiten; drittens eine Abspaltung davon, nämlich die Industrielle Revolution. In Deutschland erfolgt schon sehr früh das, was Engels und später Arnold Toynbee (1852–1883) als Industrielle Revolution begreifen4, die politisch depotenziert ist. Was industrielle Entwicklung bezeichnet, verliert den politischen Charakter und trennt sich davon ab, sodass das, was sich in Deutschland an Bewegungen mit revolutionärem Potenzial tut, nicht zum Tragen kommt. Die Fremdorientierung an der Französischen Revolution löst zudem einen Komplex aus, der meines Erachtens in vielen dieser Analysen als Motivation zur Vereinheitlichung da ist: dass die synthetische Einheit der Apperzeption, wie es Kant sagt, im Grunde die synthetische Einheit völlig verschiedener Wahrnehmungen ist. Das ist ein Problem, das jetzt verarbeitet wird.
Damit, dass es wenigstens zwei oder drei typische Formen der Reaktion auf diesen gesellschaftlichen Konstitutionszusammenhang gibt, möchte ich zu Beginn des Semesters ansetzen. Nehmen wir die Literatur der gebrochenen Revolutionäre. Zu ihnen würde ich zum Beispiel Heinrich von Kleist (1777–1811) und Friedrich Hölderlin (1770–1843) rechnen. Gebrochene Revolutionäre sind sie in der Weise, dass sie mit den Mitteln von Rationalität und Sprache bis zu dem Punkt gehen, wo sie selber zerbrechen, wo diese Mittel nicht mehr ausreichen, die Emanzipation auszudrücken, um die es ihnen geht, wo also die Mittel der sprachlich artikulierten Vernunft bis zu dem Punkt getrieben werden, dass der eine Selbstmord begeht und der andere in die Isolierung von der Gesellschaft getrieben wird. Es ist nicht so wichtig, und auf die Frage will ich mich auch gar nicht einlassen, ob Hölderlin wahnsinnig gewesen ist oder nicht; jedenfalls ist es Wahnsinn im Sinne der totalen Isoliertheit, des Zerbrechens des Zusammenhangs, auf den sich seine Theorie richtet, genauso wie bei Kleist. Es ist gewissermaßen die synthetische Einheit der Apperzeption, die sie herstellen wollen. In der späteren Phase kann man dasselbe oder etwas Ähnliches noch einmal unter anderen Bedingungen an Georg Büchner aufzeigen.
Die zweite Form der Verarbeitung ist die klassizistische Verarbeitung desselben Tatbestandes bei Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) und Friedrich Schiller (1759–1805), die eine Form des harmonisierenden Ausgleichs disparater Wahrnehmungen betreiben; die Elemente bekommen Gleichgewichtigkeit. Es findet zwar eine Identitätsbildung und Synthetisierung statt, aber sie hat einen ganz anderen Charakter als bei Kleist und Hölderlin. Diese Synthetisierung ist nicht darauf gerichtet, die in der Realität nicht zusammenstimmenden Elemente zueinanderzuzwingen. Sondern es ist ein Versuch, das Universum als Disparates im Subjekt zu reproduzieren und in eine Form von Ausgleich und Harmonie zu bringen.
Die dritte Form ist die romantische Form, die sicherlich spezifische Komponenten hat wie die romantische Ironie. Ironie ist ein Element, das auf der einen Seite eines klar bezeichnet: Mit dieser Realität ist auf der Ebene der vorhandenen Mittel nicht fertigzuwerden; deswegen produzieren die Romantiker auch eigene Sprachen und organisieren neue Mittel, mit denen sie umgehen zu können glauben. Gleichzeitig bricht in der Romantik – sehr schematisch gesagt – im Zusammenhang dieser Ironisierung die Beziehung zur Realität. Aber es wird eine Realität rekonstruiert, die sich über diese Realität setzt, die also im Grunde eine eigene Realität ist. Wenn es mit der vorhandenen Realität nicht geht, gibt es nur noch die Möglichkeit, eine eigene zu schaffen. Das ist nicht einfach als Fluchtmechanismus zu verstehen, sondern als die Form synthetischer Leistung von Subjekten, die in der Innendimension ein Stück von Utopie festhalten, gerade indem sie die Realität, wie sie besteht, nicht als gültige annehmen können. Ich werde mich hierbei auf Novalis und E.T.A. Hoffmann beziehen.
Das ist mein Versuch, aus der Armut der philosophischen Reflexion etwas rauszukommen in das Leben von Dichtung und Literatur. Ich bin an sich Laie darin. Ich muss mir die Texte selber aneignen – Goethe und Schiller habe ich durch meine Bildungsgeschichte einigermaßen verfügbar. Ich will versuchen, einen Zugang zu dieser Realität aufzuzeigen, bei der dann am Ende stehen könnte, wie philosophische Reflexion denselben Tatbestand verarbeitet; das ist beispielsweise beim frühen Hegel sichtbarer als beim späten. Dabei wird immer versucht, Literatur und Gesellschaft nicht als ein Ableitungs-, sondern als ein Konstitutionsverhältnis zu begreifen in dem Sinne, dass eine Dialektik abläuft, die mit einem ganz sicher nichts zu tun hat: mit Widerspiegelung, wie sie gemeinhin verstanden wird. Was an Konstruktionsleistungen vom Subjekt ausgeht, kann nach meiner Auffassung nicht mit dem klassischen Widerspruchsbegriff verstanden werden, denn dann ist es keine Widerspiegelung mehr. Für mich ist es wirklich ein Spiegelverhältnis, wenn man von Widerspiegelung redet, es sei denn, man verbindet mit Widerspiegelung, dass alle Ideen in letzter Instanz auch auf Gesellschaft zurückbezogen sind. Darüber besteht natürlich völlige Einigkeit, dass die Ideen nicht allein aus sich selbst produziert werden.5
Ich glaube, einer der Gründe des Scheiterns auch der Lukács’schen Ästhetik besteht darin, dass, wenn man sich auf das Ableitungsverhältnis einlässt, diese Literaturtheorie in die Breite geht; dann muss man wirklich den ganzen Komplexitätsweg, den man in der Interpretation der Literatur gegangen ist, noch einmal theoretisch fassen. Und Lukács’ Literaturtheorie wirkt am Ende positivistisch in dem Sinne, dass sie unabschließbar ist, dass sie kein organisierendes Zentrum mehr hat, im klaren Unterschied zu Adorno, bei dem allerdings die Frage der inneren Konstitution literarisch-philosophischer Produkte nicht auf den Konstitutionsprozess der Gesellschaft als Ganzes bezogen wird, sondern nur auf einzelne Momente, zum Beispiel auf die Warenproduktion. Aber das ist zu wenig für die Konstitution dieser Elemente. Bei Joseph von Eichendorff (1788–1857) zeigt sich sehr deutlich, dass dort verdrängte, von der Warenproduktion aufgezehrte Momente in der Lyrik verlebendigt werden.6 Aber auch das reicht eigentlich nicht aus. Was sich gegenübersteht, wenn sich überhaupt etwas gegenübersteht, ist Literatur und Philosophie als konstituierter, durch synthetische Leistungen bestimmter Zusammenhang gegenüber einer konstituierten gesellschaftlichen Realität, in der eben die Kategorien eine wichtige Rolle spielen, die ich hier aufgezeigt habe.
Literatur und Erkenntnis
Vorlesung vom 21. Oktober 1976
Sehr geehrte Damen und Herren,*
ich habe eine Vorlesung mit dem Thema »Literatursoziologie« angekündigt, und bin Ihnen zu Anfang Rechenschaft darüber schuldig, was ich darunter verstehe. Zunächst befand ich mich in der Verlegenheit, zu diesem globalen Ansatz überhaupt einen treffenden Titel zu finden. Obwohl ich das Thema in den nächsten Stunden präzisieren werde, weiß ich doch zum ersten Mal in meinen Vorlesungen nicht, was dabei herauskommt, ja ich bin mir nicht einmal sicher, ob überhaupt etwas dabei herauskommt. Der Grund liegt darin – und die Erfahrung mit der Hegel-Vorlesung hat mich dahin geführt –, dass ich nicht sicher bin, ob man diese systematische Deduktion von Theorien noch so einfach anbieten kann, ohne eine Problematik zugrunde zu legen, in der man selber steckt. Das heißt, ich betrete mit diesem Thema einen Boden, auf dem ich nicht so arg viel mehr weiß als Sie, und betrachte diese Vorlesung auch als eine Form von Aneignung, die gegenseitig ist, obwohl ich selbstverständlich schon eine Reihe von Ideen dazu habe.
Zunächst: Was ist mein eigenes Interesse an diesem Thema? Ich glaube, dass heute die zentrale Frage jeder Beschäftigung mit Literatur, mit Dichtung, aber auch mit philosophischen Theorien darin besteht – und daran kommt keine dieser Betrachtungen vorbei –, zu klären, wie die Phantasie der Dichter und Denker zur Phantasie der Massen kommt. Ich halte das nicht für ein äußerliches Problem, denn alle große Literatur und Dichtung hat sich bisher in diesem Bezugsrahmen bewegt, nur hat sie es nicht in dieser Weise formuliert, weil sie es nicht musste. Wir dagegen müssen dieses Thema ausdrücklich und präzise formulieren, um in irgendeiner Art und Weise Antworten geben zu können.
Zunächst scheint mir diese abstrakte Frage, so wie ich die Literaturtheorien überschaue, nicht radikal und ehrlich genug gestellt zu sein. Nicht radikal genug in dem Sinne, dass es gar nicht mehr darauf ankommt, weil Dichtung und Literatur letztlich tot seien; das sind sie mit Sicherheit nicht. Diese Feststellung hat es eigentlich immer gegeben. Das ist nicht radikal, sondern das versucht, ein sich stellendes Problem zu schlichten, ohne es klar und ehrlich genug formuliert zu haben. Da spielen akademische Interessen eine Rolle und auch die Interessen derjenigen, die von Literatur leben. Und das ist nicht ehrlich genug, weil natürlich in jeder Gesellschaft, in jeder Kultur immer etwas bleibt, über das man schreiben kann. Das heißt, die Tatsache des Schreibens, des Schriftstellers, des Dichters ist dann ausreichend, zu begründen, warum es auch so sein muss.
Ich will die Frage, wie die Phantasie der Dichter und Denker zu den Massen kommt, einmal an einem Problem diskutieren, wo es noch gar nicht so präzise auftritt, nämlich bei Friedrich Schiller. In einer Besprechung der Gedichte von Gottfried August Bürger stellt sich Schiller die Frage, wie Popularisierung möglich ist. Kann es so etwas wie populäre, für das Volk verständliche Gedichte geben? Ist das vereinbar mit dem Wahrheitsanspruch von Dichtung? Er thematisiert einen Zusammenhang, der, wie ich glaube, heute im Zentrum aller Analysen der Literatur und auch der Produktion von Literatur steht. Ich will einige Sätze vortragen: »Ein Volksdichter in jenem Sinn, wie es Homer seinem Weltalter oder die Troubadours dem ihrigen waren, dürfte in unsern Tagen vergeblich gesucht werden. Unsre Welt ist die homerische nicht mehr, wo alle Glieder der Gesellschaft im Empfinden und Meinen ungefähr dieselbe Stufe einnahmen, sich also leicht in derselben Schilderung erkennen, in denselben Gefühlen begegnen konnten. Jetzt ist zwischen der Auswahl einer Nation« – er meint die Privilegierten, die Elite einer Nation – »und der Masse derselben ein sehr großer Abstand sichtbar, wovon die Ursache zum Teil schon darin liegt, daß Aufklärung der Begriffe und sittliche Veredlung ein zusammenhängendes Ganze ausmachen, mit dessen Bruchstücken nichts gewonnen wird. Außer diesem Kulturunterschied ist es noch die Konvenienz, welche die Glieder der Nation in der Empfindungsart und im Ausdruck der Empfindung einander so äußerst unähnlich macht. Es würde daher umsonst sein, willkürlich in einen Begriff zusammen zu werfen, was längst schon keine Einheit mehr ist. Ein Volksdichter für unsre Zeiten hätte also bloß zwischen dem Allerleichtesten und dem Allerschweresten die Wahl; entweder sich ausschließend der Fassungskraft des großen Haufens zu bequemen und auf den Beifall der gebildeten Klasse Verzicht zu tun, – oder den ungeheuern Abstand, der zwischen beiden sich befindet, durch die Größe seiner Kunst aufzuheben, und beide Zwecke vereinigt zu verfolgen.«1
Hier zeigt sich ein Problem des Widerspruchs zwischen dem, was bei der Produktion in den Dichtern abläuft, und der großen Masse. Schiller löst das Problem, indem er sagt, nur dort, wo eine Mythologie herrscht, die sowohl die Mythologie des Alltags der Massen wie die Mythologie der Dichtung selbst ist, gibt es die gleiche Empfindung und Denkstruktur. Die Identität stellt sich nicht von außen her, sondern große Dichtung, die zugleich Volksdichtung sein könnte und in ihrem Wahrheitsanspruch nach auch sein will, geht von der Identität der Empfindungen im Großen und Ganzen aus. Man sieht, dass dieser von Schiller benannte Widerspruch etwas bezeichnet, was Karl Marx (1818–1883) in den »Grundrissen« ganz ähnlich sagt, wenn er feststellt, dass die griechische Mythologie2, die Volksphantasie die Grundlage der großen Tragödien und Dichtung ist und dass in dem Augenblick, wo diese Mythologie, Volksphantasie als objektive verschwindet, ein spezifisches Problem der Literatur auftritt, nämlich das Problem, wie die Phantasie der Dichter zu den Massen kommt.
Ich glaube, dass dies ein grundsätzliches Problem ist, weil heute wieder die Neigung besteht, sich kurzzuschließen mit dem, was die Massen angeblich denken und fühlen. Es beginnt schon wieder die Zeit, in der die Stunde der wahren Empfindung, des Mutterglücks gefeiert wird oder Dichter meinen, dass sie endlich wieder »Ich« sagen dürfen. Sie fleddern die Innerlichkeit und tun so, als ob es das wäre, was in der Volksphantasie gewissermaßen vorgeprägt ist und was sie als Alternative zu den Trivialformen der Literatur anbieten können. Hier deutet sich eine Begriffslosigkeit in der Literatur selbst an, die wieder die Kompensationsform von Sonntagsreden annimmt. Das ist ganz entsprechend der Phase der Restauration, in der wir uns befinden. Das Subjekt sperrt sich also nicht gegen den objektivistischen Zusammenhang mit dem Anspruch, ihn aufzusprengen, womit eine befreiende, anarchistische Ästhetik betrieben würde, ein Gegenentwurf zum Objektivismus entstünde, in dem Spontaneität von Gefühlen und Gedanken wieder zum Tragen kommt. Sondern es ist eine Katalogisierung und Einordnung von Innerlichkeit in die Lücken der bestehenden Gesellschaft, und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, da werden, wie Kurt Tucholsky (1890–1935) einmal gesagt hat, wieder Aufsätze und Klausuren mit dem Thema »Goethe als solcher« geschrieben werden.3
Bestehende Tendenzen im Literaturbetrieb sind vom Verlust der Erkenntnisdimension in der Literatur und Dichtung gekennzeichet. Was bedeutet Erkenntnisdimension von Literatur? Ich möchte an den ersten Gedanken anknüpfen und wiederum zum Vergleich die Stufen heranziehen, auf denen so etwas wie eine Ghettoisierung von Phantasie und Erkenntnis nicht vorhanden war, und zwar nicht vorhanden sein konnte. Ich begreife Literatur, Dichtung als eine Erkenntnisform, und wo sie das nicht ist, ist sie gar nichts. Ist ein Gedicht schlecht, ist ein Roman schlecht, wird keine Erkenntnisform dargestellt. Literatur kann nie unter dem Niveau der kulturell bedingten objektiven Erkenntnismittel stehen, in keiner Zeit. Und wo es große Literatur gegeben hat, hat sie auch nicht darunter gestanden. Wenn Bertolt Brecht (1898–1956), Walter Benjamin (1892–1940) und andere sagen, wir produzieren unter den Bedingungen eines verwissenschaftlichten Zeitalters, so meinen sie nicht die der Literatur fremden Mittel, die man außerhalb halten könnte. Sie meinen damit vielmehr, dass diese Erkenntnismittel konstitutiver Bestandteil der Literatur und Dichtung selbst werden und ihre Darstellungsformen prägen. Bis ins Innerste hinein wird Literatur durch den objektiven Erkenntnisstand einer Gesellschaft geprägt. Wir werden das an einzelnen Produkten sehen; meine Erläuterungen führen nur hin auf die Analyse von Literatur, von Gedichten und Romanen usw.
Diese Trennung von Literatur und Erkenntnis hat es wenigstens im 19. Jahrhundert überhaupt nicht gegeben, und wir werden sehen, dass eine Deformierung im Gang der Literaturbetrachtung darin besteht, die Fülle der Erkenntnisdimensionen aus der Literatur auszuklammern. Was Literatur und Dichtung der Lebensdeutung an Zusätzlichem zu bieten haben, ist das Problem, nicht, was sie neben anderen Erkenntnismitteln bieten, zeigen und darstellen. Was können sie zusätzlich? Was bieten sie für Orientierungen an Bewusstsein, an Erkenntnis zum bestehenden Erkenntnisstand der Gesellschaft? Das ist das Problem, nicht, was sie neben dem bestehenden Erkenntnisstand bieten können. Diese Trennung von Empfindung und Sinn hat natürlich gesellschaftliche Grundlagen, das ist klar, aber das ist nicht unser Problem. Ich möchte nur zeigen, wie zum Beispiel unter gegenwärtigen Bedingungen nicht nur in der Literatur, sondern auch in Soziologie und Philosophie das Problem der Sinnproduktion als etwas verstanden wird, was getrennt abläuft. Helmut Schelsky (1912–1984) hat ein großes Buch, groß dem Umfang nach, mit dem Titel »Die Arbeit tun die anderen«4 geschrieben. Diese anderen sind die wirklichen Arbeiter, die für die Linken schuften. Deren Aufgabe besteht nur darin, Sinn zu produzieren und Sinn zu vermitteln; Lehrer als Sinnvermittler gehören dazu, aber auch Soziologen – Schelsky ist da nicht pingelig in der Unterscheidung der einzelnen Kategorien. Jedenfalls sind die Sinnproduzenten und Sinnvermittler zu einer einzigen Klasse zusammengeschlossen, bei ihm im Grunde in Erinnerung an die monastische Tradition, das heißt an die Tradition der Klöster, von denen er meint, sie würden der Welt einen Sinn produzieren, was schon damals falsch war. Sie haben allenfalls den Sinn oder den Unsinn der Realität verdoppelt, noch einmal interpretiert. Immerhin zeigt sich hier innerhalb der bürgerlichen Soziologie das Gefühl einer totalen Sinnlosigkeit der Realität, denn sonst wäre eine sinnproduzierende und sinnvermittelnde Klasse als eigene Klasse nicht notwendig. Zum anderen aber wird deutlich, dass die Intelligenz als etwas Apartes verstanden wird, das eben diesen Sinn produziert. Ich glaube nicht, dass das einfach eine Konstruktion ist, sondern ich sehe in diesem Entwurf die genaue Beobachtung von Tendenzen, die sich auch in der Literatur zeigen, nämlich die Abspaltung von Sinnproduktion und Erkenntnisproduktion. Das ist ein Auseinanderzerren von Dimensionen, die im eigentlichen Sinne zusammengehören und die heute nicht mehr so zusammenzubringen sind, sondern nur äußerlich zusammengebracht werden.
Meine These lautet also: Die wirkliche Poesie lebt von der Not der Begriffe. Sie erlöst diese Begriffe nicht von ihrer Not, sondern sie ist der Teil an Sinn und Sinnstiftung, an Begreifen, das in den Begriffen nicht mehr vorhanden ist, schon gar nicht in den wissenschaftlich verengten Begriffen. Diese Dinge möchte ich mittels eines kurz formulierten Textes5 an drei Beispielen erläutern, also was es heißt, von der Not der Begriffe zu sprechen, die etwas hervortreiben, was sie eben nicht sind und was die Wissenschaft, so wie sie als Erfahrungs-, aber auch als Reflexionswissenschaft betrieben wird, nicht leisten kann. Es stellt sich hier das Problem, die Beziehung zwischen Begriff und Bild zu bestimmen, zwischen Wissenschaft und Utopie, zwischen dem, was analytisch durchsichtig, rational ist, und der Dimension, die etwa Michel Foucault (1926–1984) unter dem Titel Wahnsinn abhandelt.6 Nehmen wir diese Begriffe in dieser Entgegensetzung, so zeigt sich, dass in der Philosophie von Kant und Hegel wie auch bei Marx diese Dinge viel stärker das hervortreiben, was als materialistische Ästhetik bezeichnet werden mag, als das, was aus den – immer misslungenen – Beispielen der abgespaltenen ästhetischen Äußerungen von ihnen zu finden ist. Ich werde das gleich verdeutlichen.
Das erste Beispiel ist der Philosophie Kants entnommen. Nachdem es Kant mit einiger Mühe gelungen ist, die reinen Verstandesbegriffe abzuleiten – und das ist außerordentlich mühevoll, weil es an sich nicht möglich ist, aber Kant hat es doch insofern möglich gemacht, als er sich noch auf Abstraktionen verlassen konnte, die die der Gesellschaft waren –, nachdem es ihm also gelungen ist, Verstandesbegriffe als reine abzuleiten, sucht er den Rückweg zur Sinnlichkeit, dem zweiten Stamm der Erkenntnis. Die Vermittlungsarbeit im Schematismuskapitel, dem Zentralkapitel der Vernunftkritik, trägt Züge von Poesie. Auch hier muss ich noch offenlassen, was ich darunter verstehe; jeder hat aber erst einmal eine Vorstellung davon. Er sagt: »Der Begriff vom Hunde bedeutet eine Regel, nach welcher meine Einbildungskraft die Gestalt eines vierfüßigen Tieres allgemein verzeichnen kann, ohne auf irgendeine einzige besondere Gestalt, die mir die Erfahrung darbietet, oder auch ein jedes mögliche Bild, was ich in concreto darstellen kann, eingeschränkt zu sein. Dieser Schematismus unseres Verstandes, in Ansehung der Erscheinungen und ihrer bloßen Form, ist eine verborgene Kunst in den Tiefen der menschlichen Seele, deren wahre Handgriffe wir der Natur schwerlich jemals abraten, und sie unverdeckt vor Augen legen werden.«7 Der Begriff des Hundes soll sich bilden, ohne dass ich je in meinem Leben einen Hund gesehen habe, also eine bloß reine Regel sein. Und diese Regel soll nun allerdings dazu dienen, dass sich doch eine Vermittlung zu einer konkreten sinnlichen Gestalt bildet.
Wo Kant die Formen ästhetischer Phantasie unter dem Titel Einbildungskraft systematisch abhandelt, nämlich in der als Mittelglied zwischen theoretischer und praktischer Vernunft gedachten Urteilskraft, wirken die Beispiele konstruiert und ohne Kraft der Anschauung. Mit der Definition des Genies als der angeborenen Gemütslage, durch welche die Natur der Kunst die Regel gibt, leitet Kant den fatalen Geniekult ein. Die wirkliche ästhetische Produktivkraft dagegen tritt da auf, wo Selbsterkenntnis ohne Rückgriff auf eine verborgene Kunst in den Tiefen der Seele, also ohne Sinnlichkeit und Phantasie, nicht mehr möglich ist, wo die Erkenntnis an dem Punkt angelangt ist, wo ich selbst den Verstand nicht mehr ohne Sinnlichkeit denken kann. Dann produziert gewissermaßen die Einbildungskraft ein Stück von dem, was ich als Not der Begriffe bezeichnen würde. Da geht es um die Tiefen der Seele, was in der Kantischen Philosophie keinen systematischen Platz haben darf, aber einen zentralen Platz einnimmt. Hier geht es nicht weiter. Der Begriff vom Hunde ist eine aporetische Kategorie, in der alle Widersprüche in der tief in der Seele verborgenen Kunst zusammengezogen sind, von der wir nicht wissen können, wie sie produziert. Das kehrt in gewissem Maße in der »Kritik der Urteilskraft« als das Genie wieder, aber hier tritt es als etwas Notwendiges auf, in der »Kritik der Urteilskraft« hingegen als äußere Vermittlung. Diese Phantasie zehrt von der Not der Begriffe. Und ohne Begriffe bleibt sie blind.
Es sind die Bruchstellen zwischen Erkenntnis, Moral und Sinnlichkeit, welche substanzielle Phantasie hervortreiben. Wie anders wäre die Vorstellung von einem vierfüßigen Tier, das keine besondere Gestalt haben darf, aber gleichwohl Sinnlichkeit und Verstand haben soll, zu verstehen? Ein transzendentaler Hund wäre das; der Hund als eine transzendentale Kategorie. Es steckt eine abgründige Ironie in diesem Satz. Da ist das eigentlich unbewusste Moment der ästhetischen Produktion, wider Willen zu produzieren. Es ist gerade das, was gegen den Willen konstruiert ist, und nie wäre Kant auf die Idee gekommen, über diesen Satz zu lachen. Es hat aber etwas fast Ironisches, und die Romantiker greifen solche Sätze sehr gerne auf. Die »Kritik der reinen Vernunft« ist voll von solchen und ähnlichen Bildern, und wenn man will, ist die »Kritik der reinen Vernunft« die Ästhetik Kants oder wenigstens unerlöste, unbefreite Ästhetik als Theorie.
Solche Bilder sind keineswegs, das möchte ich hier hervorheben, austauschbar, an ihre Stelle kann man keine beliebigen Metaphern setzen. Sie sprengen die Wissenschaftssprache auf, zeigen, dass sie nicht von sich leben kann, dass Erkenntnis ohne das, was sich als Kunst bezeichnen lässt, nicht möglich ist. Sie treiben den Verstand bis zu dem Grenzpunkt, an dem er sinnlich zu denken gezwungen wird, wenngleich er bewusst mit Sinnlichkeit sich zu vermitteln nicht imstande ist. Ähnliches gilt für die »Kritik der praktischen Vernunft«. Das Sittengesetz ist auf die reine Form allgemeiner Gesetzgebung gegründet. Aber zu seiner philosophischen Begründung gebraucht Kant Bilder und Metaphern. An wichtigen Punkten seiner Argumentation verdichtet sich seine Kritik zu poetischen Ausdrücken, Metaphern von ungeheurer Kraft, sinnlichen Signalen. ›Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir‹, Würde als das, was keinen Preis hat, ›Menschheit in meiner Person‹ – an keiner Stelle sind die versinnlichenden Beispiele und die poetischen Bilder seinem Denken äußerlich oder zufällig. Die aus Verstand und Vernunft geschöpfte Poesie lässt sich nicht arbeitsteilig separieren, einem besonderen Ressort oder Kultursegment zuordnen.
Das zweite Beispiel entnehme ich der Warenanalyse von Marx’ »Kapital«. Es sind nicht die Begriffe, die Phantasie ausbrüten, sondern es sind die Dinge, die sich in Phantasmagorien umwandeln, also der umgekehrte Prozess. Es sind nicht die Begriffe, es ist nicht der konsequente Zwang des Denkens, sondern bei Marx sind es umgekehrt die Dinge, die sich mit Phantasmagorien aufladen, die lebendig und gespenstisch werden. Er schreibt: »Eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. Ihre Analyse ergibt, daß sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Soweit sie Gebrauchswert, ist nichts Mysteriöses an ihr, ob ich sie nun unter dem Gesichtspunkt betrachte, daß sie durch ihre Eigenschaften menschliche Bedürfnisse befriedigt oder diese Eigenschaften erst als Produkt menschlicher Arbeit erhält. Es ist sinnenklar, daß der Mensch durch seine Tätigkeit die Formen der Naturstoffe in einer ihm nützlichen Weise verändert. Die Form des Holzes z.B. wird verändert, wenn man aus ihm einen Tisch macht. Nichtsdestoweniger bleibt der Tisch Holz, ein ordinäres sinnliches Ding. Aber sobald er als Ware auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich übersinnliches Ding«,8 also in etwas, was Qualitäten anreichert, etwas anderes wird, was ein Stück Abstraktion bekommt: »Er steht nicht nur mit seinen Füßen auf dem Boden, sondern er stellt sich allen andren Waren gegenüber auf den Kopf und entwickelt aus seinem Holzkopf Grillen, viel wunderlicher, als wenn er aus freien Stücken zu tanzen begänne.«9 Ich möchte mal den Dichter sehen, der so etwas erfunden hätte. Das ist ein prototypisches Beispiel für große Poesie im wissenschaftlichen Zeitalter. Homer hätte das sicherlich nicht erfunden.
Auch vom Marx’schen Werk kann man sagen, dass die eigentliche Ästhetik in den theoretischen und politischen Schriften steckt und nicht in jenen Passagen, wo er sich ausdrücklich, wie in der Einleitung zu den »Grundrissen«, über Kunst und Literatur äußert, die man seit einem Jahrhundert tot- und plattgetreten hat. Das sind alles Äußerungen wie die aus der Sickingen-Debatte mit Ferdinand Lassalle10, nichtssagende Sachen, die gar nichts mit der Größe seiner Theorie zu tun haben, sondern die aus Augenblickszwängen zustande gekommen sind. Diese Äußerungen artikulieren im Übrigen zumeist klassizistische Vorstellungen und knüpfen nicht an die fortgeschrittenste Entwicklung der gesellschaftlichen Blockierung der Sinne an. Ähnliches gilt von Hegel, dessen »Logik« und »Phänomenologie« voll von unerlöster Phantasie ist. Man denke an den abgründig ironischen Satz von der Schädelstätte des absoluten Geistes am Schluss der »Phänomenologie des Geistes«, durch die sich der absolute Geist durchgequält hat. Hegel sagt am Schluss der »Phänomenologie« nicht besonders christlich, das sei jetzt die Schädelstätte des absoluten Geistes, die abgemagerten Begriffe sind der Rest.11 Hier ist im Grunde das Ende von Erkenntnis erreicht, die die Menschen nicht mehr weitertreiben können. Sie bedürfen also einer neuen Dimension, sie müssen etwas anderes bekommen, indem er die Odyssee der Bewusstseinsgestalten in der »Phänomenologie« enden lässt. Hegel spürt allerdings, dass die Aporie von Bild und Begriff im heraufziehenden Zeitalter der Wissenschaft das Ende aller Kunst, nicht nur einer bestimmten Kunstform, ankündigt.
Es geht mir also um einen spezifischen Gedanken – was dabei rauskommt, weiß ich noch nicht. Es geht mir um die deutsche, in diesem Fall literarische Verarbeitung der Französischen Revolution, um die deutsche Aufarbeitung, Darstellung, Reaktion auf die Französische Revolution. Wobei Revolution hier nicht in einem sehr engen Sinne gemeint ist, sondern sich auf das bezieht, was das in der Vor- und der Nachphase der Französischen Revolution in Gang gesetzte bürgerliche Zeitalter unter den ganz spezifischen historischen Bedingungen Deutschlands bedeutet. Mein Programm geht dahin, die Verarbeitung dieses revolutionären Zeitalters unter deutschen Bedingungen zu betrachten, wie es in die ästhetischen Strukturen dieser Produkte hineinkommt. Das wird der schwierigste Teil sein.
* Mit dieser Anrede begann Negt jede seiner Vorlesungen. Im Buch verzichten wir nachfolgend darauf.
Die politische Substanz großer Literatur – Grundkategorien der Interpretation
Vorlesung vom 22. Oktober 1976
Zunächst einige Vorbemerkungen zu der Frage, warum ich diesen angekündigten Zyklus nicht fortsetze. Ich hatte ja einen Vorlesungszyklus angekündigt, der mit Kant beginnt und wenigstens vorläufig mit Freud aufhört. Ich bin darauf angesprochen worden, warum das jetzt an diesem Punkt endet, da bin ich natürlich Rechenschaft schuldig. Es gibt keine systematischen Gründe dafür – ich werde das auch zu irgendeinem Zeitpunkt wieder aufnehmen –, sondern die Gründe liegen eher darin, dass man nicht so in einem Zuge große Theorien behandeln kann, also sich auf eine Konsequenz einlassen muss, die nicht an einem Punkt aufgesprengt wird. Es ist eher eine Art Müdigkeit von mir, sich jetzt durch Hegel zu quälen, und schon die Erwartung, dass danach Marx kommt, ist absolut tödlich. Ich kann mir denken, dass die Gefühle nicht völlig abwegig sind, die ich dabei empfinde. Ich werde auch einmal Marx hier systematisch behandeln und sicherlich auch Freud, aber ich weiß noch nicht wann. So ein Studentenleben ist relativ kurz, daraus ergibt sich eine gewisse Ungeduld, während das bei mir ja etwas längerfristig gedacht werden kann. Es gibt also keinen systematischen Grund oder eine Veränderung der Theoriekonzeption, sondern ich glaube, gerade wenn man die Kategorien von Freud und Marx nutzen und lebendig machen will, ist es notwendig, dass sie sich auch an anderen Gegenständen bewähren. Die Bewährungsprobe für diese Kategorien ist das Wichtige. Wir werden auch sehen, dass ich mich in dieser Vorlesung auf diese Begriffe beziehe.
Mein letzter Gesichtspunkt, mit dem ich aufhörte, bestand darin, dass ein Zentralproblem diese Beziehung zwischen Bild und Begriff sei. Ich möchte diesen Punkt weiterführen. Zunächst bin ich von der These ausgegangen, dass wir uns, wenn die geschichtliche Situationsdeutung richtig ist, in einem wissenschaftlichen Zeitalter befinden. Das ist zunächst eine sehr allgemeine Feststellung, aber sie wird sich im Einzelnen dann doch als folgenreich zeigen für alles, was die spezifischen Kategorien betrifft, die in der kulturellen Produktion eine Bedeutung haben. Ich unterbrach die Vorlesung an dem Punkt, an dem von Hegel ausgehend der Versuch gemacht wurde, die völlige Durchdringung der ästhetischen Produkte, also die völlige Auflösung des Innenbegriffs, als das Ende der Kunst zu diagnostizieren. Wir wissen aus seiner »Ästhetik«, dass Hegel die Romantik als den Abschluss der Kunst überhaupt betrachtet, weil alles aus dem Subjekt heraus ist und durchsichtig ist. Hegel spürt zweifellos, dass die Aporie von Bild und Begriff im heraufziehenden Zeitalter der Wissenschaft das Ende aller Kunst, nicht nur einer bestimmten Kunstform, ankündigt. Die klassizistische Liaison, die abgestorbene Formen, Kunstmittel und Gefühle zu regenerieren und zu vergegenwärtigen versucht, ist substanzlos, also die Rückwendung zu vergangenen Epochen, in denen der Volksgeist alle Ebenen des menschlichen Lebens durchdringt. Sie sind nicht durch äußere Aneignung lebendig zu halten. Das ist der Großeinwand Hegels gegen alle Möglichkeiten der klassizistischen Regeneration von Kunst, aber auch von anderen Formen des Lebens und der Subjekt-Objekt-Beziehung. Sie werden substanzlos. Es gibt keine Rückwendung, es sei denn eine neue geschichtliche Gestalt gestaltet die alte Geschichte und die alte Kunst um. Aber dann ist daraus ein Neues geworden. Es ist nicht etwas, was sich nur äußerlich aneignen ließe. Hegel sagt in der Ästhetik: »Es hilft da weiter nichts, sich vergangene Weltanschauungen wieder, sozusagen substantiell, aneignen, d. i. sich in eine dieser Anschauungsweisen fest hineinmachen zu wollen, als z. B. katholisch zu werden, wie es in neueren Zeiten der Kunst wegen viele getan, um ihr Gemüt zu fixieren«1. Er hat hier einen Teil der Frühromantiker im Auge. Dieser Ausweg, sich des entfalteten Formenreichtums der Vergangenheit für die eigene lebendige Produktion zu bedienen, ist versperrt, so sehr wie der, die Kunst im Medium der Wissenschaft zu retten. Beide Möglichkeiten schließt Hegel aus. Er sagt: »Was wir als Gegenstand durch die Kunst oder das Denken so vollständig vor unserem sinnlichen oder geistigen Auge haben, daß der Gehalt erschöpft, daß alles heraus ist und nichts Dunkles und Innerliches mehr übrigbleibt, daran verschwindet das absolute Interesse. Denn Interesse findet nur bei frischer Tätigkeit statt. Der Geist arbeitet sich nur so lange in den Gegenständen herum, solange noch ein Geheimes, Nichtoffenbares darin ist.«2
Diese Diagnose ist nun umso erstaunlicher, als der dialektische Begriff gerade in Hegels Theorie ohne Momente mimetischer Erfahrung gar nicht zu denken ist. Hegels Diagnose führe ich an, um zu zeigen, dass diese Aporie, der Dualismus von Begriff und Bild, so einfach nicht zu fassen ist: Der Begriff zehrt das Bild auf, und damit sei das Ende der Kunst gekommen. Es stellt sich das Problem, das wir gestern diskutiert haben, noch von einer ganz anderen Seite. Ich habe gesagt, die Kunst zehrt von der Not der Begriffe. Man muss dabei sehen, was diese Begriffe bezeichnen. Schon bei Hegel sind sie mehr als Demarkationszeichen zur Benennung von Gegenständen. Der Begriff hat ein Moment von Sinnlichkeit, von Mimesis, von Erfahrung. Das treibt ihn voran. Er ist nicht eine bloß logische Merkmalseinheit, sondern eine Totalität in sich, die sich am Gegenstand entfaltet. Es gibt im Hegel’schen Begriff so etwas wie eine Subjekt-Objekt-Dialektik, die dem Begriff selbst immanent ist. Aber selbst hier sagt Hegel: Wenn der Begriff das aufgezehrt hat, wenn er alles durchsichtig gemacht hat, wenn das Dunkle, von dem die Sinnlichkeit im Bürgertum lebt, durchsichtig ist, hört Kunst auf. Ich glaube, hier wird schon gezeigt, dass diese Form der Verwissenschaftlichung zu eng gefasst ist. Es tritt nämlich ein zweites Moment auf, das die Sache sehr viel komplizierter macht, als sie in dieser Aporie von Begriff und Bild bezeichnet ist.
Es gibt in der Kunst immer eine Art Gegenvernunft. Der Vernunftbegriff ist gefasst in der doppelten Struktur, also auch darin, was er ausschließt. Ich habe das nur kurz angedeutet mit dem Hinweis auf den Wahnsinn, gewissermaßen das mystische und gnostische Element, Elemente, die gerade das konstituieren, was der Begriff und die Wissenschaft ausschließen. Mit einem Wort: Kunst hat immer etwas Antigesellschaftliches an sich, jedenfalls solange es Gesellschaft als antagonistische Gesellschaft gibt. Wir wissen nicht, wie es aussieht, wenn es sie so nicht mehr gibt. Das hat eine Reihe von zusätzlichen Bedingungen, nicht nur die Aufhebung der Klassenrealität. So lange ist Kunst jedenfalls immer etwas, was gegen die Gesellschaft gerichtet ist. Es ist ein Nicht-Gesellschaftliches, ein Nicht-Vernünftiges, ein Element, in dem der Rest Substanz und Ausdrucksmittel gewinnt. Sie ist immer auch Ausdruck dessen, was sich nicht gesellschaftlich konstituieren und durchsetzen kann. Ich werde in einem anderen Zusammenhang auf die Widerspiegelungstheorien in der Ästhetik kommen, die die Frage der Widerspiegelung realistischer Elemente in der Kunst überbetonen. Es ist immer nur ein Moment, und häufig nicht einmal das wesentliche. Heute besteht die Substanz der Kunstwerke gerade darin, dass sie nicht widerspiegeln. Oder prägnanter formuliert: Das Gesellschaftliche der Kunst besteht in der Regel im Nicht-Gesellschaftlichen, in dem, was sie nicht abbildet, was sie zum Ausdruck bringt, obwohl es keine Kraft in der Gesellschaft gibt für das, was sie zum Ausdruck bringt. Das ist das Gesellschaftliche. Ich habe das in der Kant-Vorlesung einmal zu verdeutlichen versucht am Begriff des Apriori, des Ungeschichtlichen bei Kant. Gerade was sich bei Kant als Ungeschichtliches darstellt, als reine Geltungskategorien, bezeichnet gewissermaßen die Angemessenheit an den bürgerlichen Zustand dieser Gesellschaft, und nicht das, was Kant an geschichtlichen Elementen dieser Gesellschaft abbildet. Der Wahrheitsgehalt und der geschichtliche Gehalt stecken nicht immer im bewusstgemachten geschichtlichen Bezug zur Gesellschaft, sondern es kann der Gegenteil der Fall sein, und ein wesentliches Moment der Kunstproduktion besteht gerade darin, Protestform gegen die Gesellschaft zu sein, also das auszudrücken, was in einer Gesellschaft sonst keinen Ausdruck findet, was natürlich immer etwas Ohnmächtiges und immer etwas Gebrochenes an sich hat. Das muss man erst einmal begreifen: eine Erkenntnisform, die sich nicht an den Regeln der Vernunft orientiert. Die ist dann ausgeschaltet, wie Foucault das nachzuweisen versucht: Wahnsinn als eine Erkenntnisform. Wir können das an vielen Produkten sehen, ob bei Hölderlin, Novalis oder anderen. Die sind nicht wahnsinnig, die Gesellschaft ist wahnsinnig, die sie in diese Ghettoisierung treibt. Und der Wahnsinn ist die einzige Form ihrer Lebenserhaltung gegen die Gesellschaft.
Das heißt auf der einen Seite zweifellos Not der Begriffe, auf der anderen Seite ist das nur die eine Hälfte, der andere Teil konstituiert einen Zusammenhang, der weit darüber hinausführt und in den einzelnen Produkten geschichtlich dechiffriert werden muss. Wenn ich diese zwei Momente hier anführe, so muss ich ein drittes angeben für das, was ein Gesichtspunkt meiner Analyse von literarischen Produktionen ist. Große Literatur ist politische Literatur, allerdings in einem ganz anderen Sinne als eine politische Gebrauchsliteratur, sondern in dem Sinne, dass man die Momente der komplexen Auseinandersetzung mit der Zeit versteht, soweit sie sich als Ganze darstellt, soweit sie Staat und Gesellschaft, politische Beziehungen, sicherlich auch Klassen mit einbezieht. Politische Literatur also in dem Sinne, dass sie durch ihr eigenes Formgesetz diagnostiziert, was die Zeit zum Ausdruck bringt, was Tendenzen sind, was der Nährboden der Zeit ist.
Ich will das kurz an einem Beispiel erläutern, das vielleicht nicht in dem Sinne zur großen Literatur gehört, aber doch sehr interessant ist, nämlich an George Orwell (1903–1950). Sie werden vielleicht die bekannteste Fabel, »Farm der Tiere« (1945), kennen, aber es gibt noch eine Reihe anderer Texte, z.B. »Mein Katalonien« (1938), die durch den Spanischen Bürgerkrieg motiviert sind. Sein ganzes Denken ist eigentlich vom Spanischen Bürgerkrieg geprägt. Orwell hat einen Essay geschrieben mit dem Titel »Warum ich schreibe«. Ich möchte einige Passagen daraus vortragen, weil Orwell zu den Dichtern und Denkern gehört, die eine absolute Ehrlichkeit gegenüber dem haben, was sie tun. Zunächst gibt er einige Kriterien an, warum er schreibt, warum man sich überhaupt dazu finden kann. Er sagt: »1. Reiner Egoismus. Der Wunsch überlegen zu sein, jemand zu sein, von dem man spricht, den man auch nach seinem Tod nicht vergißt; den Erwachsenen die Nichtachtung heimzuzahlen, die sie einen als Kind haben fühlen lassen etc. etc. Leugnen zu wollen, daß das ein Grund ist, und zwar ein sehr starker, ist einfach lächerlich. Schriftsteller teilen diesen Charakterzug mit Wissenschaftlern, Künstlern, Politikern, Rechtsanwälten, Soldaten, erfolgreichen Geschäftsleuten, kurz mit der gesamten Oberschicht der Menschheit. Die große Masse menschlicher Wesen ist nicht so ausgesprochen Ich-bezogen. Etwa nach Erreichung des dreißigsten Lebensjahres stecken sie jeden individuellen Ehrgeiz auf, ja, sie verlieren vielfach fast gänzlich das Gefühl für ihre eigene Persönlichkeit und leben hauptsächlich für andere oder werden einfach in der Knochenmühle der Alltagsarbeit aufgerieben. Dagegen steht eine Minderheit von begabten, selbstbewussten Menschen, die entschlossen sind, ihr eigenes Leben bis zum Ende zu leben und zu ihnen gehören die Schriftsteller. Ernstzunehmende Schriftsteller sind meiner Meinung nach im allgemeinen eitler und egozentrischer als Journalisten, dafür jedoch weniger an Geld interessiert. 2. ästhetischer Enthusiasmus. Sinn für die Schönheit der Umwelt oder für Worte und ihre richtige Anwendung. Freude an der Wechselwirkung schönklingender Worte, an der Geschlossenheit guter Prosa oder dem Duktus einer guten Erzählung. Der Wunsch, mit anderen ein Erlebnis zu teilen, das man als wertvoll empfindet und nicht in Vergessenheit geraten lassen möchte. Das ästhetische Motiv ist bei den meisten Schriftstellern nur in geringem Maße vorhanden. Aber selbst ein Pamphletist oder ein Verfasser von Lehrbüchern wird eine Liebe zu bestimmten Worten und Ausdrücken haben, die nicht zweckhaft bestimmt ist, oder ein ausgeprägtes Gefühl für die Anordnung des Satzes, die Breite des Buchrandes etc. etc. Von Kursbüchern abgesehen, ist kein Buch gänzlich frei von ästhetischen Erwägungen. 3. Sinn für Geschichte. Der Wunsch, die Dinge zu sehen, wie sie sind, den Wahrheitsgehalt von Ereignissen herauszufinden und sie für die Nachwelt aufzuzeichnen. 4. Politisches Engagement – wobei ich das Wort ›politisch‹ im weitesten Sinne benutze. Der Wunsch, der Welt eine bestimmte Richtung zu geben, die Anschauung anderer in Bezug auf ein gesellschaftliches Ideal zu verändern. Jedenfalls ist kein Buch gänzlich frei von Politik. Wenn man behauptet, Kunst sollte nichts mit Politik zu tun haben, so ist dies schon selbst eine politische Meinung.«3 Und er sagt am Schluss, die Sache resümierend: »Bei einem Rückblick über mein Werk stelle ich fest, daß die Bücher, die ich schrieb, immer dann leblos geworden sind, wenn ihnen eine politische Absicht fehlte und ich mich in gedrechselte Passagen, nichtssagende Sentenzen, schmückende Beiwörter und ganz allgemeinen Humbug verlor.«4
Diese in ihrer Aufzählung nicht sehr präzisen Kriterien bezeichnen im letzten Punkt etwas, was, glaube ich, ein selbst produzierender Schriftsteller nicht häufig so klar gesagt hat, nämlich das Formgesetz, in das nicht einfach politische Intentionen des Autors eingehen – was biographisch analysierbar wäre, also wo und wann hat er sich womit auseinandergesetzt –, sondern politisch bezeichnet in seiner eigenen Biographie die politische Grunderfahrung, die in die ästhetische Produktion mit eingeht. Diese Grunderfahrung ist immer eine der gegenwärtig ablaufenden Geschichte, bei ihm der Spanische Bürgerkrieg. Von dort hat er das Motiv und die Grunderfahrung für alles, was er danach geschrieben hat, und zwar auch bei Sachen, die gar nichts mit dem Spanischen Bürgerkrieg zu tun haben. Das ist die Frage, dass die Realitätsbestandteile überall sichtbar werden. Diese realistische Analyse verfehlt, dass sich auf Grundlage einer solchen bestimmenden Erfahrung eine eigene Logik der Produktion ergibt, die zweifellos zu bestimmten ästhetischen Umgestaltungen und Umformungen führt, die mit dem Grundsätzlichen nichts zu tun haben und zu tun haben dürfen. Es geht vielfach darum, das Grundmotiv gerade in der Objektivierung verschwinden zu lassen. Dann würde unsere Analyse nicht darin bestehen, die Genealogie der Grundmotive aufzuzeigen, sondern davon ausgehen, dass der Bezugsrahmen eines ästhetischen Produkts, der geschichtliche Bezugsrahmen, in die Poren der Sachkonstruktion, bis in die tiefsten und innersten ästhetischen Formgebilde eindringt. Es ist nicht so, wenn man Goethe nimmt, dass man nur seine »Kampagne in Frankreich« (1822) lesen muss, wo er sich explizit zur Französischen Revolution äußert. Gleichwohl kann man sagen, dass die Autoren, die ich aufgezählt habe, die bestimmende Grunderfahrung in ihre gesamte Produktion einbringen. Ja, ihre Phantasie wäre in diesem Ausmaß gar nicht denkbar ohne das Ereignis der Französischen Revolution. Ihre Phantasie würde völlig individualistisch ausgetrocknet sein, wenn dieses bestimmende Motiv fehlte, das ganz andere Folgen hat als die, ein Denker der Französischen Revolution zu sein, das aber dazu führt, dass die Phantasie als kollektive Phantasie die individuelle, die poetische Phantasie des einzelnen Dichters einbezieht. In diesem Sinne kann man sagen, dass hier Literatur im strengen Sinne politische Literatur ist, und das bedeutet, dass wir zunächst klären müssen, was eigentlich Geschichte in diesem Zusammenhang bedeutet.
Wir sehen heute, dass auf allen Ebenen wieder angefangen wird, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, geschichtliche Themen gestellt werden, also in Examensarbeiten, aber auch im öffentlichen Bewusstsein. Jeder fordert auf, Geschichte nicht zu vergessen. Gustav Heinemann (1899–1976) hat noch aufgefordert, sich mit dem Bauernkrieg, mit den deutschen revolutionären Traditionen auseinanderzusetzen. Walter Scheel (1919–2016) hätte sich einen der unsinnigsten, sogar borniertesten, wenngleich großen Historiker als Autor unserer Lehrbücher gewünscht, nämlich Leopold von Ranke (1795–1886), und wehrt sich gegen eine einseitige Geschichtsinterpretation von der Linken, wobei man sagen kann, dass vielleicht von hundert Büchern zwei von Linken geschrieben sind. Das ganze Geschichtsbild ist von anderen Traditionen geprägt, sodass man hier auch die Entwicklung der letzten Jahre beobachten kann. Die Zeitungen sind voll mit geschichtlichen Analysen, die biographische Methode greift um sich wie eine Pest; ein Kahlschlag in der Aufarbeitung der individuellen und kollektiven Geschichte. Ein Moment ist bei dieser Tendenz deutlich, nämlich die Rückwendung zur deutschen Geschichte, die, glaube ich, eine größere Schwerkraft auf alles heute Geschehende ausübt, als selbst in linken Analysen bisher angenommen wurde. Die Schwerkraft der deutschen Geschichte kommt erst heute wieder wirklich zum Tragen, und zwar in dem Widerspruch von Revolution, gescheiterter Revolution und Konterrevolution.
Ich will nicht sagen, dass ich mein Programm unbedingt dort einordnen möchte, aber ich will doch diese Tendenzen sehr ernst nehmen. In der Weise, wie deutsche Geschichte neu geschrieben wird, hat das auch unmittelbar politische Folgen. Es ist ja nicht gleichgültig, ob in Hunderttausenden von Exemplaren ein Freibeuter und mittelmäßiger Feldherr wie Albrecht von Wallenstein (1583–1634) ins deutsche Bewusstsein eindringt oder zum Beispiel Thomas Müntzer (1489–1525) oder Joß Fritz (1470–1525), den wahrscheinlich keiner hier kennt. Er war einer der größten Bauernführer, die es gegeben hat. Mit dem hat sich noch niemand richtig befasst. Generationen von Leuten müssen überhaupt erst mal die Quellen über Joß Fritz erschließen, um ihn zu dem Staatsmann dieser Periode machen zu können, der er gewesen ist: der eigentliche Revolutionär des Bundschuhs und des Bauernkrieges. Diese Aufarbeitung der Geschichte ist notwendig, aber sie kann nur unter bestimmten Voraussetzungen geleistet werden.
Mit den literarischen Autoren der Zeit von 1770 bis 1820 habe ich jene Periode ausgewählt, von der man sagen kann, dass sie der zweite Knotenpunkt der deutschen Entwicklung gewesen ist. Der erste war ganz zweifellos der Bauernkrieg, die Niederschlagung der Bauern. Die große Bauernrevolution war die erste, die die Massen erfasst hat, mit einem Programm, das weit über die unmittelbaren Forderungen der Bauern hinausging. Seitdem ist die deutsche Revolution gebrochen. Auch die Emanzipation der Städte kommt nicht mehr zustande. Ich werde darauf noch eingehend zurückkommen. An diesem zweiten Knotenpunkt geht es um die Phase, die Tendenzen der Revolution von oben einleitet mit den Stein-Hardenberg’schen Reformen, mit dem preußischen Weg des Kapitalismus. Damit wurden auch Aufstiegshoffnungen der deutschen Intelligenz befriedigt, indem diese Intelligenz sich entweder in die Verwaltungsbürokratie einordnet oder literarisch wird, was eine eigene, prekäre Aufstiegsmöglichkeit darstellte. Die politische Beteiligung großer Teile der deutschen Intelligenz ist reduziert auf das, was sie selber produzieren. Sie haben noch nicht einmal ein bürgerliches Publikum. Sie müssen das Publikum erst produzieren, das ihre Bücher liest. Das erklärt die Zwiespältigkeit in dieser Produktion. Sie orientiert sich nämlich an der höfischen Kultur und ist gleichzeitig der Versuch, so etwas wie bürgerliche Öffentlichkeit herzustellen. Deshalb gründet jeder Dichter ein Journal, setzt die Kommunikationsmittel und -medien, derer er sich bedienen will, für die eigene Verständigung selbst in Kraft. Hier sind Elemente enthalten, die viel früher angelegt sind als etwa in der Revolution von 1848. Das ist schon ein Resultat dieser ganzen Entwicklung.
Warum wähle ich diese Periode? Warum nicht etwa Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781)? Lessing gehört zu einer anderen Periode, davon abgesehen, dass Franz Mehring (1846–1919) schon genügend über sie gesagt hat, wenn auch nicht über Lessing selbst. Die »Lessing-Legende« (1893) ist eigentlich eine Arbeit über Preußen, nicht aber über die Produkte von Lessing. In dieser Periode seit Goethes »Götz von Berlichingen« (1774) Anfang der 1770er-Jahre – worin nicht zufällig ein Motiv aus dem Bauernkrieg aufgegriffen wird und ganz sicher nicht zufällig Götz von Berlichingen (1480–1562) und nicht Ulrich von Hutten (1488–1523) oder Franz von Sickingen (1481–1523) – dringt die deutsche Revolution nur in Gestalt der Räuber, der Räuberromantik, in die Klassik; buchstäblich in Schillers »Die Räuber« (1781). Seitdem ist das Motiv gesetzt, mit dem sich Klassik, Romantik und die gebrochenen Revolutionäre konfrontiert sehen: der Zwang, sich als Intelligenz auch revolutionär zu befreien, aber es unter deutschen Bedingungen nicht zu können. Die Französische Revolution als der Emanzipationsrahmen, in dem sie alle stehen, erlaubt auf der einen Seite nur Fernorientierungen, auf der anderen Seite aber ist der Zwang der Realität, dieser Gesellschaft so, dass sie das unter deutschen Bedingungen verarbeiten müssen. Diese Periode beginnt in den 1770er-Jahren mit den zeitgeschichtlichen Vorboten der Französischen Revolution und endet im Grunde mit der Konterrevolution in Gestalt den Karlsbader Beschlüssen (1819), wobei die absolute Ironie darin besteht, dass etwa E.T.A. Hoffmann (1776–1822) Mitglied der Immediat-Kommission der preußischen Regierung war, um antinationale Umtriebe festzustellen; und er hat dann im Briefwechsel mit Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852) eine fatale Rolle gespielt.5 Turnvater Jahn wurde verhaftet und ins Gefängnis gesteckt und hat von einem der drei Mitglieder, E.T.A. Hoffmann, Rechenschaft darüber verlangt, aufgrund welcher Indizien das geschehe. Er könne sich zwar denken, dass seine Anweisung an die Jugend, beim Klettern den Blick nach oben zu richten, als republikanisch betrachtet werde, und er sei sich auch bewusst, dass er eine Stegreifrede über Luther gehalten habe; er möchte aber doch sein Delikt genauer bezeichnet wissen. Worauf Hoffmann ihm antwortet, er solle keine Reden halten und sich gefälligst den Beschlüssen der preußischen Regierung und dieser Kommission