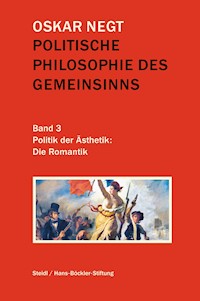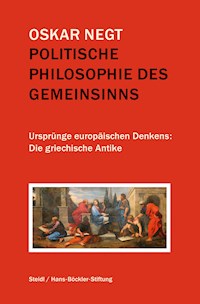Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl GmbH & Co. OHG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Oskar Negts autobiographische Spurensuche, die er in Überlebensglück so eindrücklich wie bewegend beschrieben hat, findet nun ihre Fortsetzung im zweiten Teil. Sein Flüchtlingsdasein hat Negt für sich abgeschlossen, sich mit dem Oldenburger Abitur ein Zertifikat der Sesshaftigkeit ausgestellt. Als junger Mann geht Negt an der Frankfurter Universität auf eine 'Denk-Reise'. Und das tun viele seines Alters. Die Vorlesungen bei Adorno, Horkheimer und Habermas sind brechend voll, auch wenn sie in einem alten halbzerstörten und kalten Biologiesaal stattfinden. Besonders der Vortragsstil Horkheimers schlägt die Studenten in seinen Bann, der mit seiner Fähigkeit, auch den abwegigsten Fragen seiner Zuhörer einen rationellen Kern abzugewinnen, viele ermutigt, sich am philosophischen Gespräch zu beteiligen. Negts Studienjahre münden in die Assistenz bei Jürgen Habermas. Während dieser Zeit tritt er mit Vorträgen und Kampfschriften als einer der Wortführer der Außerparlamentarischen Opposition auf, sucht aber auch die öffentliche Auseinandersetzung mit der RAF. Als politischer Intellektueller ist er unbotmäßiger Zeitgenosse, als Wissenschaftler und Denker wandelt er zwischen Soziologie und Philosophie. 1970 wird Negt Professor an der Universität Hannover, doch seine Arbeit bleibt nicht auf die akademische Lehre beschränkt. Als Publizist setzt er sich für die gewerkschaftliche Bildungs- und Kulturarbeit ein, gründet mit der 'Glocksee' ein alternatives Schulmodell und wird später politischer Berater während der rot-grünen Regierungsjahre um Gerhard Schröder, dessen Agenda 2010 er heftig kritisiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
OSKAR NEGT
ERFAHRUNGSSPUREN
EINE AUTOBIOGRAPHISCHEDENKREISE
STEIDL
Hegel an Niethammer:
»Die theoretische Arbeit, überzeuge ich mich täglich mehr, bringt mehr zustande in der Welt als die praktische; ist erst das Reich der Vorstellungen revolutioniert, so hält die Wirklichkeit nicht aus.«1
Kant dagegen:
»Der praktische Philosoph, der Lehrer der Weisheit durch Lehre und Beispiel, ist der eigentliche Philosoph. Denn Philosophie ist die Idee einer vollkommenen Weisheit, die uns die letzten Zwecke der menschlichen Vernunft zeigt.«2
VORWORT
I
Der zweite Teil meiner Spurensuche ist nun doch viel umfangreicher geworden als ursprünglich geplant; die Gründe dafür sind vielfältig. Entscheidend war am Ende, dass ich oft meiner Neigung gefolgt bin, den autobiographischen Erzählschwung an dem Punkt zu unterbrechen, an dem ich in die lebensgeschichtliche Berichterstattung tiefer hätte eindringen können, aber stattdessen Lust verspürte, lieber am Faden eines Theorieproblems weiterzuspinnen. Mir erschien es zu dürftig, über einen Lebensabschnitt oder eine Tätigkeit nur zu berichten. Vielmehr wollte ich mich der Anstrengung unterwerfen, das Problem, um das es ging, zu erweitern und zu vertiefen – immer die Frage im Nacken: Was bedeutet denn das? In manchen Fällen habe ich zunächst das Theorieproblem diskutiert, bevor ich die lebensgeschichtliche Entscheidung in Worte zu fassen versuchte, obwohl es doch in der Realität so gewesen sein wird, dass zunächst die Erfahrungen bestimmter Entscheidungssituationen die Denkfähigkeit angeregt haben, bevor eine allgemeine Theorie dazu entwickelt wurde. Deshalb kam immer wieder die Warnung von Freundinnen und Freunden, die Zielvorstellungen einer Autobiographie zu verfehlen, indem das Ganze zu einer klugen Ansammlung von Aufsätzen versteinert wird.
Wie immer bei solchen Unternehmungen, die sich im Arbeitsprozess noch einmal nach allen Seiten ausdehnen und krakenhaft Gegenstände an sich ziehen, sind viele am Gelingen beteiligt gewesen. Die kritische Begleitung, an der auch das beharrliche Interesse erkennbar ist, haben wenige durchgehalten. Da sind Hendrik Wallat zu nennen, Michael Schumann, Richard Detje, Stefan Lohr und, wie immer bei meiner Arbeit, Christine Morgenroth. Ihnen gilt besonderer Dank.
Manche Personen, Situationen oder einflussreiche Lektüren kommen in dieser autobiographischen Spurensuche mehrmals vor. Doch es handelt sich nicht um einfache Wiederholungen; vielmehr sind es Deutungen derselben Person oder Situation, desselben Werks aus verschiedenen Perspektiven, denn sie treten in einem ausgedehnten Leben in ganz unterschiedlichen Konstellationen auf. Das alles auf eine Linie zu bringen, wäre mir abstrakt und leblos erschienen. Ich habe viel Mühe darauf verwendet, die Stellung der einzelnen Kapitel im Ganzen immer wieder zu erproben. Häufiger als in anderen Büchern habe ich deshalb den kritischen Hinweis gehört: Das kommt doch schon einmal vor! Das ist kein Versehen, sondern gehört zu den konstitutiven Prinzipien dieses Buchs.
Einige Worte zu dem, worüber ich nicht spreche. Autobiographien haben den Anspruch einer Persönlichkeitsdeutung aus Sicht des Autors. Das ist das Markenzeichen dieses Buchtyps. Leserinnen und Leser, die von diesem zweiten autobiographischen Band Auskunft über meine Privatverhältnisse erwarten, werden enttäuscht sein, dass sie darüber nichts erfahren. Den Schutzraum meiner Familienverhältnisse und meiner Beziehungsarbeit, soweit sie nicht öffentliche Arbeitsfelder betrifft, habe ich sehr weit gefasst. Außerdem habe ich darauf verzichtet, Hinweise oder gar längere Ausführungen zu einzelnen, von mir allein oder in Kooperation mit Anderen geschriebenen Büchern zu geben.
Der Bogen zum ersten Band der Autobiographie, Überlebensglück,3 lässt sich am besten spannen, indem ich die Schreiberfahrung zitiere, die ich bei dem gesamten Biographieprojekt gemacht habe: Am Ende sieht es so aus, als gäbe es eine Art Lebensplan, der umgesetzt wird. Das ist jedoch eine Täuschung, der wohl die meisten Autobiographen unterliegen. Tatsächlich blickt man am Ende – mit viel gutem Willen – mehr oder minder freundlich zustimmend auf ein Fragment.
II
Dieser zweite Teil meiner autobiographischen Spurensuche trägt – wie stark die Verästelungen auch auf die Vergangenheit bezogen sein mögen – eine zentrale Botschaft für die Gegenwart und für die Zukunft: Wir dürfen nicht warten, bis das Gemeinwesen verrottet ist und die moralische Verkrüppelung ein gesellschaftliches Betriebsklima geschaffen hat, das die Mühe um Anstand und politische Urteilskraft immer beschwerlicher und vielfach aussichtslos werden lässt. Das Erstarken der Rechtsradikalen liefert den Beweis, dass die neoliberal inszenierte Rücknahme des Klassenkompromisses der Nachkriegszeit nicht ohne Folgen bleibt. Sie bewirkt soziale Pathologien und Instabilität, die letztlich in der Delegitimierung des Systems enden. Dabei verstärken sich nationale und internationale Phänomene: Globalisierung und Digitalisierung, Migration und Ausgrenzung, rechter Autokratismus und Populismus der Trump, Erdoğan, Orbán und Le Pen. Der Angstrohstoff, der Bearbeitung erfordert, hat ein furchterregendes Gewicht bekommen. Dieser zweite Teil der Autobiographie steht im Zeichen einer inneren Zerrissenheit der Gesellschaft, wie es sie in der durch sozialstaatliche Kompromisse geprägten Nachkriegszeit nicht gegeben hat.
Die hier vorgelegten Texte haben autobiographische Motive, aber sie folgen nicht den Maßstäben einer Autobiographie. Ich will damit bekennen, dass ich die Erwartung an Vollständigkeit und schließende Übergänge in diesem Lebensabschnitt der Vita activa nur in wenigen Bezügen erfüllen kann. Nicht nur das Ganze ist ein Fragment, auch die einzelnen Abschnitte sind fragmentarisch und fügen sich nicht in einen geordneten Gesamtzusammenhang, dem ich mich sonst wissenschaftlich verpflichtet fühle.
Die Bezüge zum ersten Teil meiner Autobiographie sind so verfasst, dass die beiden Teile auch unabhängig voneinander gelesen werden können. Ich habe mehr Zeit als bei meinen anderen Büchern benötigt, um eine überzeugende Darstellungsstruktur zu finden. Meine Frau, Mitinitiatorin dieses autobiographischen Buchprojekts, wurde immer nervöser, wenn sie mitansehen musste, wie ich fortwährend die einzelnen Textteile von einem Zimmer zum nächsten trug. In diesem Sinne einer offenen Suchbewegung änderte ich immer wieder den Rahmen, zu dem meine politische Lebensgeschichte passt.
Jede Biographie ist ein Fragment – auch die, die sich auf Archivmaterial stützt und darauf bedacht ist, möglichst viele Daten zu sichern und die vielfältigen Meinungen, die den Porträtierten mit Bildern und Symbolen umgeben, in einen lesbaren Text zu bringen. Der erste Teil dieses autobiographischen Buchprojekts bewegt sich in einem Handlungsrahmen, in dem alltäglich lebenswichtige Entscheidungen zu treffen waren, weitgehend aber nicht zu selbst gewählten Bedingungen. Im »Überlebensglück« stecken viele Zufallsmomente, die den Handlungsspielraum einschränken oder auch Perspektiven aufblitzen lassen, die ein wahrnehmungsfähiger Mensch sofort zu nutzen versteht. Meine beiden Schwestern Ursel und Margot, mit denen ich mich fast drei Jahre auf der Flucht befand, zunächst von Ostpreußen nach Dänemark, dann in dänischen Flüchtlingslagern, hatten eine besondere Sensibilität für offene Situationen entwickelt, die für Augenblicke kleine, aber folgenreiche Vorteile anzeigten. Selten sah ich meine Schwestern sitzen und ihr Schicksal beklagen. Wo immer Angebote zur Betätigung gemacht wurden oder auch nur erkennbar waren, nutzten sie diese. So ermöglichte mir die Arbeit einer meiner Schwestern als Küchengehilfin im dänischen Flüchtlingslager, hin und wieder das Lager zu verlassen – was für mich eine enorme Bedeutung hatte.
Der philosophische Spannungsbogen, der im zweiten Teil der Autobiographie aufgezeigt wird, hat eine ganz andere Dimension. Bei dieser Fortsetzung des autobiographischen Berichts, der zum Nachdenken über das eigene Leben anregen sollte, ist eine entscheidende Frage: Welches sind meine bestimmenden Erkenntnisinteressen und auf welche Gegenstände richten sie sich? Bedenke ich das Ausmaß an Energie, Ausdauer und Arbeitskraft, mit denen ich jahrzehntelang immer wieder an denselben Baustellen experimentiert habe, dann lässt sich unschwer ein großer geistesgeschichtlicher Bogen spannen: von Kant bis Marx. Philosophischer ausgedrückt: Es geht um Genesis und Geltung, um Sein und Sollen. Das sind aber traditionelle Formeln und Symbole, die an Heidegger erinnern oder an Erich Fromm (Sein und Haben). Mir geht es jedoch um die erfahrungsbezogene Ausfüllung dieses gewaltigen Spannungsbogens zwischen Kant und Marx: Wie konstituiert sich das Allgemeine durch das Besondere? Die Sache ist kompliziert und vertrackt. In der kantischen Moralphilosophie sind die Individuen und das Allgemeine direkt miteinander verknüpft. »Handle so, dass die höchst individuelle Maxime deines Wollens jederzeit allgemeines Gesetz werden kann«, bedeutet, dass ich das Allgemeine in meine Individualität aufnehme. Indem ich so handle, wie Kant es vorsieht, bin ich ein allgemeines Individuum geworden, um nicht zu sagen: das Prinzip der Individualität, das mit autonomer Macht angefüllt ist. »Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir«4, wie es die Schlusspassage der Kritik der praktischen Vernunft ausdrückt, erfordern fortwährende Bewunderung, ja Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Aber wie sind sie in der Alltagsphilosophie der Menschen konkret miteinander vermittelt? Das autonome Individuum kennt keine Vermittlungsebenen. Moralität kennt keine Kompromisse. Der kategorische Imperativ steckt als Motiv des Handelns in jedem Menschen. Bei Marx ist es umgekehrt; der Zwang der Verhältnisse und die sich daran entzündende Empörung bringen die Menschen dazu, sich zu wehren und gegen ihr Elend zu kämpfen. Es gibt bei Marx so etwas wie den Bildungswert des Elends. Auch bei ihm fehlt jedoch jene Ebene, auf der ein Mensch mit begrifflichen und sonstigen Möglichkeiten, sich kollektiv zu wehren, ausgestattet wird. Bei beiden Denkern gibt es keine politische Psychologie. Es sind zwei Abstraktionen, die sich gegenüberstehen. Hegel versucht eine Vermittlung. Dialektik ist dabei ein wesentlicher Punkt.
Wollte man nun den zweiten Teil meiner autobiographischen Spurensuche auf einen Zentralbegriff bringen, dann müsste ich alle Mühe darauf richten, einer beschädigten Denkweise wieder Reflexionsraum zu sichern, die einst dies geistige Geschehen maßgeblich prägte: der Dialektik. Von Ernst Bloch stammt der Satz, der Kapitalismus in seiner entfalteten Gestalt erzeuge keine Ambivalenzen. Das ist ein Irrtum! Nur Ambivalenzen halten ihn am Leben. Dialektisches Denken ist inhaltsvolles Denken, das gerade das Aufdecken solcher Ambivalenzen und Widersprüche zum leitenden Motiv hat. Es folgt der Erfahrungsspur der Verhältnisse, und seit Platon wird ein auf Zusammenhang gehendes Denken mit der Dialektik verknüpft. Wo die Dialektik zu einem klappernden Argumentationsskelett wird, hört das lebendige Denken jedoch auf. Beispielhaft führt Adorno in den Noten zur Literatur an der Lyrik Eichendorffs vor, was er unter dialektischem Denken, dem reinen Zusehen gegenüber der Selbstentwicklung der Sache, versteht. Erst die Vertiefung in das Subjekt macht das Gesellschaftliche kenntlich. Immer wieder: Die Vertiefung ins Subjekt, die Versenkung in den Gegenstand, ins Besondere, treibt das Gesellschaftlich-Allgemeine hervor. Dialektik spricht aus, dass philosophische Erkenntnis nicht dort zu Hause ist, wo das Herkommen sie ansiedelt: im toten Schema eines wiederholbaren Dreiklangs.
Teile dieser autobiographischen Spurensuche gliedern sich nach Erfahrungszentren und Handlungsfeldern, die sich nur schwer einer chronologischen Anordnung fügen. Ein Zusammenhang stellt sich zwar dadurch her, dass ich es bin, der an diesen Erfahrungszentren beteiligt ist, aber Einzelkausalitäten zwischen den konkreten Erfahrungen lassen sich nur schwer ausmachen; Adornos Erfahrungsbegriff deckt empirische Sozialforschung genauso ab wie das, was er metaphysische Erfahrung nennt. Der Zeitverlauf ist unterbrochen. Es entsteht der Eindruck von Gleichzeitigkeit der Ereignisse oder das Gegenteil: periodische Ungleichzeitigkeit der Entwicklung. Das betrifft auch die Veränderung in der Beziehung zwischen Privatem und Öffentlichem, das Politische lässt sich immer schwerer institutionell identifizieren. Es ist charakteristisch für dieses am Ende um Marx und einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz organisierte Buch, dass ich die Chronologie der Ereignisse sprenge. Gleichwohl kann dieser Band als zweiter Teil meiner Autobiographie gelesen werden.
Was kennzeichnet die geistige Situation der Zeit, um diesen Begriff von Karl Jaspers hier zu verwenden? Die Denkpositionen sind klar polarisiert; Links und Rechts bezeichnen Wegmarkierungen, die den Suchenden auf radikal verschiedene Wege verweisen, die ihre ganz eigene Symbolwelt haben. Alles was sich im sozialistischen Begriffshorizont bewegt, verbindet mit der Kritik des Bestehenden die Aussicht auf Veränderung, im Grunde auf die Neukonstitution der Gesellschaft. Da sind jetzt noch Unterschiede in der Radikalität dieser Neukonstitution festzumachen, aber das geistige Milieu enthält auf allen Stufen ein Plädoyer für das Neue.
Ich muss gestehen, dass mir die Atmosphäre im Frankfurter SDS, als ich in diesem sozialistischen Verband Fuß zu fassen versuchte, etwas fremdartig vorkam. Hätte ich die Einzelnen befragt, was sie in diesem Verband suchen, wäre mit Sicherheit prompt die Antwort gekommen: »Wir erstreben eine sozialistische Gesellschaft.« Das war nun selbst im Frankfurter SDS ein sehr weites Spektrum. Es reichte von vorstandstreuen Positionen (damals SPD-Orientierungen) über Formen des ethischen Sozialismus bis zu radikalen marxistischen Positionen. Aber Sozialist wollte jeder sein. Warum eigentlich? Die Mitglieder waren überwiegend Bürgerkinder. Im Frankfurter SDS gab es zwei Ausnahmen: Alfred Schmidt war Arbeitersohn, ich kam vom Bauernhof. Wollte man dieselbe Frage an Leute, die sich als links verstehen, heute stellen, würde man kaum eine positive oder gar eindeutige Antwort bekommen. Das ist der Hintergrund des Ausblicks auf Marx am Ende des Buchs.
III
Verständlich wird das, wenn wir uns bewusst werden, in welcher Krise wir leben. Ich spreche von einer kulturellen Erosionskrise. Alte Normen, Verpflichtungen, Haltungen, Grundsätze gelten nicht mehr unbesehen, können deshalb der jüngeren Generation auch nicht mit großer Überzeugungskraft vermittelt werden. Es gibt sie aber noch. So entsteht eine Zwischenwelt, die Émile Durkheim als einen anomischen Zustand beschreibt; alte Regeln und Haltungen sind ausgehöhlt. Tendenzen zeichnen sich ab und verweisen auf neue Orientierungen, ihnen fehlt aber noch die Realitätsmacht einer zweifelsfreien Zuordnung. Das Neue wird gesucht; man kann das gegenwärtige Zeitalter als eines der intensiven kulturellen Suchbewegungen bezeichnen. Was können die Alten dazu beitragen, dass diese Suchbewegung nicht in die Irre führt? Ich bin der Überzeugung: sehr viel! In allen Handlungsfeldern, die eines Ackerbaus der Vernunft bedürfen, kann die Generation derer, die Diktatur, Krieg, Flucht oder Vertreibung überlebt haben, erheblich zur Aufklärung über den Nutzen von Demokratie und individueller Freiheit, über die Richtung von Lernprozessen und menschlicher Gestaltung der Lebensverhältnisse beitragen.
Das gegenwärtige Herrschaftssystem, das die Prinzipien der Warenproduktion bis in die letzten Winkel des Körpers und der Seele getrieben hat, zehrt von der Störung der Balance. Der Historiker Eric Hobsbawm hat aus guten Grund vom »Zeitalter der Extreme« gesprochen; das ist ein milder Ausdruck für die Gebrochenheit der Maßverhältnisse, wie sie heute auftritt. Eine totalisierende Warenproduktion, die fortwährend auf Neues setzt, zerstört jenen Boden kultureller Produktion, die gleichgewichtig von Erfahrung, Bindung und Erinnerung lebt. Wenn ich diese drei menschlichen Existenzialien für meine eigene Biographie zulasse, dann ist es mir unmöglich, anders zu denken und zu handeln, als auf der Linie einer Friedensordnung, die die demokratischen Bedürfnisse ebenso wie die Emanzipationskraft der Menschen einbezieht. Ein friedensfähiges Europa ist deshalb für mich kein bloßes Postulat, sondern ein aus Erfahrung gewachsener kategorischer Imperativ, der gerade anlässlich der bedrohlichen Entwicklungen in Europa wach gehalten werden muss – auch durch Erfahrungen, Bindungen und Erinnerungen.
Hannover, Herbst 2018
Oskar Negt
SUCHBEWEGUNGEN UND ORTSBESTIMMUNG
Der Altersblick
Überprüft man die Suchbewegungen, zufälligen Begegnungen, weitschweifigen Assoziationen, die ich zu meinem Leben gesammelt habe, auf Inhalt und Tendenz, dann wird man unschwer feststellen können, wie uneinheitlich die Blicke des Achtzigjährigen auf vergangene Wünsche, Hoffnungen, Bedürfnisse sind, wenn er sich ein Gesamtbild machen will. Die Hilflosigkeit, mit der ich Stoff und Gedanken für die Spurensuche im Erwachsenenleben einsammelte, hat mir nahestehende Menschen und wohlwollende Kritiker zutiefst irritiert. Die ausgebreiteten Materialien machten häufig den Eindruck einer organisierten Anarchie. Man müsse doch erst einmal eine strategische Linie formulieren, die es ermöglicht, Tatbestände, Berichte, Erinnerungen zu sortieren. Genau das ist es, was fehlt. Nimmt man aber diesen gut gemeinten Vorschlag auf und versucht, ihn umzusetzen, dann bemerkt man schnell, dass dies nicht so umstandslos und einfach umzusetzen ist, wie es ein formalisiertes Konzeptpapier vorsieht. Aus Verlegenheit, den roten Faden nicht sichtbar machen zu können, habe ich immer neue Textvarianten produziert. Diese Textvariationen, im Einzelnen weiterverfolgt, hätten Ansätze für spezifische Essays sein können, aber sie hatten nichts zu tun mit dem Hauptzweck dieses Buchs: der Abfassung einer autobiographischen Schrift.
Je mehr ich mich vertiefte und mich zu wiederholen drohte, desto stärker wurde mir bewusst, wie wenig ich im Zuge meiner lebenslangen Schreibarbeit und der ausgiebigen Vortragstätigkeit von meiner Person preisgegeben habe. Über Neigungen, Bedürfnisse, Ansprüche, also jenen Bereich individueller Charaktereigenschaften, habe ich weitgehend geschwiegen. Das scheint in einem krassen Widerspruch zu meiner Tätigkeit zu stehen, in der ich die Öffentlichkeit nie gemieden habe.
Auf Motivsuche
Um einen tragfähigen Prozess des autobiographischen Schreibens in Gang zu bringen, schließt die Motivsuche verschiedene Erweiterungen und Gewichtungen von Theorien und die Überprüfung ihres Gebrauchswerts für meine Zwecke ein. Auf der Suche nach einer verlässlichen und glaubwürdigen Theorie der Gesellschaft, die mir Handlungsmöglichkeiten anbot, ohne sie auf technisch-didaktische Strategien der Umsetzung zu reduzieren, lagen Auseinandersetzungen mit Marx und den Grundpositionen der Frankfurter Schule nahe. Indem ich mir aber vor Augen hielt, wie viel Zeit ich aufgewendet habe, Praktiker oder Philosophen der Linken in meine Betrachtungen einzuschließen, muss doch mehr dahintergesteckt haben als das individuelle Bildungsbedürfnis. Als Sozialist, der ich sein wollte, hatte ich den Imperativ im Kopf, mich niemals auf die bloße Interpretation der Welt zu beschränken, sondern zu deren Veränderung beizutragen. Die elfte Feuerbach-These war mir zu einer fixen Idee geworden: »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt drauf an, sie zu verändern.«5 Deshalb stellte ich schon sehr früh die Frage, wie eine Theorie auszusehen hätte, die beide Bedürfnisse angemessen erfüllt: die Interpretation der Welt mit der Perspektive der Veränderung. Als Schüler der Adorno’schen Dialektik sollte es mir nicht schwerfallen, einen Ausweg aus diesem Dilemma zu finden. So war es aber nicht.
Adornos Satz, Theorie selber sei eine Form der Praxis, konnte mich nicht befriedigen. Je weiter ich die sozialistische Theoriebildung mit ihren Praxiskonzepten entwickelte, umso deutlicher wurden mir die Grenzen der herkömmlich definierten Frankfurter Schule. Ich begann mit einem intensiven Studium politischer Leitfiguren der sozialistischen Bewegung, die mir immer näher rückten, je entschiedener die jeweils spezifische Logik des Handelns und der Begriffsbildung entwickelt wurden. Dabei achtete ich weniger auf die Resultate, die Darstellungsformen dieser Theorien, als vielmehr auf den Produktionsprozess des Wissens und der Grundlagen des Handelns. Diese spezifischen Erweiterungen der kritischen Theorie eröffnen Handlungsfelder, welche den ursprünglichen philosophischen Ansatz bewahren und gleichzeitig um bisher ausgegrenzte Theorietraditionen erweitern. In dieser erfahrungserweiterten Dimension der kritischen Theorie haben auch Denkformen wie die des frühen Georg Lukács oder die von Karl Korsch ihren Platz.
Wenn heute verstärkt der Gedanke auftaucht, auch die linken Erbschaften aufzuarbeiten, die des guten Willens mit ihren ungewollten Nebenfolgen ebenso wie die des Machtmissbrauchs und der menschenverachtenden Strategien, dann ist mit dieser Idee ein Projekt verknüpft, das man als Phänomenologie des Marxismus bezeichnen kann. Lernprozesse in dieser geschichtlichen Dimension lassen sich nur noch in Gang setzen, wenn es um die Konstitution der gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse menschlicher Einrichtungen geht. So sehr der Adorno’sche Satz von der Unwahrheit des Ganzen berechtigt sein mag (er war ja auf die Allmachtsvorstellungen des Idealismus gemünzt), sobald es um den Begriff einer vernünftigen Organisation der Gesellschaft geht, kommt das Ganze doch wieder ins Spiel. Gerade dafür sind vereinseitigte philosophische Schulbildungen institutionell befestigte Irrtümer. Der dogmatische Eifer zerstört jede Wahrheitssuche. Die durch Macht verzerrten Resultate von Denkbewegungen sind keine Bausteine einer vernünftigen Einrichtung der Gesellschaft.
Bei meinen Versuchen, eine Theorie zu begründen, die gesellschaftliche Prozesse begreifbar macht und gleichzeitig Anleitung zum Handeln ist, bin ich in vielfacher Weise auf Positionen gestoßen, die bei näherem Hinsehen deutlich Motive enthüllen, die im Begriff des revolutionären Prozesses enthalten sein müssen, wenn er gelingen soll. Ich habe mir in der Auseinandersetzung mit marxistisch orientierten Theorien oft die Frage gestellt, warum ich mich so intensiv mit bestimmten politischen Positionen oder Philosophen auseinandersetzte. Was sind die Gründe dafür, dass ich mich mit Rosa Luxemburg befasst habe oder mit Karl Korsch? Es ist kaum anzunehmen, dass es sich dabei um Spezialprobleme handelt, deren Lösung ich bei den jeweiligen Autoren zu finden hoffte. Immer ging es um die Denkweise und die philosophische Haltung gegenüber den Dingen und den Entwicklungsprozessen; es war stets eine Art Ethik des Intellektuellen, die ich mit diesen Sozialisten verknüpfte. Ich stellte mir die Frage: Was eigentlich unterscheidet Adornos Denkweise von der Rosa Luxemburgs, wenn man die Verschiedenartigkeit der geschichtlichen Kampfsituation in Betracht zieht?
Wie stark der Druck auf einem lastet, in den herkömmlichen Linien der Abgrenzung zu denken und die krummen Wege zu vermeiden, konnte ich daran ablesen, wie schwer es mir fiel, bestimmte Theorien unbeachtet zu lassen. In einer autobiographischen Schrift mag es zulässig sein, diesen Schritt der Integration zu wagen; ich berücksichtige deshalb Texte einer Reihe origineller Denker der politischen Philosophie, die den gleichen Geist atmen wie die Ursprungstexte der kritischen Theorie. Für mich gehören Denker, politische Menschen wie Rosa Luxemburg, der frühe Lukács, Karl Korsch, Lelio Basso und andere zur Frankfurter Schule, wie ich sie verstehe, weil sie sich in ihren Denkstilen ähneln.
Es ist erstaunlich, was einem so alles durch den Kopf geht, nachdem die Entwicklung vollzogen ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen, die eigene Person als Beziehungsgeflecht zu verstehen, und am Ende daraus ein Buch zu machen. Ich öffne den Assoziationshorizont sehr weit.
Exterritoriale Distanz – Einladung nach Wien
Um im Rückblick auf die eigene Lebensgeschichte Situationen wieder lebendig werden zu lassen, die in den Alltagserinnerungen verloren gegangen sind, bedarf es der Verfremdung, einer gleichsam exterritorialen Distanz. 2014 erhielt ich eine Einladung des Internationalen Forschungszentrums für Kulturwissenschaften (IFK) und der Kulturabteilung der Stadt Wien, mich für vier Monate als Gast dieser beiden Institutionen zu betrachten, ohne große Vortrags- oder sonstige Verpflichtungen. Sämtliche Kosten würden übernommen. Die Rede war von nur einem Vortrag im Wiener Rathaus im Rahmen der berühmten Wiener Vorlesungen. Ich empfand das als eine große Ehrung, die man in meinem Alter nicht ausschlagen darf. Meine Frau rief begeistert aus: »Das machen wir!« Da war es schon entschieden. Aber ich erschrak: Vier Monate allein in Wien?
Meine erste Reaktion auf den Brief des Direktors des IFK, an seinem Institut für vier Monate Forschungen zu betreiben – nach selbstgesetzter Methodik, ohne Lehrverpflichtungen –, war ein reserviertes Misstrauen: Meine Gefühle spalteten sich auf. Welche Absicht verfolgte Helmut Lethen – unbewusst, versteckt? Die zweite Reaktion bezog sich auf den Sinn eines solchen Forschungsaufenthalts. Ich bin kein Museumsmensch. Was sollte ich vier Monate in Wien? Es bedurfte der Überredungskunst meiner Frau, es zu versuchen. Ich reduzierte die Zeit auf drei Monate – und schon bei den Überlegungen zu einer Antwort schossen tausend Gedanken durch meinen Kopf, was ich mit diesem exterritorialen Zeitgewinn machen könne. Diese Assoziationen setzten kraftvolle Akzente, lange bevor sich das Arbeitspensum auf die autobiographische Spurensuche konzentrierte. Aber diese Assoziationen gehörten schon zum autobiographischen Schreiben.
Als ich mich im IFK vorstellte und im Gespräch mit Helmut Lethen, dem damaligen Direktor dieser Wissenschaftseinrichtung, andeutete, dass ich gerne ein Forschungsprojekt Autobiographie verfolgen würde, kam es zu einem Missverständnis: Ich dachte an ein abgetrenntes Forschungsprojekt, er an meine Autobiographie. Aus Höflichkeit wagte ich nicht zu widersprechen, als er große Zustimmung bekundete, und es war die Verabredung, dass neben den geringen Diskussionsverpflichtungen mit Doktoranden (genauer Junior und Senior Fellows) dieses Instituts nur diese Autobiographie als Arbeitsleistung von mir erwartet wurde. Vielfach erinnerte Erlebnisse und theoretische Zusammenhänge, die mit Lebensentscheidungen zu tun haben, hatte ich aufgezeichnet, aber nie in der Absicht einer systematischen öffentlichen Darstellung meines Lebens. Ich hatte eher an ein kleines Forschungsprojekt gedacht, das mit mir persönlich nichts zu tun hat.
Lösung aus der Klammer der Näheverhältnisse – Arbeitsplatz zwischen zwei Kirchen
Nun saß ich grübelnd in einer kleinen Suite in der Josefstadt, einem angenehmen Stadtteil Wiens, den ich schon ein bisschen erkundet hatte, und zermarterte mein Gehirn, um Stufe für Stufe mein Leben für eine Autobiographie zurechtzurücken. Meine Frau, die mich in den mir völlig fremden Single-Alltag eingeführt hatte, war gerade zum Flughafen abgereist. Ich hatte mich bemüht, meine kleine Hotelsuite in ein Arbeitszimmer umzuwandeln, hatte den Glastisch in die Mitte des Zimmers gerückt, sodass ich von allen Seiten an meine Papiere kommen und diktieren konnte. Zunächst wirkten die Taubengeräusche im Innenhof des Hotels störend, aber mit der Zeit fand ich selbst die Kabbeleien von Taubenpaaren, die versuchten, sich gegenseitig von der Dachrinne zu stoßen, als wohltuende Abwechslung – vielleicht auch, weil sie mich an unseren quicklebendigen Jack Russel Terrier Luis erinnerten.
Um keine Zeit zu verlieren und die drohende Leere gar nicht erst aufkommen zu lassen, setzte ich mich sofort hin und fing an zu diktieren, was wir in den fünf Tagen Gesprächen an Problemen einer Autobiographie auf den Tisch bekommen hatten. Denn die Autobiographie hat nicht nur die Dialoge mit meiner Frau aufgesogen; sie war auch die Kraftquelle beim Weitermachen. Als kompetente Interviewerin hatte sie schon während vieler Ferienaufenthalte mit einer unglaublichen Hartnäckigkeit in die in mir verankerte Abwehrschicht eingegriffen: Die Autobiographie sollte zur Information und zum Nachdenken dienen – Wissen für die nachkommende Generation.
Am nächsten Tag würde ich in das Institut gehen und meine Arbeitsmittel ausbreiten, die aus einem Diktiergerät, einigen leeren Kassetten, angespitzten Bleistiften, Schere und Prittstift bestanden. Die Arbeitsphase verteilte ich je nach Bedarf auf meine Unterkunft in der Laudongasse 8 im achten Bezirk der Josefstadt und das Institut in der Reichsratsstraße 17. Die Wegstrecke vom Hotel zum Arbeitsplatz organisierte sich sehr leicht zwischen den Kirchtürmen, denen der Dreifaltigkeitskirche, in deren Nähe ich wohnte, und denen der Votivkirche, auf die ich von meinem Arbeitsplatz blickte.
Ich hatte jetzt elf Arbeitswochen vor mir. In meiner schriftstellerischen Tätigkeit sind mir immer wieder Menschen begegnet, über die ich Portraits verfasst habe. Aber systematisch über mich selbst zu reflektieren und das für die Öffentlichkeit niederzuschreiben, ist mir nie in den Sinn gekommen – was Freunde und Freundinnen allseits als Mangel bekundeten. So war diese Art des subjektbezogenen Nachdenkens für mich ein völlig neuer Auftrag – vielleicht aber doch nicht ganz neu. Seit ich die Einladung nach Wien bekommen hatte, hatte ich schon einige Texte formuliert, die sich mit meiner Kindheit, der Flucht und dänischen Internierungslagern beschäftigen (Texte, die später in den ersten Teil der Autobiographie, Überlebensglück, einflossen). Aber die durchgängig organisierenden Gedanken einer solchen Autobiographie waren mir noch nicht klar geworden. Auch nicht die entscheidenden Bruchlinien. Und, was noch wichtiger ist: Der rote Faden fehlte.
Was ist eine geglückte Autobiographie? Ich habe mich beim Diktat in Wien immer wieder gefragt: Was könnte Leserinnen oder Leser an meinem Leben interessieren, was sie nicht schon aus den Medien oder meinen Schriften erfahren haben? Da es sich um eine Autobiographie handelt, würde ich die Daten, wann ich wo gewesen bin, zwar überprüfen, aber das ist nicht das Wesentliche des Berichts, den ich hier in Wien (und in den folgenden Jahren) formulierte. Wenn ich einmal die postmoderne Redeweise von den großen und kleinen Erzählungen zitieren darf, dann handelt es sich bei meinen Lebensberichten um kleine Erzählungen, aber eben doch um Erzählungen. Es geht also nicht um die Aufklärung von Umständen und Verhältnissen, die auf gesellschaftlichen und politischen Arbeitsfeldern standortgebunden sind; darüber habe ich genug geschrieben und öffentlich geredet. Vielmehr geht es mir in dieser Autobiographie darum, bestimmte Charakterprägungen, die gelebten Erfahrungen entspringen, öffentlich kenntlich zu machen. Es sind Erfahrungsspuren, die ich suche. Die Chancen, die mir das Wiener Schreibexil gewährte, lagen in einer merkwürdigen Verfremdung meiner Lebensgeschichte.
Erst als ich den Schritt wagte, mich neben mich zu stellen, also mich mir selbst zu entfremden, war ich imstande, eine Art Fließtext zu formulieren. Erst der Standpunkt, den ich als fremder Betrachter meiner eigenen Lebensgeschichte errungen hatte, ermöglichte mir, unbefangen zu schreiben und Geschichten zu erzählen. Wenn man sich aus der Klammer der Näheverhältnisse kaum zu lösen vermag, engt Scham die Lebensberichte nach Art eines inneren Zensors ein. Es ist die Distanz eines Beobachters nötig, der gewissermaßen als »Fremder« aufzeichnet und berichtet. Christen könnten von syneidēsis oder conscientia sprechen, einer Gewissensinstanz. Es ist etwas von dem enthalten, was Livius, laut Cicero der pater historiae, unter Geschichtsschreibung versteht – aufzeichnen und wiedergeben, was erzählt wird, oder genauer: erzählen, was erzählt wird. Das nimmt zwar diesem autobiographischen Erzählen die vom Primärautor ausgehende Zuspitzung der Verhältnisse, aber es ist reichhaltiger und unbefangener als das, was durch zahlreiche Prüfstellen gefiltert ist.
Fremdheit und Ankommen – Die Arbeitssituation
Die ersten Wochen in Wien waren mir sehr lang vorgekommen, vieles war mir fremd, auch hatte ich Probleme mit meinem Status im Institut. Die Einladung galt an sich ohne weitere Verpflichtungen, außer der Rede im Rathaus im Zusammenhang der Wiener Vorlesungen, die Christian Ehalt von der Kulturbehörde der Stadt seit über zehn Jahren organisiert. Aber innerlich hatte ich das Gefühl, dass ich mehr tun müsste als das, was offiziell erwartet wurde. Zwei Tage nach meiner Vorlesung im Wiener Rathaus hatte ich sogar eine Art Albtraum, was meine Situation am IFK betrifft. Die Atmosphäre war in diesem Traum sehr angespannt, mir wurde vorgeworfen, nur an einem Teil der Vortragssitzungen teilgenommen zu haben. Es war ein merkwürdig bedrückender Traum, der mich zu diesem Zeitpunkt umso mehr überraschte, als ich nun auf die Frage, wie es mir gehe, eindeutig positiv antwortete: Gerade sei ich dabei, mich hier aufgenommen zu fühlen.
Gegen Ende meiner Zeit in Wien war ich selbst überrascht, wie schnell dann doch die drei Monate vergangen waren, die ich als Gast des IFK verbringen durfte. In der letzten Phase meines Wien-Aufenthalts verspürte ich eine Sprachveränderung. Wenn ich angeben wollte, wo ich mich mit jemandem treffe oder wo ein Interview stattfinden sollte, bezeichnete ich den Ort des Treffens nicht mehr als Hotel, sondern als ein Zuhause: Treffen wir uns zu Hause.
Etwas Ähnliches könnte ich in Bezug auf das Institut sagen, in dem ich mich nur zeitweilig aufhielt. Als ich das erste Mal an einem Arbeitstag mein Zimmer aufsuchte, herrschte Totenstille in den Räumen, so als seien hier gar keine sprechenden und handelnden Menschen anwesend. Aber das war eine Täuschung. Durch die offenen Türen konnte man sehen, dass alle Räume besetzt waren. Ich nahm allerdings nur Schattenrisse wahr von Menschen, die bewegungslos vor ihren Computerbildschirmen saßen und keinen Blick davon abwendeten. Erst nach Tagen wagte ich, diese Totenstille zu durchbrechen, indem ich an einzelne Türen klopfte, um mich vorzustellen. Ich merkte aber, dass dieser Wunsch nach Begrüßung zwar sehr freundlich aufgenommen wurde, aber der Blick starr zum Bildschirm gerichtet blieb, und ich kürzte deshalb die Vorstellungsrunde ab. Nur einzelne Mitarbeiter gingen auf ein etwas längeres Gespräch ein; alle waren konzentriert beschäftigt.
Allmählich lockerte sich jedoch die Fremdheit der Situation. Immer wieder verwickelte ich mich mit meinem Arbeitsnachbarn Moshe, einem leidenschaftlichen Pessimisten, in Gespräche, die wir in radebrechendem Englisch führten. Dass die Dinge in der Regel schieflaufen, versuchte er mir nicht nur durch geschichtliche Beispiele zu beweisen, sondern auch durch alltägliche Vorkommnisse. Als ich ihm von einem Zoobesuch berichtete und erwähnte, dass der Eisbär einen Pfau gefressen hatte, bestätigte er mir sofort, dass das auch in der menschlichen Gesellschaft üblich sei: Fressen und Gefressenwerden scheine zur anthropologischen Grundausstattung zu gehören.
Die Zahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten, die Gesprächswünsche äußerten, wuchs mit der Zeit merklich. So schmolz gegen Ende das Eis. Als ich am 1. Juni 2014 aus meinem autobiographischen Bericht vortrug, hatte sich ein großer Teil der Junior Fellows versammelt. Ich las einige Passagen aus der Storchengeschichte, die ich später in den ersten Band der Autobiographie, Überlebensglück, aufgenommen habe.6 Sie stießen auf Begeisterung. Die Diskussion in diesem zum Abschied versammelten Kreis konzentrierte sich auf meine Bildungsgeschichte und die meiner Familie: Wie kam ein ostpreußischer Kleinbauer darauf, allen fünf Töchtern eine Berufsausbildung zu ermöglichen? Wie konnte ich, trotz Flucht, Internierung und Jahren ohne Schulbesuch, eine so erfolgreiche akademische Laufbahn einschlagen? Ich berichtete etwas ausführlicher über meinen Bildungsgang, der in bestimmenden Zügen unabhängig vom offiziellen Schulsystem verlief. Aber es waren auch andere Zeiten; man kann das nicht einfach auf unsere Verhältnisse übertragen. Ich fand nie einen vernünftigen Anschluss an die Leistungsstandards der offiziellen Schule, wollte aber ab einem bestimmten Alter gerne das Gymnasium besuchen, wollte Griechisch und Latein lernen, hatte jedoch praktisch keine Voraussetzungen dafür. Deshalb wurde ich in die Oberrealschule und – strafverschärfend – in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig geschickt. Es war ausgeschlossen, hier festen Boden unter die Füße zu bekommen.
Bei dieser Abschlussrunde mit den Junior Fellows hatte ich den Eindruck, dass einige traurig waren, als ich mich offiziell verabschiedete. Ich verließ das IFK mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Meine Hochachtung vor diesem Institut und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war von Woche zu Woche gewachsen.7 Auf meine Rede zu Europa im Wiener Rathaus habe ich viele Rückmeldungen bekommen, gerade von Stipendiatinnen und Stipendiaten. Die Reaktionen des IFK, der Presse, des Fernsehens und Rundfunks signalisierten mir, dass ich in Wien wahrgenommen worden war.8
Er dreht sich nicht um – Tierischer Eigensinn
Nachdem ich mit Vorträgen, Interviews und Diskussionen gesättigt war, hatte ich während meines Studienaufenthalts in Wien schon mehrmals daran gedacht, den Zoo zu besuchen, fand aber in meinen Reiseführern nicht einmal einen Hinweis darauf. Der junge Mann, den ich schließlich fragte, hielt eine Lobrede auf den Wiener Zoo, einen der ältesten der Welt, wie er sagte. Warum denn keine Hinweise darauf zu finden seien? Es heiße hier eben nicht Zoo, sondern Tiergarten – Tiergarten Schönbrunn. Er sei um 1730 eingerichtet worden, auf Wunsch von Maria Theresia, versteckt, aber großräumig als einheitlicher Bestandteil der Palastanlage.
Am nächsten Tag machte ich mich auf den Weg, fand den Tiergarten und stellte fest, dass er ebenso weiträumig angelegt ist wie die historischen Schlossbauten. Gleich am Eingang wird ein großer Panda angekündigt. Ich war erfreut, dieses Prachtexemplar unmittelbar vor mir zu sehen. Der Panda kehrte mir den Rücken zu, war aber zwischen zwei Baumstümpfen gut zu erkennen; bedächtig knabberte er an einem Bambusstab nach dem anderen. Ich war entschlossen zu warten, bis er sich umdreht. Den Wunsch teilte ich mit vielen Kindern, die sich hier versammelt hatten, um dieses »Kuscheltier« in wirklicher Größe zu sehen. Aber nichts passierte, Bambusstäbchen auf Bambusstäbchen wurde sorgfältig auseinandergenommen und irgendetwas daraus verzehrt. Ich dachte: Der muss sich doch irgendwann einmal umdrehen! Gab mir eine halbe Stunde. Als eine Dreiviertelstunde vergangen war und der Panda sich keinen Zentimeter bewegt hatte, verließ ich den privilegierten Beobachtungsposten und ging zu den Nilpferden. Unbeweglich standen die schweren Tiere neben dem Wasserbecken, sammelten Krümel für Krümel vom Boden auf und verzehrten sie; auch sie entzogen sich meinem Wunsch, sich zu rühren. Nach Beobachtung dieser Tiere verließ ich den Tiergarten Schönbrunn in nachdenklicher Stimmung. Ich erinnerte mich daran, dass ich eigentlich in allen größeren Städten, die ich besucht habe, wenn irgend möglich einen Zoo besuchte.
Was faszinierte mich im Tiergarten Schönbrunn an diesen Tieren, die angesichts meines aufdringlichen Wunsches, sie mögen sich bewegen und etwas vorführen, Haltung bewahrten? Gerade dann, wenn bei meinen Vorträgen Diskussionsturbulenzen entstanden, fühlte ich mich zu den Zoos und ihren Tieren hingezogen.9
Verschweigen möchte ich aber auch nicht, dass mich bei jüngsten Zoobesuchen immer stärker das beklemmende Gefühl ergriff, dass diese Tiere, obwohl versorgt, in ihrer Gefangenschaft doch entsetzlich leiden. Selbst für Tiere ist die Versorgung nur eine Seite ihres Lebens; der Bewegungsraum, die Grenzen, auf die sie stoßen, sind ein ebenso wesentlicher Aspekt.
Wollte man das, was ich an diesem Vormittag in Wien erlebt habe, auf eine kulturkritische Ebene heben, so könnte man sagen, dass diese Tiere mit einer demonstrativen Missachtung der Wünsche der Zoobesucher den Eigensinn der Natur ausdrücken wollten. Das ist aber gewiss eine unzulässige Verallgemeinerung dieser zwei Einzelsituationen. Irgendwann werden sie sich drehen oder bewegen, irgendwann wird das Flusspferd ins Wasser springen, der Pandabär den Bambusstab verlassen – aber nicht dann, wenn wir es wollen.
Offene Gedanken – Abschied von Wien
Es war der 28. Juni. Am nächsten Tag würde ich nach Hannover zurückfliegen; die drei Monate Wiener Schreibarbeit waren beendet. Ich hatte über eine ganze Reihe von Stadien meiner Lebensgeschichte in einer Weise nachgedacht wie zu keinem Zeitpunkt vorher. Meine diktierten Formulierungen waren so offen gehalten, dass es nicht zu einer kontinuierlichen Linie der Rechtfertigungen kommen kann. Jedenfalls wäre das ein Fehlgriff. Nach wie vor fehlte mir der organisierende Obertitel: Sind es Lebensberichte? Sind es Erzählungen aus meinen Leben? Kann man das, was ich niedergeschrieben habe, überhaupt als eine Autobiographie bezeichnen?
Nur nachträglich sieht es so aus, als stünde ein geheimer Plan im Hintergrund. Man könnte meinen, ich hätte immer die richtigen Leute getroffen, die mir Schritt für Schritt weiterhalfen, hätte sie vielleicht sogar ausdrücklich gesucht: Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas, Alexander Kluge, Hans Matthöfer, Michael Schumann, Herbert Marcuse und viele andere, zu denen ich freundschaftliche Beziehungen aufbauen konnte. Schon von Kindheit an sind mir, selbst in bedrohlichen und gefährlichen Situationen, auf der Flucht oder bei der Bombardierung der Festung Königsberg, die freundlichen und wohlwollenden Menschen entgegengekommen, haben mich großzügig gefördert und beschützt. Wie kommt eine Haltung zustande, in der jemand sagen kann, ihm sei die Welt nichts schuldig geblieben?
Über meine Familie
Wie sehr zwei meiner fünf Schwestern, Ruth und Ursel, diese Haltung schon in meiner Kindheit und Jugend prägten, erzähle ich im ersten Band meiner Autobiographie. Nicht zuletzt ihnen ist es zu verdanken, dass ich die Erfahrungen der Kindheitsjahre auf der Flucht und in den Internierungslagern mit dem Titel Überlebensglück überschreiben kann.10
Ich kann nicht sagen, dass meine Ursprungsfamilie eine einheitliche Frontstellung einnahm, wie bei manchen Widerstandskämpfern, die sich der Kommunistischen Partei zugehörig fühlten. Mein Vater war seit Jahrzehnten Sozialdemokrat; er wurde es immer mehr. Mein fünf Jahre älterer Bruder war ein Schwerstarbeiter mit großem Verantwortungsgefühl für das Wohlergehen des Betriebs, von dem er sprach, als sei er der Eigentümer. Über die Gewerkschaften hatte er bei Tischgesprächen in der Familie nur Abfälliges zu berichten. In einer Straßenbaufirma in der Nähe von Gütersloh hatte er es zu einer Art Vorarbeiter gebracht. Häufig schlief er in den Baugruben, um sie zu bewachen und die Geräte vor Diebstahl zu schützen. Wenn man heute von grenzenloser Selbstausbeutung spricht, könnte man diese Ideologie auch schon bei meinem Bruder finden. Er behandelte die Teerwalze, die er bediente, wie sein kostbarstes Gut. Sein Tod durch Lungenkrebs wurde jedoch von den Behörden nicht als berufsbedingt anerkannt – ein besonders tragisches Moment am Lebensende meines über die Maßen fleißigen Bruders.
Meine Mutter verfolgte eine strikte Familienpolitik. Sie gab sich nach außen hin politisch neutral. Im Grunde ihres Herzens waren alle ihre Entscheidungen auf Sicherung des familiären Lebenszusammenhangs gerichtet. Sie wusste, wie gefährlich die Flugblätter waren, die der Dorfschmied, ein alter Kommunist, in der Zeit des Nationalsozialismus immer wieder über den Zaun unseres ostpreußischen Hofes warf. Sie sammelte alle sorgfältig ein und verbrannte sie. Sie brachte den Mut auf, nach dem Polenfeldzug Hermann Göring zu schreiben und darauf hinzuweisen, dass nunmehr der Krieg zu Ende sei und die Ernte eingebracht werden müsse. Vier Wochen später wurde mein Vater aus dem Dienst entlassen. Ich bin nicht sicher, ob meine Mutter nicht tatsächlich glaubte, ihr Brief an den Reichsmarschall habe diese Entlassung bewirkt; es ist unwahrscheinlich, aber nicht völlig auszuschließen. Das Lebenswerk meiner Mutter bedürfte einer eigenen Darstellung. Zwei Bauernhöfe hatte sie aufgebaut und verloren – einen in Ostpreußen und einen nach dem Zweiten Weltkrieg nahe Berlin. Das war genug. Als das niedersächsische Landwirtschaftsministerium meinen Eltern nach der Flucht aus der DDR erneut einen Hof anbot, sagten beide entschlossen: Nein! Nicht noch einmal! Sie arbeiteten lieber bei Bauern in Großenkneten in der Nähe Oldenburgs, bis sie nach Gütersloh umzogen. Der Bruder meines Vaters, Vorarbeiter in dem Hartpappenwerk »Wirus«, lockte nach und nach alle Verwandten nach Gütersloh. Auch ich war als Werkstudent in diesem Betrieb tätig. Mein Vater arbeitete in einem kleinen Holz verarbeitenden Betrieb, in dem er sofort einen Betriebsrat bildete, der sich äußerst produktiv auf das Unternehmen auswirkte.
Viele Jahre war mein Vater SPD-Abgeordneter im Stadtrat von Gütersloh. Über den Bauausschuss hatte er großen Einfluss auf die Industriepolitik der Stadt und die Ansiedlung von Kaufhäusern. Bei seiner Aktivität wäre es wohl gut möglich gewesen, eine Beamtenstelle zu erlangen. Er wollte es nicht. Als Nicht-Studierter hat er es sich auch nicht zugetraut; darüber haben wir immer wieder geredet. In den innerparteilichen Frontstellungen der SPD bezog mein Vater eine Linksposition, die auf der Linie von Peter von Oertzen und Wolfgang Abendroth lag. Die »Abschaffung des Zwischenhandels«, wie Heinrich Deist das nannte, und die Liquidierung der marxistischen Traditionsbestände – diese Zielrichtung des Godesberger Programms empfand mein Vater als ruinös für die Partei. Da gab es keine Meinungsverschiedenheit zwischen uns. Ich hatte meinem Vater versprochen, am 1. August 1954, an meinem zwanzigsten Geburtstag, in die Partei einzutreten. Ob ich genau an diesem Tag dieses Versprechen eingelöst habe, weiß ich nicht. Nachträgliche Erinnerungshinweise lassen vermuten, dass der Parteieintritt mit einer Art feierlichem Ritual verknüpft war.
Sein Leben lang war mein Vater verlässlicher Parteisoldat. Zuweilen haderte er mit dieser Partei, zum Beispiel bei der von ihm als zu schwach betrachteten Politik gegen die Notstandsgesetze und bei der Ostpolitik Willy Brandts. Aber er kündigte nie seine Loyalität auf. Am deutlichsten zeigte sich das in seiner Kritik von Brandts Ostpolitik. Den Verlust der Ostgebiete völkerrechtlich zu legalisieren, widerstrebte völlig dem innerlichen Heimatgefühl meines Vaters. Mit zunehmendem Alter wuchs die Zahl der Erinnerungsstücke an das ostpreußische Kapkeim, die die Wohnzimmerwände schmückten – und zum Leidwesen meiner Mutter immer mehr Raum ergriffen. Diese ostpreußische Symbolwelt wurde übrigens ergänzt durch die Dokumente meines Bildungswegs: eingerahmt das Abiturzeugnis (alles andere als ein Glanzstück) und später die Berufungsurkunde auf den Lehrstuhl in Hannover mit der Unterschrift des von meinem Vater sehr verehrten Peter von Oertzen, der mir im Amt des Kultusministers den Lehrstuhl für Sozialwissenschaften angeboten hatte. Diese Dokumente »auszustellen«, war Ausdruck des Vaterstolzes. Seine Kritik der sozialdemokratischen Ostpolitik hinderte ihn jedoch nicht, ganze Straßenzüge, die von Ostflüchtlingen bewohnt wurden, bei Kommunalwahlen für die SPD zu organisieren. Da er die Leute besuchte und mit ihnen diskutierte, erreichte er am Ende ein Wahlergebnis, das den DDR-Fälschungen nahe kam: 95 Prozent oder mehr für die SPD. Als Höhepunkt seiner SPD-Karriere betrachtete er, mittlerweile Alterspräsident des Gütersloher Stadtparlaments, die öffentliche Vereidigung des Oberbürgermeisters (der Mitglied der CDU war).
Nachholende Bildung – Lebensbegleitendes Grundstudium
Neben den persönlichen Erfahrungen und Begegnungen war und blieb bei meinen Suchbewegungen das Buch das Objekt der erfahrbaren Gegenstandswelt, das meine Phantasie am intensivsten fesselte. Das klingt reichlich geschwollen, trifft aber den entscheidenden Punkt eines Bildungsprozesses, der ganz auf nachholende Aneignung von Wissen gerichtet war. Im ersten Teil meiner Autobiographie, Überlebensglück, habe ich schon berichtet, dass ich gegen Naturalien, die unser Bauernhof bot, Meyers Konversationslexikon in 16 Bänden (Leipzig/Wien, Bibliographisches Institut 1890) und Schlossers Weltgeschichte (Original Volksausgabe, 23. Gesamtauflage, Berlin, Verlag von Oswald Seehagen 1892) eingetauscht hatte. Diese Entwicklung setzte sich fort mit Überlegungen, was von dem gewaltigen Gesamtvorrat an Wissen unbedingt gelernt werden muss. Gut nachvollziehen konnte ich Fausts bittere Klage, es verbrenne ihm schier das Herz, dass wir nicht alles wissen können. Aber was ist wichtig zu wissen? Ganz einfach: Die bekannten klassischen Texte.
In der Literatur fing ich an, Goethe systematisch zu lesen, von Band 1 bis 32 in einer handlichen Werkausgabe. Zwar besuchte ich später während meines Studiums auch Germanistikvorlesungen über moderne Lyrik bei Walter Höllerer, aber das war der Neugierde auf den Dozenten geschuldet, nicht eigentlich der Sache. Weil ich ein Doppelstudium im Auge hatte, nämlich Philosophie und Soziologie, musste ich für mich entscheiden, was die Grundtexte in diesen Wissensgebieten sind. In der Soziologie schien es mir am sinnvollsten, dort zu beginnen, wo sie als Wissenschaft zum ersten Mal auftritt: bei Auguste Comte, bei Spencer, bei Durkheim und Max Weber. Da ich während meines gesamten Studiums selten in öffentlichen Büchereien oder Bibliotheken gearbeitet habe, aber auch nicht besonders viel Geld für den Ankauf von Büchern verfügbar hatte, beschränkte ich mich auf den Erwerb der Grundtexte in Philosophie und Soziologie. Auch das war schon ziemlich viel; Platos Politeia gehörte dazu, die Metaphysik des Aristoteles und seine Nikomachische Ethik. Eine große Lücke bildete die mittelalterliche philosophische Literatur. Eher kursorisch habe ich mich mit dem Thomismus beschäftigt; vor allem dann mit der über Avicenna und Averhoes vermittelten Aristoteles-Rezeption – In der Literatur fing ich an, Goethe systematisch zu lesen, von Band 1 bis 32 in einer handlichen Werkausgabe. Zwar besuchte ich später während meines Studiums auch Germanistikvorlesungen über moderne Lyrik bei Walter Höllerer, aber das war der Neugierde auf den Dozenten geschuldet, nicht eigentlich der Sache. Weil ich ein Doppelstudium im Auge hatte, nämlich Philosophie und Soziologie, musste ich für mich entscheiden, was die Grundtexte in diesen Wissensgebieten sind. In der Soziologie schien es mir am sinnvollsten, dort zu beginnen, wo sie als Wissenschaft zum ersten Mal auftritt: bei Auguste Comte, bei Spencer, bei Durkheim und Max Weber. Da ich während meines gesamten Studiums selten in öffentlichen Büchereien oder Bibliotheken gearbeitet habe, aber auch nicht besonders viel Geld für den Ankauf von Büchern verfügbar hatte, beschränkte ich mich auf den Erwerb der Grundtexte in Philosophie und Soziologie. Auch das war schon ziemlich viel; Platos Politeia gehörte dazu, die Metaphysik des Aristoteles und seine Nikomachische Ethik. Eine große Lücke bildete die mittelalterliche philosophische Literatur. Eher kursorisch habe ich mich mit dem Thomismus beschäftigt; vor allem dann mit der über Avicenna und Averhoes vermittelten Aristoteles-Rezeption –kurioserweise vermittelten zwei arabische Philosophen den Europäern die Schriften des Aristoteles. Dabei spielte der Thomist Joseph Pieper, ein Philosoph aus Münster, für mich eine bedeutende Vermittlungsrolle; über die Tugendlehren hat er die Tradition des aristotelisch zurechtgebogenen Thomismus in die moderne Welt hinüberretten wollen. Schon in der Oberstufe der Oldenburger Hindenburg-Schule hatte ich das Glück, einen Schüler Joseph Piepers zum Klassenlehrer zu haben, sodass die Deutschstunden immer mit tiefergehenden philosophischen Fragestellungen verknüpft waren.
Während meines Studiums las ich gründlich und immer wieder die griechischen Texte der Vorsokratiker und von Platon und Aristoteles. Mein philosophisches Hauptinteresse konzentrierte sich jedoch auf die Auseinandersetzung mit den Schriften des deutschen Idealismus, mit Kant, Fichte, Hegel, sowie dem frühen Marx. Immer wieder: Kritik der reinen Vernunft, die gesellschaftsphilosophischen Schriften Kants, Hegels Große Logik und die Phänomenologie des Geistes, Fichtes Wissenschaftslehre. Vielleicht war es einfach die drängende Orientierungsnot, die mich veranlasste, nach sicheren Fundamenten der Aufklärung und des Vernunftzeitalters zu suchen, dem ich von Jugend an mit einem gewissen Vernunftglauben anhing. Das ist bis heute so geblieben.
Bei jedem Problem, für dessen Lösung ich wissenschaftliche Anleitung suchte, gehörte der Rückgriff auf die Grundtexte der europäischen Philosophie zu einer Art spontaner Hinwendung. Schon zu Beginn meines Studiums hatte ich den Eindruck, man müsse, um an die Erkenntnisquellen zu kommen, eine Menge sekundärer Überlagerungen beiseiteschaffen. Ich habe das später die Palimpsest-Methode genannt, das Abkratzen der Überlagerungen, die das Original unkenntlich gemacht oder verzerrt haben. Ich hatte mir eine Art Grundstudium verordnet, um Boden unter die Füße zu bekommen, von dem aus ich auch größere Zusammenhänge entwickeln konnte, die jedoch nie den Legitimationsfaden überprüfbarer Erfahrungen und Erkenntnisse zerrissen haben. Dieses »Grundstudium« ist sehr weitreichend selbst in den spekulativen Verästelungen meiner Erkenntnisse noch spürbar.
Immer spielt in meiner Arbeit der Erfahrungszusammenhang, auf den ich mich stütze und der für mich eine Leitlinie der Sinnvermutung ist, eine entscheidende Rolle. Wenn ich mich in spekulativen Verbindungen zu verlieren drohe, stelle ich die Frage: Was haben Platon und Aristoteles darüber gedacht? Was Hegel oder Kant oder Marx? Max Weber und Freud? Ich befrage sie nicht, um mich von der weiteren Wahrheitssuche zu entlasten, sondern um den großen Denkern der Vergangenheit meinen Respekt zu zollen, bevor ich mich in als wahr geglaubten Spekulationen aufs Glatteis begebe. Aber diese Überprüfungen gehen stets nicht nur »nach oben«, zum Reflexionsvorrat der Philosophen, sondern auch »nach unten«, zu den Erfahrungen des Alltagslebens.
Angesichts der enormen Bedeutung dessen, was ich »lebensbegleitendes Grundstudium« nenne, kamen viele intellektuelle Vergnügungen, die sich bei jedem Denken und Lesen einstellen, zu kurz. Diese Zeitnot hat mich immer wieder irritiert, wenn ich mich auf die Lektüre großer Romane eingelassen habe. Dazu zählten Tolstois Krieg und Frieden, Dostojewskis Der Idiot, Musils Mann ohne Eigenschaften, der lange Zeit mein literarischer Leitfaden war, Goethes Wilhelm Meister, auch seine frühe Arbeit Wilhelm Meisters theatralische Sendung, einige Erzählungen von Kafka, Die Blechtrommel von Günter Grass. Es mag bei diesem »Zeitraub« durch die Lektüre von Romanen eine Rolle gespielt haben, dass ich sehr langsam lese und bei jedem Stolperstein anfange nachzugrübeln, was natürlich den Lesefluss beträchtlich behindert. Die klassischen Texte der philosophischen Tradition habe ich jedoch gründlich und immer wieder studiert.
FRANKFURTER LEHRJAHRE
Frühe Wissensaneignung – Regulierte Anarchie
Die Frau an der Garderobe des Oldenburger Museums rief mit lauter Stimme: »Fragen Sie doch den Herrn dort, der hat sich bisher sämtliche Vorträge angehört. Er wird wissen, ob der Vortrag von Martin Heidegger stattfindet oder nicht.« Ich erschrak etwas, denn der Finger wies eindeutig auf mich. Ein Besucher war aufgrund einer missverständlichen Zeitungsmeldung im Zweifel, ob der große Philosoph tatsächlich sprechen würde. Er hat gesprochen. Es war das Jahr 1954, ein Jahr vor meinem Abitur. Ich war an diesem Abend sehr aufgeregt. Es war zu dieser Zeit keineswegs unproblematisch, Heidegger zu einem Vortrag einzuladen, schon gar nicht am Heimatort seines bedeutendsten Rivalen, des liberalen Karl Jaspers. Ich saß in der zweiten oder dritten Reihe, also ziemlich weit vorne, als Heidegger sich gemächlichen Schrittes zum Rednerpult bewegte. Er erschien mir kleiner als auf den Bildern, die ich kannte. Entweder war das Rednerpult zu hoch eingestellt oder der Mann war so klein, wie ich es nicht vermutet hatte. Er war hinter dem Pult praktisch nicht zu sehen. Das machte auch nichts, weil er ohnehin Blickkontakt mit dem Publikum vermied.
Ich erzähle diese Begebenheit, weil ich nach Anhaltspunkten suche, wo der Name Adorno mir zum ersten Mal aufgefallen sein könnte. Zeitweilig genoss ich den Gedanken, Heidegger könnte ihn in diesem Vortrag erwähnt haben, der ein Hölderlin-Zitat als Titel trug: … und dichterisch wohnet der Mensch. Das ist aber unwahrscheinlich. Näher liegt die Vermutung, dass wir in der Klasse mit unserem Deutschlehrer über Heidegger und seine Kritiker gesprochen haben. Es gab auch Zeiten, in denen ich ziemlich sicher war, die Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno in der Oldenburger Stadtbibliothek ausgeliehen und gelesen zu haben. Aber auch das ist nicht besonders überzeugend. Die Nazis hatten die Bibliotheken von marxistischer Literatur und jüdischen Autoren mit fanatischer Gründlichkeit gesäubert.
Während die schöne Geschichte von der Garderobenfrau meine lückenlose Präsenz bei den »Göttinger Vorträgen« in Oldenburg bekundet, erinnere ich von vielen Vorträgen nur Versatzstücke, die mit meinem Leben oft gar nichts zu tun hatten. So sprach ein Professor Stich über moderne Methoden der chirurgischen Eingriffe, was mich wegen des Wortspiels mit seinem Namen belustigte, und ein Professor Kopfermann über die Elektronenschleuder. Es wäre zu schön gewesen, wenn Heidegger bei seinem Vortrag seinen schärfsten Kritiker erwähnt hätte: Adorno.
Warum ist das von Interesse? Wer möchte schon wissen, wann und wo ich in Berührung mit den Philosophen Horkheimer und Adorno gekommen bin? Warum hat mich Heidegger mit einem tiefsinnigen Vortrag nicht für seine Philosophie gewinnen können? Vieles in dieser Frühphase der Wissensaneignung macht den Eindruck einer regulierten Anarchie. Gerade Linien sind nur schwer erkennbar. Bildungsprozesse haben ihre eigene Entwicklungslogik, die nur selten planbar und mit Sicherheit von Erfolg gekrönt ist. Über lange Strecken können es Irrwege und Nebenpfade sein, die man in vollem Bewusstsein und gutem Glauben auf vernünftige Ziele beschreitet, ohne das Gefühl zu haben, in einer Sackgasse zu enden.
Fluchterfahrungen und Erkenntnissuche11
Wie kommt es zu Charakterprägungen, die sich durchhalten und einer Lebensgeschichte einen unverkennbaren Stempel aufdrücken? Ich wüsste nicht, wie man einen roten Faden konstruieren könnte von dem ostpreußischen Bauernhof, auf dem ich mich als Kind zehn Jahre tummelte, zum Studium bei Horkheimer und Adorno, die mich in eine Denkweise einführten, mit deren Erkenntniswerkzeugen ich mir eine lebenswürdige Welt erschloss. Es mag sein, dass die bitteren Erfahrungen während der Flucht dazu beigetragen haben, meine Aufmerksamkeit auf den gesellschaftlichen Zustand und die zerstörerischen Folgen des Krieges und des Faschismus zu konzentrieren. Es mag solche Verbindungen geben, aber sicher bin ich nicht. Von meinen beiden Schwestern hatte ich jedenfalls gelernt, meine Traumwelt auf die wechselnden Bedingungen zu beziehen, ohne sie zu opfern und in eine individuelle Leidensgeschichte einzugliedern.
Nachdem ich das Abitur mit einem Notendurchschnitt bestanden hatte, der leicht über dem erforderlichen Minimum lag, verspürte ich ein Gefühl der Erleichterung und der Freiheit, wie ich es selten vorher und bestimmt nicht nachher empfunden habe. Wäre ich nicht immer wieder auf verständnisvolle Förderer gestoßen, die ihr Lehramt nicht nur als Brotverdienst und bloße Wissensvermittlung betrachteten, sondern sich als wirkliche Erzieher, als Lehrer