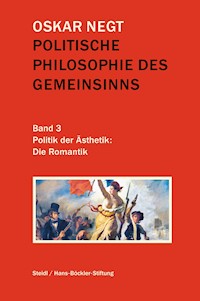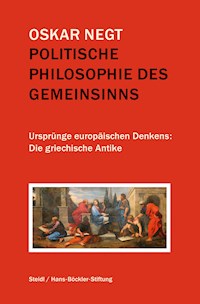Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Oskar Negt hat Glück gehabt. Sein Leben könnte als Erfolgsgeschichte erzählt werden: Als jüngstes von sieben Kindern auf einem Kleinbauernhof ohne Bildungsgüter im ostpreußischen Kapkeim aufgewachsen, wurde er zum Repräsentanten der Frankfurter Schule, zum anerkannten, in der ganzen Welt geehrten Philosophen und Soziologieprofessor. Doch Negts Kindheit und Jugend war von schmerzhaften Erfahrungen und Erlebnissen geprägt, von der Flucht mit zwei halbwüchsigen Schwestern in die »Totenstadt« Königsberg und über die Ostsee nach Dänemark, wo er jahrelang in Internierungslagern lebte bis die Familie nahe Ostberlin wieder zusammengeführt wurde. Und dann erneut flüchtete, diesmal Richtung Westen. Erst 1955, zehn Jahre nach dem Aufbruch aus Ostpreußen, fühlt er sich angekommen. Negt nimmt seine individuelle Geschichte zum Anlass, grundsätzliche Fragen zu stellen: über das autobiographische Schreiben, über gesellschaftliche Orientierung und persönliche Identität. Er will ergründen, was nötig ist, damit ungünstige Ausgangsbedingungen und traumatische Erfahrungen keinen lebenslangen Opferstatus fixieren. Seine autobiographische Spurensuche weist weit über das eigene Schicksal hinaus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
OSKAR NEGT
ÜBER
LEBENS
GLÜCK
VORWORT
Warum eine Autobiographie? – Annäherungen
Die Autobiographie ist eine literarische Form der individuellen Selbstentäußerung, in der das gelebte Leben die Schwerkraft der vergeblichen Mühe verliert; wer sich darauf einlässt, muss damit rechnen, dass die Verletzlichkeit wächst. Aber nur das Risiko, das geschützte Innere dem öffentlichen Urteil auszusetzen, verschafft dem Autor die Möglichkeit, auf jeder Stufe des Lebens die überschüssigen Kraftquellen zu bezeichnen, die in der Vergangenheit nicht genutzt wurden – vielleicht nicht genutzt werden konnten. Daran anzuknüpfen und unverdrossen weiterzumachen, wäre eine sinnvolle Zukunftsaufgabe einer autobiographischen Spurensuche.
Lange Zeit war ich der Überzeugung, dass eine Autobiographie nur verfassen kann, wer Gedanken und Erlebnisse kontinuierlich in Tagebucheinträgen festgehalten hat. Bei der Überprüfung der Materiallage für ein solches biographisches Unternehmen musste ich den betrüblichen Tatbestand zur Kenntnis nehmen, dass zerstreute Absichten erkennbar sind, Aufzeichnungen über Tageserlebnisse und einfallsreiche Gedanken gelegentlich mit Ort und Datum festgehalten wurden, was aber eben fehlt, ist das Regelmäßige. So konnte sich mit Gründen eine innere Abwehr gegen das Projekt Autobiographie entwickeln, weil alles Wissenswerte über meine Person in Interviews, Schriften, Reden ausgebreitet zu sein schien. Die Ankündigung meines Verlegers, eine umfangreiche Werkausgabe herauszubringen, hat meine Abwehr gegen ein Biographieprojekt, das nicht auf Archivarbeit beruht, zusätzlich bestärkt.
Es waren dann von außen kommende Anstöße, bekräftigt durch persönliche Ermutigungen, über bestimmte Phasen meines Lebens nachzudenken, die allmählich einen Sinneswandel bewirkten. Ausschlaggebend bei meiner Entscheidung, mich auf ein längeres Arbeitsprojekt »Autobiographie« einzulassen, war die Einladung Helmut Lethens, an dem von ihm geleiteten Internationalen Forschungszentrum Kultur (IFK) in Wien für vier Monate ohne besondere Verpflichtungen zu arbeiten. Nachdem ich die Zeit auf drei Monate reduziert und kleinere Aufgaben, wie einen Vortrag im Rahmen der Wiener Vorlesungen, verabredet hatte, sagte ich zu und schlug als Forschungsprojekt eine autobiographische Spurensuche vor. In der angenehmen Arbeitsatmosphäre des Instituts arbeitete ich drei Monate intensiv. Dem Institut, den Mitarbeitern und dem Leiter sei hier für die anregende Forschungsatmosphäre und die persönliche Freundschaft ausdrücklich gedankt.
Zu den Anregungen und Anstößen, die das Interesse an dem Biographieprojekt atmosphärisch bestimmten, trug auch der von Hans Werner Dannowski und mir gegründete Montagsgesprächskreis bei. Einzelne Mitglieder dieses Kreises haben verschiedene Fassungen des Manuskripts kritisch begleitet.
Die Gespräche, die ich mit meinen Schwestern Ruth, Ursel und Margot während des Arbeitsprozesses führen durfte, gehören zur Basisausstattung dieser Autobiographie. Vieles von dem, was ich längst vergessen oder überhaupt nicht unmittelbar erfahren hatte, haben ihre Erzählungen zutage gefördert. Ohne diese kombinierten »kleinen Erzählungen« hätte die autobiographische Spurensuche häufig in Sackgassen geendet.
Die ersten Gespräche über ein mögliches Biographieprojekt, das allerdings so überhaupt nicht genannt wurde, liegen weiter zurück. Es waren Feriengespräche im Haus von Alexander Kluge in Ligurien. Meine Abwehrhaltung spürend, die sie nicht akzeptierte, war die professionell geschulte Sozialpsychologin Christine Morgenroth, meine Frau, unentwegt darum bemüht, Schichten meiner Erinnerung aufzudecken, die vollständig getilgt waren. Wie produktiv das hermeneutische Verfahren ist, habe ich an ihrem bohrenden Eigensinn aus der Nähe erleben können. Danke auch dafür!
Hendrik Wallat schulde ich Dank für die zuverlässige Arbeit und die mit kritischem Blick zusammengetragenen und niedergeschriebenen Texte. Besonders hervorheben möchte ich das, weil die Art und Weise, wie ich arbeite, einen Kopf erforderlich macht, der die Übersicht behält.
Nachdem auf sehr verschiedenen Ebenen der Prozess des Aufdeckens und Bewusstmachens von Verzerrungen und Spaltungen einmal in Gang gekommen war, ließ er sich nicht mehr aufhalten, sondern weitete sich auch auf Lebensbereiche aus, die das Erwachsenendasein betrafen. Eine Archiv-Biographie, auf der Grundlage von Archivalien von einem Dritten verfasst, wird man an der Sorgfalt der Quellenarbeit messen; die Autobiographie ist ein viel sensibleres Gebilde; jeder Satz enthält eine Wertung, ist ein Wahrheitsversprechen. Deshalb spielen Glaubwürdigkeit und Aufrichtigkeit eine zentrale Rolle. Wo eine solche Biographie geglückt ist, hat sie die Lebensatmosphäre des Porträtierten erfasst, überzeugend dargestellt, hat sie eine Vertrauensbeziehung begründet. Zu dieser Vertrauensbeziehung gehört auch, dass Orientierungen nicht versprochen werden, wo es keine gibt.
Im Grunde sind es Stichworte, Erlebnisse und assoziative Gedanken, die hier zu einem geschriebenen Text zusammengefügt sind. Ich habe mir Mühe gegeben, die autobiographische Spurensuche nicht als einen isolierten Akt von kausalen Zuordnungen der Einzelereignisse zum gesellschaftlichen Gesamtgeschehen zu organisieren, sie vielmehr in die Atmosphäre der Zeit einzuordnen. Ich spreche von der geistigen Situation der Zeit als einem Orientierungsnotstand. Mit dieser Diagnose beginnt auch meine autobiographische Spurensuche. Indem ich die Zeitverhältnisse so charakterisiere, kann der Orientierungsnotstand als ein allgemeines kulturelles Problem besonders auch entwickelter Gesellschaftsordnungen betrachtet werden. Er hat aber existenzielle Bedeutung für unsere Gegenwart, wenn wir an die vielen Flüchtlinge denken, die aus ihren Heimatorten vertrieben werden, durch Krieg oder materielle Not, und die jetzt einen Ort suchen, der ihnen einen menschenwürdiges Dasein ermöglicht. Sie sind allemal Verfolgte ihres Elends, wie weitreichend auch definiert sein mag, worin die Motive ihrer Flucht bestehen.
Sobald das Stichwort »Flüchtlinge« fällt, bildet sich bei mir ein ganzer Kranz von Assoziationen, die auch meine eigene Lebensgeschichte betreffen. Vor mir liegt ein auf meinen Namen ausgestellter Ausweis für »Vertriebene und Flüchtlinge« Kategorie A, ausgestellt am 31.Oktober 1953 in Oldenburg. Auch der Lastenausgleich drängt sich in meine Assoziation mit dem Flüchtlingsdasein. Der Lastenausgleich, den meine Eltern für den Verlust ihres Hofes in Ostpreußen erhielten, hat es mir ermöglicht, zu studieren. Für die jüngeren Leserinnen und Leser bedarf es vielleicht einer kurzen Erinnerung: In der Bundesrepublik Deutschland gab es nach dem Zweiten Weltkrieg eine Art Vermögensausgleich zwischen den durch die Kriegs- und Nachkriegsereignisse – Vertreibung, Flucht, Evakuierung, Währungsreform – Geschädigten und denen, die ihren Besitzstand ganz oder überwiegend bewahrt hatten.
Die Assimilation und Integration der Millionen von Flüchtlingen aus Ostpreußen, Schlesien und anderen Gebieten war eine der größten sozialen und gesellschaftspolitischen Leistungen der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Einer der Gründe für die humane Flüchtlingspolitik in den späten 1940er und den 1950er Jahren war der Schuldenerlass. Der Marshallplan war ein Wiederaufbaugeschenk an die deutsche Nachkriegsgesellschaft des Westens – wenngleich diese Wiedergutmachung zweifellos auch dazu diente, Westdeutschland als Bollwerk gegen den Kommunismus in die Fronten des Kalten Krieges einzubinden.
»Überlebensstrategien« und »Überlebensglück« sind andere Stichworte, die ich mit meiner autobiographischen Spurensuche assoziiere. Was sind die Voraussetzungen dafür, dass manche Menschen die schlimmsten Situationen überleben und andere unter viel günstigeren Bedingungen zu Tode kommen oder für ihr Leben traumatisiert werden? Haben wir es dabei auch mit Subjektanteilen zu tun, die sich beschreiben lassen? Mit Verhaltensweisen, Denkformen, Begriffen, die das Erkenntnisinteresse auf Spuren leiten, die Auswege andeuten?
So überkreuzen sich Fragestellungen, deren Aktualitätsbezug kaum noch besonderer Betonung bedarf, mit Orientierungsbedürfnissen, die viel allgemeiner gefasst sind, weil sie die Identitätsproblematik einer Persönlichkeit berühren und gleichsam philosophische Anforderungen an das erkennende Subjekt stellen; in einer Autobiographie ist der rote Faden der Persönlichkeitsentwicklung schwerlich auf Lebensstufen zu reduzieren. Denn die lebendige Erfahrung des Nicht-Identischen im Subjekt selbst motiviert eine Art dialektischer Spannung zwischen dem Selbst und dem Anderen, die auf einem unaufhebbaren Wechselverhältnis beruht. In den Turbulenzen der Objektwelt mit sich identisch zu bleiben, ist eine Anstrengung, die sich praktisch nie erledigt.
Worin besteht der Persönlichkeitskern, der sich bildet und durchhält – ein Leben lang, ohne durch besondere Ereignisse beschädigt oder zerstört zu werden? Diese Frage hatte Goethe offenbar im Sinn, als er die Faust-Tragödie mit dem Prolog im Himmel beginnen ließ. Darin geht es um eine etwas einseitige Wette zwischen Gott und Mephisto, die Faust betrifft, eine Art Garantieerklärung für den Erhalt des Persönlichkeitskerns; die Prüfungen, denen Hiob ausgesetzt ist, sind wohl das Modell dafür. Der Herr sagt: »Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab, / Und führ’ ihn, kannst du ihn erfassen, / Auf deinem Wege mit herab, / Und steh’ beschämt, wenn du bekennen musst: / Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange / Ist sich des rechten Weges wohl bewusst.«[1] Hier liegt der Punkt, an dem sich eine Archiv-Biographie von der Autobiographie radikal unterscheidet.
Denn: Was ist der Urquell eines Menschen? Was von Faust am Ende des fünften Aktes übrig bleibt, ist nicht viel; es lässt sich gut die These vertreten, dass es Mephisto gelungen ist, diesen Geist von seinem Urquell abzuziehen – wenn man denn genauer wüsste, worin dieser Urquell besteht. Eine Autobiographie trägt immer auch Züge einer Selbsttherapie. Sollte es einen solchen Urquell im Sinne Goethes geben, zeichnet er sich jedenfalls nicht durch einen konstanten unzerstörbaren Kernbestand an fließenden Vorräten aus, sondern durch Lernprozesse, die auf lebendiger Erfahrung beruhen.
Habent sua fata libelli – Bücher haben ihre Schicksale: Das steht in jedem lateinischen Spruchwörterbuch, und jede Autorin, jeder Autor weiß, was das heißt. Häufig wird aber der Zusatz des Terentianus Maurus überlesen, der an den Leser und die Leserin gerichtet ist: pro lectoris. Den Lesern dieser Autobiographie wird auffallen, dass das gesamte erste Kapitel wenig biographische Auskünfte bietet, dagegen viele Überlegungen zum Sinngehalt einer Autobiographie und der gesellschaftlichen Verhältnisse, in die sie eingebunden ist.
Diese Autobiographie soll keine Sammlung in chronologischer Abfolge erzählter und zu Geschichten verdichteter Ereignisse sein. Vielmehr will sie eine Gesamtaussage wagen, wie jemand mit vergleichsweise ungünstigen bis traumatischen Erfahrungen in Kindheit und Jugend eine derartige Entwicklung nehmen konnte, die ihn dahin führte, wo er heute steht. Denn was sind die Ausgangsbedingungen? Leben in einem ostpreußischen Dorf, als letztes von sieben Kindern weitgehend mitgelaufen, keine Bildungsgüter in der Familie, weil immer die Arbeit im Mittelpunkt stehen musste – harte, körperlich schwere Arbeit, die gerade eben die Ernährung der Familie gewährleistete; dann Krieg – Flucht ohne Eltern mit zwei Schwestern, mehrfach tödlichen Gefahren ausgesetzt, durch einen Zugunfall verspätet in Königsberg angekommen, das zu diesem Zeitpunkt bereits von der Roten Armee eingeschlossen war – ein Ort, den man als »Totenstadt« bezeichnen kann. Dennoch gelang es, auf einem wenig vertrauenswürdigen Schiff zu entkommen – eine Fahrt, die nach Dänemark in ein Flüchtlingslager führte; dort fast drei Jahre ohne Schulunterricht. Dann glückliche Zusammenführung der Familie, Neustart mit einem der Bodenreform zu verdankenden Bauernhof in Falkensee Finkenkrug in der SBZ (in der Nähe von Berlin). Von dort erneute Flucht. Ende des Flüchtlingslebens 1955 in Oldenburg. Erst mit dem Abiturzeugnis in der Hand, diesem Erfolgsdokument der Integration, wagte ich die Behauptung: Das ist das Ende des Flüchtlingsdaseins! Wir schrieben das Jahr 1955 – zehn Jahre nach dem Aufbruch zur Flucht in Ostpreußen.
Wenn ein Mensch mit diesen Erfahrungen später Schwierigkeiten gehabt hätte – niemand würde sich wundern. Aber es sind hierbei nicht immer nur die Charakterprägungen, die für einen solchen Lebensweg entscheidend sind. Es sind vor allem die Tätigkeitsformen, die dazu beitragen, ob sich authentische Kohärenzgefühle entwickeln können oder Lernprozesse blockiert bleiben. Zufriedenheit entsteht dort, wo ich mit mir übereinstimme. Aber wo kann man mit sich übereinstimmen, wenn man als Flüchtling durch die Materialfelder des Krieges und der Gewalt, der Unterdrückung und der Erniedrigung hin und her geschoben wird? Wie groß ist der Spielraum der Autonomie, um überhaupt Entscheidungen treffen zu können? Die von dem Medizinsoziologen Aaron Antonovsky entwickelten drei Positionen und Kraftfelder, die für das Kohärenzgeschehen im Subjekt entscheidend sind – Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit – sind hoch besetzte kognitive Ansprüche. Alle drei Faktoren müssen beteiligt sein, damit ein solches Kohärenzgefühl die gesamte Gemütslage eines Menschen bestimmt.
Mit sich selbst übereinzustimmen, mit sich im Reinen zu sein, setzt allerdings eine eigentümliche Kraft des Subjekts voraus. Sie besteht in dem Willen, sich mit der Welt aktiv auseinanderzusetzen, ohne sie ständig mit Ansprüchen zu konfrontieren, die darauf hinaus laufen: Die Welt ist mir etwas schuldig geblieben. Wer davon ausgeht, verlässt den Standpunkt der Anklage nie. In der Sprache Kants heißt das: »Der Mensch kann nicht glücklich seyn, ohne wenn er sich selbst wegen seines Charakters Beyfall geben kann.«[2]
Dieser Beifall für sich selbst ist nur möglich, wenn der Mensch die spekulativen Ausfluchten meidet und seine Energien darauf richtet, die Phantasie von der Veränderung der Dinge in Handhabbarkeit umzusetzen; das setzt Sinnverständnis voraus und eine hohe Bedeutung der Dinge, die als veränderbar eingeschätzt werden, die sich also dem Veränderungswillen fügen könnten. Ein wichtiges Element einer solchen Kohärenz ist die pragmatische Überprüfung der Dinge durch Tätigkeit. Dies ist immer wieder der springende Punkt, an dem der spekulative Überhang seine Schranken findet: Bindekräften durch Arbeit, tätigen Umgang mit Menschen und Dingen, Bodenhaftung zu verschaffen – und damit verlässliche Orientierung.
Ich will mit dieser Autobiographie nicht eine Erfolgsgeschichte in den Techniken des Überlebens präsentieren. Mein Erkenntnisinteresse richtet sich vielmehr darauf, an meinem individuellen Fall kenntlich zu machen, welche Mechanismen mit im Spiel sind, wenn aus schmerzhaften Erfahrungen und schrecklichen Erlebnissen, die im Gedächtnis haften bleiben, nicht zwangsläufig Beschädigungen der Person erfolgen, die dazu beitragen, den Opferstatus lebenslang zu fixieren. Schon Anna Freud hatte in ihrer Analyse von Kriegskindern eine Komponente der Persönlichkeitsentwicklung benannt, die entscheidend dafür ist, ob Ängste der erwachsenen Personen auf die Kinder übertragen werden oder nicht. Wo verlässliche Beziehungen, Vertrauensverhältnisse zwischen Erwachsenen und Kindern existieren, müssen selbst schreckliche Erlebnisse nicht zwangsläufig die seelische Gesundheit beeinträchtigen.
Für Antonovsky bezeichnet Verstehbarkeit eine solide Fähigkeit, die Realität zu beurteilen – und eine Voraussetzung, widrige Umstände zu überleben: »Die Person mit einem hohen Ausmaß an Verstehbarkeit geht davon aus, dass Stimuli, denen sie in Zukunft begegnet, vorhersagbar sein werden, oder dass sie zumindest, sollten sie tatsächlich überraschend auftreten, eingeordnet und erklärt werden können. (…) Tod, Krieg und Versagen können eintreten, aber solch eine Person kann sie sich erklären. Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit des Überlebens, Deutung der Situation, in der man sich befindet – das alles sind Faktoren, die den Subjektanteil am Überleben bezeichnen.«[3]
Der Autor einer Autobiographie möchte mit der Darstellung seines Lebens wohl auch Lernprozesse anstoßen; die hohe Gewichtung der Ich-Anteile legt das nahe. Unter diesem Blickwinkel könnte ein autobiographischer Bericht helfen, subjektive und objektive Interessenkonstellationen zu unterscheiden. Mancher Dogmatismus, der Erstaunen und Unverständnis hervorruft, wenn man die übrige Verstandestätigkeit des betreffenden Autors oder Politikers betrachtet, wäre aus seiner lebensgeschichtlichen Situation sehr schnell aufzulösen – was häufig dann auch tatsächlich passiert, meist aber zu spät. So verbinde ich mit diesem autobiographischen Unternehmen den Wunsch, dass meine Gedanken und das, was ich bisher niedergeschrieben habe, für mich selbst und für andere dadurch besser zu verstehen sind. So einzigartig ist ein Leben nie, dass man daraus ein geschlossenes Ganzes machen könnte, das für sich steht. Andererseits lässt sich nicht alles in eindeutige Kausalbeziehungen auflösen, indem man Kindheitserlebnisse dokumentiert, die im Kern bereits das Spätere offenbaren.
Es ist eine merkwürdige Erfahrung, die ich bei der Betrachtung der einzelnen Stationen meines Lebensweges machte: dass am Ende alles so erschien, als sei es Stück für Stück geplant und in sich folgerichtig, dass man sich Stufe für Stufe vorwärts bewegt und am Ende ein systematisches Ganzes vor sich hat. Als ich diesen Gedanken fasste, war ich erschrocken. Denn wie kann angesichts eines chaotischen Lebens, in dem erst viel später so etwas wie eine planende Rationalität der Entscheidungen zustande gekommen ist, der Eindruck entstehen, als wäre das ganze Geschehen nach Regeln einer invisible hand abgelaufen? Erschreckt hat mich dieser Gedanke deshalb, weil ich anerkennen musste, dass Steuerungsmechanismen in einem tätig sind, die den Arbeitsprozess planender Vernunft der trügerischen Scheinwelt überführen. Natürlich sind das rückblickende Betrachtungen, die solchen Widerspruch enthüllen; aber etwas an realem Rohstoff muss davon in den Objekten, mit denen man es auf den verschiedenen Lebensstufen zu tun hat, enthalten sein. Es hat etwas von einer Collage an sich, in der alte Verbindungen zerbrochen und neue hergestellt werden, allerdings ohne dass bewusstes Handeln dabei im Spiel wäre.
Was ist eine Collage? Max Ernst beschreibt sie so: »Collage-Technik ist die systematische Ausbeutung des zufälligen oder künstlich provozierten Zusammentreffens von zwei oder mehr wesensfremden Realitäten auf einer augenscheinlich dazu ungeeigneten Ebene – und der Funke Poesie, welcher bei der Annäherung dieser Realitäten überspringt.«[4] Dieser Funke wird unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen weniger die Entstehung eines Kunstwerks entzünden. Vielmehr wird er etwas schaffen, um Auswege aus der Not zu finden. Wer die Grunderfahrung von Flucht und Vertreibung einmal gemacht hat, der arbeitet ein Leben lang an dem Problem der Ich-Findung und der Orientierungssicherheit, denn das erste, was das Flüchtlingsdasein bewirkt, ist die Zerstörung verlässlicher Orientierung. Diese wiederherzustellen oder neu zu gründen, ist ein wesentliches Aufbauelement einer Gesellschaft, die den Menschen ein Stück Macht über die eigenen Verhältnisse zurückgeben kann.
Hannover, Frühjahr 2016
Oskar Negt
ORIENTIERUNGSSUCHE – THEORETISCHE VORÜBERLEGUNGEN
Verzögerter Aufbruch – Nur dreißig Kilometer bis Königsberg
Als wir uns umsehen, ist alles weg. – Mit einem gewaltigen Knall waren wir aus den überwiegend für Tiertransporte und verwundete Soldaten ausgestatteten Waggons herausgeschleudert worden, mitsamt unseren gut verschnürten und zu Rucksäcken zurechtgeschneiderten Gepäckstücken. Der meterhohe Schnee begrub alles, auch die von meiner Mutter mit liebevoller Sorgfalt verpackten Essens- und Trinkvorräte. Nach einer Stunde des erstarrten Nichtstuns machten Gerüchte über die Ursache dieses Unfalls die Runde. Man sprach von fehlgeleiteter Sabotage, die eigentlich einen Truppentransport treffen sollte. Man sprach von einem russischen Fliegerangriff, aber niemand hatte ein Flugzeug gehört. Schließlich verbreitete sich die Nachricht, dass eine Lokomotive frontal in unseren Zug hineingefahren sei, es habe viele Tote in den ersten Waggons gegeben und es sei anzunehmen, dass die verbogenen Gleise und die quer liegenden Waggons nur mit schwerem Gerät, das man aus Königsberg herbeirufen werde, repariert werden könnten. Bis die Strecke wieder frei sei, könne es eine ganze Woche dauern.
Im Grunde aber gab es nur Gerüchte, wie es weitergehen würde, keine offizielle Auskunft von dem Militärtrupp, der einen halben Tag nach dem Unfall mit Bergungsgerät und Hebekränen eingetroffen war. Nur eine Sicherheit gab es: Die Strecke musste wieder unbehindert befahrbar sein, weil sie für Militärtransporte benötigt wurde. Nach einem kurzen Kontrollblick, was uns an Winterausstattung geblieben war, stellten wir fest, dass außer einem Koffer fast alles verloren gegangen war, wir aber glücklicherweise unverletzt und zusammen geblieben sind. Wir: Das sind meine beiden älteren Schwestern, Ursel und Margot, damals sechzehn und siebzehn, und ich, zehn Jahre alt. Wir saßen auf halber Strecke nach Königsberg fest, im meterhohen Schnee und in einer klirrenden Kälte von unter zwanzig Grad minus. Brennholz in der Umgebung zu verschaffen, bereitete Schwierigkeiten. Doch zwischen Weinen und Fluchen gewann sehr schnell die Hoffnung Oberhand, bald bei unserer ältesten Schwester, die seit einigen Jahren in Berlin eine Verkäuferinnenlehre machte, Zuflucht zu finden. Nach vier Tagen konnte unser Zug, um einige demolierte Waggons verkürzt, seine Fahrt von Groß-Lindenau nach Königsberg, eine Wegstrecke von dreißig Kilometern, fortsetzen. Doch Berlin war das eigentliche Fahrtziel, Königsberg nur eine Zwischenstation.
So sah der strategische Fluchtplan meiner Mutter aus: Sechs Kinder auf einem Leiterwagen unterzubringen, bedeutete, dass nur wenig Gepäck oder Hausrat befördert werden konnte; also mussten die Jüngsten vorausgeschickt werden. Eigentlich hätte auch mein fünf Jahre älterer Bruder Gerhard zu denjenigen gehört, die mit der Bahn vorausfahren; aber er war, während unser Vater beim Militär, später dann beim Volkssturm Dienst tat, der kompetente Ersatzbauer, der mit den Pferden am besten zurechtkam. Auf ihn konnte unsere Mutter, solange unser Vater in Tauroggen beim Volkssturm nutzlose Gräben aushob, nicht verzichten. Und unsere Mutter war fest entschlossen, sich dem Dorftreck anzuschließen. Ein überdachter Wagen, total überladen, stand zur Abfahrt bereit, als mein Vater, der einen Bauerntrupp befehligt hatte, zurückkam; er hatte den Bauern erklärt: Es hat keinen Sinn mehr, denn die Gräben, die wir mühsam in fest gefrorener Erde schaufeln, durchfahren die russischen Panzer mit Leichtigkeit. Obwohl sich die Parteiführer längst Richtung Westen abgesetzt hatten, war solch eine eigenmächtige Handlung riskant.
Als mein Vater, wie später berichtet wurde, den überladenen Leiterwagen sah, war seine erste Maßnahme, die gerade neu erworbenen Schlafzimmermöbel herunterzuräumen – unter bitteren Tränen meiner Mutter. Dann machte er sich auf den Weg, um uns zu suchen. Wir drei waren aber inzwischen schon weitergefahren. Nicht nur der Zugunfall war eine Tragödie, sondern auch das, was darauf folgte. Kinder waren, um sich vor der Kälte zu schützen, in den Wagen geblieben, während die Mütter in der Umgebung nach Lebensmitteln oder Brennholz suchten. Als sie zurückkamen, sahen sie, dass der Zug auf der freigeräumten Strecke bereits weitergefahren war.
Es war der 25.Januar 1945. An diesem Tag endete meine Kindheit. Die Fluchtwege hatten sich getrennt. Meine Eltern und vier meiner Geschwister sah ich erst zweieinhalb Jahre später wieder. Sie sind über das gefrorene Frische Haff, dessen Eisdecke bereits zu brechen begann, sicher nach Westen gelangt. Als unser Zug mit vier Tagen Verspätung in Königsberg ankam, liefen wir freudestrahlend auf einen Bahnbeamten zu und fragten ihn: Auf welchem Gleis fährt der nächste Zug nach Berlin? – Berlin? Es fährt kein Zug mehr nach Berlin. Der letzte, der trotz aller Fliegerangriffe und Frostbehinderungen die Stadt verlassen und Richtung Westen fahren konnte, war am Tag zuvor als völlig überladener Flüchtlingstransporter abgefahren. Königsberg war eingeschlossen. Es gab keinen über Land gehenden Fluchtweg mehr. Wir waren verzweifelt.
Wenige Tage sind es, die mein Leben radikal verändert haben. Die bis zu dem Zeitpunkt, da die Geschosssalven der Roten Armee unserem Dorf bedrohlich näher rückten, als glücklich empfundenen Kindertage waren abrupt beendet. Hungrig und frierend standen wir auf dem Königsberger Bahnhof und wussten nicht ein noch aus; als einziges Gepäckstück hatten wir einen Koffer gerettet, den wir abwechselnd schleppten, der mit jedem Meter schwerer wurde und den wir gerne in einer Ecke hätten stehen lassen – wenn uns nicht klar gewesen wäre, dass er unsere letzte Habe enthielt. So stapften wir ermüdet und ermattet bei Schnee und Kälte in Richtung Zentrum und waren überglücklich, als plötzlich ein Schlitten vorbeikam und der peitschenbewaffnete Schlittenführer uns aufforderte aufzusteigen. Der Schlitten war voll beladen und im ersten Augenblick konnte man nicht feststellen, worin diese Ladung bestand. Plötzlich schrie meine Schwester Margot auf. Sie hatte Halt suchend eine gefrorene Hand ergriffen. Wir saßen auf einem Leichen-Schlitten. Sofort wollten wir abspringen, aber Margot zögerte und fragte den Mann, der mit einem abgemagerten Gaul diesen Schlitten führte, was denn der Sinn dieses absurden Transports sei, bei dieser Kälte könne man doch keinen Menschen beerdigen. Er erklärte, niemand komme mehr aus Königsberg heraus, alle versuchten es. Er auch. Welches Interesse sollten die Russen haben, einen Leichen-Schlitten auf der Flucht aus Königsberg anzuhalten? Das war unsere erste Begegnung mit der Aussichtslosigkeit, diese Stadt lebend verlassen zu können; wir blieben also auf dem Leichen-Schlitten sitzen. Jetzt waren wir drei nicht nur Geschwister, wir waren eine Rettungsgemeinschaft.
Mit solchen oder ähnlichen Erlebnissen kann man einen autobiographischen Bericht durchaus beginnen. Es ist der unmittelbare Blick auf ein Ereignis, das einen radikalen Umbruch in der Lebensgeschichte dokumentiert und schmerzhaft verdeutlicht, dass alle gewohnten Orientierungen zerstört sind. Solche existenziellen Erfahrungen in ihren Nachwirkungen erklären zu wollen, könnte der Sinn einer Autobiographie sein. Denkbar sind aber auch ganz andere Begründungen und Zugänge.
Es ist eine Situation der Vergangenheit, die ich beschreibe; dieses Zugunglück reißt mein Leben auseinander. Es könnte eine folgenschwere Schockstarre bewirkt haben, die alle anderen Erfahrungen der späteren Jahre überlagert. Aber die aktuellen Assoziationen verknüpfen sich mit dem Flüchtlingselend, das heute andere Menschen betrifft, aber ähnliche Hilflosigkeit ausdrückt wie damals, als Hunderttausende sich in den Häfen zusammendrängten, um über die Ostsee zu fliehen.
Flüchtlingsdasein und die Suche nach Halt
Sucht man nach einem Leitfaden, der Einzelerlebnisse und kollektive Erfahrungen einer geschichtlichen Periode miteinander verknüpft, dann könnte man für eine gut zehn Jahre umfassende Zeitspanne meiner Lebensgeschichte Existenzialien eines Flüchtlingsdaseins beschreiben. Das wäre nicht umfassend genug, um den vollen Lebenszusammenhang auf den verschiedenen Stufen zu begreifen, weil die Phasen der Unterbrechung, der Glückserfahrungen darin fehlten, aber ich könnte durchaus eine Lebenslinie konstruieren, die den Flüchtling in den Mittelpunkt rückt. Es war im Januar 1945, als ich den vergeblichen Versuch unternahm, gemeinsam mit zwei älteren Schwestern nach Berlin zu gelangen. Erst 1955, als ich in Oldenburg Abitur gemacht hatte, spürte ich wieder festeren Boden unter den Füßen und in einer Art heimatlichem Vorgefühl kam mir der tröstliche Gedanke: Hier wirst du bleiben! Von hier wird dich niemand mehr vertreiben! Zehn Jahre auf der Flucht hinterlassen Narben, die immer wieder aufreißen; sie sind besonders dann spürbar, wenn – wie heute – Massen von Menschen aus Existenzangst aufbrechen und ihr Leben aufs Spiel zu setzen bereit sind, um dem Krieg, der politischen Unterdrückung, der religiösen Verfolgung oder der materiellen Not zu entfliehen. Lebensgefahr und Not sind der Antrieb, wenn sie auf Wanderschaft gehen, und nicht Gründergeist oder die Abenteuerlust, etwas anderes zu erleben als die stickige Luft der alten Heimat. Nie hat es in der Geschichte so viele Flüchtlinge gegeben; mit gutem Grund kann man unser Zeitalter als das der Flüchtlinge bezeichnen.
Es ist also nicht gleichgültig, wie der Anfang einer Autobiographie gestaltet ist, wo die Akzente gesetzt werden: auf den Erfahrungszuwachs, auf das Leid und Elend oder auf die Überlebensstrategien, die verallgemeinerbar sind. In dem Maße, wie die Zerstörung von Bindungen nicht nur, wie in allen Modernisierungsprozessen üblich, als unbeabsichtigte Nebenfolge auftritt, sondern gewollt ist, zum System gehört, wird Energie in Suchbewegungen verbraucht, die sich auf verlässliche Orte richten, also einzig und allein dem Zweck dienen, »Bodenhaftung« herzustellen. Es gehört wohl zur anthropologischen Bedürfnisausstattung des Menschen, dass er selbst dann, wenn Wanderschaft und Mobilität weit oben in seiner Wertehierarchie rangieren, nur bis zu einem bestimmten Grad in Bewegung zu halten ist.
Wo liegt der archimedische Punkt? Wo stehe ich?
Wo stehe ich? Wo komme ich her? Welches sind meine Wurzeln? Was sind meine Ziele? Wo will ich hin? Wie sieht die Welt von morgen aus? Das alles sind Fragen, die den uralten Wunschtraum von einem archimedischen Punkt ausdrücken – einem festen Ort verlässlicher Bodenhaftung, von dem aus auch ich meine Lebenswelt einschätzen, ordnen und in Bewegung bringen kann.
Von dem berühmten griechischen Mechaniker und Mathematiker Archimedes (285 bis 212 v.Chr.) sind nicht nur mathematisch-geometrische Berechnungen und naturwissenschaftliche Sätze überliefert; an seine Person knüpfen sich auch legendäre Aussprüche, wie der, man möge ihm einen festen Punkt außerhalb der Erde geben, auf dem er stehen könne, dann werde er die Erde mit seinem Hebel bewegen. Dieses pu sto (που ςτω, wörtlich »wo ich stehe«, als Tatsachenfeststellung, aber auch als Frage: »wo stehe ich?«) hat das europäische Denken maßgeblich bestimmt und als Verlangen nach Antwort taucht dieser Gedanke immer wieder auf. Descartes’ cogito, ergo sum – Denken als Existenzbeweis – enthält denselben Impuls wie Kants Konstruktion des Transzendentalen, des Erfahrungsunabhängigen, das doch Erfahrung begründen soll. Es sind ordnende Orts- und Zeitbestimmungen, aus denen sich das Sicherheitsdenken speist.
Welcher Standpunkt verbürgt einen begründeten Anfang und einen überzeugenden Abschluss? Wie ist der Boden beschaffen, auf dem sich Wegweiser befestigen lassen, die mir eine gesicherte Rückkehr erlauben und mich vor Verirrungen bewahren?
Solange die Menschen in übersichtlichen Verhältnissen leben, Wege und Orte erfahrbare Sicherheit verbürgen, können alle diese Fragen sehr schnell beantwortet werden. Sobald sie sich aufs Meer begeben oder in die Dunkelheit geraten oder das Weltgeschehen an sich heranlassen, versagen auch die ausgekügeltsten und genauesten Topographien. Es ist daher kaum ein Zufall, dass der Begriff Orientierung zunächst vor allem in der Navigationstechnik, der Schifffahrt praktische Anwendung fand, bevor er dann im 18.Jahrhundert aus dem Französischen orienter in verallgemeinernder Bedeutung Eingang in die europäischen Sprachen gefunden hat. »Sich orientieren« heißt seitdem so viel wie »sich zurechtfinden«, sich im Labyrinth der Verhältnisse nicht zu verirren.
Aber bereits im lateinischen Ursprungssinn des Wortes ist ein doppelter Bedeutungshorizont angesprochen: Fixpunkt und Hebel in einem. Das Lateinische orior bedeutet »sich erheben, aufsteigen«, aber auch »sichtbar werden, aufgehen, sich zeigen«. Darin ist freilich auch die eindringliche Suche nach dem Ursprung, der Abstammung, dem Anfang mit gesetzt.
Orientierung und Aufklärung gehören zusammen
Wo wir also von Orientierung sprechen, ist das bloße Wissen nie ausreichend; auch hat das Differenzierungsgebot, das im Übrigen für diskursives Denken insgesamt Geltung hat, in diesem Zusammenhang seine deutlichen Grenzen. Man hat mit Recht Verfügungswissen vom Orientierungswissen unterschieden; Jürgen Mittelstraß hat diese Unterscheidung getroffen; er sagt: »Verfügungswissen ist ein Wissen um Ursachen, Wirkungen und Mittel; es ist das Wissen, das Wissenschaft und Technik unter gegebenen Zwecken zur Verfügung stellen. Orientierungswissen ist ein Wissen um gerechtfertigte Zwecke und Ziele.«[5]Orientierungswissen hat jedoch immer auch mit einer Strukturveränderung des Wissens zu tun, selbst dann, wenn Verfügungswissen auf Zwecke und Ziele gerichtet ist; man kann das vielleicht am besten mit dem benennen, was Niklas Luhmann einmal als Komplexitätsreduktion bezeichnet hat. Im Grunde geht es bei diesem Vorgang nicht nur um Vereinfachung sachlich ausdifferenzierter Inhalte, sondern um die Konzentration auf einen politisch so zugespitzten Sachverhalt, dass er aus seiner Einseitigkeit, und gerade aus seiner Einseitigkeit, Brennstoff für öffentlichen Zwist liefert. Wenn das ein produktiver öffentlicher Streit sein soll, dann setzt er ein begründetes Koordinatensystem voraus, in dem es eindeutige Zeit- und Raumachsen gibt.
Aber Orientierung in diesem weit gefassten Sinn besteht nicht nur aus objektiven Raum-Zeit-Koordinaten, aus »Fixsternen« und archimedischen Punkten. Schon Kant bringt das Subjekt mit ins Spiel; er verknüpft systematisch Orientierung mit Aufklärung und stellt deshalb eine Wahrheitsverbindung zwischen beiden her, die in Erziehung und Selbstbildung begründet ist – und geübt werden muss. In Kants berühmter Schrift über Aufklärung aus dem Jahre 1784, also aus vorrevolutionärer Zeit, wird Aufklärung als eine Art Wegbeschreibung verstanden; die Vernunft wagt den Ausgang in die Öffentlichkeit, indem sie selbstverschuldete Faulheit und Feigheit überwindet und die entmündigende Abhängigkeit von »Vormündern« und einschüchternden Autoritäten überwindet. Nicht am Aufklärungsvermögen scheitert das Mündigwerden, sondern am mangelnden Entschluss zum Risiko, die im Privaten, vielleicht an einem Stammtisch oder in der Familie, angesammelten und erprobten Vernunftgründe dem öffentlichen Urteil auszusetzen. »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Anleitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.«[6]Man kann dieses »Sapere aude« auch als kürzeste Formel des Humanismus nehmen.
Wenn in diesem Zusammenhang von Orientieren gesprochen werden kann, dann mit dem klaren und entschiedenen Blick auf eine nach Freiheitsgesetzen gestaltete Öffentlichkeit. Diese Wegmarkierung eines Ausgangs ist auf die Urteilsfähigkeit eines öffentlichen Gemeinwesens gerichtet, das eine eigene Kommunikationsstruktur besitzt. Aufklärung in diesem Sinne hat also eine inhaltliche Ausrichtung; der enge Umkreis des Privatgebrauchs der eigenen Vernunft ist noch nicht überwunden, wenn ein Lehrer oder ein Pfarrer oder ein Beamter der Verwaltung vor dem Publikum redet, für das er zuständig ist und das von ihm kompetente Entscheidungen erwartet. Es sind im Grunde die öffentlichen Angelegenheiten, das Wohl und Wehe des Gemeinwesens, dem eine Art naturrechtlicher Schutz zukommt. Die »Freiheit der Feder« soll nach Kant zwar das einzige Palladium der Volksrechte sein, aber diese Volksrechte sind so weit gefasst, dass sie allgemeine Denkfreiheit einschließen. Diese einzuschränken, hat keine Herrschaftsordnung eine Befugnis. Deshalb ist für Kant diese Form selbstkritischer Aufklärung, welche die Menschen aus ihrer Rohheit und Gewalttätigkeit herauszuführen imstande ist, immer gebunden an eine Vorstellung von Welt. Der Gelehrte, der durch Schriften zum »eigentlichen Publikum, nämlich der Welt« spricht, ist der Mensch im öffentlichen Gebrauch seiner Vernunft und genießt deshalb uneingeschränkte Freiheit, sich seiner eigenen Vernunft zu bedienen und dadurch in praktischer Arbeit zu bekräftigen, dass ein »Kontrakt, der auf immer alle weitere Aufklärung vom Menschengeschlechte abzuhalten geschlossen würde, (…) null und nichtig ist, selbst wenn er von irgendwelcher obersten Gewalt beschlossen sein sollte.«[7]
Was heißt: sich im Denken orientieren? – Der Vernunftglaube
Es gibt, meines Wissens, nur zwei Aufsätze Kants, die sich mit der Beantwortung von Fragen beschäftigen, die offensichtlich damals im gesellschaftlichen Verkehr umliefen und von den Zeitgenossen Kants als klärungsbedürftig betrachtet wurden. Das ist neben der erwähnten Schrift Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? die zwei Jahre später erschienene kleine Schrift Was heißt: sich im Denken orientieren? Sie bilden einen inneren Zusammenhang, denn gerade der in der vorrevolutionären Umbruchzeit gewachsene Orientierungsbedarf schien es unabwendbar zu machen, Grenzbestimmungen zu markieren und gleichzeitig mit den Anmaßungen der spekulativen Vernunft ihre Orientierungsfunktion im menschlichen Leben zu bekräftigen. Der empirische Teil des Orientierens erweckt den Eindruck einer Banalität. »Sich orientieren heißt, in der eigentlichen Bedeutung des Worts: Aus einer gegebenen Weltgegend (in deren vier wir den Horizont einteilen) die übrigen, namentlich den Aufgang zu finden. Sehe ich nun die Sonne am Himmel, und weiß, dass es um die Mittagszeit ist, so weiß ich Süden, Westen, Norden und Osten zu finden.«[8]
Damit hat es bei Kant aber nicht sein Bewenden. Genau hier setzen bei ihm Problemstellungen ein, die Orientierung in ein ganz neues, eher modernes Licht rücken. Wie in der modernen Physik seit Einstein und Heisenberg, die, sehr vereinfacht ausgedrückt, Wahrnehmungsweisen der Subjekte in die objektiven Tatbestände einbeziehen, rückt hier Kant auch die kopernikanische Wende ins Zentrum der Subjekt-Objekt-Dialektik, die konstitutive Bedeutung des Subjekts für den Objektzusammenhang, indem er erklärt: »Also orientiere ich mich geographisch bei allen objektiven Datis am Himmel doch nur durch einen subjektiven Unterscheidungsgrund.«[9] Es ist meine alltägliche Lebenserfahrung, der Boden, auf dem ich stehe, der mir Sicherheit bei der Orientierung verschafft. Was ich am Himmel sehe, verschafft mir Wahrnehmungsgewissheit nicht allein durch den objektiven Tatbestand dieses Blicks, sondern durch das »öftere Ausübung gewohnte Unterscheidungsvermögen, durchs Gefühl der rechten und linken Hand«.[10] Dass der Polarstern ein Fixstern ist, reicht für meine Orientierung nicht aus. Die Sinnenerforschung von rechter und linker Hand benötige ich, wenn ich mich zum Beispiel in einem dunklen Raum orientieren will.
Und jetzt bringt Kant zwei für das Orientierungsproblem entscheidende Momente ins Spiel, welche den vernunftfernen Orientierungsbedarf in zweierlei Richtungen brechen: Verlässliche Orientierungen sind nicht möglich, wenn sie der Anschaulichkeit, der Bildlichkeit möglicher Erfahrungen ermangeln. Er sagt: »Wir mögen unsere Begriffe noch so hoch anlegen, und dabei noch so sehr von der Sinnlichkeit abstrahieren, so hängen ihnen doch noch immer bildliche Vorstellungen an, deren eigentliche Bestimmung es ist, sie, die sonst nicht von der Erfahrung abgeleitet sind, zum Erfahrungsgebrauche tauglich zu machen. Denn wie wollten wir auch unseren Begriffen Sinn und Bedeutung verschaffen, wenn ihnen nicht irgendeine Anschauung (welche zuletzt immer ein Beispiel aus irgendeiner möglichen Erfahrung sein muss) untergelegt würde? Wenn wir hernach von dieser konkreten Verstandeshandlung die Beimischung des Bildes, zuerst der zufälligen Wahrnehmung durch Sinne, dann sogar die reine sinnliche Anschauung überhaupt, weglassen: so bleibt jener reine Verstandesbegriff übrig, dessen Umfang nun erweitert ist, und eine Regel des Denkens überhaupt enthält.«[11]
Darin besteht jetzt, was das Orientierungsproblem betrifft, die grundsätzliche Grenze der spekulativen, das heißt: der theoretischen Vernunft. Ohne das Anschauen exemplarischer Bilder sind Begriffe in der Tat leer; so steht es schon in der Kritik der reinen Vernunft. Aber Kant möchte ja in seiner Schrift nicht erläutern, was Orientieren im Zusammenhang der empirischen Erfahrungswelt bedeutet; vielmehr liegt ihm am Herzen, wie sich das Orientierungsproblem begründen lässt, wenn es um das eigentümliche Reich der spekulativen Vernunft geht, wenn die Sicherheitsbasis der empirischen Anschauung verloren gegangen ist. In diesem Falle fehlt nun der anschauliche Boden, von dem man ausgehen kann. Orientierung bedarf aber der verlässlichen Wiederkehr eines erfahrbaren Punktes oder Ortes in der Welt, wo eben rechts und links, wie Kant sagt, unterscheidbar sind. Da für Kant ein Sicherheitsversprechen auszuschließen ist, nämlich die der kritischen Selbstreflexion entzogene dogmatische Setzung einer Position oder eines Grundsatzes, rettet er sich durch eine aporetische (in sich paradoxe) Konstruktion: Er spricht vom Vernunftglauben. Der Vernunftglaube enthält so etwas wie eine Redlichkeitssubstanz im Denken. Es ist keine Erkenntnis, kein Wissen, es ist ein Fürwahrhalten, aber ausgestattet mit einem hohen Glaubwürdigkeitsbonus. »Ein reiner Vernunftglaube ist also der Wegweiser oder Kompass, wodurch der spekulative Denker sich auf seinen Vernunftstreitereien im Felde übersinnlicher Gegenstände orientieren, der Mensch von gemeiner doch (moralisch) gesunder Vernunft aber seinen Weg, sowohl in theoretischer als praktischer Absicht, dem ganzen Zwecke seiner Bestimmung völlig angemessen vorzeichnen kann; und dieser Vernunftglaube ist es auch, der jedem anderen Glauben, ja jeder Offenbarung zugrundegelegt werden muss.«[12]
Es ist hier nicht der Ort, den spekulativen, den innerphilosophischen Gedanken dieser Erweiterung des Orientierungsproblems im Einzelnen weiter zu verfolgen. Für Kant läuft die »Grenzbestimmung des reinen Vernunftvermögens«, das heißt die Kritik von Schwärmerei und spekulativem Dogmatismus, auf einfache, praktische Lösungen hinaus. Das knüpft wiederum unmittelbar an die Aufklärungsschrift an. Im spekulativen Bereich ist die Redlichkeit des Vernunftglaubens die einzige Bremse, die das Denken daran hindern kann, im Zug der Phantasterei fortzufahren. Zur Aufklärung gibt es keine Alternativen, und in diesem Sinne sind Bildung der Urteilskraft und Selbstdenken das einzige, wodurch das Elend der dogmatischen Kriege, im Denken genauso wie in der Wirklichkeit, zu vermeiden ist. Kant sagt: »Selbstdenken heißt, den obersten Probierstein der Wahrheit in sich selbst (d. i. in seiner eigenen Vernunft) suchen; und die Maxime, jederzeit selbst zu denken, ist die Aufklärung. (…) Aufklärung in einzelnen Subjekten durch Erziehung zu gründen, ist also gar leicht; man muss nur früh anfangen, die jungen Köpfe zu dieser Reflexion zu gewöhnen. Ein Zeitalter aber aufzuklären ist sehr langwierig; denn es finden sich viel äußere Hindernisse, welche jene Erziehungsart teils verbieten, teils erschweren.«[13]
Orientieren heißt Mut zur Selbstaufklärung
Aufklärung und Orientierung, die das Selbstopfer der Vernunft und die Übergabe der menschlich definierten Bedürfnisse an fremde Verfügungen ausschließen, sind heute unabdingbar miteinander verknüpft. Was ich unter gesellschaftlicher Orientierung verstehe, hat als wesentliche Kraftquelle diesen Emanzipationsanspruch der Menschen in einem Gemeinwesen, das menschenwürdig ist. Es mag konservativen Weltanschauungen bedauerlich erscheinen und auch als Last empfunden werden, dass die Sicherheiten der Tradition und der überlieferten Lebensregeln nicht mehr als Bürgschaft verstanden werden können, den Menschen einfache Antworten auf ihre Lebensprobleme zu garantieren; aber es gibt keine menschlich vertretbare Alternative dazu.
So zentral nun auch diese Bindung von Aufklärung an Orientierung und Emanzipation für meine Begründung einer biographischen Reflexion des eigenen Lebens ist, so entschieden ist zu betonen, dass diese drei Komponenten erst dann in konkreten Lernprozessen ihre eigentliche Wirksamkeit zeigen, wenn sie in einem spezifischen Weltverständnis fundiert sind.
Ursprünge und Hoffnungsanfänge
Das Bedürfnis, sich des Ursprungs und der Anfänge zu vergewissern, ist ein starkes Erkenntnismotiv in der europäischen Denktradition. Jeder Blick auf die Kindheit verrät etwas von dieser ursprungsphilosophischen Neugierde. Was sind die Hoffnungsanfänge, die in einem neuen Lebewesen stecken? Welche Brüche gibt es, wie wurden die ursprünglichen Potenziale umgesetzt? Ein biographisches Projekt ist stets mit solchen Fragestellungen belastet, und sie tauchen auf jeder Lebensstufe erneut auf. Was das eine, der Blick auf die Kindheit, mit dem anderen, einer auf Ursprünge gerichteten Neugier, zu tun hat, ist mir erst sehr spät klar geworden.
Von den systematischen Büchern Adornos hat mich in der Frühphase meines Studiums jene Schrift am meisten fasziniert, die in der Regel als die abstrakteste und blutleerste betrachtet wird, weil sie im Grunde eine Abarbeitung an Husserls Phänomenologie enthält, also als Übungsbuch zur Dialektik verstanden werden kann. Hier fand ich zum ersten Mal in meinem Studium den Begriff der Ursprungsphilosophie entwickelt; denn selbst nach Sicherheiten suchend, um das Flüchtlingsschicksal loszuwerden, hat mich Adornos Kritik an Husserls »logischem Absolutismus« darüber belehrt, dass das ursprungsphilosophische Sicherheitsdenken als Antriebsmotiv der Erkenntnis eine ebenso verständliche Einstellung wie ein Irrtum ist. Eine Seinssphäre absoluter Ursprünge, wie Husserl sie behauptet, ist eine trügerische Hoffnung auf Sicherheit,