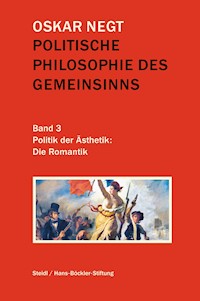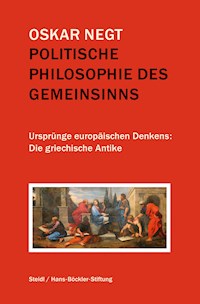
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl GmbH & Co. OHG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es gab Zeiten, in denen Vorlesungen nicht schneller Wissensvermittlung dienten, sondern der öffentlichen Entwicklung eines Gedankens. Damit waren sie offen, lebendig und angreifbar. Als solch eigensinnige Unternehmungen sind die Vorlesungen Negts eine Erinnerung an ein zugrunde gegangenes Ideal akademischer Bildung und ein Dokument öffentlicher Wahrheitssuche in der Tradition der Aufklärung. Sie richten sich an alle, die bereit sind, den häufig anstrengenden, bisweilen aber auch heiteren Weg der Reflexion zu gehen. In seinen Vorlesungen aus dem Sommersemester 2001 verfolgt Negt die Anfänge des philosophischen Denkens in Europa bis in die Geografie der hellenischen Welt und bis in die Gestalten der griechischen Mythologie. Weder tritt er dabei mit einer monokausalen Erklärung für die Entstehung abendländischer Rationalität auf, noch ergeht er sich in graecophilen Hymnen auf den ›abendländischen Geist‹. Mit Bedacht lehnt sich Negt vielmehr an Max Webers Begriff der Konstellation an, in welche die Entstehung der Philosophie eingebettet ist: jene berühmte »Verkettung von Umständen«, die den abendländischen Prozess der Rationalisierung beflügelten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
OSKAR NEGT
POLITISCHE PHILOSOPHIE DES GEMEINSINNS
Band 1 Ursprünge europäischen Denkens: Die griechische Antike
Herausgegeben von der Hans-Böckler-StiftungSteidl
Inhalt
Cover
Titel
Vorbemerkung
Max Weber und die Frage nach den Ursprüngen okzidentaler Rationalität
Vorlesung vom 10. April 2001
Die Geografie der antiken Philosophie: Küstenstädte und Kolonien
Vorlesung vom 11. April 2001
Griechischer Mythos und Polis
Vorlesung vom 17. April 2001
Die Anfänge der Philosophie: die Vorsokratiker
Vorlesung vom 18. April 2001
Ein erster Aufklärungsschub: innerweltliches Denken und das Entstehen von Kategorien
Vorlesung vom 24. April 2001
Der Fortschritt der Reflexion: von Thales zu Heraklit
Vorlesung vom 25. April 2001
Zôon politikón, zôon logon echonund der Beginn der Abstraktion
Vorlesung vom 2. Mai 2001
Heideggers Heraklit
Vorlesung vom 8. Mai 2001
Das politische Fundament der klassischen Philosophie: das Perikleische Zeitalter I
Vorlesung vom 9. Mai 2001
Das Perikleische Zeitalter II
Vorlesung vom 15. Mai 2001
Auf dem Weg zur Apologie des Sokrates
Vorlesung vom 16. Mai 2001
Die Methode des Sokrates: die anti-autoritäre Selbstbefragung der Vernunft
Vorlesung vom 22. Mai 2001
Dialog und Dialektik
Vorlesung vom 23. Mai 2001
Platon, der Tod und die Ideen
Vorlesung vom 29. Mai 2001
Ideenlehre und Höhlengleichnis I
Vorlesung vom 30. Mai 2001
Ideenlehre und Höhlengleichnis II
Vorlesung vom 12. Juni 2001
Das Höhlengleichnis und die Bildungsfrage
Vorlesung vom 20. Juni 2001
Aristoteles’ Kategorienlehre
Vorlesung vom 26. Juni 2001
Kategorienlehre II
Vorlesung vom 27. Juni 2001
Aristoteles und der Aristotelismus
Vorlesung vom 3. Juli 2001
Der politische Ursprungscharakter der (aristotelischen) Philosophie
Vorlesung vom 4. Juli 2001
Polis und Politik, Erziehung und Tugenden bei Aristoteles
Vorlesung vom 10. Juli 2001
Schlussbetrachtung
Vorlesung vom 11. Juli 2001
Nachwort von Hendrik Wallat
Anmerkungen
Impressum
Vorbemerkung
Über drei Jahrzehnte lang habe ich an der Universität Hannover umfangreiche Großvorlesungen gehalten; der Dauer wie auch der Hörerschaft nach. Diese Vorlesungen waren jener zentrale Bestandteil meiner akademischen Tätigkeit, der mir am meisten Freude bereitete. Zusammenhänge herzustellen, große Bögen zu spannen, das war mein eigentliches Anliegen. Ein Anliegen, das entsprechende Zeithorizonte des Lernens voraussetzt, die zunehmend bedroht sind. An Disziplingrenzen habe ich mich hierbei nie starr gehalten. Angestellt am Institut für Soziologie, habe ich häufig philosophische Themen und Fragen behandelt, die für mich von soziologischer Theorie gar nicht zu trennen sind. Mir ging es auch nicht um reine Wissensvermittlung, sondern primär um das produktive Rückgängigmachen von an sich sinnvoller wissenschaftlicher Arbeitsteilung, deren Verselbstständigung jedoch meinem Verständnis von Erkenntnis widerspricht. In diesem Sinne habe ich meine Vorlesungen immer als eine Art öffentliches Denken verstanden, als intellektuelle Praxis, die zum Selbst- und Weiterdenken anleiten sollte und nicht bloß die Studierenden mit einem gesicherten und abgeschlossenen Wissensbestand versorgt. Die Vorlesungen sollten größere Zusammenhänge herstellen und gleichsam die politische Dimension des Menschseins durch die Aneignung von Theorie darstellen. Ich war dabei stets darum bemüht, die Autonomie der Theoriebildung gegenüber politischem Aktionismus, der in den 1970er Jahren im studentischen Milieu virulent war, zu verteidigen wie auch den Zuhörern nahezubringen, dass Theorie nicht nur Voraussetzung bewusster emanzipatorischer Praxis ist, sondern selbst auch eine spezifische Form politischer Praxis darstellt. Für diese bedarf es anderer Zeitmaße als für direkte politische Aktionen. Mit diesen ist Theorie zwar im besten Fall überaus komplex vermittelt, sie ist deswegen aber keineswegs eine bloße Ersatzhandlung oder ein Hilfsmittel für die vermeintlich »echte« Praxis.
Es war es für mich ein großes Glück, dass Ingbert Schmidt als Hörer meiner Vorlesungen diese kontinuierlich über Jahre hinweg akribisch auf Tonband aufzeichnete. Nachdem diese Vorlesungsmitschnitte über Jahrzehnte ungenutzt in meinem Keller lagen, wurden sie 2010 in meinem Vorlass im Archiv der Frankfurter Universitätsbibliothek J.C. Senckenberg aufgenommen. Dort wurden sie unter der Leitung von Dr. Mathias Jehn digitalisiert und so für eine zeitgemäße Bearbeitung zugänglich gemacht. Dem gilt mein Dank genauso wie der Hans-Böckler-Stiftung, die es ermöglichte, die Vorlesungen angemessen aufzuarbeiten. Seit 2016 fördert die Hans-Böckler-Stiftung das Projekt »Politische Philosophie«, in dem Dr. Hendrik Wallat die Vorlesungen für ein lesendes Publikum kenntnisreich aufbereitet und mit ein- und weiterführenden Nachworten versehen hat. Es werden am Ende des Projekts verschiedene Vorlesungen als Reihe »Politische Philosophie des Gemeinsinns« in Buchform vorliegen, die Fragen von der Ästhetik bis zur Wissenschaftstheorie behandeln und Denker von Platon bis Popper umfassen. Bis auf eine Vorlesung stammt das gesamte Material aus den 1970er Jahren, deren politisierter Charakter auch in den Vorlesungen nachhallt.
Die eine zeitliche Ausnahme hiervon bildet diejenige Vorlesung, die dem vorliegenden Buch zugrunde liegt. Es handelt sich um eine Vorlesung über die Anfänge des europäischen Denkens in der griechischen Antike, die ich im Sommersemester 2001 hielt. Diese Vorlesung, die in das Ende meiner Lehrtätigkeit fällt, nimmt sich einer Epoche an, die nicht eben zur Domäne der akademischen Linken zählt und auch keinen Schwerpunkt meiner Forschungen bildet. Obgleich auch ich Max Webers berühmte Fragestellung nach den spezifisch okzidentalen Rationalisierungsprozessen und ihren Ursprüngen aufgreife – man kann sie als Soziologe schlicht nicht übergehen, und ich habe sie bereits in meiner Deutung der Modernisierung in China aufgegriffen1 –, ging es mir doch primär darum, die politischen Wurzeln der europäischen Vernunfttradition herauszustellen und als ein Erbe zu würdigen, das nicht verjubelt gehört, sondern sich aus der Perspektive der Gegenwart angeeignet werden muss. Mein Anspruch war es dabei, weder in einen philhellenischen Traditionalismus zu verfallen, noch eine entfernte Epoche unhistorisch zu aktualisieren; zwei beliebte Verfahren, die weder der Gegenwart noch der Geschichte gerecht werden, aber die dialektische Vermittlung beider zugunsten jeweils eines Pols abstrakt stillstellen. Weit mehr scheint mir die griechische Erfahrung des Politischen, die der Althistoriker Christian Meier so emphatisch herausgestellt hat, ein paradigmatisches Beispiel für die immanente Verbindung praktisch-politischer Emanzipationsprozesse mit jenen der (Selbst-)Aufklärung des Geistes abzugeben. Diese Erfahrung ist überaus aktuell und lädt ein zu einem (Rück-) Blick auf eine vergangene Epoche, deren geschichtliche Erfahrung Unabgegoltenes transportiert. Dieses betrifft gleichermaßen die praktische Erfahrung der politischen Freiheit wie die autonome Reflexion der Vernunft: eine Tradition, an der auch die humane Zukunft Europas hängt.
Wenn ich hiervon etwas einst meiner studentischen Hörerschaft und jetzt dem lesenden Publikum zu vermitteln vermag, wäre die primäre Intention meiner Ausführungen erfüllt.
Oskar Negt, im Juni 2019
Max Weber und die Frage nach den Ursprüngen okzidentaler Rationalität
Vorlesung vom 10. April 2001
Es erscheint zunächst anmaßend, dem europäischen Denken auf den Grund gehen zu wollen. Auch ist es keineswegs das erste Mal, dass jemand darüber nachzudenken unternimmt, warum es in den Denkformen, etwa in den verschiedenen Hochreligionen, erhebliche Unterschiede gibt. Blickt man auf den Konfuzianismus, auf taoistische Praktiken, auf den Islam, auf die jüdische Religion, dann erscheinen diese Geistesgebilde als ganz verschiedene Formen des Denkens. Die Genesis solch unterschiedlicher Denkkategorien zu bestimmen und die gesellschaftlichen Ursachen zu benennen, ohne in eine Wertung zu verfallen, ist dabei ein zentrales Problem. Was ich hier an europäischem, okzidentalem Denken vorstelle, ist also nicht als Modell des Denkens schlechthin aufzunehmen, selbst wenn gelegentlich ein anderer Eindruck entsteht, weil ich eben aufgewachsen bin in einem mitteleuropäischen Rationalitätsmilieu und auch gar nicht anders denken kann.
So mag es bisweilen erscheinen, als ob die europäisch-okzidentale Denkungsart ein Modell von Denkformen und von Kategorien wäre, das sich über die ganze Welt mit Legitimität ausbreitet. Dass es sich tatsächlich ausbreitet, das können wir alltäglich beobachten. Aber ob es sich legitimerweise ausbreitet, das heißt, ob es also begründet universalistischen Anspruch hat oder nur aufgrund bestimmter ökonomischer und politischer Konstellationen bis in die letzten Winkel der Welt hineingetragen wird – diese Entscheidung möchte ich zunächst offenlassen.
Es gibt so etwas wie einen chronischen Begriffsimperialismus, der vom europäischen Denken ausgeht. Auch das ist nichts Neues. Die Welt hat eine Kolonialperiode über mehrere Jahrhunderte erlebt, in der sich mit der Sprache selbstverständlich auch englisches, französisches oder holländisches Gedankengut etwa bis nach Indonesien verbreitet hat, und fast alle afrikanischen Länder sind noch heute bestimmt von diesen europäischen Sprachformen. Die Dekolonisierung hat nicht bewirkt, dass autochthone Sprachen jene der Kolonisatoren wieder aus all ihren Wirkungsbereichen verdrängen, was häufig auch gar nicht möglich ist. So ist beispielsweise die Hochsprache Algeriens Französisch geblieben, weil nur diese Sprache eine stammesübergreifende Verständigung möglich macht. Selbstverständlich spielen hier auch Elemente eine Rolle, die schon im Römischen Imperium Bedeutung hatten. Natürlich konnten sich die Kelten mit den Phöniziern nicht verständigen, aber in der Periode des Römischen Reiches waren sie über das Lateinische, über die Sprache des Herrschaftszentrums, dazu sehr wohl in der Lage. Ein kultureller Austausch zwischen den Völkern wurde also häufig erst möglich und auch erforderlich durch die imperiale Sprache und die jeweiligen imperialen Denksysteme.
Max Weber kam in seinen intensiven Studien zu den Hochreligionen immer wieder darauf zurück, nach den spezifischen Vernunftvermögen und der Zweckrationalität zu suchen, die in ihnen gesellschaftswirksam inkorporiert sind. Dabei deckte er viele verschiedene Entwicklungslinien auf, die mit den Hochreligionen verknüpft sind, und seine Analysen über den Konfuzianismus und die hinduistischen Religionen werden heute immer noch als besonders intensive, seinen Prinzipien der verstehenden Soziologie verpflichtete Auseinandersetzung mit dem Denken einer fremden Kultur gelesen. Und es war auch Max Weber, der um die Jahrhundertwende die uns noch heute erregende Frage stellte: Warum entstand gerade in Mitteleuropa ausgehend vom Mittelmeer so etwas wie eine Form des Denkens, die wir als Rationalität bezeichnen? Nicht Vernunft im Sinne der Aufklärung, nicht dezidierte, entscheidungsfähige Vernunft ist damit zwingend gemeint; das gewiss auch. Vor allem aber Zweckrationalität, also eine Rationalitätsform, die sich dadurch auszeichnet, dass für definierte, vorgegebene Ziele die kostengünstigsten Mittel verwendet werden. Diese Form der Rationalität meint Max Weber primär, wenn er vom okzidentalen Rationalismus spricht. Warum geschieht das gerade unter (west-)europäischen Bedingungen? Max Weber exponiert diese Leitfrage seines soziologischen Werkes im ersten Band seiner religionssoziologischen Studien, wo auch die große Arbeit »Protestantismus und der Geist des Kapitalismus« enthalten ist. Er sagt in seiner berühmten Vorbemerkung:
Universalgeschichtliche Probleme wird der Sohn der modernen europäischen Kulturwelt unvermeidlicher- und berechtigterweise unter der Fragestellung behandeln: welche Verkettung von Umständen hat dazu geführt, daß gerade auf dem Boden des Okzident, und nur hier, Kulturerscheinungen auftraten, welche doch – wie wenigstens wir uns gern vorstellen – in einer Entwicklungsrichtung von universeller Bedeutung und Gültigkeit lagen.2
Damit ist, das sei gleich betont, eine Verkettung von historischen Konstellationen gemeint, nicht etwa von »rassischen«. Denn dort, wo Rationalität in einem uns verständlichen Sinne entstand, etwa in den ionischen Gebieten zwischen Griechenland und Vorderasien, war das kulturelle Milieu durch Vermischung und Austausch von Völkern und Volksgruppen charakterisiert.
Ein weitsichtiger Denker und Sozialforscher, Karl Polanyi, der bis heute in seiner Bedeutung unterschätzt ist, hat in einem Buch, das auch auf Deutsch mit dem englischen Titel »The Great Transformation« erschienen ist,3 einmal gesagt, das westliche Denken gründe sich auf drei Formen des Wissens: erstens das Wissen um den Tod, also die Endlichkeit, die Diesseitigkeit des Menschen, zweitens das Wissen um die Freiheit und drittens das Wissen um die Gesellschaft, als ein Wissen darüber, dass die Menschen die Bedingungen ihres Lebens immer selbst erzeugen müssen. So ist etwa die Herstellung einer haltbaren Stadt ein wesentlicher Baustein für die Entwicklung dessen, was man westliches Denken nennen kann. Demnach ist Verfassungsdenken, politisches Denken im emphatischen Sinne, von okzidentaler Rationalität nie ganz abtrennbar.
Seit den Vorsokratikern ist die Frage nach der Freiheit ein bohrendes Thema. Was ist ein freies Leben, was ist ein befreites Leben, was ist überhaupt Freiheit? Was ist Autonomie, was autarkes Wirtschaften eines Gemeinwesens? Mit Sokrates und Antigone existieren sehr frühe und berühmte Beispiele für die Autonomie des Eigensinns, der so weit reicht, sich von der Gesellschaft töten zu lassen. Dabei sind beide nicht gefangen: Sokrates kämpft vielmehr mit der Macht des inneren Daimonion, mit dem (autonomen) Gewissen, um es modern auszudrücken. Und Antigone klagt unnachgiebig ein archaisches Recht der Beerdigung ihres Bruders ein, gegen Kreon, gegen den Nomos, gegen die Gesetze der Stadt; eine Rechtskollision, wie Hegel das nennt. Stoßen bei Antigone noch archaische Sitte und das neue Recht der Polis aufeinander, so haben wir spätestens bei Sokrates wenigstens so etwas wie den Vorschein eines Individualraums von Freiheit und Freiheitsbewusstsein.
Ich will nicht ausführlich darüber reden, was diese Aussage von Polanyi mit dem Wissen um den Tod bedeutet. Gemeint ist augenscheinlich das Wissen um die Endlichkeit des Menschen, dem immer das Bedürfnis nach Unsterblichkeit korrespondierte. Aber wie Kant gesagt hat: Das Bedürfnis nach Gott ist kein Beweis seiner Existenz. Deshalb ist die Arbeit an der Endlichkeit ein Element westlicher Rationalität. Man kann es auch so ausdrücken, das Wissen um die Endlichkeit führt dazu, dass die Menschen darangehen, so etwas wie eine diesseitige Unendlichkeit herzustellen, das heißt etwas zu begründen, was bleibt, was den Wandel der Zeiten überdauert. Man kann die europäische Stadt als solch ein Phänomen betrachten. Die Stadt ist eine der großen Gründungen mit politischer Substanz – die bewusst gestaltete Stadt, nicht Babylon, als ein sich ausweitender Aufenthaltsort von Flüchtenden, Menschen, die aus aller Welt kommen, nicht die mesopotamischen Städte, sondern konstituierte Staaten, die durch Verfassungen gefestigt sind, was in Griechenland erst 600, 500 v. Chr. beginnt.
Es gibt verschiedene Facetten, die darauf hindeuten, dass sich hier sehr früh Entwicklungen im Mittelmeerraum vollziehen, die einen wesentlichen sozialen Hintergrund der Genesis westlicher Rationalität darstellen. Die antike europäische Kultur ist gleichermaßen eine Küstenkultur und eine Stadtkultur. Vieles, was an Denkkategorien entsteht und sich über Jahrhunderte weiterentwickelt, hat mit der Stadt zu tun als eine der großen abendländischen, überaus politischen Erfindungen, die fundamental in den Prozess der Rationalisierung involviert sind. Fraglos hat es große Städte in anderen Bereichen außerhalb des Mittelmeerraums gegeben, hier aber geht es, wie wir noch sehen werden, um eine bestimmte Form der Stadt: um die konstitutionalisierte Stadt, die durch bewusste Gesetze und bewusste Regeln zusammengeführte, lebensfähig gehaltene und gleichsam ideell ummauerte Stadt.
Max Weber genügt die Entwicklung solcher Städte jedoch nicht als Antwort auf seine übergeordnete Frage, warum sich gerade im Mittelmeerraum eine spezifische Form des Denkens herausgebildet hat. Er geht vielmehr noch weiter und stellt die Anschlussfrage, warum sich diese spezifische Stadtentwicklung nur im Okzident ereignete. Nur in diesem Kulturraum gibt es Wissenschaft in einem Entwicklungsstadium, das wir heute als gültig anerkennen, nämlich eine empirische Wissenschaft, die sich auf Beobachtung und Experiment gründet. Diese ermöglicht einen weltgestaltenden und -verändernden Zugriff auf die äußere Natur, der als zentral für das europäische Projekt der Naturbeherrschung anzusehen ist – wie auch immer man diesem gegenüberstehen mag. Beobachtung und Experiment sind die zwei Methoden, die das westeuropäische Denken seit der Renaissance und dann mit aller Macht in modernen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften ausmachen.
Nicht weniger bedeutend ist für Max Weber die Entstehung des Fachbeamten, also der Rationalisierung der politischen Sphäre, von Herrschaft und Verwaltung. Nun kann man sich darüber streiten, ob das wirklich so eine riesige Errungenschaft ist – das hat ja bekanntlich auch zweifelhafte Züge –, aber Weber will beschreiben, was einen Fachbeamten von einem Hochbeamten unterscheidet. Das Fachbeamtentum beruht darauf, dass allmählich so etwas wie ein rationaler Staatsapparat entsteht, der eine historische Konstanz aufweist, die über die schnelleren Wechselspiele an der politischen Oberfläche weit hinausgeht. Niemand überlebt gesellschaftliche Katastrophen so unbeschadet wie der Fachbeamte, wie sich etwa an den Kontinuitäten des deutschen Verwaltungsapparats veranschaulichen lässt, der vom Kaiserreich bis in die Bundesrepublik existiert und Revolution, Faschismus und die sogenannte »Stunde Null« überstand. Im Fachbeamten entsteht also so etwas wie eine Verwaltungsschicht, die eine entsprechende Verwaltungsrationalität verkörpert. Neben einer Wissenschaft mit bestimmten Merkmalen, die wir noch genauer nachzeichnen wollen, ist es ein Fachbeamtentum, das wesentlich auf Verwaltung, also Verwaltung unter Gesichtspunkten der Rationalität, der Zweckrationalität, gerichtet ist, was die Neutralisierung der verfolgten politischen Ziele bedingt. Die entpolitisierte Erziehung des Fachbeamten ist die besondere Qualität und die habituelle Voraussetzung der Verwaltungsrationalität. Dieser soll sich nicht darum kümmern, wer die Befehle gibt, sondern prüfen, wie sie möglichst ökonomisch umzusetzen sind. Die Entstehung eines solchen Fachbeamtentums findet sich in keiner anderen Kultur. Im kaiserzeitlichen China waren die Beamten alle Hofbeamte. Sie sind selbstverständlich Hofbeamte und verstehen sich auch nicht anders. Sie sind im Herrschaftsgefüge ausführende Organe. Das wird hier in Europa mit Friedrich dem Großen anders, wodurch das Fachbeamtentum in der Verwaltung, aber vor allem auch in der Entstehung einer Gerichtsbarkeit mit dem Fachbeamten als Richter ein gewisses Maß an Unabhängigkeit gewinnen kann. Ob man dafür Colbert in Frankreich unter Ludwig XIV. oder die Fachbeamten in der Verwaltung von Friedrich dem Großen anführt, sie alle wahrten stets eine bestimmte Unabhängigkeit gegenüber dem Fürsten.
Die absolut unentrinnbare Gebanntheit unserer ganzen Existenz – da wird Max Weber geschichtsphilosophisch –, der politischen, technischen und wirtschaftlichen Grundbedingungen unseres Daseins in das Gehäuse einer fachgeschulten Beamtenorganisation, den technischen, kaufmännischen, vor allem aber den juristisch geschulten staatlichen Beamten als Träger der wichtigsten Alltagsfunktionen des sozialen Lebens hat kein Land und keine Zeit in dem Sinne gekannt wie der bürgerliche Staat und der moderne Fortschritt, dessen Dialektik Weber an keiner Stelle unterschlägt. Mit diesem Fachbeamten ist auch das »stählerne Gehäuse der Hörigkeit«, sind die Versteinerungen des lebendigen Gemeinwesens verknüpft. Diese Verkörperung von Rationalität durch Verfahrensrationalität sieht Max Weber als eingehendes Merkmal des okzidentalen Denkens (und Handelns). Dieses Fachbeamtentum hat etwas mit dem Lebensbeamtentum zu tun, ist der Wahlbeamte doch weitestgehend aus dem europäischen Zentrum verschwunden. Hier, und darin liegt ein Unterschied zu den Vereinigten Staaten, werden Richter und andere Beamte nicht gewählt. Das gilt auch heute noch in Deutschland bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht, selbst wenn dieses durch die Parteiopposition vordefiniert ist. Also die hochgeschulten Beamtenorganisationen erfahren ihre spezifische (Verfahrens-) Rationalität durch die hierarchische Ernennung.
Historisch reicht diese Entwicklung abermals in die Antike zurück, in die antike römische Gesellschaft als eine juristische Gesellschaft, die ihr soziales Leben mit ungeheuer entwickelten gerichtlichen Verfahren formte. Natürlich war das Römische Reich eine Klassengesellschaft, aber es war auch eine seit frühester Zeit durchorganisierte Gesellschaft mittels Verfahrensregeln, deren Anfang in den Zwölf Tafeln gesetzt ist. »Wenn du zu Gericht gerufen wirst, musst du kommen«, schreibt das Zwölftafelgesetz vor. Erscheint der Angeklagte nicht, kann er gerufen werden. Ist er nicht in der Lage, aus eigener Kraft zu kommen, weil er zu alt ist, muss der Ankläger ihm einen Planwagen zur Verfügung stellen. Damit haben wir schon 450 v. Chr. ein Gesetz, das eindeutige Verfahrensregeln beinhaltet. Das heißt, bereits hier liegt eine Form der Verfahrensrationalität vor, die sich spezifisch auf die juristische Verwaltung des Gemeinwesens bezieht. Der Prätor ist dabei jener Beamte, der dem Gericht vorsitzt, ein Privileg, das der ihm übergeordnete Konsul nicht genießt. Die Organisation der Beamten ist also mit Kompetenzhierarchien und Abgrenzungen verknüpft. Selbst der Souverän kann nicht willkürlich bestimmen und sich über die Verfahrensregeln hinwegsetzen.
Ein berühmtes Beispiel stammt aus anderer Zeit, von Friedrich dem Großen: Als Müller Arnold im Rechtsstreit um die Nutzungsrechte seiner Mühle vor Gericht unterlag, konnte er Friedrich II. dazu bewegen, für ihn Partei zu ergreifen. Er bewirkte eine Wiederaufnahme des Verfahrens, welches allerdings auch in zweiter Instanz mit einem Urteilsspruch zuungunsten des Müllers endete. Daraufhin ließ Friedrich II. die verantwortlichen Richter verhaften und selbst vor Gericht stellen. Dieses verweigerte jedoch die Verurteilung von Kollegen, worauf dem König nur noch die Möglichkeit blieb, selbst dem Müller Schadensersatz zuzusprechen und die Richter zu verurteilen. Die Unabhängigkeit des Justizapparats war also schon derart fortgeschritten, dass Friedrich II. nichts anderes übrigblieb, als mittels offener Machtanmaßung seinen Willen durchzusetzen. Um 1740 hatte sich in Preußen so etwas herausgebildet wie ein selbstständiges Bürgertum, auch mit dem Bewusstsein solcher Kompetenzabgrenzungen und Souveränitätseinschränkungen. Das meint Max Weber mit dem Fachbeamtentum und der Verfahrensrationalität als einem Element der okzidentalen Rationalität, wie sie etwa im China der Kaiserzeit undenkbar war: Die Mandarine entschieden selbstverständlich völlig selbstherrlich und ohne konstitutionelle Begrenzungen über solche Dinge.
Das dritte zentrale Element im okzidentalen Prozess der Rationalisierung ist der moderne Kapitalismus. Max Weber sagt, dieser könne erlernt werden, und – so heißt es in der Schrift über den Konfuzianismus – den Japanern als fleißigen Menschen falle das relativ leicht, aber entstanden ist der Kapitalismus in Japan nicht.4 Gerade die gegenwärtige Krise der japanischen Gesellschaft besteht darin, dass die alten Strukturen, von denen dieser Kapitalismus gelebt hat, also Formen der Familienselbstausbeutung und der feudalen Gefolgschaften, nicht zuletzt durch eine gewisse Unabhängigkeitsbewegung von Frauen in Auflösung begriffen sind und ökonomisch in Schwierigkeiten geraten. Lernfähige Menschen haben sich einen entsprechenden Erwerbsgeist auch in Japan angeeignet, wo der Kapitalismus auf eine überdauernde Feudalstruktur gesetzt wurde. Diese Strukturen stellen aber nicht den genuinen Boden dar, auf dem der Kapitalismus entstanden ist.
Was ist Kapitalismus für Max Weber? Es ist nicht Geldgewinn. Erwerben, streben nach Gewinn, nach Geldgewinn, nach möglichst hohem Geldgewinn, ist nicht genuin kapitalistisch. Dieses Streben ist viel älter und universeller. Dieses Gewinnstreben ist bei Kellnern, Ärzten, Kutschern, Künstlern, Kokotten, bestechlichen Beamten, Soldaten, Räubern, Kreuzfahrern, Spielhöllenbesuchern, Bettlern gleichermaßen zu finden, aber es ist nicht Kapitalismus. Schrankenlose Erwerbsgier ist nicht im Mindesten gleich Kapitalismus, noch weniger gleich dessen Geist. Doch wenn er nicht auf Geldgier und Habsucht zu reduzieren ist, alles Eigenschaften, die wir schon in der archaischen Literatur bis hin zum Gilgamesch-Epos finden, was ist dann das historisch Spezifische am Kapitalismus? Was ist die Essenz dieser Produktionsform? Industrialisierung ist sicherlich ein Element davon, Marktwirtschaft ein weiteres. Akkumulation, erweiterte Akkumulation, Arbeitsteilung wären die nächsten Stichworte. Aber wie wird produziert? Machtausübung, Akkumulation, das finden wir auch in römischen oder mittelalterlichen Zusammenhängen.
Wesentliche Voraussetzung ist das Privateigentum an Produktionsmitteln! Von entsprechender Bedeutung ist für Weber daher die Betriebsförmigkeit beziehungsweise die betriebsförmige Organisation der kapitalistischen Produktion, die deren ununterbrochene, rastlose Kontinuität gewährleistet. Der zweite wesentliche Punkt ist das Aufbringen formal freier Arbeitskraft über den Markt, was Marx unter ökonomischen Gesichtspunkten als Ausbeutung bezeichnet. Der Markt muss nicht nur die Güter, die Produktionsmittel, sondern auch die Arbeitskraft selbst als Ware erfassen. Die Zwiespältigkeit der Ware Arbeitskraft ist eine wesentliche Voraussetzung für den betriebsförmigen Kapitalismus. Die Arbeiter sind nicht mehr persönlich abhängige Gefolgschaften und können nicht mehr gehalten werden, sondern sie werden für bestimmte Zeiten für eine betriebsförmige Produktion angeworben und können auch wieder abbestellt werden. Der Verkauf der Ware Arbeitskraft ist ein wesentliches Element möglicher kapitalistischer Kalkulationen. Den Großspekulanten-, Kolonial-, Finanzierungskapitalismus und auch den Handelskapitalismus hat es bereits vor 1600 gegeben, schon im Frieden, vor allem jedoch als spezifisch kriegsorientierten Protokapitalismus. Aber der Okzident kennt in der Neuzeit auch eine ganz andere und nirgends sonst auf der Erde entwickelte Art des Kapitalismus: die rational-kapitalistische Organisation von formell freier Arbeit. Entwickelter Kapitalismus entsteht erst, wenn der Arbeiter selbst Eigentümer seiner Arbeitskraft ist. Dass wir es mit formal freien Menschen zu tun haben, ist für Weber wie für Marx ein Spezifikum der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und bedingt eine ganz andere Produktionsweise.
Wie war es in der römischen Gesellschaft? Dort existierte Sklaverei, und der Sklave war als ganze Person, nicht nur mit seiner Arbeitskraft, eine Ware. Die großen Latifundien und die großen Bergwerksgesellschaften sind kapitalistische Unternehmen, aber nicht mit freier Lohnarbeit. Kapitalismus hat es also zu tun mit über den Markt vermittelter Ausbeutung, mit der Verwendung formell freier Arbeitskraft. Max Weber sagt bewusst formell frei, er sagt nicht, dass sie frei sei.
Das ist Kapitalismus, wie er im Westen entstanden ist. Wie wir gesehen haben, ist er auch andernorts schnell zu erlernen, und niemand hat das so eindrücklich bewiesen wie die Japaner, die zunächst einmal viel stärker in der Kriegsproduktion tätig waren. Die ganzen Samurai-Traditionen, die ganzen feudalen Traditionen sind eher auf Krieg aus, und solche aggressiven Kräfte, das hat sich auch im Nachkriegsdeutschland gezeigt, sind offenbar gut auf die Produktion zu übertragen. Man kann sie in die kapitalistische Produktion umlenken, aber sie sind nicht in ihr entstanden.
In diesem Zusammenhang ist Marx sehr zwiespältig. Auf der einen Seite polemisiert er entschieden gegen Utopisten, die sich gleichsam ein Reich neben diesem geschichtsmächtigen Projekt Kapitalismus aufbauen und Freiheit herstellen wollen, ohne die Freiheit der Märkte zu beseitigen, die Ideen ohne ein materielles historisches Korrelat realisieren wollen. Marx hofft natürlich, dass die lebendige Arbeitskraft in ihren kollektiven Bindungen durch die Arbeiterbewegung den Kapitalismus zum Kippen bringt und nicht einfach etwas daneben aufbaut. Das war ja die Tragödie der Sowjetunion, dass gleichsam der prosperierende Kapitalismus weiterlief und man daneben das Reich der Freiheit aufzubauen gedachte. Das hat Marx nie so gesehen, sondern nur auf der Grundlage der entwickelten kapitalistischen Produktion lässt sich so etwas machen. Das Wort Kapitalismus ist bei Marx nicht ein Substanzbegriff. Er spricht von kapitalistischen Produktionsweisen, von kapitalistischer Ausbeutung, das heißt also, Kapitalismus gibt es nur in adjektivischer Form. Das Wort Kapitalismus stammt im Grunde in der Breitenwirkung von Werner Sombart, der 1902 ein Buch veröffentlicht hat: »Der moderne Kapitalismus«. Erst mit diesem Werk ist Kapitalismus zu einer Art Substanzbegriff und zu einem (politischen) Agitationsbegriff geworden. Im Grunde war er zu Anfang des Jahrhunderts zunächst ein Denunziationsbegriff der Sozialdemokratie, den Marx, der ein sehr vorsichtiger Denker war, mit Bedacht vermied. Wie häufig er Formulierungen ausprobierte, bevor er sie niederschrieb, zeigen die Überlieferungen.
Zurück zu Weber: Mit der Betriebsförmigkeit der Produktion ist die Trennung von Haushalt und Betrieb verknüpft. Eine strikte Durchführung getrennter Bilanzen, also die Trennung der Betriebsgewinne und gleichsam dessen, was der Kapitalbesitzer für sich privat abziehen kann. Natürlich sind diese Grenzen nie eingehalten worden. Für Weber ist das nicht zuletzt sehr wichtig, weil diese Dinge zunächst in der Staatsorganisation entwickelt wurden, nämlich in der preußischen Domänenverwaltung. Die Hohenzollern haben in der Domänenverwaltung, das heißt in der Verwaltung von Staatsgütern, ein striktes Regime geführt, wobei sie Management und das, was an Gewinnen erwirtschaftet wurde, streng trennten.
Es soll hier noch auf einen Bereich hingewiesen werden, der in seiner Wirksamkeit nicht so offensichtlich zeigt, was Rationalität ist. Weber sagt, dass die Rationalisierung auch in der Kultur allmählich eine Form annimmt, die sich sehr gut an der Entstehung der okzidentalen Musikalität studieren lässt. Es gibt eine hochinteressante Schrift von Max Weber über die rationalen Grundlagen der Entstehung von Musik,5 wo er zeigt, dass in allen Völkern gesungen wurde, ihre Musikalität sehr verschieden war und keineswegs die mitteleuropäische Musikalität, das Deutsche oder so, besonders ausgeprägt war, und sich trotzdem im Zentrum Europas so etwas wie eine hochdifferenzierte, an der Fuge orientierte Form der Musik entwickelte. Es entsteht ähnlich wie in der Kunst eine differenzierte Musikalität, die jetzt auch etwas wie ein Modell der Rationalität abgibt. Das musikalische Gehör war bei anderen Völkern eher feiner entwickelt, als es das unsere heute ist, jedenfalls nicht minder fein. Polyphonie verschiedener Art war weithin auf der Erde verbreitet. Auch das Zusammenwirken einer Vielzahl von Instrumenten findet sich anderswo, und alle unsere rationalen Tonintervalle waren anderwärts ebenfalls bekannt. Aber rationale harmonische Musik, sowohl Kontrapunktik wie Akkordharmonik, die Bildung des Tonmaterials auf der Basis der Dreiklänge, unser Orchestermodell mit dem Streichquartett als Kern, die Organisation des Bläser-Ensembles und der Notenschrift, entwickelt in Europa ein entfaltetes, rationales Musikwesen sui generis. Doch so offensichtlich das erscheint, so schwierig bleibt die Frage nach dem Warum.
Der Widerspruch zwischen der Musikalität im Alltag und dem Kunstlied, dem Schubert-Lied, also auch die Liedtradition, die romantische Liedtradition, hat sich gewaltig geändert. Das sind, sagt Weber, abgesehen von der Kunst der Fuge oder dem wohltemperierten Klavier, völlig durchorganisierte rationale und doch sehr kunstfertige Experimente mit Tönen. Die Erweiterung der Orchester, wie er sagt, mit dem Modell des Streichquartetts, in das Modell der Sinfonie entfaltet eine musikalische Tradition höchster Rationalität. Das geht nicht nur von Bach, sondern auch von den Italienern seiner Zeit aus, von denen Bach sehr viel übernommen hat. Diese Form rational durchorganisierter Kontrapunktik ist ein Produkt der Mittelmeerkultur. Man kann diese ästhetischen Phänomene auf einen durchrationalisierten kapitalistischen Betrieb und eine durchrationalisierte Verwaltung beziehen, weil das Prinzip der Kalkulation in all diesen Bereichen zentral ist, und natürlich auf das Prinzip, auf das es Max Weber hier ankommt, die Zweckrationalität. Wobei dennoch viele Elemente freigesetzt werden, die zur Differenzierung von Gefühlen und Gefühlsqualitäten führen.
Wenden wir uns wieder der Antike zu. Im Folgenden geht es um Texte, die keine Urtexte sind, wie Heidegger sie manchmal behandelt, als ob da das Sein selbst rede und sich entberge. Es geht vielmehr um das Aufspüren von Ansätzen, in denen sich der moderne Begriff von Rationalität allmählich herauskristallisiert. Zuerst wird zurückgegangen auf die sogenannten Vorsokratiker, also jene Naturphilosophen, die am Ionischen Meer ansässig waren und sich über Gott und die Welt Gedanken gemacht haben. Von ihnen sind, wenn auch nicht sehr zahlreich, ganz verschiedene Fragmente überliefert. Von manchen, etwa von Heraklit, einem der berühmtesten, gibt es nur wenige Sätze, die überliefert sind. Andere sind später kommentiert worden, das heißt sekundäre Überlieferungen.
Die Leitfrage dabei ist, wie sich allmählich aus dem Mythos das rationale Denken herausschälte. Natürlich waren sie alle noch darum bemüht, den Mythos zu respektieren, wäre alles andere doch zu gefährlich gewesen. Sie beziehen sich auf Homer oder Hesiod, ihre großen Vorläufer, die sich mit der Stadt, mit der Entstehung der Erde, mit dem Prinzip des Weltalls, mit Denken und dem Denken des Denkens beschäftigten. An solchen Texten gilt es zunächst, den sogenannten Übergang vom Mythos zum Logos zu entschlüsseln.
Die Geografie der antiken Philosophie: Küstenstädte und Kolonien
Vorlesung vom 11. April 2001
Mit Max Weber haben wir zunächst die Frage nach historischen Konstellationen gestellt, die es ermöglichen, dass in einer bestimmten Kultur etwas geschieht, eine Entwicklung einsetzt, die sich von jenen in anderen Hochkulturen deutlich unterscheidet. Dabei geht es nicht darum, einzelne Kulturen zu bewerten, sondern ausschließlich um geschichtliche Bedingungen, unter denen eine Hochkultur einen charakteristischen Zug annimmt, der etwas wie eine Überlieferungstradition nach sich zieht. Denn das ist ein zweiter Aspekt, ob irgendetwas an irgendeinem Punkt der Welt entsteht und wieder zugrunde geht oder ob hier Überlieferungen stattfinden, die über Jahrtausende gehen, wobei – für Weber vielleicht weniger als für spätere Forscher – das Mittelalter wichtig ist.
Das Mittelalter selbst enthält in seinen Konstellationen vieles von dem, was später in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zum Tragen kommt. Das sogenannte »dunkle Mittelalter«, das so dunkel nicht war, wie es das Verdikt der Aufklärung gemacht hat, lässt sich nicht auf eine ereignisarme Zeit reduzieren, selbst abgesehen von ewig währenden Kriegen und der jahrhundertelangen Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Adel. Die moderne Forschung ist weiter und unterstreicht, die architektonischen und technischen Entwicklungen des Mittelalters seien wichtige Voraussetzungen der Moderne gewesen, immerhin entstand die Drei-Felder-Wirtschaft und vieles andere, nicht zuletzt die Antizipation modernen Denkens im Universalienstreit.
Es geht Max Weber um die Frage, warum jetzt und gerade hier? Er stellt diese Frage post festum, vom Resultat her, von der Entwicklung, wie sie geschehen ist. Er will nicht nach einzelnen Ursachen forschen, sondern betont immer wieder, entscheidend seien Konstellationen, folglich sehr viele Faktoren, die zusammen betrachtet werden müssen. Denn viele Dinge, subjektive, objektive, auch geologische, geografische Faktoren der Raumausdehnung, der Aufteilung, müssen zusammenkommen, damit etwas entsteht, was eine gewisse, wie man heute sagen würde, Nachhaltigkeit entfaltet, also eine Erbschaft hinterlässt, von der wir heute ausgehen, mit der wir heute arbeiten, in der wir heute denken.
Die antike griechisch-römische Kultur ist eine Küstenkultur. Das heißt, sie hat eine spezifische geografische Lage. Alle großen Städte sind in Küstennähe angesiedelt, was schon gleichsam in sich eine bestimmte Aufforderung technischer Art enthält, nämlich einen entwickelten Schiffsbau, gilt es doch die Werkzeuge selbst zu produzieren, mit denen man sich bewegt. Gleichermaßen ist ein Drang zum Handeln und zur Piraterie, zur Räuberei festzustellen; die Schiffsräuberei im Mittelmeer ist wenigstens so gut dokumentiert wie der Handel. Warum die Menschen sich an den Küsten niedergelassen haben, ist entweder sehr einfach oder gar nicht zu erklären. Wer sich auf das Meer einlässt und die Werkzeuge produziert, sich zu schützen, der wird dies naheliegenderweise in Meeres- oder Flussnähe tun. Entsprechend war es für Athen ein großes Problem, dass es nicht direkt am Meer lag und deshalb diese berühmte lange Mauer zum Hafen Piräus erbauen musste, was wiederum Anlass zum Krieg mit anderen Städten bot.
Des Weiteren ist die antike griechisch-römische Kultur eine Stadtkultur, wie bedeutend auch immer der Grundbesitz auf dem Lande gewesen sein mag. Letzterer war nicht bestimmend für das Leben in dieser antiken Welt, sondern die Mühe um Eudaimonia, das Wohl und Wehe der Stadt, was über Jahrhunderte viel Energie und sehr viel Denkkraft in Anspruch nahm. Dabei ging es nicht nur darum, dass man sich in der Stadt versammelte und aufhielt, sondern wie die Stadt überhaupt aussah. Die politische Struktur der Stadt in Griechenland ist in einer Weise Gegenstand des Denkens wie sonst nirgendwo in der damaligen Welt.
Und schließlich ist es eine Sklavenkultur. Die griechisch-römische Gesellschaft beruht auf Sklaverei, weshalb die Ressourcen wiederum verknüpft sind mit kriegerischen Unternehmen; der Mittelmeerraum war ein kriegerischer Raum. Es geht nicht nur darum, zu verteidigen, sondern wer sich wohlfühlte, ging auf Raubzug. Wer glaubte, besonders viel rauben zu können, ging auch große Risiken ein, und immer wieder sind ganze Städte zerstört worden. Mit anderen Worten: Eine primäre Ressource dieser Wirtschaftsform ist der Krieg. Eine der Bedingungen, wieso sich diese Ressource allmählich erschöpfte, ist nach Weber übrigens das Eindringen des Christentums in den römischen Seelenhaushalt. Am Ende waren nicht mehr genügend Arbeitskräfte, also Sklaven da, sodass sich ein Wandel vollziehen musste hin zu Gefolgschaften, die auf gegenseitiger Abhängigkeit beruhten, auf Fürsorglichkeit gegenüber dem arbeitenden Untergebenen.
Diese drei Faktoren, Küstennähe, Stadtkultur und Sklaverei, sind zunächst einmal im Mittelmeerraum lokalisiert. Natürlich hat es Sklaverei und Küstenstädte auch in anderen Regionen gegeben. Deshalb ist es ja eben eine Frage der Gesamtkonstellationen, die dazu führen, einen bestimmten Zuschnitt der Kultur zu erzeugen. Wenn man davon ausgeht, dass es sehr verschiedene Bedingungen für die Mittelmeerkultur gibt, dann spielt auch die geografische und geologische Struktur eine Rolle. Gerade die französische Annales-Schule hat sich darum bemüht, den Mittelmeerraum unter dem Gesichtspunkt verschiedener Konstellationen zu untersuchen, wobei auch das Wetter eine signifikante Rolle spielte. Wie sich das kulturell umsetzt, dazu kann man sehr verschiedene Gedanken entwickeln, und die Annales behaupten auch nicht, Wetter, Geologie oder Geografie seien die einzig wirksamen Faktoren. Und doch sei es nicht unbedeutend, dass zum Beispiel Friedrich II., der große Stauferkaisers der über ein riesiges Reich verfügte bis hin nach England und Ostfriesland, einstmals die Grenzen des Römischen Reiches, ausgerechnet in Sizilien residierte und nicht irgendwo in Mitteleuropa. Er sprach Arabisch, las und schrieb Griechisch und Lateinisch. Mit anderen Worten: Friedrich II. repräsentierte eine sehr kompakte Mischung von Kulturen.
Diese Forscher gehen davon aus, dass hier eine besonders zerklüftete und extrem gestaltete geologische Landschaft existierte, die tektonisch recht aktiv war. Es ist nicht klar, wie Menschen darauf reagierten, sicherlich mit Ängsten, vermutlich aber auch mit einer gewissen Sorgfalt im Umgang mit Bauten. Möglicherweise haben die Athener um 400 v. Chr. sicherer gebaut als die Griechen heute. Immerhin führt die Wahrnehmung der Naturgegebenheiten zu einem anderen Umgang auch mit den gesellschaftlichen Institutionen, die man für sich sichert, nicht nur durch Mauern gegen den Feind von außen, sondern auch durch einen sorgfältigen Umgang mit Strukturen, die man für das eigene Leben, aber auch für nachfolgende Generationen als wichtig erachtet. Das wäre ein Feld, in dem sich etwas wie eine gleichzeitig auf Abdichtung und auf Kommunikation gesetzte Zivilisation gründen könnte. Ich sage auch auf Abdichtung, denn häufig sind es unwegsame Gebirge wie in Griechenland, die eigentlich die Abdichtung befördern könnten, während gleichzeitig die Meeresnähe die Neugierde und das Interesse, sich zu vergrößern und auf Reisen zu gehen, hervorruft. Entsprechend ist die Zeit zwischen Homer und den Vorsokratikern, 800 bis 600 v. Chr. – die Lokalisierung ist sehr grob –, eine der sehr intensiven Perioden des Kulturaustausches.
Geologisch haben wir es also mit einer zerklüfteten und extrem gestalteten Landschaft zu tun, in der ein Klima herrscht, das von heiß bis kalt variiert. Hohe Berge und tiefe Täler, mit Flächen dazwischen. Die französischen Forscher gehen davon aus, und das ist jetzt meine Folgerung, dass es eigentlich eine geologische Konstellation, eine Landschaft ist, die sich vorzüglich für Mythenbildung eignet. Zum einen stellt sich, wer unter einem Berg lebt und nicht drüber kommt, vor, was hinter diesem Berg sein mag. Zum anderen sorgen tektonische Aktivitäten für vulkanologische Mythen. Offenbar ist deshalb gerade im Mittelmeerraum eine Mythologie mit einer derart ausdifferenzierten Gestaltungskraft entstanden, wie es sie sonst nirgendwo gibt, in nahezu keiner Hochreligion und in keinem Gebiet von Hochreligionen, die wir aus der Geschichte kennen. Man stelle sich einmal vor, was das für einen Griechen der Zeit nach Homer bedeutete, was der alles wissen musste, um als gebildeter Grieche zu gelten.
Die Erregung dieser kontrastreichen Landschaft wirkt hinein in das mythologische Geschehen, das eben nicht bezogen ist auf eine lineare Kausalität eines Gottes, wie es der jüdischen Religion entspricht. Wie diese Vielfalt die Menschen jahrtausendelang erregt hat, begreift, wer sich vor Augen führt, was in der griechischen Mythologie an legitimen und illegitimen Beziehungsgeflechten in den Himmel gesetzt ist. Und bis in die heutige Zeit hinein erscheinen Umgestaltungen der griechischen Mythen. Diese sind überwiegend bevölkert von fiktiven Figuren oder von Gestalten und Gestaltungen, die allenfalls Partikel realer Personen enthalten. Ob Odysseus wirklich existiert hat, wissen wir nicht. Dies sind Gestaltungen nicht eines einzelnen Menschen, sondern es sind Gestaltungen eines Volkes, das Lust am Fantasieren hat.
Meine These ist: Diese Mythologie ist die Grundlage eines differenzierten philosophischen Denkens. Menschen, die in dieser Weise Dinge mythologisch gestalten, vermenschlichen die Gegenstände der Natur. Demeter ist Natur, eine Göttin, die Naturqualitäten übernimmt, wie auch Poseidon der Gott des Meeres ist. Das heißt, diese Götter und Halbgötter haben alle ihre jeweilige Kompetenz und ihre Grenzen. Da ist ein ungeheurer Kompetenzhimmel und ein Kompetenzgerangel unter den Göttern, denn der Kampf spielt sich jetzt auch zwischen ihnen ab. Das ist unvergleichlich anders als zum Beispiel das biblische Geschehen, wo alles sehr einfach abläuft. Dort steht am Anfang der Urvater, Abraham, und dann geht es über Isaak, Jakob und die Generationen, 13, 14 Geschlechter bis zum Ende, worauf auch schon der neue Teil folgt. Da zeigten Griechen und Römer eine ganz andere Bildfähigkeit, und wir müssen davon ausgehen, dass diese so stark in ihrer Alltagsreligion verankert gewesen ist, dass es nicht nur eine Angelegenheit der Priester war, entsprechende religiöse Rituale zu praktizieren. Natürlich haben Priester eine zentrale Rolle gespielt, aber in den ursprünglich griechischen Staaten wie Athen oder Sparta haben sie nicht dieselbe Bedeutung gehabt wie in der Römischen Republik und in der späteren römischen Kaiserzeit.
Wenn Adorno und Horkheimer in ihrer »Dialektik der Aufklärung«6 sagen, der Mythos sei Aufklärung, und Aufklärung schlage am Ende in Mythos zurück, dann müssen wir fragen, was ist Aufklärung bei einer solchen Mythologie? Jedenfalls ist es die Reflexion darauf, dass Natur nicht chaotische Mannigfaltigkeit ist, weshalb eben Kompetenzen verliehen und Grenzen gesetzt werden; Denken hat etwas mit Grenzsetzung zu tun. Und wenn gesagt wird, Hera habe diese eine Funktion und keine andere oder Athene sei die Gerechte, Abwägende, dann liegt darin eine ungeheure kollektive Denkkraft. Zeus ist immer der Rabauke unter den Göttern gewesen; er ist ja auch durch eine Revolte gegen Kronos zur Macht gekommen. Überhaupt spielen Revolten eine Rolle, und auch Prometheus ist ein Rebell. Ein vergleichbares mythisches Geflecht von unzähligen kompetenten Halbgöttern und Göttern ist in dieser spezifischen, protorationalistischen Ausgestaltung nirgendwo bekannt.
Ich möchte hier von einer in den Himmel gesetzten Polis sprechen. Götter und Halbgötter gleichen handelnden Menschen, die ihre Kompetenzen haben und diese nicht überschreiten dürfen. Auch die Titanen, Halbgötter, dürfen nicht alles. Das heißt, es ist ein Handlungszusammenhang, der in der griechischen Tragödie noch einmal fassbar wird. So ist zum Beispiel im »Prometheus« des Aischylos, des ältesten dieser Tragödiendichter, ein ins Mythische versetzter Klassenkampf zu beobachten. Und wenn man Homer nimmt, hat man im Grunde handelnde Gestalten, die sich alle auf etwas Jenseitiges beziehen, dabei aber absolut diesseitig sind. Zeus etwa mit seinen Neigungen, zu betrügen, ist ein ganz gewöhnlicher Mensch.
In diesem Zusammenhang spielt es eine Rolle, dass die Menschen jetzt anfangen, die Welt nicht mehr ursächlich auf das zu beziehen, was von draußen kommt, von oben, von den Göttern. Diese Genealogie hat das Chaos als Grundlage, dann aber entstehen Gaia, die Erde, und Uranos, die Zyklopen, die Halbgötter, dann kommt Kronos und dann der Sturz des alten Titanengeschlechts durch Zeus. Das ist ein allmähliches Lösen aus dem Chaos, und wenn man hier von Aufklärung sprechen kann, ist es der Versuch, die Gegenstände, mit denen wir es zu tun haben, durch Wörter, Namen, zunächst Götternamen, zu bannen. Es geht weiter darum, bestimmte Kausalitäten in diese Gegenstände einzubringen und mit Namen zu verbinden. Zeus hat nicht die Möglichkeit, das Meer zu bewegen, obwohl er als einer der Obergötter gilt, sondern diese Möglichkeit hat Poseidon. Wenn Zeus eingreifen würde, würde Poseidon sich rächen, indem er irgendetwas an einer Stadt zerstört. Da sind Kausalitäten in den einzelnen Kompetenzen, Energien und Kräften, die aus dem Chaos etwas wie ein gegliedertes Ganzes machen. Der Begriff des Kosmos bezeichnet im Griechischen zweierlei: Es ist einmal der geordnete Zusammenhang und zweitens Schmuck. Der geschmückte Zusammenhang. Es muss auch gut aussehen, es muss harmonisch aussehen, denn es ist nicht nur Einheit, sondern geordnete Einheit. Deshalb lässt sich vorsichtig sagen, der Mythos sei etwas wie eine Vorform der Philosophie im Sinne eines ordnenden Denkens.
Schließlich fangen Philosophen wie Thales an zu sagen, woraus die Welt bestehe, was das Prinzip, , was der Ursprung der Welt sei. Er stellt fest, alles komme aus dem Wasser. Aber natürlich bleibt bei einer solchen Bestimmung nichts dauerhaft unbestritten. Schon folgt Anaximander: Nein, das Wasser sei es nicht, sondern das Feuer, denn man sehe ja wohl die Vulkane; man spricht vom Vulkanismus. Diese beiden Positionen von Thales und Anaximander mit Feuer und Wasser findet man übrigens im zweiten Teil des »Faust« noch einmal als Antwort auf die zentrale Frage: Was ist das Prinzip der Welt?
Hier artikulieren sich also Fragen, die sich aus dem Bedürfnis ergeben, das im Mythos bereits Zusammenhängende nun auch zu begründen und die mythologische Erklärung einer rationalen Kritik zu unterziehen. Der erste Akt dieser vorsokratischen Philosophen besteht darin, zu sagen, dass es sich dabei um Fantasien der Menschen handele. Weil sie aber den Mythos angreifen, sind die vorsokratischen Protoaufklärer bedroht und verschwinden aus ihren Ursprungsstädten. Und deshalb sind spätere Philosophen, die wissen, wie stark der Mythos in die bestehenden Herrschaftsverhältnisse eingebunden ist, immer zu sagen bemüht: Wir sind auch Freunde des Mythos. Daher rührt die Formulierung vom philosophos philomythos, der Philosoph ist ein Freund des Mythos, die nicht wahr ist: Er ist kein Freund des Mythos, er behauptet es nur als eine Absicherung gegenüber denjenigen, die ihm vorwerfen wollen, er sei wie schon Sokrates ein Verderber der Menschen und Sitten. Wenn man dem nachgeht, wie das abendländische Denken im antiken Griechenland entstanden ist und was die Konstellationen sind, in denen eine solche Art des Denkens, zum Beispiel disponierendes Denken und katalogisierendes Denken, verortet ist, dann ist die Vielgestaltigkeit der Mythen gegenüber dem Monotheismus eine komplexere Form der Wirklichkeitserfassung. Das ist doch sehr stark mit dem Begriff der okzidentalen, also westeuropäischen Rationalität verknüpft, in einem durchaus nicht linear besseren oder werthaltigeren Sinne, aber doch in einem charakteristischen Unterschied zu Denkformen anderer Hochreligionen.
Wenn man bedenkt, was Karl Polanyi über das Wissen um den Tod, das Wissen um die Freiheit und das Wissen um die Gesellschaft sagt, so spielt die Konstitution der Gesellschaft schon im Mythos eine zentrale Rolle. Dies lässt sich nachverfolgen in den großen Tragödien, die ganze Menschenmassen besucht haben. Tausende von Menschen haben diese Tragödien, auf die Bühne gebrachte Lebensgeschichten, inszenierten Mythos, gesehen. In der »Antigone« etwa geht es um nicht weniger als ein Prinzip der Gesellschaft, um die Polis: Ist sie imstande, sind die Gesetze Kreons imstande, altes archaisches Recht zu verletzen? Eine gestalterische Theatertradition in dieser Form, bei der gleichsam die Gesellschaft auf die Theaterbühne gebracht wird, ist aus anderen Regionen und Religionen nicht bekannt.
Mythos heißt erzählen. Mythopoios, der Fabeldichter, mythologos, der Fabelerzähler – eine ganze Vielzahl von Wortverbindungen ist mit dem Mythos verbunden –, mythoma, gesagte Erzählung, mythos, erste Regel, Wort, Äußerung, Ausspruch, ausgesprochener Gedanke, auch Spruch und Sprichwort, insbesondere öffentliche Rede … Mythos ist also auch, und das ist bemerkenswert, die öffentliche Rede, gerade keine Geheimsache, nichts Magisch-Praktisches. Der Rhetor, der Staatsmann und Redner, erreicht nichts im Volk, wenn er den Mythos nicht beherrscht und nicht mit ihm arbeitet. Also ist der Mythos eine öffentliche Angelegenheit. Wie überhaupt gesellschaftliche Öffentlichkeit, öffentliche Rede ein wesentliches Merkmal dieser griechisch-römischen Kultur ist. Dort wo Tyrannis entsteht, wird Öffentlichkeit beiseitegeschafft, was in der Regel zur Rebellion führt. Mythos: Rede, Wort, a) öffentliche Rede, b) Erzählung, Mitteilung, Bericht, Nachricht, Botschaft, Meldung, Kunde, Gespräch, Unterredung, Überlegung, Gedanke, Meinung, Willensbekundung, Beschluss, Abschlag, Plan, Rat, Vorschlag, Befehl, Bescheid im Auftrag, Gerücht, Gerede, verdichtete und sagenhafte Erzählung, alte Sage, Götter-, Heldensage, Legende, Erzählung und so weiter und so weiter. So ist sie, die griechische Sprache: Schon allein an diesem Wort Mythos lässt sich die Lust am Fabulieren wahrnehmen.
Die Frage, was der Mythos mit der Philosophie und ihren Denkformen zu tun hat, stellt sich in dem Augenblick, wo nicht mehr Chaos, Uranos, Zeus als Gründer der Welt auftreten und ihre Geschicke lenken, sondern Ursachenforschung betrieben wird. Politik ist bei den Vorsokratikern eine Art Naturalisierung des Mythos, das heißt, man fragt nach der Natur, nach den Naturkräften, nach Feuer und Wasser. Wer einen Blick auf die Heimatstädte vorsokratischer Philosophen wirft, erkennt eine sehr merkwürdige Konstellation: Da sind sehr bedeutende Denker, deren Fragmente man gefunden hat, an Schnittstellen von Kulturen. Man kann sie sich als Immigranten vorstellen. Es gibt keinen Vorsokratiker in Athen; in Sparta hat es überhaupt keine Philosophen gegeben. Die Vorsokratiker lebten auf Inseln und an den Rändern, also dort, wo Handel getrieben wurde. Zugespitzt: Wo Handel getrieben wurde, wurde auch gedacht. Hier tauchen die ersten Philosophen in unserem modernen Sinne auf: Sie bedienen sich bereits der Mittel der Logik, der Argumentation, der Kausalität, die dann bei Plato und Aristoteles ihre systematisierten Formen bekommen, aber hier zum ersten Mal in ihrer diesseitigen Gestalt auftauchen.
Griechischer Mythos und Polis
Vorlesung vom 17. April 2001
Wer darzustellen versucht, wie in einer spezifischen Konstellation geschichtlicher Umstände und geografischer wie geologischer Bedingungen bestimmte Denkformen entstehen, die sich über Jahrhunderte, vielleicht über Jahrtausende festigen und überliefert werden, wird mit dem Zufall rechnen müssen. Das Zufallsprinzip spielt bei der Entstehung von Hochkulturen eine große Rolle, allerdings nicht, was Grundbedingungen betrifft. So ist Wasser bei der Entstehung der Hochkulturen immer wesentlich, müssen bestimmte materielle Elemente offenbar vorhanden sein. Aber ob sich eine Entwicklung geschichtlich festigt und wie lange, hängt von sehr vielen Randbedingungen ab, die so voraussehbar nicht sind und die sich selbstverständlich auch verändern. Natürlich ist die Nil-Kultur, die ägyptische Hochkultur, abhängig auch von der Berechenbarkeit der Nilüberschwemmungen, von der daraus resultierenden Fruchtbarkeit. Aber warum diese Kultur, die etwa 2000 bis 3000 Jahre besteht, schließlich zugrunde geht und heute nur noch in den sichtbaren Überresten einer religiös, einer theokratisch bestimmten Kultur greifbar ist, das ist schwer zu sagen.
Es stellt sich also eine Frage, der man sich nur tastend nähern kann: Warum gibt es in der Mittelmeerkultur etwas, was man heute noch mit rationaler Erkenntnis verbindet, mit vielen Dingen, die uns selbstverständlich sind, die zwar immer in Frage gestellt werden, aber doch mit beispiellosem Erfolg durchhalten und sich ausbreiten? Drei Elemente sind es, die sich in der Mittelmeerkultur ausbilden, und zwar in einer sehr differenzierten, sehr gründlichen Gestalt: erstens der Mythos, zweitens die Stadt und drittens die Philosophie. Mythos, Stadt und Philosophie sind drei wesentliche Elemente, die in dieser Kombination nur hier entstehen. Es gibt keine andere Hochreligion, weder den Buddhismus noch den Hinduismus, noch die jüdische Religion, keine andere Hochreligion, die während ihrer Entfaltung mit diesen drei Elementen verknüpft war.
Theorie, theos, der Gott, das Schauen des Ganzen, bildet sich sehr früh aus, als ein Schauen des Gesamten. Bei der späteren Annäherung an die Vorsokratiker wird noch zu zeigen sein, wie einzigartig hier versucht wird, Erkenntnis von den praktischen und von den religiösen Erfordernissen abzukoppeln. So lässt sich feststellen, dass in der Zeit zwischen 800 und 500 v. Chr. etwas wie ein Theoriebewusstsein entsteht, das es sonst nirgendwo gibt. Kausal zu erklären, woher das kommt, dürfte angesichts der Masse an wirksamen Faktoren und ihres komplexen Zusammenhangs kaum möglich sein. Daher geht es um ein bescheideneres Vorhaben: zu zeigen, wie sich kleine Veränderungen zu einer Art Quantensprung verdichten.
Der Zeitraum der griechischen Kolonisation ist auch der Zeitpunkt, zu dem sich Philosophie allmählich bildet. Wie wir bereits gesehen haben, findet das auf einem Gebiet statt, das zum einen von zerklüfteter Landschaft und zum anderen von Vulkanismus geprägt ist. Natürlich spielt in einer Gegend, wo Ätna, Vesuv und Stromboli immer wieder aktiv sind, die Vulkanologie seit frühester Zeit eine zentrale Rolle. Die Mythologie ist als ein erstes Nachdenken über Ursachen, Kompetenzen von Göttern und Halbgöttern eine Reaktion auf diese spezifische Umwelt. Entworfen wird darin ein Fantasiegeschlecht, in dem Handeln stattfindet, das menschenähnlich ist und mit bestimmten Kompetenzen und Zuständigkeitsbereichen ausgestattet ist: Nicht alle dürfen alles überall. Kennzeichnend für diesen Mittelmeerraum ist es nun, dass es zwei große literarische Gebilde gibt, die den gesamten Vorrat der Mythen ordnen und zusammenfügen, in ein Epos bringen. Das eine sind die zwei Epen von Homer, »Ilias« und »Odyssee«, etwa um 900 entstanden, und das zweite sind die beiden Bücher von Hesiod, einmal »Theogonie« und dann »Werke und Tage«. »Theogonie« schildert die Genealogie der Götter, »Werke und Tage« aber ist noch wichtiger, weil hier gleichsam die ganze Landwirtschaft geordnet und die Welt nach landwirtschaftlichen Prinzipien organisiert wird, wobei Götter und Taten eine Rolle spielen. Arbeit ist hier eine wesentliche diesseitige Tätigkeit. Wir haben es hier mit einer Mythenbildung zu tun, die gegenüber den monotheistischen Religionen, auch gegenüber den schamanischen Religionen oder konfuzianischen religiösen Systemen etwas an sich hat, was die Fantasie und die Neugierde erhöht und vor allen Dingen das Denken erforderlich macht. Man hat es hier nicht mit Praktiken zur besseren Lebensgestaltung, sondern mit einer Art wohlgefälligen Anschauens einer sehr vielfältigen Welt zu tun.
Diese Mythen sind voller Gestalten, und ein Beispiel kann verdeutlichen, wie diese Verbindung von Gestalt und Denken aussieht. Nimmt man einmal solch einen Begriff wie Tyche. »Tyche ist eine Tochter des Zeus. Zeus verlieh ihr die Macht, über das Schicksal der Sterblichen zu entscheiden«,7 das heißt eine beliehene Macht. Der in der Rangfolge höhere Gott beleiht, stattet mit Kompetenz aus. »Manche beschenkt sie reich mit Gaben aus ihrem Füllhorn; anderen raubt sie alles, was sie besitzen«, eben so, wie das Glück gerade läuft. Tyche ist mit ihrem Tun völlig unberechenbar. »Ihr Spielzeug ist ein Ball, der die Zufälligkeit des Glücks darstellt.« Man muss sich vorstellen, dass jeder Angehörige dieser hellenistischen Kultur in jahrhundertelanger Übung bei der bloßen Nennung ihres Namens weiß, dass er es bei Tyche mit einer Figur, einer Gestalt, einer Göttin zu tun hat, die ganz bestimmte Aufgaben hat, mit der er sich ins Benehmen setzen muss, auf jeden Fall aber: von der er abhängig ist. »Aber sollte ein Sterblicher, dem sie ihre Gunst erwiesen hatte, sich seiner Reichtümer brüsten und nicht den Göttern einen Teil davon opfern oder damit die Armut seiner Mitbürger lindern, dann greift die alte Göttin Nemesis ein und erniedrigt ihn.« Zu bestrafen, ist nicht mehr die Aufgabe der Tyche, sondern da tritt eine andere, nämlich Nemesis, in Funktion und greift ein. Erneut sehen wir, wie arbeitsteilig und hierarchisch der Mythos funktioniert. »Die Heimat der Nemesis ist das attische Rhamnos. Sie hält in der einen Hand einen Apfelzweig, in der anderen ein Rad«, wobei beide spezifische symbolische Bedeutung haben. »Auf dem Kopf trägt sie eine silberne, mit Hirschen verzierte Krone. An ihrem Gürtel hängt eine Geißel. Sie ist eine Tochter des Okeanos und steht Aphrodite an Schönheit nur wenig nach. Es heißt, dass Zeus sich einst in Nemesis verliebte und ihr über Land und Meer nachstellte. Obwohl sie unaufhörlich ihre Erscheinung änderte, überlistete er sie zu guter Letzt in Gestalt eines Schwanes. Dem Ei, das sie gebar, entschlüpfte Helena, die Ursache des Trojanischen Krieges wurde.«
Anschließend werden ihre differenzierten und vielfältigen Kompetenzen und natürlich deren Variationen beschrieben. Selbstverständlich sind das kombinierte Überlieferungsstücke und Fragmente, und manchmal ist eine Variation gar das absolute Gegenteil der Ursprungsbedeutung. Aber dennoch stellt Nemesis eine Grundform dar, die Grundfigur der späteren Fortuna, die bei Machiavelli eine große Rolle für den Politiker spielt. Fortuna ist eben das Glück, was die Griechen, wenn es den Einzelnen bevorteilt, als kairos bezeichneten. Hier haben wir eine Form der Kompetenzabgrenzung vorgebildet, als ginge es beispielsweise darum, die Kompetenz des Richters von jener des Feldherrn zu unterscheiden.
Man muss sich das eigentlich sehr naiv vorstellen: Die Gesellschaft lebte davon, dass diese Form von Mythos und diese mythischen Gestalten das waren, woran ein Freund wiederzuerkennen, der Grieche vom Barbaren, der nicht dazugehört, zu unterscheiden war. Denn der Grieche weiß Bescheid über die Götter und kann ihre Kompetenzen nennen. Der Mythos ist ein Bildungszusammenhang und stiftet erstmals Zusammenhalt in der griechischen Welt. Weil sich in den großen Epen Homers eine Art Ordnung findet, können Adorno und Horkheimer zudem auch davon sprechen, der Mythos sei Aufklärung. Das ist er, insofern er bestimmte Kräfte bestimmten Gestalten zuordnet und sie kausal damit verknüpft, aber auch deren Grenzen benennt. Es gibt keinen allmächtigen Gott in der griechischen Mythologie und auch keine gesicherte Rangfolge. Zeus hat mit seinen ganzen Schweinereien und Ehebrüchen diesen Mythos mitgeprägt, aber er ist auch selbst immer wieder hintergangen und betrogen worden. Er hat sich als ein listiger Gott erwiesen, aber ein listiger Gott ist kein allmächtiger. Es gibt Ränge unter den Göttern, die aber alle ihre eigenen Grenzen haben: Zeus hat nicht über Poseidon, den Gott des Meeres, die Allmacht.
Der Mythos bildet sich als eine Form der Sozialisation, der Bildung und der Wiedererkennung in der Sprache aus. Deshalb können die Griechen sagen, Barbaren seien diejenigen, die den griechischen Mythos und die griechische Sprache nicht kennen. Nur das ist das Entscheidende: der Unterschied, dass sie als Barbaren der griechischen Sprache nicht mächtig sind. Sie können so entwickelt sein, wie sie wollen, auch höher als die griechischen Staaten, aber sie sind der griechischen Sprache, das heißt der Verständigung über den Mythos, nicht mächtig.
Ich komme jetzt noch einmal auf die Frage zurück, warum dieser Mythos in dieser Mittelmeerregion entsteht. In diesem Zusammenhang spielt die Kolonisation eine wichtige Rolle, für die es natürlich Ursachen gibt. Menschen ziehen nie freiwillig weg von ihren angestammten Orten, so auch nicht in dieser Zeit, in der offenkundig in bestimmten Bereichen ein Bevölkerungswachstum stattfand. Gleichzeitig existierten wohl alte Agrargesetze, in denen Erbteilung eine große Rolle spielte. Das heißt, ein Hof, ein landwirtschaftlicher Betrieb, musste immer weiter geteilt werden, sodass, wenn die Fruchtbarkeit des Bodens schwand oder etwas anderes in der Produktion sich veränderte, die Nahrungsgrundlage immer schmaler wurde und Teile der Bevölkerung einen Ausweg suchten. Ein Ausweg ist immer der Krieg, und offenbar spielte die Überbevölkerung eine Rolle für diese Bewegung.
Und es zeigt sich, dass bei den Griechen die Neugier und Lust, irgendwo anders hinzugehen, besonders ausgeprägt war. Es